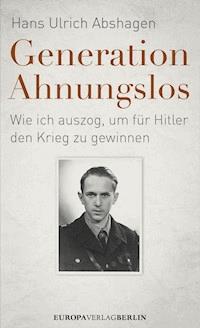
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
'DASS ICH DIE NAZIVERBRECHEN FÜR UNDENKBAR GEHALTEN HABE, VERFOLGT MICH BIS HEUTE.' HANS ULRICH ABSHAGEN Deutschland, 1944. Der siebzehnjährige Hans Ulrich Abshagen meldet sich freiwillig an die Ostfront. Ahnungslos, wie er ist, glaubt er an den Endsieg, will Offizier werden und kämpfen, für Führer, Volk und Vaterland. Begeistert absolviert er die harte Grundausbildung, wartet ungeduldig auf den ersten Einsatz an der Front – auch wenn ihn die Sehnsucht nach seiner großen Liebe Rose quält. Doch dann muss er miterleben, wie sein Vater, Leiter der militärischen Abwehr unter Admiral Canaris, als Verschwörer des 20. Juli verhaftet wird. Hautnah und packend lässt Abshagen seine Erfahrungen wiederaufleben – ein erschütterndes Zeitdokument, das keinen unberührt lässt. Im Nachklang befragt ein 17-jähriger Schüler den Autor über seine Erlebnisse und seine große Liebe. Er will sein Vaterland verteidigen, Offizier werden und seinem Vater beweisen, dass er ein ganzer Mann ist: Voller Idealismus meldet sich der siebzehnjährige Hans Ulrich Abshagen im Juli 1944 zu einer Eliteeinheit der Wehrmacht. Abseits von der Wirklichkeit des Krieges absolviert er die Grundausbildung in Westpreußen. Dort besteht seine Welt aus Befehlen und Gehorsam; weit mehr als für die Politik interessiert er sich für Rose, seine große Liebe. Als sein Vater, der im Oberkommando der Wehrmacht die Abwehr West leitet, wenige Tage nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli verhaftet wird, gerät Abshagens Weltbild ins Wanken. Ist er der Sohn eines Hochverräters? Kann er seinem Vater helfen? Sein Kompaniechef schickt ihn nach Berlin in die Höhle des Löwen. Selten hat man die Gedanken- und Gefühlswelt eines Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs authentischer und spannender gelesen als in Hans Ulrich Abshagens Erinnerungen, die er aus Briefen und Notizen rekonstruierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das vorliegende Buch basiert auf dem Titel Generation Ahnungslos,erstmals erschienen 2003 im Zeitgut Verlag.
1. eBook-Ausgabe
© 2014 Europa Verlag GmbH & Co. KG,
Wien · Berlin · MünchenUmschlaggestaltung: David Hauptmann,
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, unter Verwendungeines Motivs von Hans Ulrich Abshagen
Fotos im Innenteil: Hans Ulrich Abshagen
Quellennachweis
Seite 7 aus: Eugen Drewermann, Liebe, Leid und Tod.
Daseinsdeutung in antiken Mythen
© Patmos Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2013
www.verlagsgruppe-patmos.de
Karte Seite 33: Peter Palm, Berlin
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
ePub-ISBN: 978-3-944305-37-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Vorwort
Der Marsch nach Arnsfelde
Das Abendessen
Die Wache
Besuch im Gefängnis Moabit
Informationen von Ilse
Das Versteckspiel
Der Einsatzbefehl
T 34
Im Dreieck
Gefangen
Verschärfter Arrest
Mein Traum
Eine rettende Idee
Die Entlassung
Nachbemerkung zu meinem Vater
Ein Nachwort von Paul Stein
Dank
Literaturverzeichnis
»Man muss die Dinge nur einmal aus der Perspektive der Betroffenen, der Einzelnen, der Leidenden betrachten, und man weiß ein für allemal, daß nichts der Liebe so sehr widerspricht wie das Wort Krieg. Es schafft nicht nur unzählige Tragödien. Es ist die Tragödie schlechthin.«
Eugen Drewermann
Vorwort
Es ist das Jahr 1944. Ich will Offizier werden, Infanterieoffizier. Ich will kämpfen für Führer, Volk und Vaterland. Für den Endsieg! Jetzt bin ich in der Ausbildung. Mitten hinein platzt die Nachricht, dass ich der Sohn eines Hochverräters bin, eines Teilnehmers an der Vorbereitung des Attentats gegen Hitler am 20. Juli 1944. Zur gleichen Zeit lerne ich Rose kennen, ein Mädchen aus der Uckermark: Sie wird meine erste Liebe, meine große Liebe!
Dieses Buch beschreibt die Welt von Heranwachsenden, die fähige Offiziere werden wollen und dann endlich zum heiß ersehnten Einsatz an die Front kommen – einem Einsatz, der mit der Kriegsgefangenschaft bei den Sowjets endet. Es ist der Versuch, die Geschehnisse mit den Gedanken und in der Sprache des damals Siebzehnjährigen darzustellen. Dabei helfen mir meine Briefe aus dieser Zeit, die ich im Nachlass meiner Mutter gefunden habe.
Alles, was ich schreibe, hat so und nicht anders stattgefunden. Mein Vorgesetzter, Oberleutnant Junkmann, war ein Nazigegner. Der Leser wird es merken. Als damals Siebzehnjähriger habe ich es nicht gemerkt. Ich war politisch ahnungslos. Nach heutigen Maßstäben wurde ich streng erzogen; aber zwischen meinen Eltern, meiner Schwester und mir herrschte ein freier Umgang mit den Meinungen anderer, mit einer Ausnahme: Über den Nationalsozialismus wurde zu Hause nicht gesprochen. Außerhalb der Familie und in der Öffentlichkeit gab es nur Befehlen und Gehorchen. Es wäre töricht zu behaupten, dass dieses Umfeld mich damals nicht geprägt hätte.
Hans Ulrich AbshagenBerlin, im Januar 2014
Hans Ulrich Abshagen, 1944
Der Marsch nach Arnsfelde1
Vor zwei Stunden, früh um sechs, ging’s los. In Deutsch Krone2, Westpreußen. Übungsmarsch in gefechtsmäßiger Ausrüstung. Stundenlang. Mein Vordermann – vorschriftsmäßiger Abstand achtzig Zentimeter – ist Hermann Höfer. Er ist der Älteste von uns, schon fast achtzehn Jahre alt. Höfer ist mein Freund.
Morgens um fünf ist Wecken. Ich wache immer früher auf, kann es gar nicht abwarten. Endlich passiert etwas Sinnvolles. Die blöden Schulstunden sind vorbei. Endlich werde ich echt gefordert.
Hätte mir vor drei Monaten einer gesagt, ich würde Infanterist und hätte sogar Spaß an stundenlangem Marschieren – den hätte ich für verrückt erklärt, ehrlich. Ich wollte was ganz anderes werden. Ich wollte zur See, zur Marine. Auf ein Torpedoboot! Neulich lag eines an der Brücke von Binz auf Rügen, schmal, ganz lang und tiefschwarz. Die Schiffsmaschine lief noch. Das ganze Boot zitterte leicht. Etwas so Erhabenes, so Schönes, hatte ich noch nie gesehen. Oben auf der Brücke sah ich den Kapitän. Er trug als Einziger eine weiße Mütze. Das wollte ich werden: Torpedobootkapitän!
Die Offiziersbewerberprüfung war in Berlin, sie dauerte zwei Tage. Dazu gehörten Marschübungen, jeder Bewerber musste mal das Kommando übernehmen, Gewehrschießen, viel Sport, Fragen aus Erdkunde und Geschichte beantworten und natürlich wurde auch Gegenwartskunde abgefragt. All das hatte ich erwartet und keinen Bammel davor gehabt. Nicht erwartet hatte ich beim Sport einen Boxkampf wie bei Profis im Ring. Der für mich ausgeloste Gegner war ein Muskelprotz. Keine Chance für so ein schmales Hemd wie mich. Die erste Runde hatte ich überstanden, weil ich wie ein Besessener auf den viel Stärkeren eindrosch. Dann traf er mich voll auf die Nase. Die war platt. Der Kampf wurde abgebrochen. Der Kampfrichter bestimmte: unentschieden. Das war ungerecht. Der Sieger war natürlich der Muskelprotz.
Dann gab es für jeden Bewerber ein Einzelgespräch mit dem NS-Führungsoffizier, einem Hauptmann, Glatzkopf, so um die vierzig Jahre, hager, mit einer unangenehmen Stimme. Immer so von oben herab. Alle Kandidaten wussten, was jetzt schon wieder drankommen würde: Weltanschauung. Bestimmt sollte man irgendwas sagen zum Thema »Sicherer Endsieg«.
Ich wollte nicht durchfallen. Trotzdem hatte ich mir vorgenommen, was Eigenständiges zu sagen. Mir wurde die Frage gestellt, was ich zum Endsieg beitragen könne. Sicher war der Glatzkopf so einfallslos und stellte jedem Bewerber die gleiche Frage.
»Herr Hauptmann«, antwortete ich, »wir sollten in der Ausbildung etwas von der Mentalität der Amerikaner und der Russen lernen. Wenn ich einen Gegner kenne, kann ich ihn besser bekämpfen!«
»Wo haben Sie denn den Gedanken her, Bewerber …«, er suchte in den Papieren auf seinem Schreibtisch meinen Namen, »… Bewerber Abshagen?«
»Hat mir keiner gesagt, Herr Hauptmann. Ich denke, es ist richtig.«
»Und was denken Sie sonst noch zur Ausbildung? Sie wollen doch Offizier werden?«
»Die Ausbildung soll intensiv sein; sie soll aber nicht lange dauern, Herr Hauptmann. Unser Land ist in Gefahr. Ich will in den Kampf! Möglichst bald!«
»Sie werden den Eid ablegen für Führer, Volk und Vaterland?«
»Ich werde schwören: ›Für Führer, Volk und Vaterland!‹«
Am Schluss hieß es: »Bewerber Abshagen hat bestanden.«
Hatte ich auch nicht anders erwartet. Meine Mutter würde sich wundern. Ich würde ihr sagen, dass alles ganz einfach gewesen war. War es ja auch. Aber Mami machte sich immer Sorgen!
Sorgen, weil letztes Jahr meine Schulklasse in die Flakbatterie3 nach Berlin-Marienfelde verlegt wurde und aus uns Schülern außerhalb der Schulstunden Flakhelfer4 wurden. Das war natürlich viel interessanter als der Unterricht an unserer langweiligen Schule in der Kaulbachstraße. Ich hatte mich für das Kommandogerät gemeldet und konnte bei Einsätzen unserer Flakbatterie die feindlichen Flugzeuge im Fernglas sehen. In Marienfelde wurde übrigens weiterhin Lateinunterricht erteilt. Als ob Lateinkenntnisse einem angehenden Soldaten was bringen würden! Was für ein Schwachsinn!
Als Flakhelfer in Berlin-Marienfelde, 1943
Mami sorgte sich, weil ich mich freiwillig gemeldet hatte und Offizier werden wollte. Dabei wurde sowieso jeder Siebzehnjährige eingezogen, ob er sich nun freiwillig gemeldet hatte oder nicht. Dann sorgte sie sich, dass es kein Abitur mehr gab, weil jeder nur noch den sogenannten Reifevermerk bekam. Und den bekam man auch mit lauter Fünfen und Sechsen.
»Hans Ulrich, hast du’s dir auch wirklich überlegt?«, hatte meine Mutter gefragt.
»Mami, bitte versteh mich! Wenn wir schon im Krieg sind, will ich vorne mit dabei sein.«
»Ich mache mir Sorgen, mein Junge.«
»Bitte, Mami! Du bist die süßeste Mami der Welt. Aber das Wort ›Sorge‹ mag ich nicht mehr hören.«
Ich hasse es, wenn meine Mutter mich »mein Junge« nennt.
Mein Vater, den ich seit Kindertagen »Väti« nenne, hatte mehr Verständnis für mich. Er half mir sogar, das für mich richtige Bataillon auszusuchen. Wenn ich mich nicht freiwillig für die Offizierslaufbahn gemeldet hätte, wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielleicht wäre ich sonst in einer Schreibstube gelandet oder Schütze drei beim Maschinenge wehr geworden – das ist der, der immer die Munitionskästen schleppt.
Nach der bestandenen Offiziersbewerberprüfung musste ich noch zur Augenuntersuchung. Ein Stabsarzt stellte fest:
»Abshagen – farbenunsicher von Rot auf Grün.«
Ich kann von Weitem Rot (backbord) und Grün (steuerbord) nicht klar unterscheiden. Also: Marine ade!
Darauf meldete ich mich zur Königin der Waffen, zur Infanterie. Irgendein bedeutender Mensch, Clausewitz oder so jemand, hatte geschrieben: »Die Infanterie trägt die schwerste Last des Kampfes. Darum gebührt ihr auch der höchste Ruhm!«
Dann wollte ich da hin, in eine Eliteeinheit!
Den ersten Schritt habe ich ja nun geschafft. Das XX. Armeekorps bildet eine Offizierselite aus. Den Weg dorthin hat mir mein Vater gezeigt. Da bin ich jetzt zur Ausbildung. In Deutsch Krone.
»Absi!«, ruft mein Vordermann Höfer. Dabei wendet er beim Marschieren den Kopf nicht zur Seite. Sein Stahlhelm zeigt eisern geradeaus. Alle nennen mich Absi. Ich hasse das. Klingt wie »Abziehbild«. »Absi! Vielleicht kannste nachher Kuchen essen! Bei Gerda!«
»Komm doch mit! Allerdings gibt es bei Gerda keinen ›Völkischen Beobachter‹5.«
Gelächter bei den Kameraden ringsum.
Höfers Stahlhelm sitzt schnurgerade. Sein Koppel6 auch. Bei ihm ist alles noch gerader als bei allen anderen. Und auf der Stube liest er dauernd, vor allem den »Völkischen Beobachter«. Darin ist er groß. Und uns erzählt er immer, was los ist in der Welt. In Politik ist er eine Autorität. Und auch sonst. Höfer ist unsere Autorität.
Wir dürfen beim Marschieren miteinander reden. Natürlich nur, solange die Ordnung unserer Truppe nicht gestört wird. Wir genießen diese Freiheit. Das liegt an Oberleutnant Junkmann, unserem Kompanieführer. Ein Feingeist, ein Intellektueller, schlank, vielleicht ein Meter achtzig groß, mit ’nem runden Gesicht. Trägt ’ne dicke Brille. Er ist viel älter als wir, so um die dreißig. Und verheiratet. Gehört also schon zur alten Garde. Der riskiert schon mal einen selbstständigen Gedanken. Und er hält nicht viel von dem dauernden nervtötenden Gegröle. Deshalb müssen wir nicht ständig singen beim Marschieren.
Wenn wir nicht mit Kommandos wie »Tiefflieger von rechts!« oder »Artilleriefeuer von links!« in den Straßengraben gejagt werden, erreichen wir in einer Stunde unseren Schießplatz in Arnsfelde. Ich freue mich darauf. Aber nicht auf das, was heute dran ist: Maschinengewehrschießen. Ich bin ein lausiger MG-Schütze. Daran kann ich nichts ändern. Ich bin zu leicht. Der Rückstoß des MG drückt mich nach hinten, dadurch verliere ich mein Ziel.
Heute ist der Tag von Bandow, den wir immer »den Dicken« nennen. Grenadier Bandow. Das Schwergewicht marschiert zwei Reihen vor mir. Er trägt das MG 42, als wär’s ein Gewehr, nein, als wär’s ein Luftgewehr. Hat ’ne Figur wie der Muskelprotz, der mir die Nase platt gehauen hat. Bandow, der Dicke, wird gewinnen, das ist sicher. Dafür kriegt er den Nachmittag frei. Sicher wird er dann in der Bäckerei sitzen und sich den Bauch voll Kuchen schlagen. Und er wird versuchen, mit der Verkäuferin anzubandeln. Mit Gerda. Gerda mit dem schwarzen Bubikopf. Die trägt den kürzesten Rock, den ich je gesehen habe. Bedeckt kaum ihre Knie. Wenn meine Omi das sähe, die würde in Ohnmacht fallen.
»Dicker!«, ruft Gaida mit keuchender Stimme. Gaida marschiert rechts neben mir.
»Die Gerda kriegst du nicht. Die steht nicht auf so ’nen Max-Schmeling-Typ wie du.«
Der Dicke sagt gar nichts. Er wechselt nur das Maschinengewehr auf die andere Schulter.
Dafür meldet sich Masuch: »Gerda steht bestimmt auf ’nen Vorzeige-Germanen. Groß, blond, schlank. Sie steht auf Höfer!«
»Quatsch«, sagt Höfer, »die steht auf ’nen Intellektuellen, einen, der klug daherredet. Und der so tut, als wär er ein englischer Gentleman. Das ist Absi!«
Unwillkürlich kommt mir die Länge von Gerdas Rock in den Sinn.
»Absi kriegt sie auch nicht«, erwidert Gaida, »so eine wie die – die ist bestimmt längst vergeben.«
Auf der Straße nach Arnsfelde sorgen fast zweihundert Paar genagelter Stiefel für einen herrlichen Geräuschpegel. Die ganze Luft ist erfüllt davon. Ich genieße es. Ich fühle mich in diesem unnachahmlichen Geräusch geborgen. Rechts und links von uns wechseln sich Felder und Waldstücke ab, manchmal taucht ein kleiner See auf, wenige flache Hügel – eine typisch westpreußische Landschaft. Die Junihitze ist am frühen Morgen noch nicht drückend.
Warum denke ich jetzt an Vanilleeis?
Weil ich den Dicken um seinen Kuchen beneide. Zu Kuchen gibt es nur noch eine Steigerung: Vanilleeis! Und zwar mit so kleinen schwarzen Punkten drin. Die kommen von den Vanilleschoten. Wenn zu Hause in Berlin unsere Köchin, Frau Binger, Eis macht mit der schweren Eismaschine, dann helfe ich gerne dabei. Manchmal drehe ich die Kurbel. Das ist anstrengend. Oder ich schabe die Vanille aus den Schoten. Das Eis ist die absolute Krönung einer Mahlzeit. Gibt es leider viel zu selten.
Nie werde ich vergessen, dass ich diese Krönung einmal fast verpasste. In Berlin-Lankwitz war das, Bruchwitzstraße zwölf, an einem Sonntag am Mittagstisch: mein Vater, diesmal ohne seine Majorsuniform, also in Zivil, meine Mutter, meine Schwester Ilse und ich. Endloses, langweiliges Essen. Sonntags gibt es fast immer Götterspeise als Nachtisch. Ich hasse Götterspeise. Schmeckt wie am Ziegelstein geleckt. Da ist Alkohol drin oder so was. Mein Vater und Ilse führen gebildete Gespräche. In England gibt es angeblich einen Lordsiegelbewahrer. Weiß der Kuckuck, wozu der gut ist!
Meine Mutter hört liebevoll zu. Ich halte lieber den Mund.
Um die Götterspeise zu vermeiden, frage ich nach dem Hauptgang: »Väti, darf ich aufstehen?«
Natürlich weiß ich die Antwort. Ich muss am Tisch sitzen bleiben und wenigstens eine Anstandsportion von dem scheußlichen Nachtisch nehmen.
Da sagt mein Vater völlig überraschend: »Hans Ulrich, du kannst aufstehen!«
Jetzt darf ich keinen Fehler machen, damit die Order nicht widerrufen wird. Ich stehe auf, stelle den Stuhl langsam und sorgfältig an den gedeckten Tisch zurück, mache eine leichte Verbeugung zu meiner Mutter und sage: »Gesegnete Mahlzeit!«
Ich laufe nicht, nein, ich gehe ruhig und drehe mich, wie es sich gehört, an der Tür noch einmal zu meinen Eltern um, bevor ich das Esszimmer verlasse.
Draußen auf dem Flur kann ich es immer noch nicht fassen, dass ich dem ekligen Ziegelsteingeschmack entronnen bin. Ich laufe in mein Zimmer und schmeiße mich erleichtert auf mein Bett. Mit Schuhen aufs weiße Bett. Herrlich! Ich bin mit der Welt zufrieden. Die Tür zum Gang hatte ich offen gelassen – Gott sei Dank!
Plötzlich sehe ich nämlich unser Hausmädchen Anni – wie immer herausgeputzt mit einer weißen kleinen Schürze und einem weißen Häubchen im Haar – das Esszimmer ansteuern, in ihren Händen eine Vanilleeisbombe! Wie von der Tarantel gestochen schieße ich an ihr vorbei und versuche, mich am elterlichen Esstisch wieder hinzusetzen.
»Hans Ulrich, du hast doch eben schon ›Gesegnete Mahlzeit‹ gewünscht!«, sagt mein Vater ernst und mit ruhiger Stimme, ohne eine Miene zu verziehen.
»Wolfgang!«, wendet sich meine sonst eher schweigsame Mutter an meinen Vater: »Das konnte Hans Ulrich doch nicht wissen! Wir haben heute eine Überraschung zum Nachtisch: Vanilleeis!«
Ich schaue zu Mami. Ihre strahlenden braunen Augen blitzen mich an. Mit ihrem dunklen Wuschelkopf könnte sie die ältere Schwester von Ilse sein. Mami ist die schönste Frau der Welt!
Mein Vater wendet sich schmunzelnd an die gesamte kleine Tischrunde: »Ihr seht, ich habe in diesem Hause nichts zu sagen!«
Dreißig Meter vor uns, aus dem ersten Zug7, höre ich den Ruf »Marschordnung!«
Gleich darauf brüllt auch unser Zugführer, Unteroffizier Schmidt: »Marschordnung!«
Und wie ein Echo ist der Befehl auch hinter uns im dritten Zug zu vernehmen.
Innerhalb von Sekunden wandelt sich das Bild der ganzen Kompanie. Aus einer zwar zügig, aber doch eher locker marschierenden Truppe, deren Soldaten sich unterhalten und ihre Waffen so tragen, wie es ihnen am bequemsten ist, ist in Sekunden eine ausgerichtete Elitetruppe geworden. Die Gewehre hängen vorschriftsmäßig über der rechten Schulter, die rechte Faust in Brusthöhe, Daumen ausgestreckt hinter dem Riemen. So steht es in dem kleinen blauen Buch, das jeder von uns fast auswendig kennt: Die HDV, die Heeres-Dienstvorschrift für die Infanterie.
Das darauffolgende Kommando »Im Gleichschritt!« ändert nichts an unserer Haltung. Die Truppe marschiert jetzt auf der einsamen Straße zwischen Deutsch Krone und Arnsfelde wie auf einem Paradeplatz. Mir imponiert unsere Fähigkeit zum plötzlichen Wandel. Aber was soll das Theater? Reine Schikane? Das würde zu Oberleutnant Junkmann nicht passen.
Motorengeräusch. Von vorn kommt ein Kübelwagen8 und hält. Alle Stahlhelme sind vorschriftsmäßig geradeaus gerichtet. Trotzdem entgeht uns nicht, was sich neben uns abspielt. Aus dem Auto steigt unser Chef, Bataillonskommandeur Major von Tucher. Ich höre gerade Junkmanns Worte »Melde gehorsamst …«
In dieser Kaserne absolvierten wir unsere Grundausbildung.
Mich beeindruckt dieser Wortfetzen. Das Wort »gehorsamst« darf nur ein Offizier verwenden, kein Grenadier, kein Unteroffizier oder Feldwebel. Selbst unser »Oberfeld« – das ist Oberfeldwebel Aust – würde nicht wagen, »gehorsamst« zu sagen. Ich bin stolz, dass ich diese Feinheiten schon weiß.
»Männer! Alle mal herhören!«, ruft Höfer.
Gestern Abend in der Kaserne Deutsch Krone auf Stube zwölf. Wir sind zehn Mann, also eine Gruppe9. Höfer ist unser Stubenältester, er ist für die Ordnung verantwortlich. Wir mögen ihn. Groß, schlank, dunkelblond, mit einem offenen vertrauenerweckenden Gesicht. Kommt aus Frankfurt an der Oder. Höfer hat, wie fast alle von uns, den Reifevermerk vom Gymnasium. Hat sogar Griechisch gelernt. Zuletzt war er Fähnleinführer10 im Deutschen Jungvolk11 und hatte damit hundertfünzig Jungen unter sich. Jetzt kommandiert er unsere Stube.
»Männer, wir wollen mal über Politik reden. Jemand dagegen?«
»Ja, ich!«, ruft der dicke Bandow mit seiner tiefen Bassstimme. Dabei schaut er nicht von seiner Arbeit auf. Er putzt mit Hingabe sein Koppelschloss. »Ich finde, wir brauchen Socken! Anstelle dieser Scheißfußlappen. Das ist das Thema!«
»Der Dicke hat recht!«, ruft Gaida. Er hat das Bett unter meinem.
»Wir müssen dem Oberfeld sagen, wir brauchen Socken. Keine Fußlappen! Ganz normale Wehrmachtssocken!«
»Also, Männer, …«
Höfer will weiterreden. Da wird die Tür aufgerissen. In der Tür steht Unteroffizier Schmidt.
Höfer ruft: »Achtung!«
Alle springen auf und stehen stramm, Hände an der Hosennaht. Höfer meldet: »Stube zwölf beim Feierabend. Alle gesund!«
Schmidt ist ein Hüne, sicher ein Meter neunzig groß, mit einem breiten Grinsegesicht.
»Weitermachen!«, befiehlt er mit seiner knarrenden Stimme. »Bei euch wurde so viel geredet. Hört man meilenweit. Worüber?«
»Herr Unteroffizier!«, beginnt Höfer, »ich wollte gerade über den Führer …«
»So laut? Und dabei alle durcheinander? Bandow!«
»Wir sprachen über Fußlappen, Herr Unteroffizier!«, antwortet der Dicke wahrheitsgemäß.
»Der Führer und Fußlappen, das passt wohl nicht zusammen!« Kopfschüttelnd verlässt Schmidt die Stube zwölf und schmeißt die Tür zu.
Nach dem Einmarsch der Kompanie in das Schießstandgelände in Arnsfelde ruft Oberfeldwebel Aust: »Wer meldet sich zur Wache am Tor?«
Ich trete vor. Aus den drei Zügen der Kompanie meldet sich keiner mehr.
»Grenadier Abshagen, wer soll der Zweite sein?«
»Grenadier Höfer, zweiter Zug, Herr Oberfeld!«, rufe ich zurück.
Darauf Aust: »Grenadiere Abshagen und Höfer zur Wache abtreten!«





























