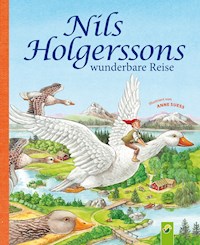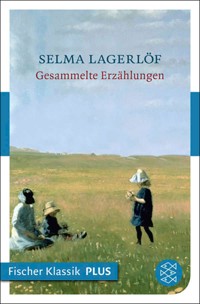
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Stimmungsvolle Landschaften, sehnsuchtsvolle Liebesgeschichten, Trolle und Heilige – die Erzählungen der schwedischen Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf zeichnen sich durch ihren Detailreichtum und den Zauber des Wundersamen aus. Dieser Band versammelt die bekanntesten und schönsten Erzählungen dieser großen Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Ähnliche
Selma Lagerlöf
Gesammelte Erzählungen
Herausgegeben von Astrid Erb
Aus dem Schwedischen von Marie Franzos
Fischer e-books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Der Stein im See
Es war einmal im siebzehnten Jahrhundert ein armer Geistlicher, der auf der Kanzel der Broer Kirche in Värmland stand und seine Predigt las. Die Bankreihen unter ihm waren voll von Leuten, die ganz stumm und andächtig dasaßen, die Frühlingssonne schien durch die kleinen Fensterscheiben und verjagte die Winterkälte aus dem ungeheizten Gotteshaus, der Küster stand Wache, um einen jeden zu wecken, der es sich etwa einfallen lassen sollte einzuschlummern, alles ging, wie es sollte, und dem Prediger war froh ums Herz wie dem Sämann, wenn er gute Saat in wohlgepflügte Erde streut.
Der Prediger war groß und ungeschlacht, mit starker Stimme und gewaltigen Fäusten, ein ganzer Kerl. Er war so dunkel, daß, wer ihn sah, ohne zu wissen, wer er war, beinahe vor ihm erschrecken konnte. Das schwarze Haar fiel ihm nach Bauernart bis auf die Schultern und hing tief in die Stirn. Die Augenbrauen zogen sich grob wie Stricke über die strengen Augen, und kaum wurde die Haut der Wangen ein bißchen lichter, fing schon der buschige schwarze Bart an und verdeckte den unteren Teil des Gesichts. Als der Geistliche ungefähr zur Mitte seiner Predigt gekommen war, hörte er vor der Kirche Pferdegetrappel und laute Menschenstimmen. »Da sind welche, die zum Gottesdienst zu spät kommen. Wenn sie doch den Verstand hätten, draußen zu bleiben, bis die Predigt aus ist«, dachte er. »Wenn sie jetzt hereinkommen, so stören sie doch nur, und sie haben ja auch keine Erbauung davon, eine halbe Predigt zu hören.« Aber es ging nicht so, wie der Geistliche wünschte. Die Neuankömmlinge kamen vielmehr gleich darauf über den Steinboden des Waffenhauses getrappelt, geradewegs auf die Kirchentüre zu. Sie gingen schwer, und sie sprachen laut. Es sah aus, als wollten sie so viel Lärm machen, als ihnen nur möglich war.
Obgleich er ruhig weitersprach, merkte der Prediger doch, daß dieser und jener unter seinen Zuhörern schon aus seiner Andacht gerissen war und den Kopf zur Türe drehte. Er wünschte inbrünstig, daß die Kommenden sich doch wenigstens auf einer der hintersten Bänke niederlassen und nicht in die Nähe der Kanzel vordringen möchten.
Aber auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Kirchentüren wurden mit Lärm und Getöse aufgerissen, und den großen Gang herauf kam ein Zug von gut zwanzig Menschen. Nach all dem Lärm, den sie gemacht hatten, hätte man eine Schar betrunkener Kriegsknechte erwarten können, doch nein, es war eine hochgewachsene junge Bauerstochter, die an der Spitze des Zuges ging, und lauter friedliche Bauersleute folgten ihr nach. Sie war blond und schön, trug pelzverbrämte Kleider aus weißem Fries und hatte so viel Silbergeschmeide um Hals und Gürtel, daß es wohl seine zwölf, dreizehn Pfund wiegen mochte. Die hinterher kamen, waren alle dunkel gekleidet. Es waren Alte und Junge darunter, Mannsbilder und Weibsleute. Der Geistliche sah, daß es Herrschaft und Gesinde eines großen Bauernhofes sein mußten, die da zur Kirche gekommen waren.
Es fiel dem Geistlichen schwer, in seiner Predigt fortzufahren, denn jetzt hatte die ganze Gemeinde ihre Gedanken von dem Gottesdienst abgewandt und starrte nur immerzu die Neuangekommenen an. Und das war auch nicht zu verwundern, denn sie betrugen sich nicht so, wie sie sollten, wenn sie in ein Gotteshaus traten. Sie verhielten sich wohl jetzt, nachdem sie unter die Kirchenwölbung getreten waren, schweigend, aber gerade als sie an der Kanzel vorbeigehen wollten, blieb die junge stattliche Bauerstochter stehen und fing an, den Geistlichen anzugaffen, als hätte sie nie seinesgleichen gesehen. Sie machte die anderen auf ihn aufmerksam, und nun blieben sie allesamt stehen und betrachteten ihn mit erstaunten Gebärden, ganz als wäre er ein wunderliches Tier in einer Jahrmarktbude.
Der Prediger war sich wohl bewußt, daß er ein geringer Mann war. Er war nicht Propst, er war nicht Pastor, er war nur ein armer Hilfsgeistlicher, der von Kirchspiel zu Kirchspiel geschickt wurde. Er war an Demütigungen und Verachtung gewöhnt, aber dieses Angaffen war doch etwas, was er nicht dulden zu müssen glaubte. Hier stand er als ein Verkünder von Gottes Wort, und hier durfte ihm niemand Mißachtung zeigen. Die grobe Faust erhob sich und fiel mit solcher Wucht auf die Kanzel nieder, daß es in der ganzen Kirche widerhallte.
Er wollte es damit nicht genug sein lassen. Dem Faustschlag sollten auch noch ein paar strenge Worte an die Friedensstörer folgen, aber dazu kam es nicht. Er sah noch einmal in das trotzige Gesicht der Bauerstochter, bevor er zu reden anfing, und dann wurde nichts aus der Strafpredigt. Er beugte sich über sein Heft und predigte zu Ende, ohne auch nur einen einzigen Blick mehr in die Kirche zu werfen. Als der Geistliche dann in die Sakristei kam, war kein Mensch drinnen. Er setzte sich auf ein kleines schmales Bänkchen, stützte den Kopf in die Hände und starrte vor sich hin. Er sah ganz verstört aus.
Das Unglück war, daß er dieser Tage mit dem Küster davon gesprochen hatte, wie kümmerlich er es hatte. Denn er bekam ja für seine Arbeit so gut wie keinen Lohn. Er war der Hilfsgeistliche eines armen Vikars, der selbst kaum genug zum Leben hatte. Er konnte nichts verlangen, wo nichts zu holen war.
Auch war er kein alleinstehender Mann. Er war verheiratet gewesen und hatte für drei kleine Kinder zwischen zwei und fünf Jahren zu sorgen. Er hatte es so schwer, daß er schon an das Konsistorium geschrieben hatte, man möchte ihm doch um Gottes Barmherzigkeit willen zu einer anderen Stelle verhelfen. Hier wohnte er ja in einer kleinen Hütte, die aus einem einzigen Raum bestand. Er hatte nicht die Mittel, sich Knecht oder Magd zu halten, und der Hunger war täglicher Gast bei ihm. Niemandem in der ganzen Gemeinde ging es so erbärmlich wie ihm. Er mußte von hier fort. Da hatte ihm der Küster gesagt, er könne doch etwas tun, das besser sei, als seiner Wege zu gehen. Der Prediger hatte zu wissen verlangt, was dies wäre, und darauf hatte der Küster zurückgefragt, ob er denn etwas dagegen habe, noch einmal zu heiraten.
Hier im Kirchspiel war eine reiche Bauerstochter. Die hatte noch keinem Freier ihr Jawort gegeben, sondern führte ihre große Wirtschaft selbst. Aber wer konnte wissen, was sie sagen würde, wenn nun der Prediger – sie war ja nicht mehr ganz so jung, aber ein stattliches Frauenzimmer. Der Prediger hatte sie wohl noch nicht gesehen, denn sie wohnte in einem entlegenen Winkel des großen Kirchspiels. Sie hatte mehrere Meilen zur Kirche und kam auch höchstens zweimal im Jahre hin. Zu seinen Zeiten war sie noch nicht da gewesen.
Der Küster hatte die Sache so gut darzustellen gewußt, daß der Prediger ihm die Erlaubnis gegeben hatte, nicht gerade zu freien, aber doch sich ein wenig zu erkundigen, ob sie, Gudrun Ivarsdotter, daran denken würde, ihn zu heiraten.
Er hatte ja begriffen, daß sie alt und häßlich sein mußte, und vielleicht war sie auch noch obendrein böse, aber danach hatte er nicht gefragt. Er hatte nur daran gedacht, daß, wenn er sie bekäme, die kleinen Kinder nicht mehr über Hunger zu klagen brauchten. Nun, in der Kirche, gerade als er seine Strafpredigt beginnen wollte, war es ihm klar geworden, daß das die reiche Bauerstochter war, um die er geworben hatte und die nun gekommen war, um ihm Bescheid zu geben.
Sie war in dieser Weise gekommen, um dem armen Geistlichen zu zeigen, daß sie viel zu gut für ihn war, und darin mußte er ihr recht geben. Wenn er doch nur dem Küster nicht aufs Wort geglaubt hätte! Hätte er nur gewußt, daß sie noch jung und schön war, so wäre er dieser neuen Demütigung entgangen! Er blieb lange in der Sakristei sitzen, um Gudrun Ivarsdotter und all den anderen Zeit zu lassen, sich wegzubegeben, bis er über den Kirchenhügel ging. Aber sie hatte sich offenbar nicht beeilt, denn als er die Sakristeitür öffnete, war sie noch da. Sie wollte sich eben in den Sattel schwingen und war auf einen Stein gestiegen, der zur Bequemlichkeit der Reitenden gerade vor das Kirchentor gelegt worden war. Ihr Knecht, der das Pferd hielt, konnte es nicht still halten, so daß es ihr ein ums andere Mal mißlang, auf den hohen Quersattel hinaufzukommen.
Da trat der Prediger rasch heran. Er faßte Gudrun mit seinen starken Armen, hob sie hoch in die Höhe und setzte sie dann derb in den Sattel.
Sie war wahrlich nicht auf den Mund gefallen, aber sie fand kein Wort der Erwiderung, sondern ritt schweigend fort.
Nach diesem Frühlingssonntag begann für den armen Hilfsgeistlichen wie für die ganze Gemeinde eine Zeit, die schlimmer war als alles, was sie je miterlebt hatten. Der Frühling hatte schon im April so schön begonnen, daß es beinahe sommerlich warm gewesen war. Schnee und Eis verschwanden, der Boden grünte, die Bäume schlugen aus, und die Leute mußten sich sputen, so sehr sie nur konnten, um die Saat in die Erde zu bringen. Dafür, daß es April war, fiel merkwürdig wenig Regen, aber um so mehr würde wohl im Mai nachkommen. Regen bekam man immer noch genug, da brauchte einem nicht bange zu sein. Von dieser Ware gab es eher zu viel als zu wenig.
Aber der Mai wurde trocken und windig, nur hier und da gab es einen kurzen Schauer. Die Leute erwarteten, daß der Regen zu Pfingsten kommen würde, wenn schon nicht früher, aber der Pfingstsonntag brach blank und klar an wie alle anderen Tage, und in der Nacht zum Pfingstmontag wurde es so kalt, daß es fror. Der Frost griff ungleich an, wie gewöhnlich. Manche Felder wurden ganz zerstört, aber viele hielten sich noch, und das Gras auf Wiesen und Angern sah ganz gut aus. Es fehlte eben nur der Regen.
Der Johannistag pflegte ja ebenso große Macht zu haben, den Regen anzuziehen, wie Pfingsten, und am Johannisabend stiegen denn auch dunkle Wolken am Himmel auf. Es gab ein heftiges Gewitter, und etliche Hagelkörner kamen herabgeprasselt, das war alles.
Dann wölbte sich der Himmel ganze drei Monate lang klar und wolkenlos. Die Erde wurde so erhitzt wie ein Backofen. Nacht und Tag waren gleich schwül und drückend.
Das Gras wurde braun gebrannt und verkümmerte. Das Korn bekam Ähren, als die Halme noch keine Handbreit aus der Erde standen. Alles wurde frühzeitig reif, und die Ernte war leicht zu bergen. Aber dafür fanden sich auch große klaffende Lücken in Scheuern und Vorratshäusern.
Den Sommer über wurde die ganze Gegend von großen Waldbränden heimgesucht. Es war kaum möglich, ein Feld zu schwenden, ohne daß das Feuer auf den Wald übergriff. Es war noch gut, daß es auf den Äckern so wenig zu tun gab, denn man mußte beständig in den Wald eilen, um dort zu löschen.
Gegen Ende August wurden die Nächte lang und dunkel, die Sonne büßte ihre Kraft ein, jetzt mußte es den Wolken doch endlich möglich sein, sich zu sammeln. Das taten sie auch, sie ballten sich so dicht und schwer zusammen, daß der Regen gar nicht die Macht hatte, aus ihnen hervorzubrechen. Um diese Zeit begann das Wasser in Quellen und Bächen zu versiegen. Die Mühlen standen still, und die Getreide zu mahlen hatten, mußten ihre alten Handmühlen hervorsuchen. Im Walde verdorrte alles Futter, die Herden kehrten von selbst auf die Höfe zurück, als wollten sie die Bauersleute um Hilfe anflehen.
Jetzt waren die Menschen nicht mehr im Zweifel darüber, daß ihnen ein Notjahr bevorstand. Sie wanderten alle aus den Häusern in den Wald, um für ihr Vieh Moos, Flechten und Laub einzusammeln. Ihr eigenes Brot mischten sie bald mit Waldbeeren, bald mit feingehacktem Stroh, bald mit getrockneter, zerstoßener Rinde.
Im Oktober mußte schließlich doch Regen kommen. Es konnte der Ernte ja nicht mehr helfen, aber es wäre doch ein Gutes, wenn man Wasser für Mensch und Vieh bekäme und die Mühlen in Gang setzen könnte. Aber der Oktober wurde klar und wolkenlos, nahezu wie ein Sommermonat. In diesen Monat fiel der Jahrmarkt, und der pflegte immer schlechtes Wetter anzuziehen wie alle großen Feiertage. Der Markttag brach auch mit scharfem Nordwind und bitterer Kälte an, aber Regen brachte er keinen.
Jetzt waren es nicht nur die zahmen Tiere, die dem Dorfe zustrebten, jetzt kamen auch die Waldtiere zu den Menschenwohnungen geschlichen, um zu sehen, ob es nicht da etwas zu essen und zu trinken gäbe.
Die Menschen konnten sich auch nicht still verhalten. Sie begannen auf die Wanderschaft zu gehen, wie die Tiere. Ganze Familien griffen zum Bettelstab und zogen fort, um zu sehen, ob es anderswo Bauernhöfe gäbe, wo man genug hatte und noch austeilen konnte. Im November kam endlich ein wenig Niederschlag. Es war Schnee. Hartgefroren fiel er zu Boden, er reichte nicht zur Schlittenbahn, er reichte zu gar nichts, es war gerade nur so viel, daß man die ausgedörrte Erde nicht mehr sah.
Im Dezember, als sich das harte Jahr endlich seinem Ende zuneigte und alles schon so schlimm war, daß es nicht mehr schlimmer werden konnte, traf den armen Prediger doch erst seine schwerste Prüfung. Er wurde eines Tages kurz vor Weihnachten mehrere Meilen weit weg in die Waldgegend zu einer armen Fischerswitwe gerufen. Nach langer Wanderung kam er zu einer kleinen Hütte, die am Ufer eines langen Sees lag. In der ganzen Umgegend sah er nicht ein Wohnhaus, keine Felder, keine Ställe, nur Wald. Die elende Hütte lag ganz einsam und verlassen da, den öden See vor sich, den stummen Wald im Rücken.
Dort drinnen hatte er eine todkranke Frau gefunden und sechs Kinder, die bald elternlos sein mußten. Ihr Vater war im Sommer vorangegangen, und nun sollten sie auch ohne Mutter bleiben.
Das älteste der Kinder zählte zehn Jahre, das jüngste nicht mehr als drei. Keines von ihnen konnte sich schon nützlich machen oder etwas für seinen Unterhalt verdienen. Alle brauchten sie noch Hilfe, und man mußte ihnen Kleider und Nahrung geben, ihnen Wartung und Pflege angedeihen lassen, wenn sie nicht zugrunde gehen sollten.
Alle hatten sie die Mutter umstanden, als sie das heilige Abendmahl empfing, und sie hatte von ihnen zum Prediger geschaut und vom Prediger zu ihnen. Sie hatte die Augen nicht geschlossen, immer nur geschaut und geschaut. Aber sie hatte nicht mit Worten gebeten. Es gibt Wünsche, die zu groß sind, als daß man sie aussprechen könnte.
Der Geistliche hatte sie gefragt, ob sie denn keine Nachbarn habe. Doch, das hatte sie. Eine Meile weiter den Rottner-See hinauf lag ein großes Gehöft, das einer gewissen Gudrun Ivarsdotter gehörte. Die Fischersfrau hatte sich vor einigen Tagen zu ihr geschleppt und ihr von den Kindern gesprochen, aber sie hatte sich ihrer nicht annehmen wollen.
Dies setzte den Prediger keineswegs in Erstaunen. Es war ja nicht zu erwarten, daß solch eine trotzige, selbstzufriedene Jungfer wie Gudrun einer so großen Kinderschar zu Hilfe kommen würde. Es war wohl auch gar nicht wünschenswert.
Die Augen der kranken Frau hatten mit solcher Herzensangst auf dem Prediger geruht, daß er es schließlich nicht mehr in der Hütte aushalten konnte. Er mußte ins Freie gehen, um nicht etwas zu versprechen, das er ja doch beim besten Willen nicht halten konnte. Er ging von der Hütte zum Seeufer hinunter. Das Wasser stand so tief, daß der Seegrund bis weit hinaus sichtbar war, und er begann, dorthin zu wandern. Er ging da allein und hilflos durch das Ödland und fühlte sich zu Tode bedrückt von der neuen Bürde, die er sich auferlegen mußte. »Wenn es doch ein anderes Jahr gewesen wäre«, dachte er, »wie kann ich es auf mich nehmen, für noch sechs Schnäbel Essen zu schaffen, wo ich die drei nicht satt machen kann, für die ich schon zu sorgen habe?«
Er hatte geglaubt, daß er im Frühjahr arm gewesen war. Aber was war das gegen die Armut gewesen, die ihn heute bedrückte? Jetzt war ja auch bei anderen Menschen keine Hilfe zu finden.
Plötzlich bemerkte er einen Stein, der dicht am Wasser lag. Es waren Buchstaben eingehauen, und er ging näher heran, um zu lesen. Er konnte ein M und ein paar X unterscheiden und dachte sich, daß da wohl, in den Stein eingeritzt, eine Jahreszahl gestanden hatte. Irgend jemand hatte in längst vergangenen Zeiten bezeichnen wollen, wie tief das Wasser in diesem Jahre zurückgetreten war.
Der Prediger blieb vor dem Steine stehen und suchte die Jahreszahl zu entziffern. Es wollte ihm nicht glücken, aber es mußte wohl etwas darin liegen, das ihm gleichsam Erleichterung und Trost brachte. Das Wasser hatte ebenso tief gestanden wie heute, aber die Menschen waren doch nicht untergegangen. Sie hatten, was ihnen auferlegt war, getragen und weitergelebt.
Rasch ergriff er einen scharfkantigen Kiesel und begann die Zahl des Notjahres, das er nun selbst durchlebt hatte, in den Stein zu klopfen.
Er setzte die Jahreszahl 1640 in den Stein, so gut er es ohne Stemmeisen und Hammer konnte. Aber als dies getan war, war es ihm nicht genug.
Jeden Tag hatte er in langen Gebeten zu Gott um Hilfe gefleht. Nun wollte er noch ein Gebet zu ihm emporsenden, aus der großen stummen Einsamkeit hier oben in der Wildnis.
Und er begann in den Stein zu graben, was sein Herz in dieser Unglückszeit stündlich rief: Gott, hilf uns. Es war eine Arbeit, die seine ganze Kraft erforderte. Aber sie tat ihm wohl. Während er das Gebet in den Stein ritzte, dünkte es ihn, daß der weite graue See und die schwarzen Tannen der Ufer und der niedrige schwere Winterhimmel zu einem großen Gotteshause wurden.
Es tat ihm gut, all die Angst, die er mit sich herumtrug, in den Stein pressen zu können. Er ritzte die Klageschreie all der Hungernden und Dürstenden ein. Er führte das Wort für die Tiere, die in der Hut der Menschen und in der Wildnis lebten, für die gewaltigen Tannen, die auf den Bergen verschmachteten, und für das kleinste Hälmchen auf dem Anger. Mit jedem Buchstaben, den er in den Stein einschrieb, wurde er mutiger. Er fühlte, wie ihm Kraft zuströmte. Er hatte keine Angst mehr, irgendeine Bürde auf sich zu nehmen, wie schwer sie auch immer sein mochte. Gott würde ihm sicherlich beistehen.
Ein paar Tage darauf war Weihnachtsabend.
An diesem Tage herrschte bei dem Hilfsgeistlichen keinerlei Not. Man hatte ihm vom Pfarrhof und auch von anderen Seiten Weihnachtsspeisen geschickt. Nach dem Mittagessen war er mit all den neun Kindern bei einem der Nachbarn in der Weihnachtsbadestube gewesen, und dann hatte er sich mit ihnen daheim in der Hütte im Weihnachtsstroh getummelt, bis sie so müde waren, daß sie sich auf dem raschelnden gelben Christusbettlein ausgestreckt hatten und eingeschlummert waren.
Der Prediger hätte auch Lust gehabt, sich ins Stroh zu legen und zu schlafen, aber er hatte an anderes zu denken. Es begann zu dunkeln, und er mußte die Gerstengrütze aufs Feuer setzen.
Von dem Augenblick an, in dem die Grütze kochte, wagte der Prediger den Kochlöffel nicht fortzulegen, sondem rührte und rührte die ganze Zeit. Hoch aufgeschossen, wie er war, mußte er beim Rühren so gebückt stehen, daß ihm der Rücken vor Müdigkeit schmerzte. Aber er ließ sich das nicht anfechten, sondern schien in vortrefflicher Weihnachtsstimmung zu sein.
Seine Lage war in keiner Weise erfreulicher geworden, er war ebenso elend daran wie zuvor, aber er hatte mehr Zuversicht. Es würde ihm schon in der einen oder anderen Weise Hilfe kommen, dessen war er gewiß.
Mit einem Mal runzelte der Prediger die dichten schwarzen Brauen. Er hörte, daß jemand auf die Türklinke drückte und herein wollte. Freilich war es in der ganzen Gemeinde bekannt, daß er seine eigene Haushälterin sein mußte, aber es war ihm doch nicht recht, Besuch zu bekommen, wenn er mit Weiberhantierung beschäftigt war.
Er griff nach den Kesselringen, als wollte er die Gerstengrütze vom Feuer wegstellen, aber er überlegte es sich wieder.
Es war wohl nur der Küster, der kam, um nachzusehen, wie es ihm und den Kindern am Weihnachtsabend erging, und vor ihm brauchte er ja keine Scheu zu haben.
Doch als die Tür aufging, sah er, daß es nicht der Küster war, sondern eine hochgewachsene Weibsperson, die da hereinkam. Er meinte auch sogleich zu wissen, wer sie war, obschon es unten bei der Türe so dunkel war, daß er ihr Gesicht nicht sehen konnte.
»Ja, das ist mir eine schöne Bescherung«, dachte er. »So etwas hat sie gewiß noch nicht erlebt. Jetzt hat sie etwas, worüber sie von Weihnachten bis zum Johannistag lachen kann!«
Die Fremde zog sachte die Türe hinter sich zu und kam zum Herd heran, die Hand zum Gruße ausgestreckt. Es war Gudrun Ivarsdotter, aber sie sah gar nicht mehr aus wie die störrische Bauerstochter, die in die Kirche geritten kam, um mit ihrem Freier Spott zu treiben. Sie war sehr bleich, und sie sah schwach und elend drein, so, als wäre sie eben erst von einer schweren Krankheit genesen. Wie es in ihrem Innern aussah, konnte der Prediger nicht wissen, aber sie schien nicht einmal zu merken, was für eine Arbeit er da unter den Händen hatte.
Der Geistliche sagte nichts, um sie willkommen zu heißen, er legte nur ganz geschwind den Kochlöffel weg und beeilte sich, ihr einen Schemel zum Sitzen hinzurücken. Es war eine so große Veränderung in ihr vorgegangen. Es war ihm eine solche Überraschung, sie so still und schwach vor sich zu sehen. Sie rührte ihn, und die Stimme wollte ihm durchaus nicht aus der Kehle hervor.
So mußte also Gudrun das Gespräch eröffnen. Und sie sprach wie jemand, der weder scheu noch unruhig ist, weil er eben erst einen großen Schrecken durchgemacht hat, der ihm alle andere Furcht genommen hat. Die ganze Zeit sah sie ins Feuer. Sie konnte die Augen nicht davon weg wenden.
Sie wollte den Prediger nach all den armen Fischerskindern fragen, sagte sie. Konnte es möglich sein, daß er sie alle miteinander zu sich genommen hatte?
Der Prediger hatte den Grützlöffel wieder ergriffen. Aber jetzt legte er ihn abermals fort und riß ein brennendes Scheit aus dem Herde und beleuchtete die Hütte, wo die Kinder im Weihnachtsstroh lagen und schliefen.
»Ich mein’ schon, daß sie alle miteinander da sind«, sagte er.
»Aber wie ist das nur möglich?« wunderte sich Gudrun. Die Kranke war in der vorigen Woche bei ihr gewesen und hatte sie gefragt, ob sie sich der Kinder annehmen könne. Und sie hatte geglaubt, nein darauf sagen zu müssen. Es war doch ein so schlimmes Jahr, daß sie für ihre eigenen Leute nichts zu essen hatte. Aber immerhin konnte sie doch mehr aufbringen als er.
»So viel wie ihre Mutter gehabt hat, habe ich vielleicht auch noch«, sagte der Prediger. »Die Kinder da sind das Hungern gewöhnt.«
Sie sprach weiter, als hätte sie seinen Einwand nicht gehört. »Ich war nicht imstande, sie aus meinen Gedanken zu bringen. Gestern ritt ich nach dem Fischerhaus, um zu sehen, wie es ihnen erging, aber da waren sie schon fort. Ich traf nur ein paar Männer, die die Leiche holen wollten, und sie sagten, daß die Kinder hier beim Hilfsgeistlichen seien.«
»Ja, da sind sie gerade an den Rechten gekommen.«
Jetzt, zum ersten Male, wandte sie sich ihm zu und sah ihm gerade ins Gesicht. Er verstand wohl nicht, wie sie es meinte, dachte sie.
Er rührte rascher und rascher in dem Kessel herum: »Ach, ich schaffe es wohl mit Gottes Hilfe«, sagte er kurz. Dieselbe Verlegenheit, die früher über den Prediger gekommen, war wieder da. Er hätte über sie weinen mögen. Was war es wohl, das sie so verändert hatte, daß sie jetzt Mitleid fühlte, auch mit ihm? Er wußte nicht, was er sagen sollte, um seine Rührung nicht zu verraten. Gudrun kam ihm nicht zu Hilfe. Sie saß da, das Gesicht in die Hände gestützt, und blickte ins Feuer. Sie dachte wohl an das, was sie so verwandelt hatte.
»Das wird ein seltsamer Weihnachtsabend für deine Leute, Gudrun, wenn du fern bist«, sagte er schließlich.
»Ja, es war auch nicht die Absicht, daß es so kommen sollte. Ich machte mich ganz frühmorgens auf, und ich glaubte, ich würde um diese Zeit längst wieder daheim sein.«
»Bist du auf dem Wege aufgehalten worden?«
»Nur dadurch, daß es zu regnen anfing; aber der Boden war doch gefroren, und da wurde es so glatt, daß das Pferd nicht vorwärts wollte.«
Wieder bekam er großes Mitleid mit ihr. Er hätte mit dabeisein mögen, um ihr zu helfen, aber das wollte er nicht sagen.
»Das ist ein merkwürdiges Jahr, in dem es am Weihnachtsabend regnet«, sagte er statt dessen, denn er mußte ja seine Worte sorgsam wählen, damit die Stimme nicht ins Schwanken kam.
»Ja, das steht fest, ein schweres und wunderliches Jahr«, sagte sie, »nicht einmal solch eine kleine Fahrt konnte ich machen, ohne daß mir dabei etwas in die Quere kam. Ich bin erst bei Einbruch der Dunkelheit ins Dorf gekommen.«
»Vielleicht hast du das Pferd hier draußen stehen, Gudrun?« fragte der Geistliche hastig. Er wäre froh gewesen, wenn er Gelegenheit gefunden hätte, etwas für sie zu tun.
»Nein«, sagte sie, »ich habe es beim Propst eingestellt. Ich bin es gewöhnt, dort einzukehren. Ich habe ja zwei Jahre im Pfarrhof gelernt.«
»Ich glaube, das hat mir der Küster erzählt«, sagte der Prediger.
»Ich werde wohl über Nacht dort bleiben müssen«, sagte sie, und da sie keine Antwort darauf bekam, fuhr sie fort: »Ich habe den Kindern etwas mitgebracht. Ich bringe es morgen, das Gehen war heut abend so schwer.«
»Es wird jederzeit willkommen sein.«
Das war nüchterne Rede – der Prediger begann seiner Erregung Herr zu werden. Er mußte daran denken, wie wunderlich es doch war, daß Gudrun selbst gekommen war. Wenn sie ihm und den Kindern nur Weihnachtsspeisen schicken wollte, hätte es ja genügt, einen Knecht auszusenden.
Gudrun hatte dagesessen und mit einem Finger Figuren auf die Herdplatte gezeichnet. Jetzt schlug sie plötzlich die Augen zu ihm auf.
»Damals im Frühling, als ich in die Kirche kam und die Predigt störte, hab’ ich mich nicht recht benommen«, sagte sie. – Nun fand der Geistliche Gelegenheit, ein Wort zu sagen, was ihm schon lange auf der Zunge gelegen war, und er fiel eifrig ein:
»Niemand hatte mir gesagt, wie du bist, Gudrun. Ich wußte nicht, wie falsch ich angeklopft hatte.«
»Ich habe mich doch auf jeden Fall falsch benommen«, beharrte sie. Jetzt wurde er abermals gerührt, weil es mit ihrem Stolz so ganz aus war. Er hätte ihr gerne gesagt, wie schön er es fand, daß sie ihr Unrecht eingestand, aber er konnte es nicht herausbringen.
Auch in ihrer Stimme waren Tränen, aber sie dachte nicht daran, sie zu verbergen, sondern fuhr fort, das auszusprechen, was sie zu sagen gekommen war. Sie wollte wissen, ob er sich noch entsinne, was er damals gesagt hatte, als er sie aufs Pferd setzte. Er hatte gewünscht, sie möge so weit fortziehen, daß sie ihm nie mehr unter die Augen kommen konnte. Sie wollte jetzt wissen, ob er etwas Bestimmtes damit gemeint hatte.
»Nein«, sagte der Prediger, »ich sagte nur so, weil ich zornig war.«
»Ja, zuerst glaubte ich auch nicht, daß es etwas anderes zu bedeuten hätte.«
Nun wandte sie die Augen wieder von seinem Gesicht ab und begann auf der Herdplatte zu zeichnen.
»Es ist heuer soviel Unglück über mich gekommen«, sagte sie. »Ich bin seit diesem Tage wie verfolgt gewesen.«
»Du siehst aus, als wärst du krank gewesen.«
»Nein, Krankheit war es nicht, die mich heimgesucht hat, ich habe mich gegrämt.«
»Ihr habt wohl oben in der Waldgegend viel unter der Dürre zu leiden gehabt«, warf der Prediger hin.
»Es war die Dürre, und es war allerlei anderes Unglück«, erwiderte Gudrun. »Aber der große Waldbrand war das ärgste. Mir ist mein ganzer Wald verbrannt, und alles, was in dem Walde war, ist auch dahin.«
»Du bist doch wohl nicht obdachlos?« rief er aus.
»Nein, nein, der Hof steht, aber all mein Vieh ist umgekommen. Und das war das Schlimmste.«
»Ah«, sagte er nur, aber nun ließ er endlich den Kochlöffel sinken. Er begriff, daß sie nach all den toten Tieren starrte, wenn sie so ins Feuer sah. Das hatte sie gebrochen.
»Ich habe viele Leute unter mir«, sagte sie. »Es ist hart, nicht zu wissen, was man ihnen zu essen geben soll, wenn es keine Milch und keine Butter gibt –«
»Darum konntest du die Kinder nicht aufnehmen?«
»Ja – nein, nicht nur darum.«
»Ich wundere mich, daß ich nichts davon gehört habe«, sagte der Prediger nachdenklich, »aber es war wohl so, daß ich nicht auf die hören wollte, die von dir gesprochen haben. Ich hatte Angst vor dir.«
Er sah, wie Gudruns Gesicht von einem flüchtigen Lächeln erhellt wurde.
»Ich habe noch mehr Angst vor dir gehabt.«
»Angst?« sagte er und war noch verdutzter über dies als über alles andere, was er sie hatte sagen hören.
»Du hast Angst vor mir gehabt?«
»Ja, seit diesem Sonntage«, sagte sie und sah wieder ganz erschrocken aus, als sie davon sprach.
»Hast du geglaubt, daß ich dir all das Unglück schickte?« rief er heftig.
»Ja, ich glaubte, du wolltest mich aus der Gegend verjagen.«
»Aber du hättest doch daran denken müssen, daß ich ein Priester bin.«
»Ja, gerade deshalb. Priester haben ja mehr Macht als wir anderen.«
Der Prediger wußte nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Er begann mit eifrigen Einwänden, aber sie unterbrach ihn.
»Daheim im Rottner-See ist ein Stein mit Hexenzeichen. Der liegt meistens auf dem Seegrund verborgen, aber in großen Unglückszeiten kommt er zum Vorschein. Meine Leute haben erzählt, du hättest ihn gesehen und noch größere Unglücksrunen eingezeichnet, als schon darin standen.«
»Ist dort oben an deinem See niemand, der lesen kann?« fragte der Prediger.
»Doch, ich kann’s«, sagte Gudrun. »Ich habe den Stein gestern gesehen und die Inschrift gelesen.«
Sie stieß einen tiefen Seufzer aus wie bei der Erinnerung an eine schwere Bürde, die von ihr genommen war.
»Nun will ich auch sagen, warum ich mich der armen Fischerkinder nicht annehmen wollte. Ich dachte, all meinen Hausrat zusammenzupacken und zu meinen Verwandten zu ziehen, die drüben auf der anderen Seite des Gebirges in einem anderen Tal wohnen.«
»Aber jetzt willst du bleiben?«
»Ich fürchtete mich nicht mehr so sehr vor dir, als ich sah, was du geschrieben hattest.«
»So hat denn Gott schon geholfen«, sagte der Geistliche.
»Ich dachte, wer dies Gebet eingegraben und sechs arme Kinder zu sich genommen hat, der kann kein harter Mann sein«, sagte Gudrun sanft.
Er stand ein wenig abseits vom Feuer und sah sie an. »Du hast das mit den Kindern als Vorwand genommen, um herzukommen und mich um Barmherzigkeit zu bitten?« sagte er ein wenig zögernd, denn es war ja schwer für ihn, es in seinen Kopf zu bringen, daß sie Angst vor ihm gehabt hatte.
»Ja«, sagte sie. Es klang wie ein ängstlicher Seufzer.
»Du willst, daß ich dir verspreche, dich nicht mehr zu verfolgen, dir nicht mehr Unglück zu senden, so daß du es wagen kannst, daheim zu bleiben?«
Sie hielt die Hände vor die Augen und antwortete nichts, bewegte nur den Kopf ein wenig. Es konnte kein Zweifel sein, daß er sie recht verstanden hatte und daß es das war, was sie zu ihm geführt hatte.
»Was soll ich dir nur sagen, damit du mir glaubst und nie mehr Angst vor mir hast?«, sagte er mit einem starken Zittern in der Stimme.
»Ich habe dir schon gesagt, daß auch ich Furcht vor dir gehabt habe, ich vor dir, den ganzen Sommer«, fuhr er fort. »Ich wäre froh gewesen, wenn ich gehört hätte, du seist über die Berge in ein andres Tal gezogen. Denn wärst du so weit fortgewesen, dann wäre meine Sehnsucht nicht so arg geworden. Es ist schlimmer zu wissen, daß die, der man gut ist, ganz nahe ist, ohne trennende Berge. – Jetzt siehst du vielleicht ein, daß du vor mir keine Angst zu haben brauchst?« fügte er mit einem kleinen Lachen hinzu, das recht wehmütig und mutlos klang. Er wartete ungeduldig darauf, daß sie etwas sagte, aber sie saß ganz still da. Er wußte gar nicht, ob sie ihn hörte.
»Du warst heut abend so, daß ich dir dies sagen konnte«, fuhr er fort. »Ich glaube nicht, daß du dich über mich lustig machen wirst.«
Endlich hob sie den Kopf. In ihren Augenwinkeln schimmerten Tränen.
»Ich bin wohl von Sinn und Verstand«, sagte sie, »aber denke nur, ich finde, es war schon wert, all das durchzumachen, was ich diesen Sommer erleiden mußte, nur um diese Worte von dir zu hören.«
Er wußte nicht, ob er es wagen sollte zu glauben, daß er recht gehört hatte.
»Ich will, daß du bleibst, wo du jetzt bist«, rief er dann aus. »Daß du nie von mir gehst! Diesen Fluch will ich über dich verhängen.«
Er trat näher an sie heran, und sie wich nicht zurück. Aber als er gerade ihre eine Hand an sich gezogen hatte, hörte man ein starkes Zischen und Prasseln vom Herde. Es war die Gerstengrütze, die überkochte.
Der Prediger wandte sich, so rasch er konnte, dem Feuer zu, aber Gudrun kam ihm zuvor. Sie faßte die Kesselringe und hob den Kessel vom Feuer. Aber es war zu spät. Die Grütze brodelte aus dem Kessel und lief über die Herdplatte. Die brennenden Scheite zischten und prasselten, starker Rauch und furchtbarer Dampf erfüllte die Stube. Die Kinder sprangen erschrocken aus dem Stroh auf, und die Kleinsten begannen zu weinen.
Aber mittendrin fing Gudrun zu lachen an. Das Herz schlug ihr rasch und sorglos in der Brust, und sie fühlte, wie sie wieder die alte wurde.
»Ja, nun siehst du, wie es in diesem Haushalt zugeht«, sagte er.
»Du mußt freilich hexen können, du schwarzer Priester, um eine Frau in dein Haus zu kriegen.«
»Ich weiß schon, wer mir meine Frau geschickt hat«, sagte der Prediger. »Die Hexen nicht.«
Plötzlich wurde Gudrun wieder ernst.
»So ist es wohl er, zu dem du gebetet hast, als du deine Bitte in den Stein schriebst, der mich hierher gesandt hat«, sagte sie.
Es heißt, daß der Stein im Rottner-See sich in diesem Jahr der Not und des Schreckens, das wir nun durchleben, wieder gezeigt hat. Die Leute in Värmland glauben, daß er Unheil verkündet, und das mag wohl sein. Aber vielleicht auch soll uns die Kunde, die er von der Not und von dem Glauben früherer Zeiten bringt, Mut einflößen, Zuversicht zu zeigen, Barmherzigkeit zu üben.
Die Silbergrube
König Gustav III. machte eine Reise durch Dalekarlien. Er hatte es eilig und wollte den ganzen Weg wie im Flug durchfahren. Und als sie mit solcher Eile dahinrasten, daß die Pferde wie gestreckte Riemen den Weg entlang lagen und der Wagen an den Biegungen auf zwei Rädern stand, da steckte der König den Kopf durchs Wagenfenster und rief dem Kutscher zu: »Warum sputet Er sich denn nicht? Glaubt Er etwa, daß Er eine Eierschale fährt?«
Da sie in so toller Hast über schlechte Landstraßen fuhren, wäre es beinahe ein Wunder gewesen, wenn Zaumzeug und Wagen gehalten hätten. Das konnten sie denn auch nicht; am Fuße eines steilen Hügels brach die Deichselstange, und da saß nun der König. Des Königs Kavaliere sprangen aus dem Wagen und schalten den Kutscher, aber das machte den Schaden nicht geringer. Es gab keine Möglichkeit für den König, die Reise fortzusetzen, ehe nicht der Wagen instand gesetzt war.
Als die Hofherren sich umsahen, um etwas ausfindig zu machen, was den König zerstreuen könnte, indes er wartete, sahen sie aus einem Gehölz, das ein Stück weit am Wege lag, einen Kirchturm aufragen. Sie schlugen dem König vor, sich in einen der Wagen zu setzen, in denen der Hofstaat fuhr, und zur Kirche zu fahren. Sonntag war es, und der König könnte ja dem Gottesdienst beiwohnen, damit die Zeit verginge, bis die große königliche Karosse fertig wäre.
Der König ging auf den Vorschlag ein und fuhr zur Kirche. Vorher war der König viele Stunden lang durch dunkle Waldgegenden gefahren, hier sah es fröhlicher aus; große Felder und Dörfer und der Daistrom, der hell und prächtig zwischen gewaltigen Massen von Erlengebüsch dahinglitt.
Nur hatte der König insofern Unglück, als der Küster gerade in dem Augenblick, in dem der König auf dem Kirchenhügel aus dem Wagen stieg, den Schlußpsalm anstimmte und das Volk schon die Kirche zu verlassen begann. Als die Menschen so an ihm vorübergingen, blieb der König mit dem einen Fuß im Wagen und dem andern auf dem Trittbrett stehen und rührte sich nicht vom Fleck, sondern betrachtete sie. Das waren die schmucksten Leute, die der König je gesehen hatte. Die Burschen waren alle über gewöhnliche Manneshöhe, mit klugen, ernsten Gesichtern, und die Frauen kamen so stattlich und würdig gegangen, daß der König fand, es könnte ihnen wohl anstehen, im feinsten Schloß zu wohnen.
Den ganzen vorhergehenden Tag hatte sich der König vor der öden Gegend geängstigt, durch die er gekommen war, und er hatte einmal übers andre zu seinen Kavalieren gesagt: »Jetzt fahre ich gewiß durch den allerärmsten Teil meines Reichs.« Aber als er nun das Volk in der schmucken Kirchspieltracht sah, da vergaß er, an Armut zu denken. Es wurde ihm im Gegenteil warm ums Herz, und er sagte zu sich selbst: »Mit dem König steht es nicht so schlimm, wie seine Feinde glauben. Solange meine Untertanen so aussehen, werde ich wohl noch imstande sein, meinen Glauben und mein Land zu verteidigen.«
Er befahl den Hofherren, dem Volk zu verkünden, daß der Fremde, der mitten unter ihnen stünde, ihr König sei und daß sie sich um ihn versammeln sollten, damit er zu ihnen reden könne.
Und nun hielt der König eine Ansprache an das Volk. Er sprach von der hohen Treppe vor der Sakristei, und die schmale Treppenstufe, auf der er stand, ist noch heute erhalten.
Der König begann darzulegen, wie schlimm es im Reich stünde. Er sagte, daß die Schweden von den Russen und Dänen mit Krieg bedrängt würden. Dies wäre unter andern Umständen nicht so gefährlich, aber im Kriegsheer gäbe es viele Verräter, und der König habe keine Armee, auf die er sich verlassen könne. Darum sei ihm nichts übriggeblieben, als selbst hinaus in die Provinzen zu ziehen und seine Untertanen zu fragen, ob sie sich den Verrätern anschließen oder dem König treu sein und ihm mit Leuten und Geld helfen wollten, das Vaterland zu befreien.
Die Bauern verhielten sich ganz still, während der König sprach, und als er geschlossen hatte, gaben sie kein Zeichen der Zustimmung oder des Mißfallens.
Dem König schien es selbst, daß er sehr beredt gewesen sei. Die Tränen waren ihm mehrere Male in die Augen getreten, während er gesprochen hatte. Aber als die Bauern noch immer ängstlich und unschlüssig dastanden und sich nicht entschließen konnten, ihm zu antworten, runzelte er die Stirn und sah mißvergnügt drein.
Die Bauern begriffen, daß es dem König schwerfallen müßte zu warten, und endlich trat einer von ihnen aus der Menge hervor.
»Nun mußt du wissen, König Gustav, daß wir heute keinen Königsbesuch im Kirchspiel erwarteten«, sagte der Bauer, »und darum sind wir auch nicht sogleich bereit, dir zu antworten. Ich will dir raten, daß du in die Sakristei gehst und mit unserm Pfarrer sprichst, während wir das beratschlagen, was du uns vorgelegt hast.«
Der König begriff, daß er fürs erste keinen besseren Bescheid erlangen könne, und fand es am klügsten, den Rat des Bauern zu befolgen. Als er in die Sakristei kam, war niemand da außer einem, der wie ein alter Bauer aussah. Er war groß und grobknochig, mit derben Händen, die von harter Arbeit schwielig waren, und trug weder Kragen noch Mantel, sondern Lederhosen und einen langen, weißen Schafpelz wie alle die andern Männer. Er stand auf und verneigte sich vor dem König, als dieser eintrat.
»Ich glaubte, ich würde den Pfarrer hier finden«, sagte der König.
Der andre wurde ein wenig rot. Er fand es peinlich zu sagen, daß er selbst der Seelsorger dieser Gemeinde sei, da er sah, daß der König ihn für einen Bauern hielt.
»Ja, der Pfarrer pflegt um diese Zeit hierzusein«, sagte er.
Der König ließ sich in einem großen, hocharmigen Lehnstuhl nieder, der dazumal in der Sakristei stand und noch heutigentags dasteht und ganz unverändert ist; nur eine vergoldete königliche Krone hat die Gemeinde an der Rückenlehne anbringen lassen.
»Habt Ihr einen guten Pfarrer hier im Kirchspiel?« fragte der König. Er wollte versuchen, Anteilnahme an dem Schicksal der Bauern zu zeigen.
Als der König ihn so fragte, schien es dem Pastor unmöglich zu sagen, wer er sei. »Es ist besser, der König bleibt bei seinem Glauben, daß ich nur ein Bauer bin«, dachte er und antwortete, der Pfarrer sei gut genug. Er predige Gottes Wort rein und klar, und er versuche zu leben, wie er lehre.
Der König fand, dies sei eine gute Auskunft, aber er hatte ein scharfes Ohr und merkte ein gewisses Zögern im Ton.
»Das klingt so, als wäre Er doch nicht so recht mit dem Pfarrer zufrieden«, sagte er.
»Er ist wohl ein bißchen eigenwillig«, sagte der Pastor. Er dachte, sollte der König doch erfahren, wer er sei, dann würde es diesem sicher nicht gefallen, daß er da gestanden und nur sich selbst gelobt hätte; und darum wollte er sich auch mit ein wenig Tadel hervorwagen. »Es gibt Leute, die vom Pfarrer sagen«, fuhr er fort, »daß er ganz allein dieses Kirchspiel lenken und regieren will.«
»Dann hat er es auf jeden Fall aufs beste geführt und geleitet«, sagte der König. Es wollte ihm nicht gefallen, daß dieser Bauer sich über den beklagte, der über ihn gesetzt war. »Mich dünkt, hier sieht es aus, als herrschten gute Sitten und altväterische Schlichtheit.«
»Das Volk ist brav«, sagte der Pastor, »aber es lebt auch weit aus der Welt in Armut und Abgeschiedenheit. Die Menschen hier würden wohl auch nicht besser sein als andre, wenn die Versuchungen dieser Welt ihnen näher kämen.«
»Nun, es ist ja wohl keine Gefahr vorhanden, daß das geschieht«, sagte der König und zuckte die Achseln. Er fand, daß er an einen geraten war, der sich unnötige Sorgen machte. Der König sagte nichts weiter, sondern begann mit den Fingern auf dem Tisch zu trommeln. Er meinte, daß er genug gnädige Worte mit diesem Bauern gewechselt hätte, und begann sich zu wundern, wann wohl die anderen bereit sein würden, ihm Antwort zu geben.
»Diese Bauern sind nicht sehr eifrig, ihrem König zu Hilfe zu kommen«, dachte er. »Wenn ich nur meinen Wagen hätte, so würde ich von ihnen und allen ihren Beratschlagungen fort meiner Wege fahren.«
Der Pastor hinwiederum saß bekümmert da und kämpfte mit sich selbst, wie er eine wichtige Sache entscheiden solle, mit der er zu Ende kommen mußte. Er fing an, sich zu freuen, daß er dem König nicht gesagt hatte, wer er sei. Nun konnte er mit ihm über das reden, was er sonst nicht hätte zur Sprache bringen können.
Nach einer kleinen Weile brach der Pfarrer das Stillschweigen und fragte den König, ob es sich wirklich so verhielte, wie er ihn eben habe sagen hören, daß die Feinde Schweden bedrohten und das Reich in Gefahr sei.
Der König meinte, daß dieser Mann soviel Verstand haben sollte, ihn nicht weiter zu stören. Er sah ihn groß an und antwortete nicht.
»Ich frage, weil ich hier drinnen stand und vielleicht nicht ganz richtig hören konnte«, sagte der Pastor. »Aber wenn es sich wirklich so verhält, dann will ich sagen, daß der Pfarrer dieser Gemeinde vielleicht imstande wäre, dem König mehr Geld zu verschaffen, als er benötigt.«
»Mich dünkt, Er sagte doch ganz kürzlich, daß alle hier so arm seien«, erwiderte der König und dachte, der Bursche wisse wohl selbst nicht, was er schwätze.
»Ja, das ist wahr«, versetzte der Pastor, »und der Pfarrer hat auch nicht mehr als irgendein andrer. Aber wenn der König so gnädig sein will, mich ein Weilchen anzuhören, dann will ich erzählen, wie es kommt, daß der Pfarrer die Macht hat, ihm zu helfen.«
»Er mag sprechen«, sagte der König. »Es scheint ihm leichter zu fallen, die Worte über die Lippen zu bringen, als seinen Freunden und Nachbarn draußen, die wohl nie mit dem zu Ende kommen, was sie mir zu sagen haben.«
»Es ist nicht so leicht, dem König zu antworten«, sagte der Pastor. »Ich fürchte, daß es schließlich der Pfarrer auf sich nehmen muß, es für die andern zu tun.«
Der König legte ein Bein über das andre, drückte sich tief in den Lehnstuhl, kreuzte die Arme und ließ den Kopf auf die Brust sinken.
»Nun kann Er beginnen«, sagte er in einem Tone, als schliefe er schon.
»Es waren einmal fünf Männer aus diesem Kirchspiel, die auf die Elenjagd in den Wald zogen«, begann der Pastor. »Einer von ihnen war der Pfarrer, von dem wir sprachen. Zwei von den andern waren Soldaten und hießen Olof und Erik Svärd, der vierte der Männer war der Gastwirt hier im Kirchdorf, und der fünfte war ein Bauer, der Israels Per Person hieß.«
»Er braucht sich nicht die Mühe zu machen, so viele Namen aufzuzählen«, murmelte der König und ließ den Kopf auf die eine Seite sinken.
»Diese Männer waren gute Jäger«, fuhr der Pastor fort, »und sie pflegten sonst Glück zu haben. Aber an diesem Tage waren sie weit und breit umhergezogen, ohne etwas anzutreffen. Endlich hörten sie völlig zu jagen auf und setzten sich nieder, um zu plaudern. Sie sprachen davon, daß es im Wald keine Stelle gäbe, die sich urbar machen ließe, alles sei nur Felsen und Morast. ›Unser Herrgott hat nicht gerecht an uns gehandelt, daß er uns ein so karges Land gegeben hat‹, sagte einer von ihnen. ›Anderswo können die Menschen sich Reichtum und Überfluß verschaffen, aber hier vermögen wir uns mit knapper Not unser tägliches Brot zu erarbeiten.‹«
Der Pastor hielt einen Augenblick inne, gleichsam im Zweifel, ob der König ihn auch höre, aber der König machte eine Bewegung mit dem kleinen Finger, um ihm zu bedeuten, daß er noch wach sei.
»Gerade als die Bauern davon sprachen, merkte der Pfarrer, daß es zwischen den Felsen an einer Stelle glitzerte, wo er zufällig mit dem Fuß das Moos weggestoßen hatte. Das ist doch ein merkwürdiger Stein, dachte er und stieß noch ein Mooshügelchen weg. Er nahm einen Steinsplitter auf, der am Moos hängengeblieben war und ebenso glänzte wie alles andere. ›Es ist doch wohl nicht möglich, daß dies hier Blei sein kann?‹ sagte er. Nun sprangen die andern auf und stießen das Moos mit den Büchsenkolben beiseite. Und als sie das getan hatten, war es prächtig zu sehen, wie eine breite Erzader sich durch das Gestein zog. ›Was glaubt ihr, daß dies sein kann?‹ fragte der Pfarrer. Die Männer schlugen Steinsplitter los und bissen hinein. ›Das muß wenigstens Blei oder Zink sein‹, sagten sie. ›Und der ganze Berg ist voll davon‹, sagte der Pfarrer.«
Als der Pastor in seiner Erzählung so weit gekommen war, sah man, wie der Kopf des Königs sich ein wenig hob und ein Auge sich öffnete. »Weiß Er, ob einer dieser Leute sich auf Erze und Gesteine verstand?« fragte er.
»Nein, davon verstanden sie nichts«, antwortete der Pastor. Da sank der Kopf des Königs hinab, und seine beiden Augen schlossen sich wieder.
»Sowohl der Pfarrer wie die, welche mit ihm waren, freuten sich sehr«, fuhr der Pastor fort, ohne sich durch die Gleichgültigkeit des Königs irremachen zu lassen. »Sie dachten, daß sie nun das gefunden hätten, was sie reich machen könnte und ihre Nachkommen ebenfalls! ›Nie mehr werde ich zu arbeiten brauchen!‹ sagte einer von den Soldaten, ›ich werde die ganze Woche nichts tun und am Sonntag in einer goldenen Kutsche zur Kirche fahren!‹
Es waren sonst verständige Leute, aber der große Fund war ihnen zu Kopf gestiegen, so daß sie wie Kinder sprachen. So viel Besinnung hatten sie doch, daß sie das Moos wieder zurechtlegten und den Schatz verbargen. Dann merkten sie sich genau den Platz, wo er sich befand, und gingen heim.
Bevor sie sich trennten, bestimmten sie, daß der Pfarrer nach Falun fahren und den Berghauptmann fragen solle, was dies für ein Erz sei. Er sollte so bald als möglich zurückkommen, und bis dahin gelobten sie einander mit heiligen Eiden, keinem Menschen zu verraten, wo das Erz zu finden sei.«
Der Kopf des Königs hob sich wieder ein wenig, aber er unterbrach den Erzähler mit keinem Wort. Er schien jetzt zu glauben, daß der andre ihm wirklich etwas Wichtiges zu sagen haben müsse, da er sich durch seine Gleichgültigkeit so gar nicht stören ließ.
»Nun machte sich der Pfarrer mit ein paar Erzproben in der Tasche auf den Weg. Er war ebenso froh, reich zu werden, wie irgendeiner der andern. Er dachte daran, daß er den Pfarrhof umbauen wollte, der jetzt um nichts besser war als eine Bauernhütte; und dann wollte er sich mit einer Propsttochter verheiraten, der er gut war. Bis dahin hatte er gedacht, daß er lange auf sie warten müßte. Er war arm und unbekannt, er wußte, daß es lange währen würde, bis er eine Stelle bekäme, die es ihm möglich machte, zu heiraten.
Der Pfarrer fuhr zwei Tage lang nach Falun, und einen Tag mußte er dort umhergehen und warten, weil der Berghauptmann verreist war, und an jemand andern wagte er sich nicht zu wenden. Endlich konnte er ihn sprechen und zeigte ihm die Erzstücke. Der Berghauptmann nahm sie in die Hand. Er sah zuerst sie an, dann den Pfarrer.
Der Pfarrer erzählte, daß er sie in seinem heimatlichen Kirchspiel in einem Felsen gefunden habe, und meinte, ob es nicht Blei sein könne.
›Nein, Blei ist es nicht‹, sagte der Berghauptmann.
›Also ist es vielleicht Zink?‹ fragte der Pfarrer.
›Zink ist es auch nicht‹, sagte der Berghauptmann.
Dem Pfarrer war zumute, als ob seine ganze Hoffnung zu Boden sänke, so verzagt hatte er sich so manchen lieben Tag nicht gefühlt.
›Habt ihr viel solche Steine in eurem Kirchspiel?‹ fragte der Berghauptmann.
›Wir haben einen ganzen Berg‹, sagte der Pfarrer.
Da ging der Berghauptmann auf ihn zu, klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Dann seht zu, daß ihr einen solchen Gebrauch davon macht, daß es euch selbst und dem Lande zum Nutzen gereicht, denn dies ist Silber!‹
›Ja so‹, stammelte der Pfarrer ganz verwirrt. ›Ja so, es ist Silber.‹
Der Berghauptmann begann, ihm zu erklären, was er zu tun hätte, um sich ein gesetzliches Recht auf die Grube zu verschaffen, und gab ihm viele gute Ratschläge, aber der Pfarrer stand, ganz wirr im Kopf, da und hörte nicht zu, was er sagte. Er dachte, wie unglaublich dies sei, daß daheim in seinem armen Kirchspiel ein ganzer Berg mit Silbererzen läge und auf ihn wartete.«
Der König erhob so heftig den Kopf, daß der Pastor sich unterbrach.
»Es kam wohl so«, sagte der König, »daß, als er nach Hause zurückkehrte und anfing, die Grube zu bearbeiten, er merkte, daß der Berghauptmann seinen Spaß mit ihm getrieben hatte.«
»Ach nein, der Berghauptmann hatte ihn durchaus nicht zum besten gehabt«, sagte der Pastor.
»Er kann fortfahren«, sagte der König und setzte sich wieder zurecht, um zuzuhören.
»Als der Pfarrer endlich zu Hause war und durch sein heimatliches Kirchspiel fuhr«, hob der Pastor wieder an, »war er sich klar, daß er vor allem seine Kameraden von der Entdeckung benachrichtigen müßte.«
»Er wollte wohl ihr Glück sehen«, fiel der König ein.