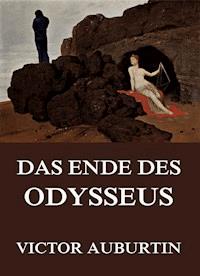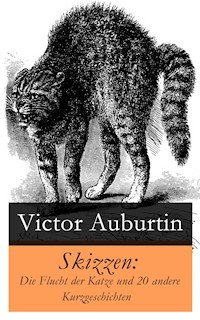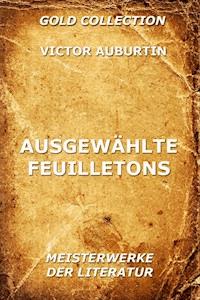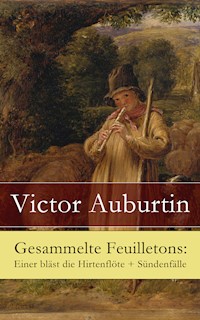
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dieses eBook: "Gesammelte Feuilletons: Einer bläst die Hirtenflöte + Sündenfälle" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Victor Auburtin (1870/1928) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Inhalt: Einer bläst die Hirtenflöte Sündenfälle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gesammelte Feuilletons: Einer bläst die Hirtenflöte + Sündenfälle
Inhaltsverzeichnis
Einer bläst die Hirtenflöte
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Ausgewählte Feuilletons
Inhaltsverzeichnis
1940
»Es war einmal ein Mann, der ging auf eine Wiese und sah in einem Tautropfen den ganzen Kosmos abgespiegelt, und weil er nicht wußte, wie der Tropfen hieß, so nannte er ihn Feuilleton.«
Quasi ein Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Nie würde ich gewagt haben, in den Titel dieses kleinen Buches das Wort »Hirtenflöte« zu setzen, wenn ich nicht schon einmal eine Hirtenflöte gesehen und gehört hätte. Das Wort Hirtenflöte kommt besonders in Leitartikeln vor, und was wissen Leitartikler von Hirtenflöten!
Es war an einem Wintertage in Athen in einem kleinen Restaurant bei der Börse zu Mittag. Das Lokal war voll von griechischen Börsenmännern, die halbrohes Lammfleisch fraßen und dazu schrien wie die Besessenen. Sie schrien aber, erstens weil die Griechen immer schreien – man denke an Demosthenes, der sich Kieselsteine in den Mund steckte, um noch besser schreien zu können –, zweitens weil die Kurse wieder gestiegen waren und das Geschäft blühte.
Da trat in das Restaurant ein alter, bäuerlich gekleideter Mann ein, blieb an der Türe stehen und stellte vor sich einen kleinen Napf. Dann zog er aus einer Ledertasche eine Hirtenflöte, eine veritable Hirtenflöte, so wie wir sie von der alten Kunst her kennen, vielleicht zehn Pfeifenröhren aneinandergebunden.
Es war ein Urenkel des großen Pan da draußen, und er fing nun an, in den Lärm zu spielen. Stille, kurze Strophen von reiner Kadenz, aber man hörte ihn kaum, man achtete nicht auf seine Melodie, und sein Näpfchen bekam nur wenig. Ich sehe das ganze Bild noch heute vor mir, es war sehr traurig, und wie alles Traurige etwas komisch.
Und weil das alles ungefähr so ähnlich ist – auch das mit dem großen Pan stimmt beinahe –, deshalb heißt mein kleines Buch so, und damit Gott befohlen...
Nur eine Bitte noch an meine Leserschar: man lese von diesen kleinen Strophen gütigst nicht zuviel hintereinander, das vertragen sie nicht. Zwei oder drei vor dem Schlafengehen, wenn der Lärm des Tages verstummt.
Aus »Die Onyxschale« (1911)
Inhaltsverzeichnis
Die Welt
Inhaltsverzeichnis
Der veilchenblaue Schmetterling wohnte auf einer Wiese am Ufer des Stromes, gerade da, wo die große Eisenbahnbrücke über das Wasser geht. Er spielte mit seiner veilchenblauen Braut, tanzte mit ihr im Sonnenschein und setzte sich auf alle Sternblumen der Wiese, auf eine nach der anderen.
Aber da kam eines Tages die Sehnsucht nach der Ferne über ihn, und er begann sich zu schämen, daß er von der Welt noch nichts anderes gesehen hatte als eben immer nur diese eine Wiese. So faßte er sich ein Herz und sagte zu seiner Braut: »Ich möchte wissen, ob am anderen Ufer des Stromes die Sternblumen ebenso sind wie unsere hier, und ob es überhaupt in der Welt etwas anderes gibt.« Und damit verließ er seine veilchenblaue und traurige Braut und flog hinweg, über den Strom hin, über den die große Eisenbahnbrücke geht.
Am anderen Ufer flog der veilchenblaue Schmetterling weit ins Land hinein, um recht viel von der Welt zu sehen. Die Sternblumen waren gerade so wie daheim, und er setzte sich hier und da auf eine, wie sie ihm gerade im Wege stand, um seiner Sache sicher zu sein. Auch hing er lange Zeit träumend unter einem Fliederblatt und fand, daß die Welt auf dieser Seite des Stromes nicht viel anders sei als daheim, nur sei sie einsamer und trauriger. Deshalb gab er die Unternehmung bald auf und machte sich wieder auf die Heimfahrt seiner Wiese zu.
Und wie er so heimwärts flog, da kam hinter ihm her der Expreßzug herbeigebraust, der auf die große Eisenbahnbrücke zueilte. Der veilchenblaue Schmetterling geriet in den Luftwirbel, setzte sich auf einen Waggon des Zuges und fuhr auf diesem Waggon geschwind seiner Heimatwiese zu.
Der Expreßzug aber eilte durch das Land, als sei es nicht da. Er raste an einem Wärterhäuschen vorbei, das laut aufschrie, und an Bäumen vorbei, die sich im Winde brausend bogen. Und dann stürzte er sich auf die große donnernde Eisenbrücke. Aber als er mitten auf der Brücke war, da flog die Lokomotive aus dem Geleise, durchbrach das Geländer und sprang in den Strom hinab. Und riß alle die Waggons des Zuges mit sich, daß sie in das Wasser krachend schlugen und da unten einen Trümmerhaufen bildeten, durch den die Wellen zu rauschen begannen.
Der Schmetterling hatte sich während des Sturzes von dem Waggon erhoben und flog nun nach der Wiese zu seiner Braut, die sich außerordentlich freute, ihn sobald wiederzusehen. Erst herzten und küßten sie einander eine Weile schweigend, dann fragte die Braut: Nun, mein Freund, wie war es auf dem anderen Ufer?
Der Schmetterling antwortete: Die Sternblumen sind dort drüben genau so wie unsere hier und duften auch so, und es ist in der ganzen Welt dasselbe.
Und hast du etwas erlebt? fragte die Schmetterlingsbraut.
Nichts habe ich erlebt, antwortete er, wenigstens nichts von Bedeutung. Was sollte man auch wohl erleben? Es ist ja doch nichts so wie der Schimmer deiner Farben und wie der Hauch deines Flügelschlages.
Da tanzten sie wieder um die Sternblumen im Sonnenscheine, und die Braut sagte lächelnd: Lohnte es sich, einen Tag unseres veilchenblauen Schmetterlingslebens fern von mir zu verbringen?
Die Inschriften
Inhaltsverzeichnis
Als Dante vor der Hölle ankam, da waren seine Augen scharf und böse wie des Sperbers und blickten in alle Ecken und Winkel. Und da sah er die Inschrift, die über dem Tore stand und die lautete: Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.
Als Dante am Paradiese ankam, führte er Beatricen leise an der Hand. Da sah er nichts als das Licht ihrer Augen und das Schreiten ihrer florentinischen Füße über die Perlmuttergefilde der Seligkeit. Und deshalb bemerkte er es nicht, daß auch über der Paradiesestür eine Inschrift stand; eine Inschrift, die da lautete: Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.
Die Villa mit den weißen Säulen
Inhaltsverzeichnis
Als Felix siebzehn Jahre alt war, und als er es über alles liebte, in der Odyssee des Dichters Homer zu lesen, kam er eines Abends an der weißen Säulenvilla vorüber. Die Villa mit den weißen Säulen lag am See in einem kühlen Garten drin, und unter den weißen Säulen saß ein stiller, alter Herr und las in einem Buche. Da flammte in Felix der Wunsch auf, auch einmal so still dazusitzen unter weißen Säulen vor dem See und die Odyssee des Dichters Homer zu lesen, immerzu.
Und er kniete nieder und schwor, daß er diese Villa einmal besitzen werde, koste sie nun, was sie wolle.
Er warf sich in den Kampf hinein; er arbeitete, um essen zu können, und aß, um arbeiten zu können; er stieg schiefe Treppen hinauf, schrieb Zahlen in seine Notizbücher und stritt um jeden Taler; er machte Geschäfte, spekulierte an der Börse und konnte die Abendzeitung nie erwarten; er berechnete sich die Konjunkturen schon wochenlang vorher, und dann war es eine große Freude, wenn alles gestimmt hatte. Er hatte große Erfolge, ruinierte alle seine Gegner, wurde eine große Finanzmacht, und wenn ein neues Syndikat gegründet werden sollte, so ging das nicht ohne ihn.
Und so bekam er nach zwanzig Jahren sehr viel Geld zusammen; und er erinnerte sich an seinen Schwur und kaufte die Villa mit den weißen Säulen schlank vom Platze weg für 40 000 Mark mit 10 000 Mark Anzahlung.
Aber als er unter den weißen Säulen saß und den Kurszettel zu Ende gelesen hatte, da sagte er sich, daß man schließlich doch etwas tun müsse, und lud telephonisch seine zwei Freunde zum Abend ein. Mit denen saß er dann unter den weißen Säulen, und sie sprachen lange und waren sich einig darüber, daß jetzt zwar eine stille Zeit sei, daß in Stahlwerken aber immerhin noch etwas verdient werden könne.
Im Kasten unten irgendwo lag die Odyssee des Dichters Homer. Und sie hatte noch immer dasselbe wie damals, als man siebzehn Jahre war: das Abenteuer des Helden, das stille Warten großer Frauen am Webstuhl, den Rat der Götter oben auf dem Schneeberge und das unermeßliche Flimmern der mittäglichen Meere.
Das Singen
Inhaltsverzeichnis
Kennst Du das Singen der großen Stille? Es ist selten, weil die große Stille selten ist. Im Winter kommt es wohl vielleicht einmal, wenn draußen der Schnee die Straßen deckt, und du liegst in der Dämmerung auf deinem Sofa und hörst. Und hörst es klingen. Es ist leise und vibriert wie das Summen einer Fliege; aber Fliegen gibt es jetzt im Winter nicht. Ganz fern, ganz leise ist es. Es ist vielleicht nur das Klingen deines Blutes. Es ist vielleicht ein Geigenspiel tief unten in einem andern Stockwerk. Es ist vielleicht das Murmeln von Stimmen in den Kammern deiner Seele. Es ist vielleicht ein Signal an dich von den Bewohnern des dunkeln Siriusbegleiters.
Lohnte es sich?
Inhaltsverzeichnis
Man legte einander die Frage vor: Lohnte sich dieses Leben: oder sollte es nicht besser gewesen sein, wenn man gar nicht geboren wäre, wenn man das Dunkel da unten niemals verlassen hätte?
Dazu wurde einerseits dieses angeführt: Das Leben besteht aus Halunken, aus Ärger, aus Fahrten im Automobilomnibus, aus verbrannten Kalbskotelettes, aus Hast, Drang und Unrast, aus Zahnschmerzen, Theaterpremieren und Zigarrenstummeln, Bettel, Zank und aus Ekel, Ekel, Ekel.
Andererseits wurde zu der Frage folgendes angeführt: Soeben steht ein klarer Januarsonnentag über unserer Ebene. Weiße Wolken gehen vor dem Ostwinde langsam dahin und haben rote flammende Ränder. Der Himmel ist gegen den Horizont blaß, gegen den Zenit immer tiefer blau, und siehst du senkrecht hinauf, so blickst du in die klare, mächtige Tiefe des Kosmos. Und gerade vor dieser Tiefe kreist ein Taubenschwarm und ist bald golden, bald dunkel, je nachdem er den Rhythmus seines Flügelschlages der Sonne zuwendet oder nicht.
Und nun antwortet man auf jene Frage so: Böte das ganze Leben an Gutem nichts als diese Taubensekunde, aus den Nächten des Nichts schrie ich nach ihm; schrie ich nach ihm.
Wasserträgerinnen
Inhaltsverzeichnis
Es liegt in Mittelitalien eine Bergstadt – ich nenne ihren edlen Namen nur mir selbst –, in der ich vor jetzt zwanzig Jahren einige dämmernde Tage lebte. Das ist eine enge Stadt mit finsteren Gassen und mit vielen kleinen Weinkneipen, an deren Decke Würste und runder Stutenkäse hängen, bunt durcheinander. Vor dem Tore aber ist ein Brunnen, und an diesen Brunnen kamen des Abends die Mädchen, um Wasser zu holen.
Jeden Abend saß ich da und sah mir das an, wie die Mädchen durch das Tor heraufkamen mit ihren Gefäßen auf den Köpfen. Die füllten sie an dem laufenden Wasser, ohne viel Gerede dabei zu machen, hoben sie schwer wieder auf und gingen gerade und edel zum Tore zurück.
Es waren aber die Wassergefäße der Mädchen aus Bronze geformt und von reinen, alten Formen wie die Hydrien der Griechen. Und das schwere Gefäß mit dem klaren Elemente drin stand gar herrlich auf dem dunkeln, stolzen Haupt Latiums.
Und immer habe ich nachher an diese Gefäße denken müssen und an diese Frauen, jahrelang. Wenn mir des Alltags Ekel das Herze brach, wenn mir das Leben zu grau und zu verwaschen schien, dann dachte ich an den Brunnen in Latium und sagte mir: das ist ja immer noch da, also ist es nicht ganz so schlimm.
Jetzt reiste ich wieder einmal dahinunter und fuhr über das große Rom und ging in die stille Bergstadt und setzte mich abends an meinen Brunnen, um auf jene Mädchen zu warten. Sie kamen auch wieder. Aber sie trugen auf den Köpfen nicht mehr die dunkeln Bronzegefäße von damals, sondern vielmehr alte Konservenbüchsen aus Weißblech, die bedeutend billiger und praktischer sind. Solche Konservenbüchsen braucht eine Aktiengesellschaft in Livorno zum Transport von eingemachten Pflaumen; die verbrauchten Konservenbüchsen aber werden um ein Billiges an alle jene Bergstädte abgegeben, in denen ein Brunnen rauscht und junge Wasserträgerinnen abendlich kommen, das Wasser zu holen.
Und als ich das sah, begriff ich, daß es wirklich in der Welt einen Fortschritt gibt und eine Auslese des Besten und Passenden.
Aber immerhin möchte ich doch nun endlich wissen, wo mein Grab sein wird. Mein Grab, Herrschaften, ich sehne mich nach meinem Grabe.
Das gute Ruhekissen.
Inhaltsverzeichnis
Wie nun der alte Doktor Dieterici so weit war, daß es langsam ans Sterben ging, da raffte er sich noch einmal auf aus seinem Lehnstuhl und kroch zum Bücherspinde hin. Dort standen dicht und bunt in Reihen die Bücher, die er liebgehabt hatte, und die Bücher, die er gebraucht hatte für die Täglichkeiten des Lebens. Weiße Bände in Schweinsleder; in Franzbänden die Schriften der Römer; alte mantuanische Schäferspiele, die er einmal gesammelt hatte; der Homer. Dazwischen Wörterbücher, zerlesene Reclamhefte, Baedekers von der Reisezeit. Ein ganzes Leben, wie man es so lebt, heute so, morgen so, ohne Ordnung. Der alte Doktor Dieterici sah sich diese Bücher noch einmal an in der Stille und seufzte. Dann rief er seine Wirtschafterin, die Marie, und wie sie gekommen war, nahm er ein Buch aus dem Spind und zeigte es ihr. Es war die Odyssee des griechischen Dichters Homer in einer einfachen Schulausgabe.
Liebe Marie, sagte der alte Doktor Dieterici, wenn ich nun in drei Tagen gestorben sein werde, dann müssen Sie mir einen Dienst tun. Sie werden mir dieses Buch hier unter den Kopf legen und es mir so mit ins Grab geben. Ich glaube, daß ich die lange Nacht ruhig durchschlafen werde, wenn ich dieses Buch als Kopfkissen habe. Geben Sie mir die Hand darauf und vergessen Sie es nicht.
Die Wirtschafterin gab ihm die Hand darauf und weinte sehr. Und sagte, soweit sei es noch gar nicht und vom Sterben keine Rede. Der alte Rat Heydebringk, der unten im zweiten Stock, sei noch viel kränker gewesen und habe sich doch auch noch einmal herausgerappelt.
Drei Tage später starb der alte Doktor Dieterici wirklich. Und als er sauber auf sein Lager gebettet war, erinnerte sich die Wirtschafterin Marie an ihr Versprechen und ging, das Buch zu holen, ohne das ihr Herr nicht ruhig schlafen könnte. Aber sie vergriff sich und nahm nicht die Odyssee, sondern die danebenstehende zweite Auflage von Brauchitschs Ausgabe des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes. Die holte sie hervor und stecke sie ihrem Herrn unter den Kopf als Ruhekissen.
Die Freunde kamen, um von dem Toten Abschied zu nehmen. Da sahen sie, daß sein Kopf auf einem Buche ruhte, und bückten sich, um zu sehen, was das für ein Buch sein möge. Und als sie sahen, daß es die zweite Auflage von Brauchitschs Gewerbeunfallversicherungsgesetz war, da erstaunten sie auf das äußerste und stellten die Wirtschafterin zur Rede wegen dieses Unfugs. Die aber wehrte sich heftig und rief, sie werde an das Buch nicht rühren lassen, und niemand dürfte es wegnehmen; denn ihr Herr habe es so gewollt, um ruhig schlafen zu können. Da wunderten sich die Freunde noch mehr und kamen überein, daß solche einsame Junggesellen die merkwürdigsten Einfälle und Gedanken haben könnten.
So wurde der alte Doktor Dieterici nicht mit der Odyssee begraben, auf der er ausruhen und von dem ewigen Meeressingen träumen wollte, sondern mit der zweiten Auflage von Brauchitschs Gewerbeunfallversicherungsgesetz.
Es ist aber anzunehmen, daß er auch so ganz ruhig und ohne irgendwelche Beschwerde seinen guten Schlaf gefunden hat.
Die Brüder in Apoll
Inhaltsverzeichnis
Ambroise, der Herzog von Guiche, hatte seinen schwarzen Tag. Er saß im Speisesaale des Schlosses, am großen Tische ganz allein, sah vor sich hin und wollte von nichts wissen.
Seine Diener und der Hofmeister standen flüsternd in der Tür und sagten sich: er sucht wahrscheinlich einen Reim und findet ihn nicht, das ist die ganze Geschichte.
Denn der Herzog von Guiche war ein Dichter und reimte Hymnen auf den Sonnenkönig Ludwig in Versailles und schrieb Schäferspiele, die man in Paris aufführte.
Es wurde Essenszeit, und aus der Küche kam ein Knuspern und Duften wie von Poulardenbraten und ein leises Klirren silbernen Geschirres. Aber der Herzog rührte sich nicht. Und der Koch Jacques trat ein, verneigte sich vor seinem Herrn und sagte: Euer Gnaden, wir haben heute eine Poularde, eine von jenen Poularden, die im Burgunderwein erstickt wurden. Sie dreht sich am Spieß und ist goldig wie die Farben des Malers Tizian und feist wie ein Canonikus von Chartres.
Aber das Gesicht des herzoglichen Dichters verfinsterte sich nur noch mehr, er schüttelte seine Lockenperücke und sagte zu dem Koche Jacques: Iß dir deine goldige Poularde allein, ich mag nichts davon wissen.
Nun wurde man doch ernstlich besorgt, und der Hofmeister beschloß, alle Mittel zu versuchen, um den Sinn des melancholischen Dichters aufzuheitern. Er holte aus dem Schrank die Kameensammlung her und legte sie auf den Tisch und legte auch die lange Perlenkette hinzu, die das Staatsstück des herzoglichen Familienschatzes war. Denn er wußte, daß des Herzogs adliger Sinn am Anblick kostbarer Dinge Freude und Kraft zu gewinnen pflegte.
Der Herzog faßte zerstreut nach den edlen Steinen, nach den Karneolen mit den Bildern von Cäsaren und nach den braunen Sardern, in die die bärtigen Gesichter attischer Rhetoren geschnitten waren. Auch spielte er ein Weniges mit der langen Perlenkette und ließ sie glatt durch seine Finger gleiten. Jede Perle war wie der Nebel eines Herbstvormittags, milchig weiß, mit einem verlöschenden Schimmer rötlichen Orientes darin. Aber das war auch das Richtige nicht, denn gleich warf der Herzog das Spielzeug wieder hin und versank aufs neue in sein verärgertes Nachdenken.
Dann versuchte der Hausmeister es mit einem Musikstück, das im Hintergrund des Saales gespielt wurde; aber das half auch nichts. Dann sprach er von den dichterischen Erfolgen des Herzogs und lobte die Hymnen und die Schäferspiele; aber nicht einmal dieses konnte den Schwermütigen ermuntern. Er wurde immer verdrießlicher und sagte:
Laßt mich doch, Freunde, und bemüht euch nicht; ich habe heute meinen üblen Tag, und der muß getragen werden. Ich weiß nicht, was mir ist; es ist nicht Liebe, und es ist nicht Krankheit; aber das Leben scheint mir schal und ekel, und ich glaube, es lohnt sich nicht; ich wünschte, ich wäre tot, so schwarz und greulich erscheint mir alle Welt und alles menschliche Unternehmen.
Da schließlich kam aus der Gruppe der Diener der Schloßkaplan hervor und sagte leise zu dem Koch: Warte, Jacques, ich werde deine Poularde gleich zu Ehren bringen, und trat zum Herzog, verneigte sich tief und sprach:
Haben Euer Gnaden schon gehört, was dem Grafen Latour zugestoßen ist?
Der Herzog sah auf. Dem Grafen Latour? fragte er. Dem Dichter, meinem lieben Freunde? Was ist ihm zugestoßen?
Sein Stück ist in Paris ausgepfiffen worden, antwortete der Kaplan.
Der Herzog blickte überrascht und scharf vor sich hin, und in seinen Augen begann es zu lodern.
So, so, sagte er, sieh mal einer an. Ausgepfiffen in Paris. Was du sagst! Nun ja, das war zu erwarten. So leicht ist es nun doch nicht, und der erste beste kann es nicht.
Und dann lächelte er, rieb sich die Hände, warf die Locken stolz zurück und dehnte sich tüchtig in erwachender Lebenskraft. Dann drehte er sich um und sagte:
Nun, Jacques, mein Koch, wie wäre es mit jener Poularde, die goldbraun ist wie die Göttinnen Tizians und feist wie die Herren Canonici in Chartres.
Das Leben
Inhaltsverzeichnis
Es lebte ein Mann, der war ein sehr tätiger Mann und konnte es nicht übers Herz bringen, eine Minute seines wichtigen Lebens ungenützt vorüber zu lassen.
Wenn er in der Stadt war, so plante er, in welchen Badeort er reisen werde. War er im Badeort, so beschloß er einen Ausflug nach Marienruh, wo man die berühmte Aussicht hat. Saß er dann auf Marienruh, so nahm er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man am schnellsten wieder zurückfahren könne. Wenn er im Gasthof einen Hammelbraten verzehrte, studierte er während des Essens die Karte, was man nachher nehmen könne. Und während er den langsamen Wein des Gottes Dionysos hastig hinuntergoß, dachte er, daß bei dieser Hitze ein Glas Bier wohl besser gewesen wäre.
So hat er niemals etwas getan, sondern immer nur ein nächstes vorbereitet. Er war nie einer ganzen und gesunden Minute Herr, und das war gewiß ein merkwürdiger Mann, wie du, lieber Leser, nie einen gesehen hast.
Und als er auf dem Sterbebette lag, wunderte er sich sehr, wie leer und zwecklos doch eigentlich dieses Leben gewissermaßen gewesen sei.
Der Theaterkritiker
Inhaltsverzeichnis
Im Restaurant von Bellmann abends um elf Uhr. Also zu der Zeit, wo es am schlimmsten zugeht. Um jeden Tisch sitzen zehn Mann und lärmen durcheinander, und die Kellner bringen immer neue Portionen herbei.
Gustav, der Oberkellner, setzt ein großes Tablett mit sechzehn vollen Tellern auf den Serviertisch nieder. Hol' es der Henker, sagte er. Und dabei läuft ihm der Schweiß von der Stirn herunter und fällt Tropfen nach Tropfen in jene Portion Hammelnieren, die sogleich von der Frau Gerichtsrat Beyer mit großem Behagen und mit einer gewissen Kennermiene verspeist werden wird.
Da betritt der große Theaterkritiker Ernst Mancke das Lokal und geht zu dem Stammtisch, der gebührenderweise leer geblieben ist. Er zieht den Paletot aus und sagt zu dem Kellner: Vorläufig bestelle ich noch nichts; mein Bote wartet am Büfett; ich schreibe ihm noch ein paar Worte.
Der Kritiker Mancke hat soeben im Theater ein neues Stück von Maeterlinck gesehen und gedenkt jetzt hier im Restaurant einen kurzen Vorbericht für seine Zeitung zu verfassen. So setzt er sich an den Stammtisch und schreibt folgendes:
Gestern im Deutschen Theater Pelleas und Melisande. Was soll man sagen, Freunde und Gefährten? Nichts soll man sagen nach solchem künstlerischen Erlebnis. Stumm und erschaudernd soll man hinausgehen, über Blütenwiesen wandeln und den feinen Duft der Tulpen einatmen. Und soll Gott aus vollem Herzen danken, daß uns diese Gnade und Gloria wurde, und diese schimmernde Magie. Morgen schreibe ich noch etwas mehr. Jetzt drängt es mich hinaus in die Nacht unter des Sternenhimmels hehren Dom. Jetzt weiß ich nur einen Rat: Schluchzen, schluchzen, schluchzen.
Der Theaterkritiker tut diesen Bericht in ein Kuvert und schickt ihn seinem Boten hinaus. Dann winkt er den Kellner herbei und sagt ihm: So, Oberkellner, jetzt bringen Sie mir einmal Pökelkamm mit Sauerkraut.
Der Schneeberg
Inhaltsverzeichnis
Wenn im Dezember der Schnee vom Himmel rieselt, weicher, flockiger Schnee, der nicht schmilzt, sondern liegenbleibt ... wenn im Dezember der Schnee vom Himmel fällt, so wird er auf meinem Hofe zusammengefegt, wie das in der Ordnung ist. Und es kommt ein großer kristallener Berg zusammen, der gerade in der Mitte des Hofes steht und über den sich jeder Mensch freut. Und dieser Berg steht auch gerade mitten drauf auf dem Wege, den ich täglich viermal über den Hof hin und her zu machen habe. Denn ich wohne, wie sich das für einen stillen und nachdenklichen Mann versteht, im Hinterhause rechts vier Treppen.
Gehe ich also über den winterlichen Hof auf mein Hinterhaus zu, so mache ich einen kleinen Bogen um den weißen Berg herum. Und ist es Nacht, und ich kann den Berg nicht sehen, so mache ich trotzdem meinen kleinen Bogen ganz schlau und richtig gerade da, wo er gemacht werden muß; und noch nie bin ich etwa täppisch in den Berg hineingerannt.
Nun geht aber der Winter im März zu Ende, und mit ihm wird der Berg klein und kleiner. Und wenn im Garten draußen die Schwarzdrossel sechsmal gepfiffen hat, ist er Gott sei Dank endlich wieder weg, der graue, schmutzige Berg aus altem Dezemberschnee. Aber das Sonderbare ist nun: ich mache meinen Bogen immer weiter, genau so, als ob der Schneeberg noch da wäre. Ich wundere mich selbst darüber und ärgere mich nicht wenig, daß der Mensch so dumm ist und ein solches Gewohnheitstier, ... aber es hilft alles nichts. Bin ich über den Hof hinweg, so merke ich, daß ich wieder den Bogen gemacht habe, als sei das ganze Jahr Winter, und als gäbe es einen Frühling nun schon gar nicht mehr.
Wenn der Flieder blüht, wenn es vor Sommerhitze nicht mehr auszuhalten ist, wenn die Kirschen rot im Baume reifen ... Das ist mir alles gleich. Ich mache meinen Bogen um den Schnee herum, der nun wer weiß wo ist, der aber in meinem kalten Herzen immer da bleibt das ganze Jahr. Und das dauert so lange, bis allmählich ein neuer Winter herangedunkelt ist und der Portier auf dem Hofe wieder antritt mit seinen dicken Handschuhen und mit seiner großen Schneeschippe. Dann steht ein frischer Kristallberg da aus dem Schnee des jungen Dezember, und wenn ich nun meinen Bogen mache, so ist endlich wieder alles in Ordnung. Und dann freue ich mich, daß wieder einmal ein aufrechter Mann recht behalten hat; trotz der Schwarzdrossel, der Fliederblüte und der roten Kirschen, die allesamt keine Ahnung von der Welt haben.
Sieben und einer
Inhaltsverzeichnis
Sieben Spatzen sitzen um meine Gartenbank herum und haschen nach den Brotstückchen, die ich ihnen hinwerfe. Sieben Kerle von Spatzen, wüst und liederlich wie die Vagabunden.
Es ist ferner noch ein Fink da, ein artiger, stiller, sauberer Geselle, mit schönen, aber etwas verlegenen Augen. Der Fink möchte wohl auch eines meiner Brotstückchen haben, aber es gelingt ihm nicht, denn immer kommt ihm frech solch ein Kerl zuvor und nimmt es ihm vor der Nase weg. Einmal hat er glücklich ein Krümchen erwischt, aber gleich fahren sie über ihn her, daß er es erschrocken fallen läßt.
Und nun gibt er es auf, fliegt auf einen Zweig des Ahornbaumes, blickt in den Himmel und singt seinen goldenen Schlag, klar und ruhig. Und weiß es wohl, wem doch alle Kronen dieser Erde gehören am letzten Ende.
Aus »Pfauen-Federn« (1921)
Inhaltsverzeichnis
Das Ende des Odysseus
Inhaltsverzeichnis
Die hundert Freier der Königin Penelope waren erschlagen, und ihre Leichen wurden, in Teppiche gehüllt, aus dem Festsaal getragen, einer nach dem anderen. Obgleich es schon gegen die Mitternacht ging, war das Haus nach dem furchtbaren Vorfall noch in voller Bewegung; die Fenster strahlten in die Nacht hinaus, und Diener liefen hin und her. Man hörte, wie in der großen Halle das Blut mit Besen über die Steinfliesen ausgefegt wurde.
In dem hell erleuchteten Schlafgemach lag Odysseus neben seiner Gattin Penelope. Und nachdem sie sich in Liebe wiedergefunden hatten, setzte er sich aufrecht und begann von seinem zwanzigjährigen Abenteuer zu erzählen; von Ilion, von dem Streit der Könige im Lager; von der Heimfahrt und den Wunderdingen der fernen See. Aber als er bei Szylla und Charybdis ankam, merkte er, daß Penelope neben ihm eingeschlafen war. Da dachte er: Die Arme hat heute viel durchgemacht, ich werde ihr morgen weitererzählen, und legte sein Haupt neben das ihrige auf die Purpurkissen.
In dem königlichen Palast war zunächst viel zu schaffen und zu richten, denn die jungen Leute hatten mit ihrem wilden Wesen alles in Unordnung gebracht. Odysseus entwarf einen Plan, ließ sich durch seine Verwalter Bericht erstatten und ging ans Werk.
Er ließ die große Halle mit neuen Marmorplatten belegen, um die letzte Erinnerung an den vergossenen Wein, aber auch an das vergossene Blut zu tilgen. Die Keller und Vorratskammern waren zur Hälfte leer und mußten neu ausgestattet werden; die Ölmühlen, früher ein Stolz der königlichen Wirtschaft, waren jahrelang nicht mehr benutzt worden, und ihre Wiederherstellung erforderte Zeit und Mühe.
Hinter dem Hause hatten die Freier einen großen Blumengarten anlegen lassen, zu dessen Besorgung ein syrischer Gärtner angestellt worden war. Dort wurden Narzissen und Nelken gezogen und jene hundertblättrigen Rosen, deren Zucht eben gelungen war. Mit diesen Blumen zierten die Freier ihre Festtafel und brachten große Sträuße der Königin, um deren Gunst sie warben. Penelope aber nahm diese Blumengaben gern entgegen und schmückte damit die Bronzevasen, die auf den Gesimsen ihres Schlafzimmers standen.
Jetzt ließ Odysseus den Blumengarten abreißen und legte an seiner Stelle eine Kohlpflanzung an mit zementierten Bewässerungskanälen, wie er es in Ägypten gesehen hatte. Die Kohlrüben schlugen gut an und gaben Viehfutter für einige Monate. Aber die Bronzevasen der Königin blieben von nun an leer.
Darauf hatte Odysseus sich während seiner langen Heimfahrt am meisten gefreut, wie er alle diese Abenteuer seiner Gattin erzählen würde und wie sie begierig an seinem Munde hängen würde, ihn mit Fragen unterbrechend.
Doch er mußte bald erkennen, daß sie keine so aufmerksame Zuhörerin war wie die Phäaken, die zwei Tage lang seinem melodischen Bericht gelauscht hatten.
Wenn er Penelope zu erzählen begann, arbeitete sie schweigend an den goldenen Mustern eines Tuches oder blickte zerstreut durch das Fenster; einmal, als er eine Frage stellte, mußte er erkennen, daß sie die Lästrygonen mit den Lotophagen verwechselte; und das schmerzte ihn, denn er hielt auf die Genauigkeit seines Erlebnisses, das er um so mehr liebte, je ferner es wurde.
Nur wenn er von der Nymphe Kalypso erzählte, schien sie aufmerksamer hinzuhören. Und diese Teilnahme reizte ihn, so daß er jenen Teil seiner Irrfahrt ausführlicher schilderte: die einsame Insel, den wunderbaren Hain, in dessen Bäumen die Seevögel nisteten, und die duftende Grotte der Göttin.
Wie lange bist du bei dieser Kalypso geblieben? fragte sie ihn einmal.
Sieben Jahre, antwortete er.
Sie beugte sich auf die Arbeit nieder, und ihre Augen wurden dunkel.
Solange Odysseus fort war, hatte jeden Abend zur Stunde des Lichteranzündens das Fest der Freier in der großen Halle begonnen. Und Penelope hörte dann bis in ihr fernes dunkelndes Zimmer den Lärm des Gelages, den Klang der Flöte und die frohen Stimmen der Männer, die ihr ergeben waren.
Manchmal war sie verschleiert und heimlich auf die Galerie gegangen, die oben um die Halle lief, und hatte hinter einer Säule her die Männer betrachtet, die auf vergoldeten Sesseln saßen: den göttlichen Antinoos, dessen Augen waren wie die Nacht, den vornehmen, schon älteren Eurymachos und Menon, der noch ein Knabe war.
Jetzt war die Flöte verstummt, und alles ging im Hause seinen ordentlichen Gang. Aber immer wenn die Stunde des Lichteranzündens kam, wurde die Königin unruhig, und es schien, als fehlten ihr dieser Ton und diese fernen Stimmen, die jetzt alle gestorben waren. Und einmal konnte sie nicht widerstehen; sie warf den Schleier über wie damals und ging auf die Galerie und sah in den Saal hinunter. Da standen die vergoldeten Sessel in langen Reihen an der Wand, und jeder war mit einem Überzug aus grauer Leinwand gedeckt.
Und durch die Stille hörte sie von draußen die Stimme ihres Gemahls, der sagte: Eumaios, du darfst die Ferkel nicht mehr in der Nacht draußen lassen; es fängt an, kühl zu werden.
Einst als bei Tisch einer jener runden Ziegenkäse aufgetragen wurde, die es auf allen Inseln des Mittelmeeres gibt, mußte Odysseus still vor sich hinlachen. Sie fragte ihn nicht, was er hätte, und so fing er von selbst an:
Dieser Ziegenkäse erinnert mich an die Höhle des Polyphem. Er hatte davon viele Hunderte auf den Brettern, die an den Steinwänden entlang liefen. Und als wir nun, meine treuen Gefährten und ich, in die Höhle eingedrungen waren, da sagte ich ...
Mein Freund, unterbrach sie ihn, du scheinst nicht zu wissen, daß du mir diese Geschichte schon viermal erzählt hast. Ich kenne sie nun; wie ihr den armen alten Mann betrunken gemacht habt, wie ihr ihm – zehn gegen einen – sein einziges Auge geblendet habt, das habe ich öfter gehört als mir angenehm war. Viel lieber möchte ich von dir erfahren, was du diese zehn Jahre bei Kalypso getrieben hast.
Sieben Jahre, antwortete er.
Gestern sagtest du zehn; du hast eben auf deinen Fahrten so viel lügen müssen, armer Freund, daß du auch jetzt die Wahrheit nicht mehr sagen kannst. Aber ob es nun zehn Jahre waren oder sieben, auf jeden Fall war es sehr lange, und du scheinst dich dort wohlgefühlt zu haben; also antworte auf meine Frage: Was hast du diese lange Zeit getrieben?
Jetzt hätte er ihr antworten müssen: Weib, ich habe mich alle diese Jahre nach dir gesehnt; ich habe alle diese Jahre am Strande der fernen Insel gesessen, über das Meer geblickt und die Götter angefleht, daß ich nur noch einmal den Rauch deines Hauses sehen könnte.
So hätte er antworten müssen. Aber als er sah, daß ihre Augen kalt und hart auf ihn gerichtet waren, verschwieg er es. Und nie hat sie von seinem großen Heimweh erfahren.
Ich habe dort viel Wein getrunken, antwortete er ruhig, der Wein jener Inseln ist gut, wenn auch etwas sauer.
Ein Jahr nach der Heimkehr des Odysseus starb sein Vater Laertes. Das war ihm ein schwerer Schlag, denn er liebte den Greis, der ihm ein Freund gewesen war in dem verödeten Hause.
Auch war Laertes der einzige gewesen, dem Odysseus von seinen Abenteuern erzählen konnte. Und ein farbiges Erzählen des Erlebten und des Erfundenen war ihm Notwendigkeit. Die alte Schaffnerin Eurykleia aber war taub, und Telemach hatte andere Sorgen. Deshalb hatte Odysseus gern im Vorwerk draußen bei Laertes gesessen und mit lebhaften Gebärden von Riesen und Prinzessinnen erzählt, wenn er auch bemerken konnte, daß der Greis, schon abgewandt und verklärt, kaum mehr hinhörte.
Als er tot war, setzte ihm Odysseus unten am Meeresstrand ein Grabmal in Form einer Pyramide aus geschliffenem Stein, an deren Eingang zwei bronzene Mädchen standen. Dort saß er viel allein, in sich zusammengesunken. Er war jetzt fünfzig Jahre alt, und das goldene Lockenhaar, das Göttinnen geliebt hatten, begann zu ergrauen.
Um diese Zeit verabschiedete sich Telemach von seinen Eltern. Das unruhige Blut des Vaters regte sich wohl in ihm, auch mochte ihm die unbehagliche Stimmung im Hause nicht gefallen, und so tat er sich mit phönizischen Schiffern zusammen, die auf der Fahrt in das östliche Meer die Insel angelaufen waren.
Und vom Dach des Hauses, von wo man jenseits der bewaldeten Hügel das Meer liegen sehen konnte, blickte Odysseus dem Schiffe nach. Es war Windstille, und tagelang lag das Schiff an derselben Stelle des Horizontes; dann, als die Meeresfläche sich vom frischen Winde dunkelte, spannte es leuchtende Segel auf und zog den Erlebnissen der Ferne zu.
Jahrelang hatte Odysseus eine kleine, blaue Meeresmuschel bei sich getragen, die von der Insel der Kalypso stammte. Dort hatte er wieder einmal am Strande gelegen und über die spritzenden Wellen der Brandung hinweg sehnend in die Ferne gesehen. Dabei hatte seine Hand im Sande gespielt und die kleine Muschel gefaßt; seitdem trug er sie bei sich als Erinnerung an die Süßigkeit jener Stunden. Auch als er nach dem Sturm, der sein Floß zerschlug, tagelang auf dem Meere schwamm, war die Muschel bei ihm, in seinem Gürtel gewesen.
Penelope bemerkte bald das kleine Ding, und wie lieb es ihm war.
Woher hast du diese Muschel? fragte sie ihn.
Ich habe sie von der Insel der Kalypso.
Dann verstehe ich, daß sie dir so lieb ist.
Er beherrschte seine Ungeduld. Nein, sagte er, du verstehst nichts, du denkst alles falsch. Sie warf ihre Arbeit hin und ging zur Türe. Weib, rief er ihr nach, wollen wir uns nicht aussprechen; soll der Dämon des Mißtrauens sich zwischen uns festsetzen? Aber sie machte schweigend die Tür hinter sich zu.
Abends vor dem Schlafengehen legte Odysseus die kleine Muschel auf das Gesims neben sein Bett. Und als er eines Morgens aufstand, war sie verschwunden. Er suchte überall, während Penelope ihm schweigend zusah, und als er sie nicht fand, rief er die ganze Dienerschaft zusammen und versprach dem, der ihm die Muschel brächte, eine Mine Goldes.
Brauche ich noch andere Beweise, sagte Penelope, nun zeigt es sich, wie sehr du an allem hängst, was dich an die Dirne erinnert.
Da faßte ihn der Zorn. Sie ist keine Dirne; sie hat mir geholfen in den Jahren der Not; und ich werde ihr meinen Dank bewahren.
Dank, ich weiß wofür, sagte Penelope mit einem häßlichen Lächeln.
Odysseus bemerkte, wie ungünstig sie in diesem Augenblicke aussah, und wurde ruhig. Du kannst das nicht begreifen, sagte er, aber ich werde mir die Heiligkeit meines Leidens nicht besudeln lassen.
Nun blieb er tagelang allein unten am Strande der See zwischen den Klippen. In seinen Beziehungen zum Meere hatte sich eine merkwürdige Veränderung vollzogen. Zuerst, nach seiner Heimkehr, hatte er das Gewässer nicht sehen wollen, in dem er so viel erduldet; damals pflegte er zu sagen, glücklich seiest du nur dort, wo die Leute das Ruder, das du über der Schulter trägst, für einen Spaten halten. Jetzt liebte er das Meer wieder und saß in den Steinen und lauschte auf das große Tönen der Brandung, bei dem ihm schmerzlich süß ein Gefühl der Kameradschaftlichkeit aufstieg.
Und da mußte er denken: wie hat sich doch alles gewendet; dort auf der Insel sehnte ich mich nach der Heimat; und nun ich die Heimat habe, sitze ich in der Wüste des Strandes zwischen den angeschwemmten Brettern der Flut und habe Heimweh nach der Heimatlosigkeit.
Aber in fabelhaftem Glanze leuchteten in seinem Innern all die Abenteuer der zwanzig Jahre auf. Und während das erlöschende Auge den Horizont suchte, flüsterten, nur für ihn selbst, seine Lippen unaufhörlich den unsterblichen Bericht: von dem Kampf der Könige, von der nächtlichen Schiffahrt durch die Meerenge und von den Inseln der Nymphen.
Die Sonnenfinsternis
Inhaltsverzeichnis
Es sollte in der Hauptstadt und überhaupt in der ganzen Umgegend eine totale Sonnenfinsternis stattfinden, und alle nötigen Vorbereitungen waren dazu getroffen worden. Denn das war noch die alte Zeit, in der es Sonnenfinsternisse, Schönheitskonkurrenzen, Mastviehausstellungen und ähnliche gemeinnützige Veranstaltungen gab, und in der die Leute Freude an so etwas hatten. Jedermann besorgte sich ein geschwärztes Glas, um das Phänomen dadurch besehen zu können, und die Zeitungen brachten wissenschaftliche Artikel, in denen von Kopernikus und Ptolemäus gesprochen wurde.
Als der Dichter Matthias Petermann diese allgemeinen Vorbereitungen bemerkte, erklärte er im Café Kaiserkrone rundheraus, daß er gesonnen sei, die totale Sonnenfinsternis zu schneiden. Ich bitt' Sie, sagte er zu seinen Freunden, was ist mir eine totale Sonnenfinsternis? Ein gutgeschriebenes Feuilleton oder eine Lokomotive haben mehr Geist. So eine Sonnenfinsternis ist grad so, als wenn einer die Hand vor das Licht hält. Ich bitt' Sie, halten Sie mal die Hand vor die elektrische Birne da; gleich sehen Sie, daß man dann die elektrische Birne nicht sieht.
Der Dichter Matthias Petermann sprühte von Einfällen über die Sonnenfinsternis und belästigte damit alle seine Bekannten. Die ganze Geschichte mit den Sternen, das ist nicht viel mehr Wert als eine Partie Karambolasch auf dem Billard, Kugeln, die durcheinanderrennen, weil sie müssen. Nur, daß in so einer Partie Karambolasch, wie sie hier der Marqueur spielt, mehr Sinn, also mehr Göttlichkeit drinnen ist als in der ganzen Astronomie. Überhaupt werde ich, wann diese Hetz stattfindet, zu Hause bleiben und ein gescheites Buch lesen.
Diese Absicht konnte der Dichter Matthias Petermann aber nicht ausführen, denn es war die Jahreszeit der Zwetschgenknödel, und der Zufall wollte, daß die Sonnenfinsternis um Mittag stattfand. So mußte der Dichter gerade während der größten Aufregung auf die Straße hinunter, wenn er nicht seiner Portion Zwetschgenknödel im Restaurant verlustig gehen wollte.
Überall standen die Leute in Haufen und sahen zu dem Himmel auf, der verdächtig braun geworden war; sogar die Automobilchauffeure ließen sich herab, einen Blick hinaufzuwerfen.
Jetzt ist es soweit, schrie der kleine Leonhard, Herr Doktor Petermann, sehen Sie hinauf, sie wird gleich verfinstert sein.
Der Dichter Matthias Petermann sah nicht hinauf, sondern fest vor sich hin. Und er erblickte ein siebzehnjähriges Mädchen, das mit entzückten Mienen in die Höhe starrte wie eine Heilige bei der Himmelfahrt. Und während der ganzen Dauer der Finsternis sah er in die Augen des Mädchens und nahm mit Erstaunen wahr, daß diese Augen die Farbe der Hyazinthe hatten, mit einem verlorenen Schimmer von Altgold darüber.
Am Abend berichteten die Zeitungen: Die Ergebnisse des heutigen astronomischen Ereignisses sind sehr bedeutend. Wie uns die Direktion der K. K. Sternwarte mitteilt, sind drei Protuberanzen beobachtet worden, und zwar eine von 3 Minuten 41,3 Sekunden, eine andere von 4 Minuten 12,8 Sekunden und eine dritte gar in der außerordentlichen Höhe von 6 Minuten 35,4 Sekunden.
Seinerseits verzeichnete der Dichter Matthias Petermann in sein Tagebuch: Der heutige Tag war reich. Ich weiß jetzt, daß es in dieser Stadt ein siebzehnjähriges Mädchen gibt, dessen Augen die Farbe einer Hyazinthe haben, mit einem verlorenen Schimmer von Altgold darüber.
Das Beutestück
Inhaltsverzeichnis
Dort, wo die March in die Donau geht, lebte und herrschte um die Wende des neunten Jahrhunderts die Markgräfin Irene von Mähren. Die große Geschichte weiß von dieser merkwürdigen Frau nicht viel zu berichten und tut sie in zwei Jahreszahlen ab; aber in der Gesellschaft jener fernen Tage war die Markgräfin Irene sehr berühmt wegen ihrer Schönheit und ihrer ganz außergewöhnlichen Gelehrtheit. Sie las Griechisch und trieb Arithmetik und hatte einen Kommentar zu dem Werke des Euklides geschrieben.
Sie war die Witwe des Markgrafen Rudolf von Mähren. Den hatte sie nach fünfjähriger Ehe mit ihrer Wissenschaft zu Tode geärgert, und nun regierte sie selber sein Land mit ihren starken und weißen Armen. Sie sprach recht wie ein Mann, ritt breitbeinig zu Pferde und verlachte die Bewerber, die um ihre Hand anhielten. Es kamen ihrer viele, denn auch in jener dunklen Zeit war es so, daß die Männer an den Frauen mehr ein unbescheidenes und starkes Wesen liebten als Zucht und Sitte.
Der Markgraf war kaum ein Jahr tot, so ritt in den Hof der Burg ein Zug von Boten ein; das waren feine Herren in neuen und schönen Kleidern und kamen als Gesandte aus Byzanz von dem Grafen Theodor, der um die Hand der Frau Irene bitten ließ. Auch brachten sie Brautgeschenke mit, wie sie nur der kaiserliche Hof von Byzanz liefern konnte, nämlich eine große blaue Kugel aus dem Stein Lapis Lazuli, zehn Sack Dukaten und ein Stück von der Haut Christi in Goldfiligran gefaßt. Die Markgräfin empfing die Boten geziemlich in der großen Halle, besah sich die schönen Geschenke und erkundigte sich nach dem Wesen des Grafen, der so herrlich um sie warb. Dann antwortete sie den Boten: Geht zu eurem Herrn und sagt ihm, daß ich die Seine werden will, wenn er den Inhalt dieser blauen Kugel hier vor mir bis auf ein Lot genau berechnen kann.
Die Gesandtschaft zog mit diesem Bescheid ab, und von dem griechischen Grafen hörte man nicht mehr.
Der zweite Freiersmann, der sich meldete, war der französische Ritter Jean de Bellejambe; der kam an einem regnerischen Abend verirrt vor dem Schlosse der Markgräfin an und bat um Einlaß. Er blieb einige Tage, las mit der Herzogin in ihrer Bibliothek, und die beiden taten sehr vertraut miteinander, so daß die Dienerschaft schon glaubte, diesmal sei die Sache richtig. Aber als der Ritter Ernst machte und nun vor ihr stand und um ihre Hand bat, sagte sie ihm: Ich will Euch gehören, wenn Ihr gleich jetzt hier vor mir die Namen der römischen Könige aufzählen könnt. Er stand da und sann nach, kam aber nur bis Numa Pompilius. Da rannte er in großem Zorn in den Hof hinab, sattelte sein Pferd und ritt spornstreichs in die Weite.
So kamen im Laufe der Zeit noch viele aus allen Gegenden des Christentums, und Frau Irene sammelte sich ihre Namen, wie man Käfer sammelt und freute sich, wie sie die Männer am Schnürchen hatte.
Schön... Zu jener Zeit nun geschah es, daß die Ungarn in die große Ebene einbrachen. Sie kamen unter der Leitung ihres Herzogs Godros, den man den Dreibart nannte, weil er seinen langen, roten Bart in drei gleiche Teile getrennt trug; und verwüsteten das östliche Land. Von dem Waldgebirge her zogen sie die Donau herauf, verbrannten das Kloster Frauenwerk, und der Schein ihrer Feuerbrünste leuchtete am Horizont. Und als sie bis zum Schlosse der Markgräfin geraten waren, umgaben sie es von allen Seiten und begannen es zu berennen.
Markgräfin Irene leitete die Verteidigung acht Tage lang nach allen Regeln der Kunst; sie ließ Sandsäcke auftragen, die Schleudern richten und schritt abends selbst mit den Fackeln die Reihe der Posten ab. Aber bald mußte man sehen, daß das Schloß nicht genügend mit Lebensmitteln versehen war und sich nicht halten konnte.
Da versammelte sie alle Männer in der Kapelle und hielt ihnen diese Rede: Ihr werdet heute noch die Sakramente der Buße und des Altars nehmen, denn morgen in der Frühe werde ich die Burg dem Feinde übergeben. Fürchtet euch nicht. Der ungarische Herzog sieht zwar schrecklich genug aus mit seinen drei Bärten, aber ich werde schon mit ihm fertig werden. Ich habe die Kunst heraus, mit den Männern umzugehen, das wißt ihr ja. Erinnert euch an den griechischen Grafen mit der blauen Kugel, an den Ritter, den Prinzen von Spanien und die vielen anderen. Ich habe sie gekirrt, und so werde ich auch den Dreibart kirren. Wenn er mich morgen als sein Ehrenstück aus der Beute ausgesucht hat, dann werde ich mir ihn vornehmen und ein Wörtchen mit ihm reden.
Am nächsten Tage wurden die Tore geöffnet, und die Ungarn ritten in die Höfe der Burg ein. Einen ganzen Vormittag beschäftigten sie sich damit, die waffenfähigen Männer an den Bäumen des Obstgartens aufzuhängen, dann wurde die Burg ausgeräumt und alles, was darinnen war, zur Verteilung der Beute in dem Hofe aufgestellt. Da standen in langen Reihen die Frauen gefesselt, mitten unter ihnen die Markgräfin; dann die kleinen Kinder, die immer drei oder vier zu Bündeln zusammengebunden waren wie die Radieschen; weiter die Kasten mit Seide und Goldsachen und schließlich das Vieh der Ställe.
Als erster schritt der Herzog Godros-Dreibart die Ausstellung ab, um vor seinen Leuten sich das kostbarste Stück auszusuchen. Er ging an den Frauen vorbei, prüfte jede mit den Augen und schritt schweigend weiter. Die Kasten überblickte er flüchtig. Doch faßte er hier und da ein Stück edlen Stoffes an. Dann ging er die Reihen des Viehes entlang. Vor einem großen Mutterschwein blieb er erstaunt stehen.
Wo habt ihr die Sau her? fragte er den Viehwärter, einen alten Mann, der bei der allgemeinen Hängerei verschont geblieben war.
Es ist ein thrakisches Mutterschwein, antwortete der Mann, eine gute Rasse. Wir haben es vor einem Jahr auf dem Markt von Adrianopel gekauft.
Hat sie schon geworfen?
Sie hat dieses Frühjahr sechs lebende gesunde Ferkel geworfen.
Der Herzog trat an das Tier heran, faßte es am Ohre und blickte in seine Augen, die klein und listig waren.
Ein herrliches Tier, sagte er. Ich habe einen Eber derselben Rasse auf meinem Schloß Theodosia am Meere.
Und sich aufrichtend, sagte er: Ich wähle diese Sau zu meinem Ehrenstück. In den Rest teile sich mein Gesinde.
Nachts saßen die ungarischen Männer in der großen Halle und tranken. Und sie sangen ihre wilden Lieder; vom Ritt über das Feld; vom Kampf an der Brücke und von dem elfenbeinernen Schmuck des Sattelzeuges.
Die Wette
Inhaltsverzeichnis
Unter der Regierung des Kalifen Mahmud lebte in Basra der Dichter Omar ibn ali Rebia, der von seinen Zeitgenossen der Dichter unter den Dichtern genannt wurde. Omar trug diesen Namen mit Recht, denn er war der Erfinder von siebenunddreißig neuen Versmaßen, und in jener an großen Dichtern so reichen Zeit kam ihm keiner gleich in der Kunst der Strophe und in der Fülle des Einfalles.
Das Besondere an seinen Versen war, daß sie zwar streng gesetzmäßig in ihrem Baue waren, aber wild in dem Sinn, und daß sie deshalb sowohl den Klugen wie den Toren gefallen mußten. Wenn Omar eine neue Strophe veröffentlicht hatte, so zählten die Literaturprofessoren prüfend ihre Silben und freuten sich, daß es stimmte; und die Trinker in der Schenke sangen sie im Chor. Die verhüllten Frauen aber, die abends auf den Dächern saßen, wiederholten flüsternd den süßen Reim, während sie der hinaufziehenden Nacht entgegensahen.
Omar verdiente mit seinen Werken viel Geld, und davon hatte er sich in der schönsten Straße von Basra ein kleines Haus gekauft, das in seinem Innern so geschmückt war, wie die Dichter sich ihr Heim herauszuputzen pflegen: mit Tischen, die mit Perlmutter eingelegt waren, mit alten Büchern und flimmernden Bronzelampen in allen Ecken. Aber das Schönste davon war der kleine Garten, der hinter dem Hause in der Stille lag. In dem Garten war ein kleiner See, und in dem See eine kleine Insel, zu der eine heimliche Brücke aus vergoldeten Hölzern hinausführte. Auf dieser Insel saß Omar den ganzen Tag, blickte in den Himmel und lauschte mit den Ohren des Dichters auf das Klingen der Welt. Und wenn er den Ton, auf den er wartete, erfaßt hatte, tauchte er seine Gänsefeder in das Töpfchen blauer Tinte, das neben ihm stand, und schrieb den Reim auf das Papier.
Nun erhob sich aber neben dem Garten des Dichters das große Handelshaus des reichen Kaufmanns Ali, dessen Schiffe bis nach Zanzibar gingen, ins Land der Mohren. Ali handelte mit Häuten und Leder, und den ganzen Tag lief es in seinem Hause ein und aus von Reisenden, die ihre Muster brachten, und von Boten mit Briefen. Und wenn nun dieser große Geschäftsmann an seinem Tische saß und Rechnungen prüfte und hundert Aufträge erteilte, so konnte er immer durch das Bogenfenster hindurch den Dichter Omar sehen, der auf dem Inselchen saß und in den Himmel guckte. Deshalb haßte Ali den Dichter und sagte zu allen seinen Freunden: Seht einmal da drüben den Omar, der jetzt seit sieben Stunden auf seiner Insel sitzt und nichts tut. Ist es erlaubt, daß so ein Taugenichts den ganzen Tag in den blauen Himmel sieht, während andere Leute schaffen müssen von früh bis spät?
Eines Tages geschah es, daß Omar aus seinem Hause auf die Straße trat mit einer großen Rolle beschriebenen Papiers, das er zu seinem Verleger bringen wollte. Gleichzeitig kam aus dem Hause des Kaufmanns die Sänfte heraus, in der sich Ali zur Börse tragen ließ. Und da der Dichter vor sich hinträumte und weder nach rechts noch nach links sah, rannte er gegen die Sänfte an, die in ein heftiges Wanken geriet. Die Träger stießen den Dichter rauh hinweg, der Kaufmann Ali aber steckte den Kopf heraus und schrie: Du Taugenichts, kannst du nicht fleißigen Leuten aus dem Wege gehen, die zur Börse wollen, wo sie an der Hebung des Nationalwohlstandes arbeiten? Eine schöne Kunst, die du da betreibst, Verse auf Papier zu schreiben. Das kann jeder, das kann jeder. Damit zog Ali seinen Kopf wieder zurück und schaukelte in der Sänfte weiter.
Der Dichter Omar ibn ali Rebia stand sprachlos da. Denn er war ebenso wie alle Dichter: wenn sie einen Streit mit groben Weltleuten haben, so wissen sie im Augenblicke nichts zu reden; erst wenn der andere längst fort ist, fällt ihnen die geschickte Antwort ein, die sie hätten geben sollen. Omar sah der Sänfte seines Nachbars nach, und als sie glücklich um die Ecke verschwunden war, bedachte er, daß er dem Grobian hätte erwidern sollen: Nun, wenn es so leicht ist, einen Reim zu schreiben, schreibe doch einmal einen.
Da ergriff ihn eine große Wut über die Dreistigkeit des Kaufmanns und ein noch größerer Zorn über seine eigene Dummheit; und nachdem er diesen Zorn zwei Tage lang gehegt hatte, hielt er's nicht mehr aus: er faßte sich Mut, ging eines Abends zu Ali herüber und trat stracks in sein Arbeitszimmer ein. Ali blickte erstaunt von seinen Papieren auf, denn bisher hatten sich die beiden Nachbarn noch nie in ihren Häusern besucht. Omar aber sagte herzhaft: Nachbar und Freund, du hast gesagt, es sei keine Kunst, Verse auf Papier zu schreiben; nun, hier bringe ich dir das Pergament, auf das ich meine Verse zu verzeichnen pflege, auch meine Feder und meine veilchenblaue Tinte. Du hast jetzt gewiß Zeit, denn es ist Abend, und bis morgen brauchst du dich nicht um den Aufbruch der Kamele zu kümmern. Zeige also, was du kannst. In einer Stunde werde ich wiederkommen, und du wirst mir dann das Gedicht oder die Strophe zeigen, die du niedergeschrieben hast; weil es ja eine so leichte Sache ist.
Haha, rief der Kaufmann, das werden wir gleich machen; geh und komm in einer Stunde wieder; aber deine Gänsefeder magst du gleich mitnehmen, mit so etwas kann ich nicht schreiben; ich bin an meine Feder mit goldener Spitze gewöhnt.
Als Omar nach einer Stunde wiederkam, saß der Kaufmann schweißgebadet vor dem Pergamente, das er mit einem wüsten Gewirr von Worten und Strichen bedeckt hatte.
Nun? sagte Omar lächelnd, lies mir deine Gedichte vor.
Es ist kein Wunder, antwortete ärgerlich der Kaufmann, es ist kein Wunder, daß es mir nicht gelang. Du hast deine Kunst erlernt, ich die meine; ich kann ebensowenig plötzlich ein Sonett schreiben, wie du jetzt in einer Stunde einen Posten persischer Lammfelle einkaufen könntest. Diese kurze Probe beweist noch nicht, ob deine Kunst wirklich etwas so Schweres ist.
Du hast recht, antwortete Omar, aber trotzdem ist zwischen uns beiden noch nicht entschieden, ob du mit deinen Vorwürfen recht hattest. Laß uns unseren Versuch fortsetzen. Du wirst ein halbes Jahr lang in deinen abendlichen Mußestunden bei meinem Lehrer Salomon die Kunst der Längen und Kürzen lernen; unterdessen erlaube mir, daß ich bei deinem Schreiber Unterricht nehme in dem Gesetz des Handels und in dem Wert der Münze, und daß ich nach seinen Lehren mit meinem geringen Geld wuchere. Dann wollen wir nach einem halben Jahre sehen, ob du ein Dichter geworden bist und ich ein Kaufmann, und daran erkennen, welche von den beiden Sachen leichter und zugänglicher ist, welche höher, seltener und heiliger.
So taten sie.
Nach einem halben Jahre hatte Ali alle Regeln der Dichtkunst auswendig gelernt, er wußte, daß jeder Vers in zwei Halbverse mit gleichem Reim zerfallen muß, und wo der Ton hinkommt; aber seine Verse fielen auseinander, und die Reime klapperten wie trockenes Holz. In einem halben Jahre hatte der Dichter Omar erfahren, daß es darauf ankommt, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, und daß die Ziegenfelle schwerer werden, wenn man Sand darauf gestreut hatte. Und gerade als die Probezeit ausging, war er beschäftigt, einen großen Posten von Kuhhäuten auf dem Markt in Koweit aufzukaufen.
Lächelnd sagte Ali: Welch Kaufmann du doch geworden bist; ich sehe nun ein, daß zur Dichtkunst ein stärkerer Geist gehört, daß das Handelsgeschäft das gemeinere ist, und ich grüße dich als Sieger. Nun laß uns jeder zu seiner Arbeit zurückkehren.
Aber da antwortete Omar: Noch nicht gleich; erlaube mir, daß ich diesen Handel erst zu Ende führe. Wenn ich nämlich die Felle jetzt nach Stambul bringe, habe ich einen Reingewinn von fünftausend Zechinen, denn der westliche Markt zieht Leder an wegen des drohenden Krieges zwischen den Bulgaren und dem Kaiserreich. Auch wollen mir Magus und Söhne in Aleppo fünfzigtausend Zechinen kreditieren, und es wäre eine Sünde, dieses Geschäft gerade jetzt abzubrechen.
So setzte Omar seine Kuhhäute in Stambul glücklich ab, und für das Geld, das er gewann, kaufte er marokkanische Lederwaren auf; die Gelegenheiten mehrten sich, die Geschäfte wuchsen, und schließlich trat Omar mit seinem Nachbar Ali in eine Handelsverbindung ein.
Da er aber Platz für seine Waren brauchte, ließ er den kleinen Garten abreißen und den See zuschütten mit der heimlichen Insel und der goldenen Brücke, und baute einen Schuppen, in dem die Ziegenfelle und die Stapel von Kuhhäuten lagern sollten, bis die Preise die richtige Höhe erreicht hätten.
So zeigte es sich, daß zwar die Poesie das Heiligere und der Handel das Gemeine ist, das jeder erfassen kann; es erwies sich aber auch, daß die Gemeinheit stärker sein kann als alles Heiligtum.
Fische
Inhaltsverzeichnis
In dem Fenster der Lebensmittelhandlung hatte man die Fische ausgelegt, die in der letzten Nacht im See gefangen worden waren. Sie lagen auf einer breiten, weißen Marmorplatte tot ausgestreckt; und zwar war diese Marmorplatte nach vorn etwas geneigt, damit das Wasser und auch das Blut hübsch sauber und ordentlich ablaufen könne.
Dicke Barsche, Äschen ganz wie aus Silber, Forellen mit runden Flecken, Hechte mit länglichen Flecken und die breitmäuligen Quappen, bei denen die Leber das beste ist. Ein ganz riesiger Hecht von anderthalb Meter Länge lag in der Mitte und war das Staatsstück.
Und sie alle, die geschwänzelt hatten in den kühlen Gründen des Sees, und immer gerudert und geflitzt und immer Welle gewesen waren, sie lagen steif ausgestreckt einer neben dem anderen und hielten sich nun endlich still.
Und weil es hübsch anzusehen war, wie sie da so sauber tot waren, deshalb blieben die Leute vor dem Laden stehen und hatten ihre Freude daran.
Dieser süße Hecht, rief das zwölfjährige Mädchen mit den nackten Beinen, und was er für reizende Zähnchen hat.
Der wiegt seine achtzehn Pfund, sagte der Herr im Gummimantel.
Warum, so murmelte der Feuilletonist, warum hat die Forelle runde Flecken und der Hecht längliche Flecken? Welch eine Spielerei ist dieses?
Der Philosoph aber dachte: In diesem Geschäft ist der Fisch während eines Monates um 20 Prozent billiger geworden.
Da geschah es, daß der große Hecht seine Kiemen öffnete und tief aufatmete; denn er war noch gar nicht tot. Und alle die Leute, die vor dem Laden gestanden hatten, fuhren erschreckt zusammen und wandten die Augen ab.
Gräßlich, daß sie da lebende Fische hinlegen, sagte der Herr im Gummimantel.
Man sollte ihm doch einfach den Bauch aufschneiden, meinte das zwölfjährige Mädchen mit den nackten Beinen.
Warum, so murmelte der Feuilletonist, warum hatten wir Wohlgefallen an dem Tode, und warum schauderten wir vor dem Leben zurück?
Der Philosoph aber dachte: Dieses Geschäft werde ich mir merken; da scheinen die Fische ganz frisch vom See herzukommen.
Das westliche Paradies
Inhaltsverzeichnis
Gottvater sprach vor sich hin in seinen langen Bart: Du lieber Gott, wie war doch das Paradies so nett, das ich damals in Zentralasien (nach einer anderen Erklärung allerdings am Kaukasus) angelegt hatte. Mit den gefleckten Hirschkühen, den Tauben und den Wachteln, die einen kleinen Schopf auf dem Kopf haben. Auch die Obstbäume waren gut geraten, neben die ich eine Tafel gesetzt hatte mit der Aufschrift: »Es ist streng verboten, Früchte abzupflücken«. Alles war so sauber und die Wege mit Kies bestreut, und Sonntag die ganze Woche. Wie schade, daß dieses zweideutige Lumpenpack mir alles verdorben hat.
So sann der liebe Gott lange seinen Erinnerungen nach. Und weil er schon alt ist und immer etwas eigensinnig war, deshalb sagte er zu sich: Und nun mache ich mir justament erst recht ein neues Paradies, genau so wie das vorige; aber dieses Mal lege ich es vorsichtshalber mehr abseits.
Er streckte seine ambrosische Hand über die unermeßlichen Gewässer des Ozeans; und schon tauchte aus den Abgründen triefend eine große Insel auf mit blauen Bergen und hohen Felsen. Und gleich bedeckte diese Insel sich mit Wäldern von Kampferholz; Gewürzpflanzen wucherten in den dampfenden Tälern, Bananen und Ananas waren schon reif und Tiere mit unerhörtem Pelzwerk jagten über die Lichtungen. In den Abhängen der Berge aber schimmerten die Adern und Schwaden schiersten Silbers.
Als alles fertig war, legte Gottvater eine Morgenröte darüber, wie noch nie eine da war; und um alle Küsten des neuen Paradieses ringsherum sangen die Brandungen das Lob des Herrn. Wie damals betrachtete er alle Dinge und fand, daß es gut sei.
Zwei Tage später fuhr an der Ostseite der Insel das englische Kanonenboot »Arrogant« vorüber. Der Kommandant, Capt. Buller, erkannte, daß er ein neues Land vor sich hatte, landete, hißte den Union Jack und nannte die Insel »Queen Marys Land«.
Gleichzeitig fuhr an der westlichen Küste der französische Passagierdampfer »Bossuet« vorüber, der eine Operettengesellschaft nach Valparaiso brachte. Der Kapitän erkannte, daß er ein neues Land vor sich hatte, landete, hißte die Trikolore und nannte die Insel »Ile de la Fraternité«.
Schiedsgericht. Ultimatum. Gasangriff. Stacheldraht. Handgranaten. Schützengräben. Trommelfeuer. Blockade. Mitrailleusennester. Generalquartier. Unterstand. Schwimmende Minen. Lederersatz. Kriegsgewinnler. Tanks. Weißkohl. Feldprediger. Läuse. Kriegskorrespondenten. Fliegerangriff. Papierhemden. Unterseeboote. Galgen. Spanische Grippe.