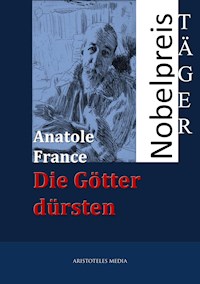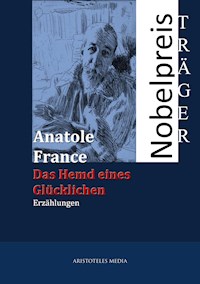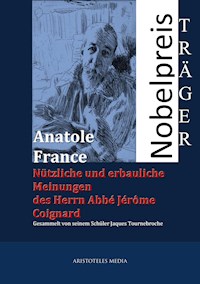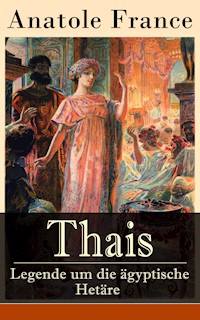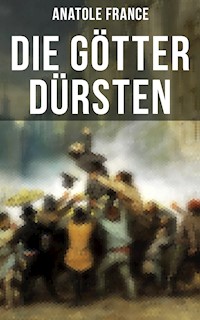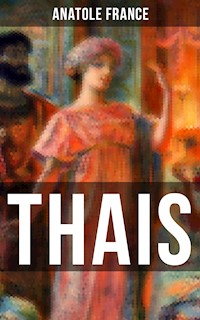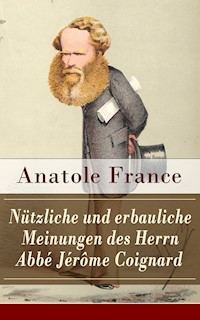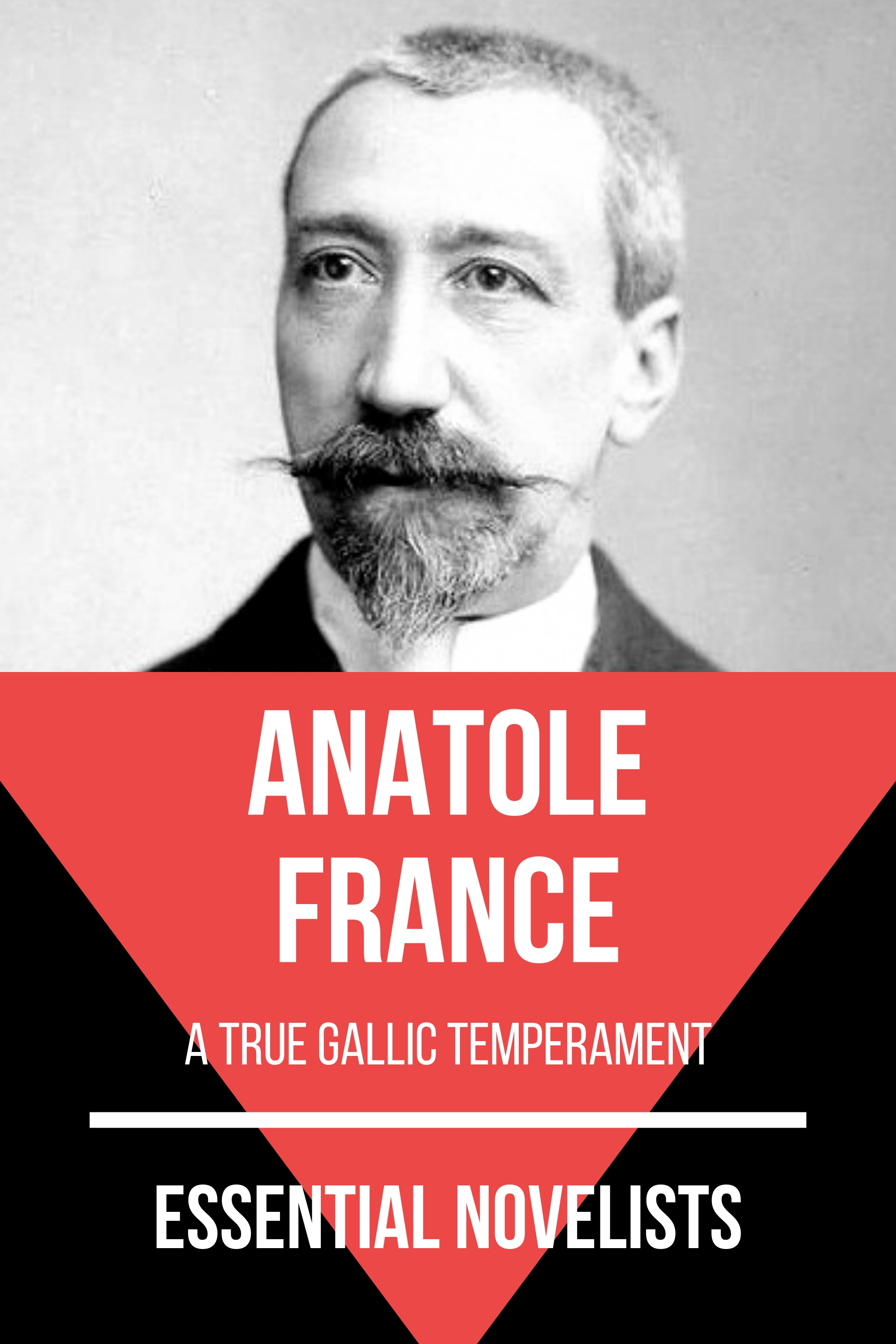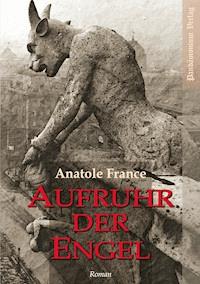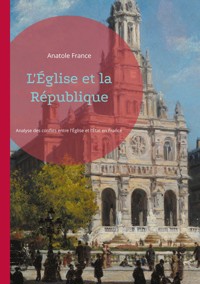1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Anatole Frances "Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen" bietet eine facettenreiche Erkundung der menschlichen Natur und der gesellschaftlichen Gegebenheiten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In einem eloquenten und oft ironischen Stil offenbart France in seinen Erzählungen die Widersprüche des Lebens, die Konflikte zwischen Moral und Verlangen sowie die Absurditäten der zeitgenössischen Gesellschaft. Seine Werke sind nicht nur literarische Meisterwerke, sondern auch tiefgründige Analysen der zeitgenössischen Fragestellungen, die auch heute noch von Relevanz sind. Durch raffinierte Charakterstudien und eine poetische Prosa lädt er den Leser ein, geselliger und skeptischer Zuschauer in der Welt seiner Figuren zu werden. Anatole France, ein führender französischer Literaturkritiker und Schriftsteller, war für seine Abneigung gegen die Konventionen seiner Zeit bekannt. Seine prägenden Erfahrungen in einer intellektuell anregenden Umgebung, beeinflusst von der Dreyfus-Affäre und sozialistischen Idealen, trugen dazu bei, seine schriftstellerische Stimme zu formen. Frankreichs Fähigkeit, spannende Geschichten mit philosophischen Einsichten zu verbinden, erfüllt sein Werk mit einer ambivalenten Betrachtung der menschlichen Existenz, die die Leser zum Nachdenken anregen soll. Diese Gesammelten Werke sind eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Entwicklung der modernen Literatur interessieren oder ein tieferes Verständnis für die zeitlosen Fragen der Menschheit suchen. Frances Kunst, tief eingedrungene Wahrheiten in fesselnde Erzählungen zu verwandeln, macht dieses Werk zu einem wertvollen Schatz für Literaturfreunde und die, die die feine Kunst des Erzählens schätzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen
Inhaltsverzeichnis
Romane:
Erzählungen:
Die Götter dürsten (Les dieux ont soif)
Erstes Kapitel
Evarist Gamelin, Maler und Schüler Davids, Bürger des Stadtbezirks Pont-Neuf (vormals Henri IV.), ging frühmorgens nach der einstigen Barnabitenkirche, in der seit drei Jahren – seit dem 21. Mai 1791 – die Generalversammlung dieses Bezirks tagte. Die Kirche ragte auf einem engen, düsteren Platze, nahe dem Gitter des Justizpalastes. Die verwitterte, von Menschenhand verstümmelte Fassade bestand aus zwei antiken Pfeilergeschossen, die mit halb zerstörten Gesimsen und mit Pechpfannen geschmückt waren. Die Wahrzeichen des Glaubens waren roh abgemeißelt, und über dem Portal stand in schwarzen Buchstaben der Wahlspruch der Republik: »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod.« Evarist Gamelin trat ein. Unter den Wölbungen des Kirchenschiffs, die einst vom Chorgesang der Bruderschaft St.Pauli wider-hallten, saßen jetzt die Patrioten in roter Mütze, um die Stadtverwaltung zu wählen und über die Geschäfte des Bezirks zu beraten. Die Heiligenfiguren waren aus ihren Nischen entfernt und durch Büsten von Brutus, Jean Jacques Rousseau und Le Peltier ersetzt worden. Auf dem seines Schmuckes beraubten Altar stand eine Tafel mit der Verkündigung der Menschenrechte.
Zweimal wöchentlich, von fünf Uhr nachmittags bis elf Uhr nachts, fanden hier die öffentlichen Versammlungen statt. Die Kanzel, an der die Nationalfahne prangte, diente als Rednertribüne. Gegenüber, auf der linken Altarseite, war ein Brettergerüst aufgeschlagen; es war für die Frauen und Kinder bestimmt, die diesen Versammlungen in großer Zahl beiwohnten. An einem Schreibtisch zu Füßen der Kanzel saß an jedem Morgen in roter Mütze und Karmagnole der Bürger Dupont der Ältere, Tischler von der Place de Thionville und Mitglied,vom Überwachungsausschuß. Auf dem Schreibtische stand eine Flasche mit Gläsern und Schreibzeug, daneben lag ein Schriftstück, der Text einer Petition, zwanzig unwürdige Mitglieder des Konvents zu ächten.
Evarist Gamelin griff zur Feder und unterschrieb.
»Ich wußte es wohl«, sprach der Tischler und Beamte, »du Würdest deine Unterschrift leisten, Bürger Gamelin. Du bist lauter. Aber die Leute vom Bezirk sind lau und ohne Bürgertugend. Ich gab dem Überwachungsausschuß den Rat, jedem, der die Petition nicht unterschreibt, die Bescheinigung des Bürgerrechts zu verweigern.«
»Ich bin bereit«, erwiderte Gamelin, »die Ächtung der föderalistischen Verräter mit meinem Blute zu unterschreiben. Sie wollten Marats Tod: nieder mit ihnen!«
»Die Lauheit«, fuhr Dupont der Ältere fort, »ist unser Verderben. In einem Bezirk von neunhundert stimmberechtigten Bürgern kommen keine fünfzig zur Versammlung. Gestern waren wir achtundzwanzig.«
»Wohlan!« rief,Gamelin, »so muß man sie bei Strafe zum Herkommen zwingen.«
»Oh! Oh!« stieß der Tischler stirnrunzelnd hervor. »Wenn sie alle kommen, sind die Patrioten in der Minderzahl… Bürger Gamelin, trinkst du ein Glas Wein auf das Wohl der braven Sansculotten?«
An der Kirchen wand auf der Kanzelseite las man die Worte: »Zivilausschuß«, Überwachungsausschuß«, »Wohltätigkeitsausschuß«. Ein schwarzer Handweiser daneben zeigte nach dem Kreuzgang. Wenige Schritte weiter, über der Tür der früheren Sakristei, stand die Inschrift:: »Militärausschuß.« Gamelin trat ein und fand den Sekretär des Ausschusses schreibend an einem großen Tische, der mit Büchern, Papieren, Eisenbarren, Patronen und Salpeterproben bepackt war. »Gruß, Bürger Trubert, wie geht’s?«
»Mir? … Ausgezeichnet!«
Das war die stehende Antwort des Sekretärs vom Militärausschuß, Fortune Trubert, auf alle Fragen nach seinem Befinden, weniger, um, die Wahrheit zu sagen, als um jede Unterhaltung über den Gegenstand abzuschneiden. Obwohl erst achtundzwanzig Jahre alt, hatte er eine welke Haut, spärliches Haar, rote Flecken auf den Backen und einen krummen Rücken. Er war Optiker am Quai des Orfèvres gewesen. Sein Geschäft war sehr alt; er hatte es aber im Jahre 91 an einen alten Gesellen verkauft, um sich ganz seinen Amtsgeschäften zu widmen. Seine reizende Mutter, die mit zwanzig Jahren gestorben war, und deren zarte Anmut einigen alten Leuten im Stadtviertel noch in rührender Erinnerung stand, hatte ihm ihre schönen leidenschaftlichen Augen, ihre Blässe und ihre Schüchternheit vererbt. Vom Vater, Optiker und Hoflieferanten, der mit dreißig Jahren der gleichen Krankheit erlegen war, hatte er klaren Geist und Fleiß überkommen. ‘
»Und du, Bürger«, fragte er im Weiterschreiben, »wie geht’s dir?«
»Gut. Was Neues?«
»Nichts, nichts. Du siehst ja, hier herrscht größte Ruhe.«
»Und die Kriegslage?«
»Stets die gleiche.«
Die Kriegslage war verzweifelt. Das schönste Heer der Republik in Mainz eingeschlossen, Valenciennes belagert, Fontenay von den Leuten der Vendée genommen, Lyon in Aufruhr, die Cevennen in heller Empörung; die spanische Grenze offen, zwei Drittel aller Departements in Feindeshand oder im Aufstand, von den österreichischen Kanonen bedroht, ohne Geld und Brot.
Fortuné Trubert schrieb ruhig weiter. Auf Befehl der Staatsverwaltung sollten die Bezirke zwölftäüsend Mann für die Vendée ausheben. Er war damit beschäftigt, die Anordnungen für die Aushebung und Bewaffnung des Kontingents vom Pont-Neuf (vormals Henri IV.) aufzusetzen. Alle Gewehre sollten auf Anforderung ausgeliefert, die Nationalgarde des Bezirks mit Jagdflinten -und Pikert ausgerüstet werden. »Ich bringe dir«, sagte Gamelin, »die Liste der Glocken, die zum Gießhaus im Luxembourg sollen, um zu Kanonen eingeschmolzen zu werden.«
Obwohl Evarist Gamelin keinen Heller besaß, war er als aktives Mitglied der Sektion eingeschrieben. Das Gesetz verlieh dieses Vorrecht zwar nur solchen Bürgern, die Geld genug besaßen, um einen Beitrag im Werte von drei Arbeitstagen zu leisten; zudem war eine Frist von zehn Tagen bis zur Wählbarkeit und Wahlberechtigung vorgeschrieben. Doch der Bezirk Pont-Neuf, der für Gleichheit schwärmte und eifersüchtig über seiner Selbständigkeit wachte, sah jeden Bürger für wahlberechtigt und wählbar an, der seine Uniform als Nationalgardist selbst bezahlt hatte. Dies war der Fall bei Garnelin, der aktives Mitglied seines Bezirkes und Mitglied des Militärausschusses war.
Fortune Trubert legte seine Feder hin und sagte:
»Bürger Evarist, geh doch zum Konvent und bitte um Instruktionen, damit wir die Kellerwände abkratzen, die Erde und die Bausteine auslaugen und Salpeter gewinnen können. Mit Kanonen allein ist nichts getan, wir brauchen auch Schießpulver.«
Ein kleiner Buckliger, die Feder hinterm Ohr, trat mit Schriftstücken in die vormalige Sakristei. Es war der Bürger Beauvisage vom Überwachungsausschuß.
»Bürger«, sagte er, »der optische Telegraph bringt uns schlimme Kunde; Custine hat Landau geräumt.« »Custine ist ein. Verräter«, rief Gamelin aus. »Er wird guillotiniert werden«, sagte Beauvisage. »Der Konvent«, erklärte Trubert mit seiner etwas atemlosen Stimme, doch in gewohnter Ruhe, »hat den öffentlichen Wohlfahrtsausschuß nicht mir nichts, dir nichts eingerichtet. Custines Verhalten wird von ihm untersucht werden. An Stelle dieses Unfähigen wird ein zum Sieg entschlossener General hingeschickt werden, und ça ira!«
Er blätterte in den Papieren und blickte mit seinen müden Augen darüber hin.
»Sollen unsere Soldaten ohne Zagen und Wanken ihre Pflicht tun, so müssen sie wissen, daß für ihre Angehörigen daheim gesorgt wird. Bist du auch der Meinung, Bürger Gamelin, so wirst du und werde ich bei der nächsten Versammlung beantragen, daß der Wohltätigkeitsausschuß sich mit dem Militärausschuß zur Unterstützung armer Familien zusammentut, die einen Verwandten im Heere haben.«
Und lächelnd summte er vor sich hin: »Ça ira, ça ira!«
Der schlichte Schreiber eines Bezirksausschusses, der Tag für Tag zwölf bis vierzehn Stunden an seinem rohen Holztisch arbeitete, um das bedrohte Vaterland zu retten, hatte keinen Blick für das Mißverhältnis zwischen seiner Riesenaufgabe und der Unzulänglichkeit seiner Mittel. Dazu fühlte er sich in seinem Streben zu einig mit allen Patrioten, und sein Ich verschmolz zu sehr mit der ganzen Nation, mit dem Sturm und Drang eines großen Volkes. Er war einer jener geduldigen Schwärmer, die nach jeder Niederlage auf den unmöglichen und doch gewissen Sieg bauten. Denn siegen mußten sie. Diese Habenichtse, die das Königtum vernichtet, Leute wie Trubert, ein kleiner Optiker, oder Gamelin, ein Winkelmaler, erwarteten von ihren Feinden keine Gnade. Sie hatten nur die Wahl zwischen Sieg und Tod. Daher ihre Begeisterung und heitere Ruhe.
Zweites Kapitel
Evarist Gamelin verließ die Barnabitenkirche und machte sich auf den Weg nach der Place de Dauphine, die zu Ehren des unbezwinglichen Diedenhofen den Namen Place de Thionville erhalten hatte. Im volkreichsten Viertel von Paris gelegen, hatte dieser Platz seit hundert Jahren sein schmuckes Aussehen verloren. Die Paläste an seinen drei Seiten, die unter Heinrich IV. gleichmäßig in rotem Ziegelbau mit Querlagen von weißem Sandstein erbaut waren, als Wohnsitze prunkvoller hoher Beamter, hatten ihre vornehmen Ziegeldächer gegen zwei, drei elende Stockwerke aus Bruchstein eingetauscht, oder sie waren ganz abgerissen worden, und an ihre Stelle waren würdelose Mietshäuser mit dürftigem Kalkverputz getreten. Ihre Straßenfronten waren unregelmäßig, armselig, schmutzig, von zahlreichen ungleichen, schmalen Fenstern durchbrochen, die Blumentöpfe, Vogelkäfige und trocknende Wäsche zierten. Hier hauste eine Schar von Handwerkern, Goldschmieden, Uhrmachern, Optikern, Buchdruckern, Näherinnen, Schneiderinnen und Wäscherinnen sowie etliche alte Juristen, die der Sturm der Revolution nicht mit der alten Justiz fortgefegt hatte.
Es war an einem Lenzmorgen. Milde Sonnenstrahlen, berauschend wie süßer Wein, leuchteten an den Häusermauern und fielen heiter in die Dachstuben. Die Schiebefenster standen offen, und in ihrem Rahmen erblickte man die unfrisierten Köpfe der Hausfrauen. Der Gerichtsschreiber des Revolutionsgerichts hatte sein Haus verlassen und ging in seinen Dienst; unterwegs klopfte er den unter den Bäumen spielenden Kindern auf die Wangen. Am Pont-Neuf wurde der Verrat des schändlichen Dumouriez ausgerufen.
Evarist Gamelin wohnte am ändern Seineufer in einem Hause aus der Zeit Heinrichs IV., das noch ganz sehmuck ausgeschaut hätte, wäre nicht unter dem vorletzten Tyrannen ein dürftiges Stockwerk mit Kalkverputz und ein niedriger, mit Ziegeln bedeckter Dachstuhl darauf gesetzt worden. Um diesen Wohnsitz eines alten Parlamentsrats den Bedürfnissen des Volkes anzupassen, das hier zur Miete wohnte, waren Scherwände und Hängeböden eingezogen worden. So hauste der Bürger Remacle, Schneider und Portier, in einem sehr engen und niedrigen Zwischenstock. Durch die Glastür sah man ihn mit untergeschlagenen Beinen auf seinem Werktisch hocken und tiefgebückt an einer Nationalgardenuniform nähen, während seine Frau, deren Herd keinen andern Abzug hatte als den Treppenflur, die Hausmieter mit dem Dunst ihrer Fleischtöpfe und gebackenen Fische einräucherte. Auf der Türschwelle saß ihr Töchterchen Josephine, das bildschöne Gesicht mit Sirup beschmiert, und spielte mit Mouton, dem Hunde des Tischlers.
Die Bürgerin Remacle, eine Frau von überquellendem Herzen, Busen und Hüften, gewährte, wie es hieß, ihre Gunst dem Bürger Dupont dem Älteren, Mitglied des Überwachungsausschusses. Wenigstens hatte ihr Mann sie stark im Verdacht, und das Haus schallte vom Stimmenschall ihres ehelichen Zwistes und ihrer Versöhnungen wider. In den oberen Stockwerken wohnten der Bürger Chaperon, ein Goldschmied, der seinen Laden am Quai de l’Horloge hatte, ferner ein Militärarzt, ein Richter, ein Goldschläger und mehrere Gerichtsbeamte.
Evarist Gamelin stieg die altmodische Treppe bis zum vierten Stock hinauf, wo sich sein Atelier und ein Zimmer für seine Mutter befanden. Dort endeten die mit Steinfliesen belegten Treppenstufen, die auf die schweren steinernen Stufen der unteren Stockwerke folgten. Eine Leiter, die an der Wand lehnte, führte auf einen Boden, von dem soeben ein dicker, alter Mann mit schönem, blühendem Antlitz herabstieg. Er trug ein riesiges Paket mit Mühe unterm Arm und summte dabei vor sich hin: »Ich hab’ meinen Diener verloren.« Er hörte mit seinem Singsang auf, sagte Gamelin höflich guten Tag, und dieser begrüßte ihn vertraulich und half ihm beim Herabbefördern seines Paketes, wofür der Alte sich sehr bedankte.
»Da drinnen«, sagte er, seine Last wieder aufnehmend, »sind Hampelmänner; ich will sie eben zu einem Spielwarenhändler in der Rue de la Loi bringen. Es ist eine ganze Schar, lauter Geschöpfe meiner Hand. Sie haben von mir einen gebrechlichen Körper bekommen, aber ohne Freuden und Leiden. Das Denken hab’ ich ihnen auch erlassen, denn ich bin ein guter Gott.«
Der so sprach, war der Bürger Maurice Brotteaux, ein alter Steuerpächter und früherer Adliger; sein Vater hatte es zu Gelde gebracht und sich durch einen Adelsbrief aus dem Pöbel emporgeschwungen. In der guten alten Zeit hieß Maurice Brotteaux Herr Des Jlettes und gab in seinem Haus in der Rue de la Chaise elegante Soupers, welche die schöne Frau von Rochemaure, die Gattin eines Staatsanwaltes; mit dem Glanz ihrer Augen verschoente. Sie war eine exemplarische Frau, deren ehrenwerte Treue nichts zu wünschen übrig ließ, solange die Revolution den Herrn Maurice Brotteaux Des Jlettes nicht um Ämter, Renten, Haus, Güter und Namen gebracht hatte. Durch die Revolution verlor er alles: Seitdem verdiente er sich sein Brot mit Porträtmalen in den Hofeinfahrten der Häuser; er buk Krapfen und Spritzkuchen am Quai de la Megisserie, verfaßte Reden für die Volksvertreter und gab den Bürgermädchen Tanzstunden. Gegenwärtig trieb er sein Gewerbe auf seinem Boden, zu dem man auf einer Leiter hinaufkroch, und in dem man nicht aufrecht stehen konnte. Dort fabrizierte er mit Hilfe eines Leim-topfes, eines Bindfadenknäuels, eines Aquarellfarbenkastens und einiger Papierfetzen Hampelmänner, die er an die Spielwarengroßhändler verkaufte. Diese setzten sie an die Straßenhändler ab, die sie auf einer Stange in den Champs-Elysees herumtrugen als Ziel des kindlichen Verlangens. In-mitten der furchtbaren öffentlichen Zustände und trotz seines eigenen großen Mißgeschicks bewahrte Maurice Brotteaux die Heiterkeit der Seele und suchte Trost in seinem Lukrez, den er in der weitoffenen Tasche seines Oberrockes beständig umhertrug.
Evarist Gamelin öffnete die Tür seiner Wohnung, die sofort aufging. Bei seiner großen Armut brauchte er sie nicht zu verschließen, und wenn seine Mutter aus Gewohnheit den Riegel vorschob, so pflegte er zu sagen: »Wozu? Man stiehlt keine Spinnweben, und die meinen erst recht nicht.« In seinem Atelier standen in dichtem Durcheinander seine ersten Versuche in der Malerei, zum Teil mit der Bildseite gegen die Wand gelehnt und mit dichter Staubschicht bedeckt. Sie stammten noch aus der Zeit, wo er mit glattem und schüchternem Pinsel entflogene Vögel und leere Köcher, kecke Liebesspiele und holde Glücksträume, hochgeschürzte Gänsemädchen und blumengeschmückte Schäferinnen gemalt hatte. Aber dieses Genre paßte nicht zu seinem Temperament. Diese Szenen bezeugten durch ihre kalte Darstellung die unversehrbare Keuschheit seines Herzens. Die Kenner hatten sich darin nicht getäuscht, und Gamelin hatte nie für einen galanten Meister gegolten.
Jetzt, wo er kaum dreißig Jahre alt war, schien ihm diese Kunst unendlich weit zurückzuliegen. In ihr sah er nur noch die Verderbnis des Königtums und eine Ausgeburt der höfischen Sittenlosigkeit. Ja, er schuldigte sich selbst an, daß er so verächtliches Zeug gemalt und sein Genie durch Knechtsdienste erniedrigt hatte. Jetzt, wo er Bürger eines freien Volkes war, zeichnete er mit kraftvollem Strich die Gestalten der Freiheit, der Menschenrechte, der französischen Konstitution, der republikanischen Tugend, volkstümliche Herkulesse, welche die Hydra der Tyrannei niederschlugen, und in alle diese Gestalten legte er die ganze Glut seines Patriotismus. Nur leider verdiente er sich sein Brot damit auch nicht. Die Zeiten waren schlimm für die Künstler. Gewiß trug der Konvent nicht die Schuld daran. Der sandte seine Heere nach allen Richtungen gegen die Könige und bot dem gegen ihn verschworenen Europa stolz, fühllos und entschlossen die Stirn. Treulos und grausam gegen die Seinen, zerfleischte er sich mit eigener Hand, erhob die Schreckensherrschaft zum Tagesbrauch, zog die Verschwörer unbarmherzig vor ein Gericht, das alsbald seine eigenen Mitglieder verschlingen sollte, und war doch zu gleicher Zeit gefaßt, nachdenklich, ein Freund der Kunst und des Schönen. Er reformierte den Kalender, gründete Fachschulen, schrieb Wettbewerbe für Malerei und Skulptur aus, ermunterte die Künstler durcht Stiftung von Preisen, schuf Jahresaufstellungen, eröffnete das Museum und beging nach dem Vorbild Athens und Roms großartige Feste und Trauerfeiern.
Aber die französische Kunst, die vormals in England, Deutschland, Rußland und Polen so verbreitet war, hatte jeden Absatz im Ausland verloren. Die Liebhaber der Malerei, die Kunstfreunde, vornehme Herren und Finanzleute waren ruiniert, ausgewandert und hielten sich versteckt. Die Leute, die durch die Revolution zu Gelde gekommen waren, Bauern, die die Nationalgüter aufgekauft hatten, Börsenspekulanten, Armeelieferanten, Spielpächter im Palais Royal, wagten ihren Wohlstand noch nicht zu zeigen und hatten zudem gar keinen Sinn für Bilder. Um ein Gemälde loszuwerden, mußte man schon den Ruf Regnaults oder das Geschick des jungen Gerard besitzen. Greuze, Fragonard, Houin nagten am Hungertuche. Prudhon schlug sich mit Frau und Kindern kümmerlich durch, indem er Zeichnungen machte, die Copia in Punktmanier stach. Die patriotischen Maler, wie Hennequin, Wikar, Topino-Lebrun darbten.
Gamelin selbst konnte die Unkosten eines Gemäldes nicht aufbringen. Er konnte sich weder Farben kaufen noch Modelle bezahlen, und so ließ er denn sein großes Gemälde »Der Tyrann, von den Furien bis in den Orkus verfolgt« in skizzenhaftem Zustand. Es bedeckte das halbe Atelier mit unvollendeten, furchtbaren, überlebensgroßen Gestalten und mit einem Knäuel von grünen Schlangen, die ihre spitzen gekrümmten Zungen hervorstießen. Links im Vordergrund erblickte man einen hageren und wilden Charon in seiner Barke, eine wuchtige Gestalt von schöner Zeichnung, nur zu schulmäßig. Viel genialer und natürlicher war ein anderes, kleineres, ebenfalls unvollendetes Gemälde, das im hellsten Teile des Ateliers hing. Es stellte den Orestes dar, wie ihn Elektra auf seinem Schmerzenslager emporrichtet. Mit rührender Gebärde strich das junge Mädchen die wirren Haare zurück, die ihres Bruders Blick trübten. Der Kopf des Orestes war von tragischer Schönheit; die Ähnlichkeit mit den Zügen des Malers war auffällig.
Gamelin stand oft traurig vor diesem Bilde. Manchmal zitterten seine Hände vor Malbegier; er erhob sie zu dem schon ziemlich ausgeführten Antlitz der Elektra und ließ sie ohnmächtig wieder sinken. Seine Brust schwoll vor Begeisterung, und seine Seele dürstete nach großen Dingen. Und doch verzettelte er sich in bestellten Arbeiten, die er mäßig ausführte, weil er den Durchschnittsgeschmack befriedigen mußte, und auch, weil es ihm nicht gelang, solchen Kleinigkeiten den Stempel des Genius aufzudrücken. Er zeichnete allegorische Bildchen, die sein Kollege Demahis recht geschickt in Schwarz oder Bunt stach, und die ein Kupferstichhändler im Faubourg Antoine, der Bürger Blaise, ihm billig abnahm. Aber die Stiche verkauften sich, wie Blaise sagte, immer schlechter, so daß er ihm seit einiger Zeit gar nichts mehr abnehmen wollte.
Doch die Not hatte Gamelin erfinderisch gemacht, und heute hatte er einen neuen, und wie er glaubte, glücklichen Einfall, mit dem der Kunsthändler, der Stecher und er selbst viel Geld verdienen mußten. Er plante ein patriotisches Kartenspiel, bei dem die Könige, Damen und Buben der alten Zeit durch Genien und durch Göttinnen der Freiheit und Gleichheit ersetzt waren. Die Figuren waren sämtlich skizziert, mehrere bereits ausgeführt, und es drängte ihn, die schon stichfertigen zu Demahis zu bringen. Die nach seiner Meihung am besten gelungene stellte einen Freiwilligen im Dreispitz, mit blauem Rock und roten Aufschlägen, gelbem Beinkleid und schwarzen Gamaschen dar. Er saß auf einer Trommel, hatte die Füße auf eine Kugelpyramide gestellt und hielt sein Gewehr zwischen den Beinen. Das war der »Herzbürger«, der den Herzbuben ersetzen sollte. Seit einem halben Jahre zeichnete Gamelin Freiwillige und stets mit Liebe. In den Tagen der Begeisterung hatte er mehrere verkauft. Andere hingen an den Wänden des Ateliers. Fünf bis sechs in Wasserfarben, Guasche oder Rotstift ausgeführt, lagen auf Tisch und Stühlen umher. Im Juli 92, als auf allen Plätzen von Paris Tribünen für die Aushebung aufgeschlagen waren, als aus allen, mit Girlanden geschmückten Wirtshäusern der Ruf erscholl: »Vive la Nation! Frei leben oder sterben!«, konnte Gamelin nicht über den Pont-Neuf oder am Rathause vorbeigehen, ohne daß sein Herz dem bewimpelten Zelte entgegenschlug, worin Beamte mit der Amtsschärpe beim Klang der Marseillaise die Freiwilligen einschrieben. Wäre er aber mit ins Feld gezogen, so hätte er seine Mutter brotlos zurückgelassen.
Evarist hörte schwer atmen, und gleich darauf trat seine Mutter, die Witwe Gamelin, ins Atelier. Sie war feuerrot, schwitzte und keuchte, und die Nationalkokarde, die nachlässig an ihrem Hute befestigt war, fiel beinahe zu Boden. Sie setzte ihren Marktkorb auf einen Stuhl, richtete sich auf, um Atem zu schöpfen, und klagte über die Teuerung der Lebensmittel.
Ihr Gatte war Messerschmied in der Rue de Grenelle in dem Laden »Zur Stadt Chätellerault« gewesen. Jetzt, wo er tot war, lebte die Bürgerin Gamelin als arme Hausfrau bei ihrem Sohne, dem Maler. Er war ihr ältestes Kind. Ihre Tochter Julie, früher Modistin in der Rue St. Honore war jetzt Gott weiß was geworden. Es war besser, nicht zu sagen, daß sie mit einem Emigranten, einem Aristokraten, verschwunden war.
»Lieber Gott!« seufzte die Bürgerin, ihrem Sohn einen Laib klitschigen, mißfarbigen Brotes zeigend, »das Brot ist gar nicht mehr zu bezahlen, und dabei ist das Mehl nicht mal rein. Auf dem Markt kriegt man weder Gemüse, noch Eier noch Käse. Wir werden so lange Kastanien essen, bis wir selbst welche sind.«
Ein langes Schweigen folgte. Dann fuhr sie fort:
»Ich sah auf der Straße Frauen, die nicht mal für ihre kleinen Kinder was zu essen hatten. Ist das ein Elend! Und das wird so weitergehen, bis die Dinge wieder in Ordnung kommen.«
»Mutter«, sagte Gamelin stirnrunzelnd, »die Teuerung, unter der wir leiden, kommt von den Kornwucherern und Spekulanten, die das Volk aushungern und im Bunde mit den äußeren Feinden stehen, um die Republik bei den Bürgern verhaßt zu machen und die Freiheit zu vernichten. Ja, dahin führen die Komplotte der Anhänger Brissots, die Verrätereien eines Petion und Roland! Wohl uns, wenn die Föderalisten nicht bewaffnet auf Paris rücken und die Bürger abschlachten, die noch nicht verhungert sind! Da ist keine Zeit zu verlieren. Man muß einen Kornpreis festsetzen und jeden guillotinieren, der mit der Volksnahrung wuchert, Aufruhr sät oder es mit dem Fremden hält. Der Konvent hat eben ein besonderes Gericht eingesetzt, um die Verschwörer zu richten. Es besteht aus Patrioten: hätten seine Mitglieder nur Energie genug, um das Vaterland gegen alle seine Feinde zu schirmen! Hoffen wir auf Robespierre: er ist tugendhaft. Hoffen wir vor allem auf Marat. Der liebt das Volk, der erkennt unseren wahren Vorteil und dient ihm. Stets war er der erste, wenn es galt, Verräter zu entlarven und Komplotte zu vereiteln. Er ist unbestechlich und furchtlos. Er allein kann die Republik aus der Gefahr retten.« Die Bürgerin Gamelin schüttelte den Kopf, und die lässig angesteckte Kokarde entfiel ihrem Hute.
»Geh doch, Evarist! Dein Marat ist auch nur ein Mensch und nicht mehr wert als andere. Du bist jung, du machst dir Illusionen. Was du heute von Marat sagst, sagtest du früher von Mirabeau, Lafayette, Petion und Brissot.« »Niemals!« rief Gamelin in ehrlicher Vergeßlichkeit. Die Bürgerin machte ein Ende des rohen Holztisches von den Büchern, Papieren, Pinseln und Zeitschriften frei und setzte die Suppenterrine aus Steingut, zwei Teller, zwei Stahlgabeln, den mißfarbenen Brotlaib und eine Flasche mit Tresterwein auf.
Mutter und Sohn verzehrten stillschweigend die Fleischbrühe und beendeten ihr frugales Mahl mit einem Stückchen Speck. Die Mutter legte ihr Suppenfleisch auf ihr Brot, führte die Stücke auf der Spitze ihres Taschenmessers feierlich an den zahnlosen Mund und kaute die teuren Speisen mit Respekt. Den Löwenanteil ließ sie ihrem Sohne, der zerstreut und versonnen blieb.
»Iß, Evarist«, mahnte sie von Zeit zu Zeit. »Iß doch!« Und dieses Wort nahm in ihrem Munde die Weihe eines religiösen Gebots an.
Dann fing sie wieder an, über die teuren Zeiten zu klagen. Gamelin empfahl aufs neue die Festsetzung des Kornpreises als einzigen Ausweg.
»Es ist kein Geld mehr im Lande«, wandte sie ein. »Die Emigranten haben alles mitgenommen. Das Vertrauen ist hin. Man möchte an allem verzweifeln.«« »Still doch, Mutter, still doch!« fuhr Gamelin auf. »Was liegt an unsern augenblicklichen Opfern und Leiden! Die Revolution wird die Menschheit auf Jahrhunderte beglücken!« Die gute Frau tauchte ihr Brot in den Wein. Ihr Geist heiterte sich auf. Lächelnd dachte sie an ihre Jugendzeit zurück, wo sie am Königsgeburtstag auf dem Rasen getanzt hatte. Sie dachte auch an den Tag, da Joseph Gamelin, zünftiger Messerschmied, um sie angehalten hatte. Und sie begann Stück für Stück zu erzählen, wie die Dinge sich zugetragen. Ihre Mutter sagte zu ihr: »Zieh dich an! Wir gehen nach dem Richtplatz in den Goldschmiedeladen von Herrn Bienassis, um zuzusehen, wie Damien gevierteilt wird.« Nur mit großer Mühe brachen sie sich Bahn durch die Menge der Schaulustigen. Im Laden des Herrn Bienassis trafen sie Joseph Gamelin in seinem schönen rosa Staatskleid, und sie begriff sofort, woher er kam. Solange sie am Fenster stand und zusah, wie der Königsmörder mit glühenden Zangen gezwickt, wie flüssiges Blei in seine Wunden gegossen, wie er von vier Pferden zerrissen und ins Feuer geworfen ward, stand Joseph Gamelin immerzu hinter ihr und machte ihr Komplimente über ihren Teint, ihren Haarputz und ihre Figur.
Sie trank die Neige ihres Weins aus und versenkte sich weiter in ihre Vergangenheit.
»Du kamst eher zur Welt, Evarist, als ich dachte, und zwar, weil ich während der Schwangerschaft einen großen Schreck bekam. Ich wurde auf dem Pont-Neuf fast umgerissen von der Menge der Schaulustigen, die zur Hinrichtung des Herrn von Lally liefen. Du warst bei der Geburt so klein, daß der Arzt glaubte, du würdest nicht am Leben bleiben. Aber ich wußte, Gott würde mir Gnade erweisen und dich mir erhalten. Ich zog dich auf, so gut ich’s vermochte; ich sparte weder Mühe noch Kosten. Es ist recht und billig, zu sagen, Evarist, daß du mir dafür dankbar wärest, und es mir von klein auf nach besten Kräften vergaltest. Du hattest ein sanftes, liebevolles Gemüt. Auch deine Schwester hatte kein schlechtes Herz, aber selbstsüchtig war sie und heftig. Du hattest mehr Mitleid als mit dem Unglück. Wenn die Gassenbuben der Stadtgegend die Vogelnester in den Bäumen ausnahmen, dann wolltest du ihnen die jungen Vögelchen entreißen und sie ihrer Mutter wiedergeben, und oft ließest du dich nur durch Fußtritte und grimmige Hiebe davon abbringen. Als du sieben Jahr alt warst, prügeltest du dich nicht etwa mit ungezogenen Bengeln herum, sondern du gingst artig auf der Straße und sagtest deinen Katechismus her, und alle Armen, denen du begegnetest, brachtest du ins Haus, um ihnen zu helfen. Ich mußte dich schließlich schlagen, um es dir abzugewöhnen. Du konntest keinen Menschen leiden sehen, ohne zu weinen. Als du erwachsen warst, wurdest du bildhübsch; und was mich sehr wunderte, du schienest es gar nicht zu merken. Darin warst du sehr verschieden von den meisten hübschen Jungen, die gefallsüchtig und auf ihr Gesicht eitel sind.«
Die alte Mutter sprach wahr. Evarist hatte mit zwanzig Jahren ein ernstes, reizendes Antlitz gehabt, eine strenge und dennoch weibliche Schönheit, wie das Gesicht der Minerva. Jetzt verrieten seine finsteren Augen und blassen Wangen eine traurige und heftige Seele. Aber seine Blicke nahmen, wenn er sie auf die Mutter richtete, bisweilen die Sanftmut der ersten Jugend an.
»Du hättest es«, fuhr die Mutter fort, »bei deinem hübschen Gesicht leicht gehabt, den Mädchen nachzulaufen; aber du bliebst lieber bei mir im Laden, und nicht selten mußte ich dir sagen, du solltest nicht immer an meinen Röcken hängen, sondern dich mit deinen Spielgefährten ein bißchen tummeln. Bis auf mein Totenbett, Evarist, werde ich dir bezeugen, daß du ein guter Sohn bist. Seit deines Vaters Tod hast du stets wacker für mich gesorgt, und obwohl dein Beruf dich kaum selbst ernährt, ließest du mich nie Mangel leiden. Und wenn wir heute alle beide arm und elend sind, so kannst du nichts dafür; die Schuld liegt an der Revolution.« Er machte eine tadelnde Gebärde, doch sie zuckte die Achseln und fuhr fort:
»Ich bin keine Aristokratin. Ich habe die vornehmen Leute im Glanz ihrer Macht gesehen und kann wohl sagen, sie mißbrauchten ihre Vorrechte. Ich sah, wie dein Vater von den Lakaien des Herzogs von Canaleille Stockhiebe bekam, weil er ihrem Herrn nicht schnell genug Platz machte. Die Österreicherin liebte ich nicht; sie war zu hochmütig und verschwenderisch. Den König hielt ich für zu gut, und erst durch seinen Prozeß und seine Hinrichtung bin ich anderer Meinung geworden. Kurz, ich wünsche die alte Zeit nicht zurück, obwohl ich damals manche angenehme Stunde verlebt habe. Aber komme mir nicht mit der Redensart, daß die Revolution die Gleichheit einführen wird. Die Menschen werden nie gleich sein, das ist ganz unmöglich, auch wenn man im Lande alles von oben nach unten kehrt. Es wird immer Große und Kleine, Dicke und Magere geben.« Während sie so sprach, deckte sie den Tisch ab. Der Maler hörte nicht mehr hin. Er entwarf im Geiste die Gestalt eines Sansculotten in roter Mütze und Karmagnole, der in seinem Kartenspiel den Pikbuben ersetzen sollte. Es pochte an die Tür, und ein Bauernmädchen trat ein. Es war breiter als hoch, rothaarig und krummbeinig. Eine Sackgeschwulst verdeckte ihr linkes Auge, und das rechte war blaßblau, beinahe weiß. Die Lippen waren wulstig, und die Zähne standen vor.
Sie fragte Gamelin, ob er der Maler wäre, und ob er ihr ein Bild ihres Bräutigams, Jules Ferrand, machen könnte, der Freiwilliger beim Ardennenheer wäre.
Gamelin antwortete, daß er dieses Bild nach der Heimkehr des braven Kriegers gern anfertigen wollte. Da bat das Mädchen mit zudringlicher Freundlichkeit, er möchte es doch gleich machen.
Der Maler mußte unwillkürlich lächeln und sagte, daß er ohne Vorbild nicht malen könnte.
Die Ärmste war sprachlos; diese Schwierigkeit hatte sie nicht vorausgesehen. Unbeweglich und stumm, den Kopf schief haltend und die Hände über dem Leibe verschränkend, stand sie da, als wollte sie vor Kummer versinken. Gamelin war von soviel Einfalt gerührt und zugleich belustigt. Um die arme Soldatenbraut aufzuheitern, drückte er ihr einen der Freiwilligen in die Hand, die er in Wasserfarben gemalt hatte, und fragte sie, ob ihr Liebster aus den Ardennen so aussähe.
Ihr trüber Blick senkte sich auf das Blatt herab, wurde nach und nach lebhafter und leuchtete plötzlich auf, während ihr breites Gesicht sich zu einem strahlenden Lächeln verzog. »Ja, genau so sieht er aus«, sagte sie schließlich. »Das ist Jules Ferrand, wie er leibt und lebt; das ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.«
Noch ehe der Maler daran gedacht hatte, ihr das Blatt aus der Hand zu nehmen, kniffte sie es sorgfältig mit ihren groben roten Fingern, faltete es ganz klein zusammen, schob es in ihren Busen zwischen Mieder und Hemd und überreichte dem Künstler ein Assignat von fünf Franken. Dann wünschte sie guten Abend und humpelte leichtfüßig hinaus.
Drittes Kapitel
Am selben Nachmittag ging Evarist zu dem Kupferstichhändler, dem Bürger Jean Blaise, der auch Tuschkästen, Papierwaren und allerlei Spiele verkaufte. Sein Laden in der Rue St. Honoré, gegenüber dem Oratorium, trug das Firmenschild »Amor als Maler«. Es lag im Erdgeschoß eines Hauses, das etwa sechzig Jahre alt war. Die Türwölbung trug als Schlußstein eine gehörnte Satyrfratze. Im Bogen unter der Wölbung prangte ein Ölbild, das den »Sizilianer oder Amor als Maler« nach einem Gemälde von Boucher darstellte. Jean Blaises Vater hatte es im Jahre 1770 anbringen lassen, und seitdem war es durch Sonne und Regen verblichen. Rechts und links von der Tür öffnete sich je ein gleichfalls gewölbtes Fenster mit einem Nymphenkopf als Schlußstein. Hinter riesigen Spiegelscheiben prangten Modekupfer und die letzten Novitäten in bunten Stichen. Heute waren galante Szenen von Billy, etwas nüchterne Arbeiten, ausgestellt: »Die Schule der ehelichen Liebe« und »Sanfter Widerstand«, die bei den Jakobinern Anstoß erregten, und die die Puritaner bei der Kunstgesellschaft denunziert hatten. Ferner eine »Promenade« von Debucourt mit einem Stutzer in gelbem Beinkleid, der sich auf drei Stühlen rekelte, Pferdebilder von dem jungen Karl Vernet, Luftballons, »das Rad der Virginia« und Figuren nach der Antike.
In dem Schwarme der Bürger, der an dem Laden vorbeikam, waren es just die Zerlumptesten, die am längsten vor den beiden schönen Schaufenstern verweilten. Sie waren zerstreuungslustig, begierig auf Bilder und wollten ihren Anteil an den Gütern der Welt wenigstens mit den Augen besitzen. Offenen Mundes standen sie davor, während die Aristokraten nur einen Blick hinwarfen, die Stirn runzelten und vorübergingen.
Sobald Evarist den Laden von fern erblickte, schaute er zu einem Fenster im ersten Stock auf, und zwar zu dem linker Hand, hinter dessen gebauchtem eisernem Balkon ein Topf roter Nelken stand. Es war das Fenster von Elodies Zimmer, der Tochter des Kupferstichhändlers, denn Jean Blaise wohnte mit seinem einzigen Kinde im ersten Stockwerk des Hauses. Einen Augenblick blieb Evarist vor dem »Amor als Maler« stehen, wie um Atem zu holen, dann drückte er auf die Türklinke.
Im Laden fand er die Bürgerin Elodie. Sie hatte Stiche verkauft, zwei Arbeiten von Fragonard Sohn und Naigeon, die aus einem Stoß andrer sorgfältig ausgesucht waren; und bevor sie die Assignate, die sie erhalten hatte, in die Kasse einschloß, hielt sie eins nach dem andern achtsam gegen das Licht, um ihre Wasserzeichen zu prüfen, denn es gab so viel falsches wie echtes Papiergeld, und der Handel wurde dadurch schwer geschädigt. Wie früher die Fälscher des Königsnamens, so bestrafte man jetzt die Papiergeldfälscher mit dem Tode: trotzdem gab es in allen Kellern Platten für Assignate; die Schweizer führten Millionen falschen Papiergeldes ein, man warf es bündelweise in die Gasthäuser; die Engländer luden täglich ganze Ballen davon an den französischen Küsten aus, um die Republik in Mißkredit zu bringen und die Patrioten ins Elend zu stürzen. Elodie fürchtete nicht nur, falsches Papiergeld zu bekommen, sondern noch mehr, welches in Umlauf zu setzen und dann als Komplizin von Pitt behandelt zu werden. Gleichwohl verließ sie sich auf ihr Glück in dem sicheren Gefühl, allen Lebenslagen gewachsen zu sein.
Evarist schaute sie mit jenem düsteren Blick an, der besser als alles Lächeln die Liebe verrät. Sie erwiderte diesen Blick mit einem spöttischen Mäulchen, wobei sie ihre schönen schwarzen Augen verdrehte. Sie tat es, weil sie sich geliebt wußte und nicht böse darüber war, und auch, weil solche Frätzchen einen Liebenden reizen, ihn zu Klagen verleiten und ihn zur Erklärung seiner Liebe drängen, sofern er das noch nicht getan hat. Und das war bei Evarist der Fall.
Als sie die Assignate in die Kasse gelegt hatte, zog sie aus ihrem Nähkörbchen einen weißen Schal, den sie zu sticken begonnen, und setzte ihre Arbeit fort. Sie war fleißig und gefallsüchtig und griff daher instinktiv zur Handarbeit, um Gefallen zu erregen und sich zugleich etwas Schmückendes zu machen. Auch stickte sie ganz verschieden, je nach dem, der ihr zusah. Wollte sie zarte Sehnsucht erwecken, so stickte sie nachlässig, wollte sie jemand zum Spaß in Verzweiflung treiben, so machte sie launische Nadelstiche. Als Evarist kam, arbeitete sie sorgfältig, weil sie ein ernstes Gefühl in ihm wachrufen wollte.
Elodie war weder die Jüngste noch die Schönste. Auf den ersten Blick konnte man sie häßlich finden. Sie hatte dunkles Haar und gelblichen Teint; unter ihrem großen, weißen nachlässig geknoteten Kopftuche quollen rabenschwarze Haarlocken hervor, und ihre glühenden Augen schienen ihre Wimpern zu versengen. Ihr volles, lustiges Antlitz mit den leicht vorspringenden Backenknochen, dem Stumpfnäschen und dem ländlichen, üppigen Ausdruck gemahnten den Maler an den Kopf des borghesischen Fauns, dessen göttlichen Mutwillen er von einem Gipsabguß kannte und schätzte. Ein leichter schwarzer Flaum über dem Munde setzte seinen Akzent auf die brennenden Lippen. Ihr Busen, wie von Liebe geschwellt, hob das Brusttuch, das sie nach der Jahresmode geknotet trug. Ihre schlanke Taille, ihre flinken Beine, ihr ganzer kräftiger Körper bewegten sich mit ungestümer, köstlicher Grazie. Ihr Blick, ihr Atem, ihr Zusammenschaudern, alles an ihr wirkte aufs Herz und versprach Liebe. Hinter dem Ladentisch machte sie den Eindruck einer Ballettnymphe, einer Bacchantin vom Opernhause, die ihr Pantherfell, ihren Thyrsusstab und ihre Efeugirlanden abgelegt hatte und nun ehrbar und wie verzaubert in der bescheidenen Hülle einer Chardinschen Hausfrau dasaß.
»Mein Vater ist nicht zu Hause«, sagte sie zu dem Maler. »Warten Sie ein Weilchen, er wird gleich wiederkommen.«
Ihre kleinen bräunlichen Hände zogen die Nadel flink durch den Stoff.
»Gefällt Ihnen das Muster, Herr Gamelin?«
Evarist besaß eine gerade Natur. Und die Liebe, die seinen Mut entflammte, übertrieb seine Aufrichtigkeit.
»Sie sticken sehr geschickt, Bürgerin, aber, wenn Sie es hören wollen: das vorgezeichnete Muster ist nicht schlicht und einfach genug; man spürt den gekünstelten Geschmack, der in Frankreich in den dekorativen Künsten, in Stoffen, Möbeln, Wandverkleidungen nur zu lange geherrscht hat. Diese Schleifen und Girlanden erinnern an den kleinlichen, zopfigen Stil, der unter dem Tyrannen Mode war. Jetzt bekommt man wieder Geschmack! Ach! wir waren tief gesunken. Zur Zeit des verruchten Ludwig XV. hatte die Dekoration etwas Chinesisches. Man machte dickbäuchige Kommoden mit lächerlichen, geschweiften Griffen, die zu nichts taugen, als zum Ofenheizen und zur Erwärmung der Patrioten. Nur das Einfache ist schön. Wir müssen zur Antike zurück. David entwirft Betten und Lehnstühle nach etruskischen Vasen und den Wandgemälden von Herkulanum.«
»Solche Betten und Lehnstühle habe ich gesehen«, nickte Elodie. »Das ist schön! Bald wird man nichts andres mehr wollen. Ich bewundere die Antike ganz wie Sie.«
»Nun also, Bürgerin,« fuhr Evarist fort, »hätten Sie diese Stickerei mit einem Mäanderband, Efeuranken, Schlangen oder gekreuzten Pfeilen verziert, so wäre sie eines Spartaners würdig … und Ihrer selbst. Immerhin können Sie das Muster behalten und es nur vereinfachen, mehr gerade Linien hineinbringen.«
Sie fragte, was sie fortlassen sollte.
Er neigte sich auf die Arbeit herab; Elodies Locken streiften seine Haare. Beider Hände begegneten sich auf der Leinwand, und ihre Atemzüge vermischten sich. Evarist fühlte sich beseligt, doch als er Elodies Lippen dicht neben den seinen fühlte, fürchtete er, dem jungen Mädchen zu nahe zu treten, und zog den Kopf rasch zurück.
Die Bürgerin Blaise liebte Gamelin; sie fand Gefallen an seinen großen glühenden Augen, seinem schönen, ovalen Gesicht, seiner Blässe und seinem dichten, schwarzen Haar, das in der Mitte gescheitelt war und in Locken auf seine Schultern herabfiel. Sie liebte sein gesetztes Benehmen, seine kalte Miene, sein herbes Wesen, seine feste, niemandem schmeichelnde Sprache. Und da sie in ihn verliebt war, so schrieb sie ihm einen stolzen Künstlergeist zu, der sich eines Tages in Meisterwerken entladen und seinen Namen berühmt machen würde; und darum liebte sie ihn doppelt. Die Bürgerin war zwar keine Verehrerin männlicher Sittsamkeit; sie war nicht moralisch entrüstet, wenn ein Mann seinen Leidenschaften, seinen Wünschen und Neigungen nachgab. Sie liebte den keuschen Evarist also nicht wegen seiner Keuschheit, sie fand diese nur vorteilhaft, weil sie ihr Eifersucht und Argwohn ersparte und jede Besorgnis vor Rivalinnen ausschloß.
In diesem Moment schien ihr seine Zurückhaltung freilich zu groß. Wenn Racines Aricia den Hippolyt liebte und die herbe Tugend des jungen Helden bewunderte, so hoffte sie diese doch zu besiegen, und über eine Sittenstrenge, die zu ihren Gunsten sich nicht erweichte, hätte sie bald geklagt. Sobald sich also Gelegenheit bot, machte sie ihm eine halbe Liebeserklärung, um ihn zu zwingen, ihr sein Herz zu entdecken. Nach dem Vorbild der zärtlichen Aricia war auch die Bürgerin Blaise fest der Meinung, daß die Frau in der Liebe das erste Wort sprechen soll. »Die am stärksten lieben«, sagte sie sich, »sind die schüchternsten. Man muß ihnen nachhelfen und sie ermutigen. Ihre Herzensunschuld ist zudem so groß, daß eine Frau ihnen auf halbem Wege, ja noch weiter entgegenkommen kann, ohne daß sie es merken; so kann sie ihnen den Schein eines kühnen Angriffs und den Ruhm der Eroberung lassen.« Über den Ausgang dieses Liebeshandels war sie ohne Sorge; wußte sie doch ganz bestimmt (ein Zweifel war ausgeschlossen), daß Evarist, bevor die Revolution ihn heroisch gemacht, in sehr irdischer Liebe für ein Weib, ein sehr dürftiges Wesen, die Portiersfrau der Akademie, entbrannt war.
Elodie war keine Naive; sie unterschied mehrere Arten von Liebe. Das Gefühl, das Evarist ihr einflößte, war tief genug, um es durch einen Lebensbund zu besiegeln. Sie hätte ihn gern geheiratet, glaubte aber, daß ihr Vater die Ehe seiner einzigen Tochter mit einem armen, unbekannten Künstler nicht zugeben würde. Gamelin hatte nichts; der Kunsthändler dagegen arbeitete mit großen Summen. Sein »Amor als Maler« brachte viel ein, das Spekulieren noch mehr, und er hatte sich mit einem Armeelieferanten zusammengetan, welcher der Kavallerie der Republik schlechte Stiefel und dumpfigen Hafer verkaufte. Schließlich war der Sohn des Messerschmieds aus der Rue Saint-Dominique keine Partie für die Tochter eines in ganz Europa bekannten Kunsthändlers, der mit den Firmen Blaizot, Bazan, Didot verwandt war und mit den Bürgern Saint-Pierre und Florian verkehrte. Zwar war sie keine gehorsame Tochter, die das Jawort ihres Vaters für ihre Ehe notwendig fand. Der war früh Witwer geworden, war begehrlich und leichtsinnig, ein Schürzenjäger und großer Geschäftsmann, der nie Zeit für sie übrig hatte und sie frei, ohne Rat, ohne Zuneigung hatte aufwachsen lassen. Anstatt den Wandel seiner Tochter zu bewachen, hatte er darüber hinweggesehen. Als Menschenkenner schätzte er ihr leidenschaftliches Gemüt richtig ein und kannte die Verführungskünste der Männer, die nicht bloß in einem hübschen Gesicht bestehen. Zu weitherzig, um ihre Tugend zu wahren, aber zu klug, um sich zu entehren, hatte sie ihre Torheiten mit Maß begangen und über dem Liebesdrang nie die Konvenienzen vergessen. Ihr Vater war ihr für diese Besonnenheit unendlich dankbar; und da sie von ihm den Geschäftssinn und die Unternehmungslust geerbt hatte, so beunruhigte er sich nicht über die geheimen Gründe, aus denen ein so heiratsfähiges Mädchen ledig und im Vaterhause blieb, wo sie mehr leistete als eine Haushälterin und vier Kommis. Mit siebenundzwanzig Jahren fühlte sie sich alt und erfahren genug, um sich ihr Leben selbst zu gestalten; sie empfand keinerlei Bedürfnis, ihren noch jungen, leichtsinnigen und zerstreuten Väter um Rat zu fragen oder seinem Willen sich zu fügen. Wenn sie indes Gamelin heiraten wollte, so mußte Herr Blaise diesem armen Schwiegersohn zu einer Stellung verhelfen, ihn an sein Geschäft ketten oder ihm Aufträge sichern, wie verschiedenen anderen Künstlern, kurz, ihm so oder so Einnahmen verschaffen. Nun aber schien es ihr ausgeschlossen, daß der eine dies Angebot machte, weil es zweifelhaft war, ob der andre es annahm: denn die beiden Männer standen auf keinem guten Fuß miteinander.
Diese Schwierigkeit, setzte die kluge und zärtliche Elodie in Verlegenheit. Der Gedanke schreckte sie nicht ab, einen heimlichen Bund mit ihrem Freunde einzugehen und den Schöpfer zum einzigen Zeugen ihrer gegenseitigen Treue zu nehmen. In ihrer Lebensklugheit fand sie nichts Verwerfliches an einem Herzensbunde, dem ihr unabhängiges Leben Vorschub leistete, und dem Evarists ehrbarer und tugendhafter Charakter eine beruhigende Sicherheit gab. Aber Gamelin schlug sich mit seiner Mutter nur mühsam durch, und in einem so eingeschränkten Dasein schien selbst für einen freien Liebesbund kein Raum. Zudem hatte Evarist sich noch nicht erklärt oder seine Absichten durchblicken lassen. Die Bürgerin Blaise nahm sich also vor, ihn bald soweit zu bringen. Sie hielt in ihren Gedanken und in ihrer Arbeit zugleich inne. »Bürger Evarist« sagte sie, »dieser Schal wird mir nur dann gefallen, wenn er Ihnen gefällt. Bitte, zeichnen Sie mir ein Muster dazu. Inzwischen trenne ich, wie Penelope, alles wieder auf, was ich in Ihrer Abwesenheit gemacht habe.«
Er antwortete mit düsterer Begeisterung:
»Das soll geschehen, Bürgerin. Ich will Ihnen das Schwert des Harmodius zeichnen, von Blumen umrankt.«
Er zog seinen Zeichenstift hervor und entwarf Schwerter und Blumen in dem klaren, schlichten Stil, den er liebte. Dabei entwickelte er seine Theorien.
»Die regenerierten Franzosen« sagte er, »sollen das Vermächtnis der Knechtschaft verwerfen, den schlechten Geschmack, die schlechte Form, die schlechte Zeichnung. Watteau, Boucher, Fragonard schufen für Tyrannen und für Sklaven; in ihren Werken fehlt jedes Gefühl für den Stil, für die reine Linie, nichts ist natürlich und wahr. Masken, Puppen, Flitter, Äffereien. Die Nachwelt wird dies frivole Zeug verachten. In hundert Jahren sind alle Bilder von Watteau in den Rumpelkammern verschimmelt; im Jahre 1893 werden die Malschüler ihre ersten Versuche auf die Bilder von Boucher klexen. David hat den Weg gewiesen; er nähert sich der Antike; doch er ist noch nicht schlicht, groß und einfach genug. Unsre Maler werden von den Wandgemälden von Herkulanum, von den römischen Basreliefs, den etruskischen Vasenbildern noch manches Geheimnis zu lernen haben.«
Er redete lang und breit von der antiken Schönheit und kam dann wieder auf Fragonard, den er mit unstillbarem Hasse verfolgte.
«Kennen Sie ihn, Bürgerin?«
Elodie nickte.
»Sie kennen auch den Biedermann Greuze, der mit seinem scharlachroten Rock und seinem Degen recht lächerlich aussieht. Aber neben Fragonard wirkt er wie ein griechischer Weiser. Vor einiger Zeit begegnete ich diesem elenden Greise, wie er unter den Arkaden des Palais-Egalité umhertrottelte, gepudert wie ein Galan, zappelig, aufgeblasen, abstoßend. Bei dem Anblick wünschte ich mir, daß ein handfester Kunstfreund die Rolle des Apollo bei Marsyas übernähme, ihn an einen Baum knüpfte und ihm das Fell vom Leibe zöge, zum ewigen Exempel für schlechte Maler.«
Elodie blickte ihn mit ihren heiteren, sinnlichen Augen an.
»Sie sind ein guter Hasser, Herr Gamelin. Soll man daraus schließen, daß Sie ebenso lie …«
»Sie, Gamelin?« unterbrach eine Tenorstimme. Es war die Stimme des Bürgers Blaise, der eben mit knarrenden Stiefeln, fliegenden Rockschößen und klirrenden Uhranhängseln in seinen Laden trat. Auf dem Kopfe trug er einen riesigen schwarzen Zweispitz, dessen Enden auf seine Schultern herabfielen.
Elodie nahm ihren Nähkorb und ging in ihr Zimmer hinauf.
»Nun, Gamelin?« fragte der Bürger, »bringen Sie mir was Neues?«
»Vielleicht«, erwiderte der Maler.
Dann entwickelte er seinen Plan.
»Unsre Spielkarten stehen in verletzendem Widerspruch zu den Sitten. Die Namen König und Bube beleidigen das Ohr des Patrioten. Ich habe ein neues, revolutionäres Kartenspiel ersonnen und ausgeführt. Dabei sind die Könige, Damen und Buben durch Gestalten der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ersetzt. Die Asse, von Rutenbündeln umgeben, heißen Gesetze … Sie sagen an: Treff-Freiheit, Pik-Gleichheit, Karo-Brüderlichkeit, Cour-Gesetz… Ich glaube, ich habe diese Karten recht kühn gezeichnet; ich will sie von Demahis stechen lassen und ein Patent darauf nehmen.«
Damit zog er aus seiner Mappe einige fertige Aquarellfiguren und reichte sie dem Kunsthändler hin.
Der Bürger Blaise lehnte sie ab und blickte fort.
»Bringen Sie das in den Konvent, mein Junge«, sagte er. »Der wird Ihnen die Ehre des Tages erweisen. Aber bilden Sie sich nicht ein, damit einen Sou zu verdienen, denn Ihre Erfindung ist nicht neu. Sie kommen einen Posttag zu spät. Ihr revolutionäres Kartenspiel ist das dritte, das mir gebracht wird. Ihr Kollege Dugourc bot mir letzte Woche ein Pikettspiel mit vier Genien, vier Gestalten der Freiheit und Gleichheit an. Mir wurde auch ein Spiel mit Weisen und Helden, Cato, Rousseau, Hannibal und was weiß ich noch angeboten … Dazu hatten die Karten, mein Lieber, vor den Ihren den Vorzug, daß sie grob gezeichnet und in Holz geschnitten waren. Wie wenig kennen Sie die Menschen! Glauben Sie etwa, die Kartenspieler würden Karten gebrauchen, die im Geschmack von David gezeichnet und im Stil von Bartolozzi gestochen sind? Außerdem eine wunderliche Einbildung, daß so viel Umstände gemacht werden müßten, um die alten Spielkarten mit den heutigen Ideen zu vereinbaren. Die braven Sansculotten retten die Bürgertugend von selbst und sagen an: »Der Tyrann!« Oder einfach: »Das dicke Schwein!« Sie spielen mit ihren fettigen Karten und kaufen sich niemals neue. Der große Kartenabsatz ist in den Spielsälen des Palais-Egalité. Ich rate Ihnen, gehen Sie da hin und bieten Sie den Spielhaltern und Spielern Ihre Freiheiten, Gleichheiten und – wie sagten Sie doch – Cour-Gesetze an. Nachher erzählen Sie mir, wie die Aufnahme war.«
Der Bürger Blaise setzte sich auf den Ladentisch, knipste sich die Tabakskörner von seinen Nankinghosen und blickte Gamelin mit sanftem Mitleid an.
»Darf ich Ihnen einen Rat geben, Bürger Malersmann? Wenn Sie sich Ihr Brot verdienen wollen, so geben Sie Ihre patriotischen Karten, Ihre Revolutionsembleme, Ihre Genien der Freiheit, Ihre Herkulesse, Hydren und Furien, die das Verbrechen verfolgen, samt und sonders auf und malen Sie hübsche Mädchen. Der patriotische Eifer flaut mit der Zeit ab, aber die Frauen werden immer von den Männern geliebt. Malen Sie mir rosige Frauen mit kleinen Füßen und Händen. Und machen Sie sich klar, daß sich kein Mensch mehr für die Revolution begeistert, daß niemand mehr davon hören will.«
»Wie?« fuhr Evarist Gamelin auf. »Nicht mehr von der Revolution hören? … Aber die Begründung der Freiheit, die Siege unsrer Heere, die Bestrafung der Tyrannen – das alles sind doch Ereignisse, die auch die fernste Nachwelt mit Staunen erfüllen werden! Und wir sollten nicht davon gepackt werden? … Wie? Die Sekte des Sansculotten Jesus hat fast achtzehn Jahrhunderte überdauert, und der Kultus der Freiheit sollte nach knapp vierjährigem Bestehen abgeschafft werden?«
»Sie träumen«, erwiderte Jean Blaise mit überlegener Miene. »Ich stehe im wirklichen Leben. Glauben Sie mir, mein Lieber, die Leute sind der Revolution überdrüssig! Sie dauert zu lange. Fünf Jahre Begeisterung, fünf Jahre Volksverbrüderungen, Morde, Reden, Marseillaisen, Sturmläuten, ›Aristokraten an der Laterne‹, auf Piken getragene Köpfe, auf Kanonen reitende Weiber, Freiheitsbäume mit Jakobinermütze obendrauf, Jungfrauen und Greise, die in weißen Gewändern auf Triumphwagen einherfahren, Einkerkerungen, Guillotinierungen, Preisbestimmungen für Lebensmittel, Maueranschläge, Kokarden, Federbüsche, Säbel, Karmagnolen – das ist ein bißchen viel! Und schließlich versteht man den ganzen Rummel nicht mehr. Wir haben zu viele große Bürger erlebt, die erst zum Kapitol geleitet und dann den Tarpejischen Fels heruntergestürzt wurden: Necker, Mirabeau, Lafayette, Bailly, Pétion, Manuel und so viele andere. Wer sagt uns, daß Sie ihren neuen Helden nicht das gleiche Schicksal bereiten? … Es ist nichts mehr sicher.«
»Nennen Sie die Namen, Bürger Blaise, nennen Sie die Namen der Helden, die wir aufopfern wollen!« rief Gamelin in einem Tone, der den Kunsthändler zur Vorsicht mahnte.
»Ich bin Patriot und Republikaner«, sagte er, die Hand aufs Herz legend. »Ebensosehr Republikaner und Patriot wie Sie, Bürger Evarist Gamelin. Ich zweifele Ihren Bürgersinn nicht an und bezichtige Sie durchaus nicht des Wankelmuts. Aber sehen Sie: mein Bürgersinn und meine Treue sind durch zahlreiche Taten bewiesen. Meine Grundsätze sind diese: Ich schenke jedem mein Vertrauen, der imstande ist, der Nation zu dienen. Vor den Männern, die durch öffentliche Wahl zur gefährlichen Ehre der gesetzgebenden Macht erhoben sind, wie Marat und Robespierre, neige ich mich in Ehrfurcht und bin bereit, sie mit meinen schwachen Kräften zu unterstützen, ihnen den schwachen Beistand eines guten Bürgers zu leisten. Die Ausschüsse können Zeugnis ablegen für meinen Eifer und meine Treue. In Gemeinschaft mit echten Patrioten habe ich Hafer und Furage für unsre brave Kavallerie und Stiefel für unsre Soldaten geliefert. Noch heute geht von Vernon ein Zug von sechzig Ochsen zur Südarmee, durch eine Gegend, die Räuber unsicher machen, und die Pitts und Condés Agenten durchstreifen. Ich rede nicht, ich handle.«
Gamelin legte seine Aquarelle ruhig in ihren Umschlag, knüpfte die Bänder zu und nahm ihn unter den Arm.
»Ein merkwürdiger Widerspruch,« sagte er, die Zähne aufeinander beißend, »wenn man unsern Soldaten hilft, die Freiheit gegen die ganze Welt zu behaupten, und sie daheim doch verrät, indem man Unruhe und Verwirrung in die Seele ihrer Verteidiger sät … Guten Abend, Bürger Blaise.«
Bevor Gamelin in die Gasse einbog, die am Oratorium entlang führte, drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick auf die roten Nelken auf einem Fenstersims. Sein Herz schwoll über vor Liebe und Zorn.
Er verzweifelte nicht an der Rettung des Vaterlandes. Den gesinnungslosen Worten des Jean Blaise setzte er seinen revolutionären Glauben entgegen. Trotzdem konnte er nicht leugnen, daß dieser Händler mit einem Anschein von Recht behauptete, das Volk von Paris würde gegen die Ereignisse flau. Wußte er doch leider selbst, daß die erste Begeisterung einer allgemeinen Gleichgültigkeit gewichen war, daß man die gewaltigen, einmütigen Massen von 89, die Millionen harmonischer Seelen nicht mehr sah, die sich 90 um den Altar der Föderierten geschart hatten. Aber gerade darum mußten die guten Bürger ihren Eifer und ihre Kühnheit verdoppeln und das schläfrige Volk aufrütteln, indem sie ihm nur die Wahl zwischen Tod und Freiheit ließen.
Also dachte Evarist Gamelin, und der Gedanke an Elodie befeuerte seinen Mut.
Als er am Seinekai anlangte, ging die Sonne hinter schweren Wolken wie hinter glühenden Lavagebirgen unter. Die Dächer der Häuser strahlten in goldigem Schein, und die Fensterscheiben blitzten. Und Gamelin malte sich im Geiste das Bild der Titanen aus, die aus den glühenden Trümmern der alten Welten die eherne Stadt Dike schmiedeten.
Da er kein Stück Brot für sich noch für seine Mutter hatte, so träumte er von der endlosen Tafel, an die sich die ganze regenerierte Menschheit setzen würde. Inzwischen redete er sich ein, daß das Vaterland als gute Mutter seinen treuen Sohn ernähren würde. Der Geringschätzung des Kunsthändlers zum Trotze zwang er sich zu dem Glauben, daß sein Plan eines revolutionären Kartenspiels neu und gut sei, und daß er mit seinen wohlgelungenen Aquarellen ein Vermögen unter dem Arm trüge. Demahis soll sie stechen, dachte er. Wir werden das neue patriotische Spiel selbst verlegen, und in einem Monat setzen wir sicher zehntausend Stück zu zwanzig Sous ab.
Und in seiner Ungeduld, dieses Projekt zu verwirklichen, strebte er mit großen Schritten nach dem Quai de la Ferraille, wo Demahis über dem Glaser wohnte.
Man mußte durch den Laden. Die Glaserfrau sagte, daß der Bürger Demahis ausgegangen sei, und dies nahm den Maler nicht wunder. Er wußte, daß sein Freund das Umherstreifen und das regellose Leben liebte, und er wunderte sich nur, daß jemand bei so wenig Beharrlichkeit so viel und so gut arbeiten konnte. Die Glaserfrau bot ihm einen Stuhl an. Sie war mürrisch und klagte über die schlechten Zeiten, obgleich die Revolution, die so viele Scheiben zerschlug, den Glasern viel einbrachte.
Als die Nacht anbrach, gab es Gamelin auf, seinen Freund zu erwarten, und verabschiedete sich. Beim Passieren des Pont-Neuf sah er berittene Nationalgarden vom Quai des Morfundus her anrücken und die Menge beiseite drängen. Sie trugen Fackeln in den Händen und eskortierten einen Henkerkarren, in dem ein völlig unbekannter Mann saß, unter lautem Säbelgerassel zur Guillotine. Es war irgendein Privilegierter von früher, das erste Opfer des neuen Revolutionstribunals. Man erkannte ihn undeutlich zwischen den Hüten der Gardisten. Er saß, die Hände auf dem Rücken gefesselt; sein geschorener Kopf, nach der Rückseite des Karrens gekehrt, wackelte hin und her. Neben ihm stand der Scharfrichter, gegen die Wagenleiter gelehnt. Die Vorübergehenden blieben stehen und meinten, es wäre wohl einer von denen, die das Volk aushungerten. Sie blickten ihn gleichgültig an. Gamelin trat näher und erkannte, unter den Zuschauern Demahis, der sich durch die Menge drängte und quer über die Straße wollte. Er rief ihn an und legte ihm die Hand auf die Schulter. Demahis blickte sich um, er war ein schöner, kräftiger junger Mann. Früher, in der Akademie, hieß es, daß er den Kopf des Bacchus auf den Schultern des Herkules trüge. Seine Freunde nannten ihn Barbaroux, wegen seiner Ähnlichkeit mit diesem Volksvertreter.
»Komm«, sagte Gamelin zu ihm, »ich habe dir was Wichtiges mitzuteilen.«
»Laß mich«, wies ihn Demahis barsch ab.
»Ich lief eben einem herrlichen Weibe im Strohhut nach, einer Modistin mit blonden Haaren. Der verdammte Karren kam dazwischen … Sie ging vor mir her, jetzt ist sie schon am Ende der Brücke!«
Gamelin suchte ihn am Rocke festzuhalten und schwor, daß die Sache von Wichtigkeit wäre. Aber Demahis hatte sich schon durch Pferde, Garden, Säbel und Fackeln hindurchgedrängt und verfolgte die Modistin.
Viertes Kapitel
Es war zehn Uhr morgens. Die Aprilsonne tauchte das junge Blattgrün in Licht. Die Luft war durch das nächtliche Unwetter gereinigt und wundervoll mild. Vereinzelt kam ein Reiter die Allee des Veuves heruntergeritten und unterbrach die stille Einsamkeit. Am Rande des schattigen Baumganges, vor der Hütte der »Schönen aus Lille«, saß Evarist auf einer Holzbank und wartete auf Elodie. Seit dem Tage, wo ihre Finger sich auf der Stickerei begegnet waren und ihre Atemzüge sich vermischt hatten, war er nicht wieder zum »Amor als Maler« gegangen. Eine ganze Woche lang hatte sein stolzer Stoizismus und seine Schüchternheit, die ihn immer ungeselliger machte, ihn von Elodie ferngehalten. Er hatte ihr einen ernsten, düstern, glutvollen Brief geschrieben, worin er sich über das Unrecht beschwerte, das ihm der Bürger Blaise getan hätte; aber seine Liebe hatte er verschwiegen und seinen Schmerz unterdrückt. Er hatte nur geschrieben, er würde nicht mehr in den Kunstladen kommen, und bei diesem Entschluß verharrte er mit größerer Festigkeit, als einem liebenden Mädchen recht war.
Elodie war von entgegengesetzter Gemütsart und stets bereit, das, was ihr gehörte, zu verteidigen. Sie nahm sich sogleich vor, sich ihren Freund wiederzuholen. Ihr erster Gedanke war, ihn in seinem Atelier auf der Place de Thionville aufzusuchen; doch da sie wußte, daß er leicht erregt war und aus seinem Briefe auf einen gereizten Gemütszustand schloß, so fürchtete sie, daß er Vater und Tochter mit dem gleichen Hasse bedenken und es darauf ablegen könnte, sie nicht wiederzusehen. So hielt sie es dann fürs beste, ihm ein sentimentales, romantisches Stelldichein zu gewähren, dem er sich nicht entziehen konnte, bei dem sie ihn in aller Muße umstimmen und ihm Eindruck machen konnte, und bei dem die Einsamkeit sich mit ihr verschwor, um ihn zu bestricken und zu besiegen.
Kluge Baumeister hatten damals in allen englischen Gärten und Modepromenaden Strohhütten erbaut, die der ländlichen Sehnsucht der Städter schmeichelten. Die Hütte der »Schönen aus Lille«, in der Limonade verkauft wurde, stand in ihrer falschen Armseligkeit auf den künstlich nachgeahmten Trümmern eines alten Turmes und vereinte so den ländlichen Reiz mit der Schwermut der Ruinen. Ja, als ob eine Hütte und eine Turmruine noch nicht genügten, um gefühlvolle Seelen zu rühren, hatte der Limonadenverkäufer unter einer Trauerweide daneben ein Grabmal errichtet, eine Säule, die eine Graburne und die Inschrift trug: »Cleonice ihrem treuen Azor.« Hütten, Ruinen, Gräber – diese Symbole der Armut, des Verfalls und des Todes hatte die Aristokratie vor ihrem Untergange in ihren ererbten Parks angelegt. Und jetzt tranken, tanzten und liebelten die patriotischen Bürger mit Vorliebe in falschen Dorfhütten, im Schatten falscher Ruinen von Kreuzgängen, zwischen falschen Gräbern; denn Bürger wie Aristokraten waren Naturschwärmer und Schüler Rousseaus, mit empfindsamen Herzen und voller Philosophie. Evarist war vor der Zeit zum Stelldichein erschienen und wartete. Er zählte die Minuten an den Schlägen seines Herzens wie am Pendelschlag einer Uhr. Eine Patrouille mit Gefangenen kam vorbei. ZehnMinuten darauf schlüpfte eine rosagekleidete Dame, die nach der Zeitmode ein Blumenbukett in der Hand trug, in Gesellschaft eines Kavaliers im Dreispitz, mit rotem Rock, gestreifter Weste und gestreiftem Beinkleid in die Hütte. Beide sahen den galanten Pärchen der alten Zeit so ähnlich, daß man dem Bürger Blaise schon glauben mußte, es gäbe Eigenschaften an Menschen die keine Revolution ändert.
Kurz darauf kam von Rueil oder Saint-Cloud her ein altes Weiblein, das eine trommelartige, knallbunte Büchse in den Händen trug. Sie setzte sich auf die Bank, auf der Gamelin wartete, und stellte ihre Büchse neben sich. Der Deckel trug eine Vorrichtung, um Lose zu ziehen. Die arme Frau hielt nämlich in den Gartenanlagen Glücksgüter für Kinder feil.
Sie verkaufte »Pläsiers« und gab damit einer alten Zuckerware einen neuen Namen. Denn mochte nun der altgewohnte Name »Oblaten« an Opfer und Schuld gemahnen, oder mochte man ihn aus Laune nicht mehr mögen, jedenfalls hießen die Oblaten damals »Pläsiers«.
Die Alte wischte sich mit dem Schürzenzipfel den Schweiß von der Stirn und begann zu jammern und Gott anzuklagen, daß er es der armen Kreatur so schlecht ergehen ließe. Ihr Mann hatte eine Schenke an der Seine in Saint-Cloud, und sie lief täglich bis nach den Champs-Elysees, lärmte mit ihrer Handklapper und rief: »Pläsiers,, meine Damen!« Und all die Mühe und Arbeit reichte nicht hin, um ihr altes Leben, zu fristen.
Als sie merkte, daß der junge Mann auf der Bank mit ihr Mitleid empfand, erklärte sie lang und breit, woher ihr Mißgeschick käme. Die Republik war schuld daran. Die hatte die Reichen enterbt und nahm damit den Armen das Brot vom Munde. Daß es nochmal besser werden würde, darauf war nicht zu hoffen. Vielmehr sprachen manche Anzeichen dafür, daß das Elend noch größer würde. In Nanterre hatte eine Frau ein Kind mit Natternkopf geboren; in die Kirche von Rueil hatte der Blitz eingeschlagen und das Kirchturmskreuz geschmolzen; in den Wäldern von Chaville hauste ein Werwolf. Maskierte Männer vergifteten die Brunnen und streuten Pulver, die Krankheiten erregten, in die Luft.
Evarist sah Elodie aus dem Wagen steigen. Er eilte auf sie zu. Die Augen des jungen Mädchens leuchteten in dem Helldunkel ihres Strohhutes; ihre Lippen, so rot wie die Nelken, die sie in der Hand trug, lachten. Ein schwarzseidenes Tuch kreuzte sich über ihrer Brust und war im Rücken geknotet. Ihr gelber Rock ließ die raschen Bewegungen der Knie durchblicken und gab die flachbeschuhten Füße frei. Die Hüften waren fast verschwunden, denn die Revolution hatte die Taille der Bürgerinnen »befreit«. Freilich trugen die Röcke so auf, daß sie die Hüften nicht sowohl verdeckten als übertrieben und die Körperformen nur unter ihrem vergrößerten Abbild verbargen.
Er wollte sprechen, fand aber keine Worte, und machte sich im stillen Vorwürfe über seine Verlegenheit. Elodie jedoch zog sie dem liebevollsten Empfang vor. Auch bemerkte sie, daß er seine Halsbinde kunstvoller als sonst umgelegt hatte, und das schien ihr ein gutes Zeichen. Sie reichte ihm die Hand,