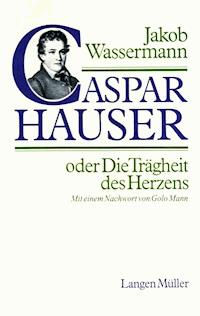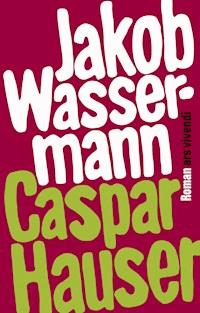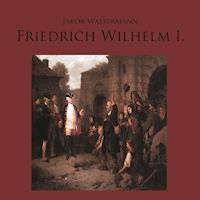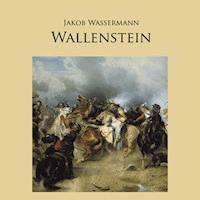Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Dramen + Essays + Gedichte + Autobiografie E-Book
Jakob Wassermann
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Dramen + Essays + Gedichte + Autobiografie" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Jakob Wassermann (1873-1934) war ein deutsch-jüdischer Schriftsteller. Inhalt: Romane: Melusine Die Juden von Zirndorf Die Geschichte der jungen Renate Fuchs Der Moloch Alexander in Babylon Caspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens Das Gänsemännchen Christian Wahnschaffe Faber oder die verlorenen Jahre Laudin und die Seinen Der Fall Maurizius Etzel Andergast Joseph Kerkhovens dritte Existenz Christoph Columbus Engelhart Ratgeber Erzählungen: Schläfst du, Mutter? Die Schaffnerin Die Mächtigen Ruth Der niegeküßte Mund Treunitz und Aurora Hilperich Die Schwestern: Donna Johanna von Castilien Sara Malcolm Clarissa Mirabel Der goldene Spiegel: Franziska und die Freunde Was über den Spiegel beschlossen wurde Die Pest im Vintschgau Der Stationschef Geronimo de Aguilar Von Helden und ihrem Widerspiel Der Tempel von Apamea Die Gefangenen auf der Plassenburg Paterner Nimführ und Willenius Herr de Landa und Peter Hannibal Meier Begegnung Die Geschichte des Grafen Erdmann Promnitz Franziskas Erzählung Aurora Der Affe und der Spiegel Faustina Der Mann von vierzig Jahren Der unbekannte Gast Adam Urbas Golowin Lukardis Ungnad Jost Oberlins drei Stufen Sturreganz Der Aufruhr um den Junker Ernst Der Geist des Pilgers: Das Gold von Caxamalca Witberg Selbstbetrachtungen Olivia oder Die unsichtbare Lampe Sabbatai Zewi Essays: Imaginäre Brücken: Was ist Besitz? Faustina Der Literat Die Kunst der Erzählung Deutsche Charaktere und Begebenheiten Dramen: Die ungleichen Schalen: Rasumowsky Gentz und Fanny Elßler Der Turm von Frommetsfelden Lord Hamiltons Bekehrung Hockenjos Die Prinzessin Girnara Gedichte: Ein jeder Tag Der Rabe Selbstvergötterung Andere Götter Hab' Acht! Mahnung Autobiografie: Mein Weg als Deutscher und Jude
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Dramen + Essays + Gedichte + Autobiografie
Mein Weg als Deutscher und Jude + Der Fall Maurizius + Caspar Hauser + Christoph Columbus + Melusine + Etzel Andergast + Joseph Kerkhovens dritte Existenz und mehr
Inhaltsverzeichnis
Melusine
Inhaltsverzeichnis
I.
Inhaltsverzeichnis
Wenige Menschen verstehen es, ihre Wünsche im Bereich des Möglichen zu lassen. –
Nach monatelangem Hungern war es Vidl Falk endlich gelungen, ein Stipendium von der Hochschule zu erhalten. Mehr hatte er nicht gewünscht. Er betrachtete sich als gemachten Mann und strebte, sich das Leben etwas gemächlicher einzurichten. Mit der ganzen Besitzesfreude eines Kapitalisten trug er sein Vermögen spazieren. Jedoch vermied er das Gedränge der Verkehrsstraßen, denn er fürchtete sich vor Taschendieben. Wenn er beim Mittagessen die Zeitung zur Hand nahm, so studierte er zuerst unter der Rubrik »Lokalnachrichten« die Aufzählung der Diebstähle und der verlorenen Geldbörsen.
Der plötzlich eingetretene Reichtum berauschte ihn. Die schmale, armselige Zelle, in der er bis jetzt gehaust, ekelte ihn auf einmal an. Er kündigte und ging aus, ein Zimmer zu suchen, das mit seinen Träumen möglichst übereinstimmen sollte. Der erfinderische Sinn Münchner Vermieterinnen, der schon den Aushängezettel mit jenen feinen Nuancen versieht, welche auf den Preis schließen lassen, erleichterte ihm das Suchen.
Eines Nachmittags erkletterte er die zwei steilen Treppen eines ziemlich vornehmen Hauses in der Heßstraße. »Pension Bender« stand an der Korridortüre.
Ein kleines, zierliches Fräulein führte ihn in das ausgeschriebene Zimmer. Leutselig und mit weltmännischem Behagen betrachtete Falk die vier Wände des Zimmerchens und beklagte, daß keine Ottomane oder »so was Ähnliches« vorhanden sei. Derselbe herablassende junge Mann hatte sich vor noch nicht vier Tagen mit einem Mittagessen begnügt, das aus einem für zehn Pfennige Äpfel bereiteten Mus und mit einem Abendessen, welches aus purem Schwarzbrot bestand.
Mit ironischem Lächeln beobachtete ihn das junge Mädchen. Es schien seine Spottlust mit Mühe zu zügeln.
»Warum lachen Sie denn?« fragte Falk, indem er ein möglichst gutmütiges Gesicht machte, fügte aber sogleich hastig hinzu, daß er das Zimmer mieten würde. »Wer wohnt denn sonst noch bei Ihnen?« fragte er, mit der Nase in der Luft schnuppernd, denn es roch nach Weihrauch.
Das Mädchen ließ ein helles, hölzernes Lachen hören und erwiderte: »Nebenan wohnt Doktor Brosam – er ist Arzt und er mag den Weihrauch sehr gern –«
»Pfui!«
»Dann ein Fräulein von Erdmann, eine Gelehrte, und Fräulein Mirbeth. Das ist alles.«
»Eine Gelehrte –? Jung?«
Jetzt lachten sie Beide. –
Gegen Abend des nächsten Tages – es war der 1. November – bezog Falk seine neue Wohnung. Als er mit Auspacken und Ordnen seiner Habseligkeiten fertig war, ging er in die Küche, um die Magd nach etwas zu fragen. Die Küchentüre stand halboffen und er wollte sie schon aufstoßen, als ihn der Anblick einer weiblichen Gestalt, welche drinnen ganz nahe an der Tür stand, daran hinderte. Diese Gestalt war groß und schlank, fast hager. Das ihm zugewandte Profil zeigte herbe und unschöne Linien, ja, es erschien ihm fast abstoßend. Soviel er im Dunkeln urteilen konnte, war sie noch sehr jung; er hörte eine schleppende und etwas gewöhnliche Stimme, die mit dem Tonfall einer Ermüdeten der Magd Erklärungen irgend welcher Art gab.
Vidl Falk wandte sich rasch ab, um nicht gesehen zu werden; aber in diesem Augenblick kam das Fräulein Bender aus dem Wohnzimmer und fragte nach seinem Begehr. Während er noch mit ihr sprach, verließ das schlanke, junge Mädchen die Küche und ging an ihnen vorbei. Falk sah ihr nicht ins Gesicht, obwohl er ihre Züge jetzt genau hätte sehen können, da die Magd mit der Korridorlampe folgte. Nur flüchtig musterte er ihren Schlafrock von düsterroter Färbung mit den Aufschlägen an der Brust und dem Brokataufputz. Doch obwohl er der Vorbeigehenden durchaus keine Beachtung schenkte, hörte er doch auch nicht darauf, was das kleine, spöttische Fräulein Bender sagte. Eine Unruhe, die freilich nur einige Sekunden dauerte, hatte ihn daran verhindert.
»Wer war denn das?« fragte er nachher ganz gleichgültig die Kleine.
Das Mädchen streifte ihn mit einem kurzen Seitenblick und sagte mit komischer, fast komödiantischer Wichtigkeit: »Das war Fräulein Mirbeth.«
Falk glaubte etwas Gehässiges aus dem Ton dieser Antwort zu hören, nicht gegen ihn, sondern gegen jene Dame. Nach Monaten noch erinnerte er sich der ironischen Betonung des Namens und des überlegen gespitzten Mundes mit der hervortretenden Unterlippe.
Noch in derselben Nacht schrieb Vidl Falk die folgenden, etwas jugendlich klingenden Sätze in sein Tagebuch: »Ich bin ruhig und glücklich jetzt, – beglückt von der Einsamkeit und allerlei unnützen Gedanken. Und doch fühle ich etwas Leeres in mir, eine Lücke, ein Loch. Sollte dies das Weib sein? Ich glaube kaum. Man kann sich doch nicht nach dem Giftbecher sehnen.«
Auf der ersten Seite dieses Tagebuchs befanden sich in lapidaren Lettern die prunkvollen Worte: Die reine Wahrheit.
II.
Inhaltsverzeichnis
Fräulein Emilie von Erdmann erwachte seufzend aus dem Morgenschlummer. Das Auf-und Zuklappen der Türen hatte ihren Schlaf verscheucht. Die dicke, ältliche Dame stöhnte sehr laut und hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Als der Lärm kein Ende nahm, murmelte sie Flüche und Schimpfworte, ballte beide Fäuste gegen die unsichtbaren Feinde draußen und rief endlich verzweifelt aus: »Mein Leben ist verpfuscht!« Dann sank sie theatralisch in die Kissen zurück und holte ein Brustbonbon aus dem Schubfach eines kleinen Tisches neben dem Bett.
Sie empfand jenes heftige Unbehagen, das Jeden heimsucht, der aus dem Schlaf zu den Sorgen des Lebens zurückkehrt. Auch die Überlegung, wieder um einen Tag älter geworden zu sein, verstimmte sie. Der Verfall ihres Körpers war das Schauspiel, worüber sie täglich von neuem grollen mußte. Und sie wollte noch jung sein und zur Jugend gezählt werden. Aber mit fünfzig Jahren ist man alt, der kunstreichsten Modistin zum Trotz.
Das Dienstmädchen brachte den Morgenkaffee und Fräulein von Erdmann beschwerte sich lebhaft über die Unruhe. »Liebste Anna,« sagte sie mit vibrierender Stimme, »ich bin so elend, so krank. Sehen Sie her,« (sie streckte ihre Gichtfinger aus den Kissen) »wissen Sie was das ist? Das ist der Hohn des Lebens! Geben Sie mir die Hand, Anna! Ich weiß, daß Sie es gut mit mir meinen. Ich war nicht immer so. Ich habe Tage des Glanzes gesehn.«
Das Mädchen lächelte kalt. Mit kecker Vertraulichkeit betrachtete es nach Dienstbotenart die gelbe, schwammige Hand. Wieder allein, nahm die Kranke eilig den kleinen Spiegel von der Wand und blickte starr hinein. Sie zuckte mit keiner Wimper, ihr Gesicht nahm einen königlich strengen und dann einen finstern, zürnenden Ausdruck an, und ihre abnorm langen, fleischigen Ohrlappen röteten sich.
Von neuem wurden draußen die Türen zugeschlagen, polternde Schritte ertönten auf dem Korridor, und der neue Herr rief nach Wasser. Mit einem Wutschrei sprang das Fräulein aus dem Bette. Sie suchte nach ihren Strümpfen, und kramte zu diesem Zweck unter den am Boden liegenden Wäschestücken, Zigarrenschachteln, Büchern, Zeitungen, Briefen und Unterröcken; sogar auf dem Tisch suchte sie zwischen den Kaffeetassen, Flaschen und Speiseresten. Aber das Erfolglose ihrer Bemühungen erkennend, begnügte sie sich damit, einen langen, faltenlosen Mantel um die Schultern zu hängen, der das schmutzige Nachthemd nur schlecht verhüllte, und barfuß in ein paar zerrissene Pantoffeln von ehrwürdigem Alter zu schlüpfen. Sie wollte schon hinausgehen, aber zwei Gründe hielten sie von ihrem Beschwerdegang ab. Erstens, dachte sie, wird mein Kaffee kalt und zweitens wäre diese kleine Frau Bender fähig, mich wegen der lumpigen paar hundert Mark, die ich schuldig bin, zu ennuyieren. Dies »ennuyieren« gefiel ihr; es verhüllte das am Besten, was zu denken sie sich schämte.
Nach dem reichlichen Frühstück hatte sie ihre Morgenzigarre angezündet und sich in schöner Pose auf die Ottomane gelegt. Da knarrte die Tür in den Angeln und unwillig wandte die Liegende das Haupt. Sie sah Fräulein Mirbeth im Zimmer stehen, dicht neben der Tür, die das junge Mädchen langsam geschlossen hatte. Emilie von Erdmann sprang auf. »Was – Sie, Fräulein!« rief sie erstaunt.
Fräulein Mirbeth antwortete nicht. Sie schaute gerade vor sich hin, aber nicht auf einen bestimmten Punkt, sondern sie blickte weit in die Ferne und sie schien etwas wahrzunehmen, das mehr und mehr ihre Angst erregte. Ihre Arme hingen schlaff an dem grauen, wollenen, schwarzgemusterten Morgenrock herab und ihre kleinen, feinen, schmalen und mageren Hände leuchteten förmlich durch das Zimmer.
»Aber liebes Kind, was haben Sie denn?« rief Fräulein von Erdmann erschrocken und haschte zärtlich nach der Hand dieses »Kindes«, das einen Kopf größer war als sie.
Das junge Mädchen machte noch immer keine Bewegung. Wohl aber begannen die Nasenflügel zu beben und die schwarzen Augen, die aus dem blassen Gesicht hervorleuchteten wie zwei überaus glänzende Perlen, füllten sich mit Tränen. Beständig, ohne aufzuhören, nagte sie an der Unterlippe und dann ging ein Zucken durch ihren Körper. Sie zitterte. Plötzlich machte sie zwei oder drei Schritte vorwärts, – schnell als fürchte sie zu fallen, warf sich auf die Ottomane, legte den Kopf auf die verschränkten Arme und begann zu weinen, – leise und unaufhaltsam.
Fräulein von Erdmann war ratlos. Mechanisch strich sie über das wirre, dunkle, glanzlose Haar der Weinenden, das bei jeder Berührung knisterte wie Seide.
Die dicke Dame suchte zu trösten. »Wer hat Ihnen denn ein Leids getan, Sie Arme? Ist es Ihr – Ihr Vormund, ist es dieser schreckliche Oberst? Sagen Sie mir alles. Unbesorgt dürfen Sie sich mir anvertrauen. Ich bin verschwiegen wie das Grab. Vertrauen Sie mir, liebes Kind. Ist er denn in Sie verliebt, dieser Oberst? Und hat er Sie beleidigt? Vertrauen Sie mir!«
Und sie drängte in das junge Mädchen mit dem ganzen Ungestüm einer Frau, die um jeden Preis ein Geheimnis zu erpressen sucht.
Fräulein Mirbeth richtete sich auf. Sie drückte einen Augenblick die Lider zu, wie um dadurch widerwärtige Bilder hinwegzuscheuchen und sagte schroff. »Lassen Sie mich!« Ihr Gesicht war voll Scham, und sie wußte nicht, wohin sie den Blick wenden sollte. Mit aufgehobenen Händen stand Fräulein von Erdmann vor ihr und sagte mehr als zehnmal: »Vertrauen Sie mir!«
Das junge Mädchen schüttelte den Kopf und entgegnete langsam: »Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein. Ich war wohl recht dumm. Aber ich kann jetzt nicht reden. Verzeihen Sie mir.« Sie nickte zerstreut und ging hastig hinaus.
Wütend, mit verächtlich zusammengepreßten Lippen sah ihr die dicke Gnädige nach.
III.
Inhaltsverzeichnis
Fräulein Mirbeth kehrte in ihr Zimmer zurück. Lange Zeit ging sie auf und nieder, mit großen Schritten und scheinbar völlig losgelöst von allem, was sie umgab. Sie war phlegmatisch in ihren Bewegungen und ihr Gesicht verriet keine innere Regung mehr. Aber etwas Freudloses und Hoffnungsloses lag auf ihr wie Novemberreif. Beim ersten Anblick erschien sie schlaff, müde und gleichgültig.
Sie setzte sich an den Schreibtisch, nahm Feder und Papier zur Hand und schickte sich an, zu schreiben. Doch blieb es nur beim Ansetzen der Feder, deren Spitze sie stets ängstlich betrachtete. Offenbar wußte sie genau, was sie schreiben wollte: Satz für Satz; aber diese Sätze aufs Papier zu bringen, war ihr unmöglich. Unmutig warf sie die Feder fort und stützte den Kopf in die Hand. Jetzt mußte sie aufquellende Tränen verschlucken und plötzlich errötete sie vor Scham oder vor Haß. Sie zog ein kleines, mit flotter Hand beschriebenes Stück Papier aus der Tasche, entknitterte es und sah länger als eine Viertelstunde darauf nieder.
Da klopfte es und das kleine Fräulein Bender trat herein. Mit ihren schwebenden, etwas gesucht graziösen Schritten ging sie auf die regungslos Dasitzende zu, faßte sie bei der Hand und sagte: »Was ist Ihnen denn, Mely? Sie sind so verstört, schon seit gestern. Sogar Mama hat es bemerkt und hat gesagt, ich solle doch mal herein.«
Mely Mirbeth schüttelte langsam den Kopf, wie jemand, der fest entschlossen ist, seinen Kummer allein zu tragen. Aber im Nu war dieser Entschluß bei ihr vergessen und die vorige Schwäche ergriff sie wieder. Hastig und suchend erfaßte sie die Hand des jüngeren Mädchens. In dieser unwillkürlichen Bewegung lag ein Schwächegeständnis und ein Anschmiegungsbedürfnis und dies wurde von dem jungen Mädchen wohl verstanden. Es näherte seine Lippen den Wangen Melys und fragte leise: »Sie waren bei Fräulein von Erdmann?«
Mely lächelte schuldbewußt.
»Das sollten Sie wirklich nicht tun,« fuhr die Kleine fort. »Warum das? Die haßt uns ja doch, weil wir jünger sind als sie. Sie stirbt vor Neid um unsere Jugend.«
Melys Lächeln wurde heller und fröhlicher. Mit naiver Verwunderung sah sie das zierliche Mädchen an, das ein so scharfes und selbständiges Urteil zu geben wagte. Man sah auch an der schnellen Bewegung ihrer Lider, daß sie darüber nachdachte. »Sie sind bös, Helene,« sagte sie endlich, erhob sich und begann wieder ihr Umherwandern. »Ach Helene,« rief sie nach einer langen Pause, »wenn Sie wüßten, was ich alles durchzumachen habe!«
Helene Bender saß mit verschränkten Armen auf der Lehne des Fauteuils und blickte mit ihren klugen, grauen Augen Mely an. Etwas Ungläubiges und Ironisches lag in ihrem aufmerksamen Blick. So klein sie war und so unbedeutend sie aussah, so skeptisch blieb sie gegenüber jedem Gefühlsausbruch und um den schmalen Mund mit der vorgeschobenen Unterlippe lag stets ein gleichgültiger Spott. Sie glaubte nicht an Melys Leiden, sie hielt jene für zimperlich und anspruchsvoll und vor allem für oberflächlich. Nur aus Neugierde war sie hereingekommen.
Mely ahnte nichts davon. Sie vertraute allen Menschen, außer denen, die sie haßte. Was man ihr sagte, das glaubte sie, selbst die plumpen Lügen. In ihrem Schmerz befangen, hielt sie es für unmöglich, daß jemand an der Tiefe dieses Gefühls zweifeln könne. Sie setzte sich und sagte mit ihrer jetzt weichen und einschmeichelnden Stimme, die etwas Bekümmertes stets in sich hatte: »Ich wollte ja auf alles gern verzichten, wenn ich nur meine Ruhe hätte. Mit nacktem Brot nahm ich vorlieb, – nur endlich einmal ein anderes Leben. Die Aufregungen, die Quälereien, die Beleidigungen, – ich bin ganz krank.«
Und sie seufzte tief auf, wie Kinder tun, wenn sie sich ausgeweint haben. »Sie wissen nicht, was das ist, Helene,« fuhr sie traurig fort. »Sie haben Ihre Mutter da und leben so bequem und Sorgen haben Sie keine. Aber ich bin ganz allein auf der Welt und dieser Mann darf mich mißhandeln wie er will, darf mich beschimpfen – o, ich bin ganz krank! Da hab ich wieder einen Brief, sehn Sie Helene, – da, was das ist! – Ich muß mich zu Tod schämen.«
»Was ist es denn?«
»Ach – das kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Es ist – er will – – nein, es ist unmöglich.« Verwirrt und voll Scham wandte sich Mely ab. »Schon einmal hat er es verlangt,« flüsterte sie. »Und weil ich nicht will, muß ich mich quälen lassen, um nichts, um jede Kleinigkeit.« Sie nahm den Brief und zerfetzte ihn nervös zwischen den Fingern. Dann ging sie zum Kleiderschrank, nahm ihre Straßenrobe heraus und öffnete mit einem einzigen Riß die Knöpfe ihres Morgenrocks.
»Ja – mögen Sie ihn denn nicht?« fragte Helene schüchtern. »Oder wie ist das?«
»Mögen! Erschießen könnt ich ihn.«
Das kleine Mädchen lächelte verständig. Sie trat zu Mely und ergriff deren beide Hände. »Seien Sie doch ruhiger,« sagte sie. »Ist es denn gar so schlimm? Wer weiß, vielleicht stellen Sie sich’s nur so entsetzlich vor. Er ist doch oft recht nett mit Ihnen. Wie viel Schönes hat er Ihnen schon geschenkt.«
Die Trostgründe waren banal; doch auf Mely übte die stille, sichere und selbstbewußte Art dieser Frühreifen einen beruhigenden Einfluß. Sie strich mit der Hand über die Stirn und blickte unschlüssig vor sich hin.
»Was wollen Sie denn tun?« fragte Helene ängstlich.
»Hinüber will ich. Alles will ich ihm sagen. Seinen Brief will ich ihm vor die Füße werfen!« stieß das junge Weib hervor. Sie hatte vergessen, daß sie den Brief soeben zerrissen hatte.
»Nicht – nicht das,« beschwichtigte Helene. »Warten Sie noch bis heute Abend wenigstens. Sie machen es ja nur schlimmer, – warten Sie.« Das Mädchen sprach sanft und zugleich überlegen. Doch Mely schüttelte den Kopf. »Ich muß,« sagte sie. »Ich bin sonst ganz unglücklich den ganzen Tag.« Und während sie sich ankleidete, erzählte sie. »Sehn Sie, Helene, ich habe neulich zu meinem schwarzen Kleid einen bunten Hut gekauft. Da gab’s Skandal. Das sei gemein, sagte er. Die Dienstboten täten das. Ich wolle mich auffallend kleiden, nur aus Koketterie. Ich soll kokett sein, Helene, das ist doch lächerlich, wie? Aber er will nicht, daß mich ein anderer Mann nur anschaut, deswegen soll ich keine Farben tragen. Und dann das: ich habe dreitausend Mark Vermögen gehabt, von der Mutter noch. Und als ich volljährig war, – nein etwas später, vor drei Jahren war’s, bekam ich das Geld. Da hat er nicht aufgehört, zu drängen, ich solle doch das Geld verbrauchen, und ich – so dumm! – mache die unsinnigsten Ausgaben. Kurz, in sechs Monaten war alles verputzt. Und wie ich dann das erste Mal von ihm Geld verlangen mußte, da hätten Sie ihn sehen sollen. Ganz glücklich war er darüber, ganz weg vor Freude.«
Helene war erstaunt. »Nun – das ist doch schön!«
»Aber verstehen Sie denn nicht? Jetzt war ich doch von ihm abhängig und er konnte machen mit mir, was er wollte. Jetzt hieß es gehorchen, – oder… Versteht! Sie nicht? Aber es ist beim Oder geblieben. O, es war gemein.«
Sie war fertig mit der Toilette, nahm Handschuhe und Schirm und zur Tür gehend, sagte sie leichthin: »Gelt, ich bin dumm, Helene. Andere würden lachen. Ach Gott und grade zu dieser alten Erdmann muß ich hinein. Wie dumm, wie dumm! Was denkt sich jetzt die.« Als ob sie aus sich selbst nicht klug zu werden vermöchte, schüttelte sie ganz langsam den Kopf. Sie war unzufrieden mit sich, auch deswegen, weil sie so offen gegen Helene gewesen war.
Als sie schon im Hausflur angelangt war, kehrte sie wieder um und ging in ihr Zimmer zurück. Furcht und Mutlosigkeit hatten sie erfaßt. Sie lehnte sich in den Fauteuil und schloß die Augen. Trotz des Mantels, den sie nicht abgelegt hatte, fror sie aus dem Innern heraus. Wie Spreu im Winde wirbelt, so stürmten die Gedanken in ihr durcheinander. Heiraten kann ich dich nicht, das wirst du doch einsehen, zitierte sie nervös lächelnd. Seine Frau hat er zu Grund gerichtet, dachte sie und runzelte feindselig die Stirn. Es war seltsam, daß diese Frau jetzt vor ihr stand, wie sie an einem Maskenball des letzten Karnevals kostümiert gewesen: im roten Pierrotgewand mit weißer Zipfelmütze. Noch deutlich entsann sie sich dabei des glühenden Gesichts, das oft mit einem spähenden und unterwürfigen Ausdruck dem Oberst sich zuwandte. Zwei Jahre erst war sie tot. Sie war ein feines Geschöpf gewesen, klug und wenig kokett, groß und in ihren Zügen der Saskia von Uhlenburg ähnlich. Sie war stets die Sklavin ihres Gatten gewesen. Bis ins Unbedeutendste ging dieser sklavische Zug an ihr, dies gänzliche und für Andere oft so unbegreifliche Aufgelöstsein im Wesen des Mannes.
Mely rührte sich nicht. Ihre Lippen waren nicht geschlossen, und sie hielt den Atem an. Und dann lächelte sie so, als sei sie mit allem einverstanden, was man mit ihr treibe. Eine große Müdigkeit kam über sie, und sie hegte den Wunsch zu schlafen. Aber Bild auf Bild stieg herauf: sie lebte wieder in ihrer Vergangenheit. Sie sah sich als Kind zur Volksschule gehen; sie sah beide Eltern auf dem Totenbette liegen, und sie sah den alten, gütigen Herrn, den Vater des Obersts, der ihr gerichtlicher Vormund geworden war. Dann blickte sie in die hellen, kahlen Klostergänge hinein, in denen sie zum erstenmal mit entsetzten Augen gestanden. Wie fremd und feierlich war dort die Welt! Sie hatte geglaubt, die Mauern seien endlos und hinter ihnen begänne das Meer. Sie hatte sich gefangen, bestraft gefühlt inmitten der gleichgekleideten Mädchen, unter der strengen Obhut der Schwestern. Ihre Sehnsucht nach der Stadt war groß; die Sandhaufen am Bahndamm erschienen in ihren Träumen, und die elterlichen Püffe und Prügel kamen ihr vor wie süße Späße. Sie mußte merkwürdig schwierige Dinge auswendig lernen und vor jedem, der sie ansprach, ängstigte sie sich. Sie fürchtete alle Menschen mit Ausnahme des Katecheten Kilian, den sie mit der Fülle ihres zwölfjährigen Herzens liebte. Er war ein schöner, blühender Jüngling, der niemals seitwärts blickte, auch nicht zu Boden, sondern stets gegen Himmel. In dieser Zeit wurde sie sehr fromm und sehr folgsam und wurde den Andern als gutes Beispiel gepriesen. Doch unverständlich war ihr nur das eine, daß sie für alle Menschen, die sie kannte, mitbeten sollte. Das konnte sie nie fassen. Wie sorgsam und gewissenhaft hatte sie stets ihre Sünden notiert, um bei der Beichte ja nichts zu vergessen: ich habe der Schwester Cäcilia in Gedanken unrecht getan; ich war zu träg, um die salischen Kaiser zu lernen; ich habe mich beim Aufwecken schlafend gestellt, um noch länger im Bett bleiben zu können – –
Wie lange war das schon her! Wie schnell waren die Jahre hingegangen! Allmählich hatte sie die Welt draußen vergessen, und sie begriff nicht mehr, daß es außerhalb des Klosters noch etwas von Wichtigkeit und Bestand geben könne. Weltlich und sündhaft waren ihr jene Mädchen erschienen, die, lustig und guter Dinge, das Leben sonnig fanden und von ihren Eltern in der Stadt erzählten, von Kaffeekränzchen, Musik und Tanz.
Eines Umstands erinnerte sie sich mit Entsetzen und stets suchte sie ihre Gedanken daran zu verscheuchen, nur um sich das Nachfühlen jenes Schreckens zu ersparen. An einem Osterfest, kurz nach ihrem fünfzehnten Geburtstag, ging mit ihrem Körper etwas Neues, Unbegreifliches vor. Sie stand vor einem Rätsel, das sie tief erschütterte. Noch sah sie sich mit zitterndem Leib an den Fensterposten gelehnt und in den verregneten Frühlingsmorgen hinausschauen. Sie wünschte aufs innigste, zu sterben, sie glaubte gesündigt zu haben und wußte nicht, worin diese Sünde bestand. Sie sah das Leben als etwas Finsteres und Gewalttätiges vor sich stehen und fürchtete sich. Stundenlang in der Nacht lag sie weinend auf ihren Kissen, und die Qual der Verheimlichung erdrückte sie. Sie schämte sich vor allen, sie versteckte sorgfältig die benutzte Wäsche, und kein Mensch fand sich, der das Dunkel ihrer kindlichen Phantasien gelichtet hätte. Einst, als ihre Seele durch das erneute Auftreten des Ungewohnten in Schrecken versetzt war, ging sie, unwissend wie sie war, ins Bad. Darauf kam die furchtbare Krankheit, deren Folgen sie niemals verwunden hatte. Eine unsichere Empfindung des Grolls und des Hasses beherrschte sie jetzt, wenn sie daran dachte, wieviel Schmerz ihr hätte erspart werden können durch die verständige Offenheit einer Lehrerin oder einer Freundin.
Aber nie hatte sie eine Freundin besessen. Von Allen war sie abseits stehen gelassen worden. Etwas, das sie unaufhörlich bedrückte, etwas Hoffnungsloses stand über ihrem Leben.
Sie überlegte, was sie tun könnte, um sich frei und unabhängig zu machen. Und doch, welche Angst empfand sie vor dieser Freiheit. Sie sah dabei immer das Bild eines einzelnen Baumes auf einer endlosen Heide, und dieses Bild der Hilflosigkeit machte sie schwach. Wenn ich doch nur einen Bruder hätte, dachte sie, der mich vor Beleidigungen wie der heutigen schützen könnte. Dann dachte sie an ihre Schwester, die sich hatte verführen lassen und die sich nun mit einem Kind elend durch die Welt schleppte. Niemand durfte wissen, daß sie eine Schwester hatte und wer das sei. Das hatte sie dem Oberst geschworen, und er hatte ihr unter dieser Bedingung erlaubt, das Mädchen zu unterstützen. »Aber sei vorsichtig dabei; denn die Gesellschaft, in der du verkehrst, und zu der ich dich emporgehoben habe, ist schlau und argwöhnisch.«
Sie zerknüllte ihren Handschuh in der Faust. Entschlossen stand sie auf, und bald darauf ging sie mit hastigen Schritten dem Hause des Oberst Thewalt zu. Ihre Augen blitzten vor Kampflust.
IV.
Inhaltsverzeichnis
Es war Nacht, als sie die Wohnung des Obersts verließ. Sie mußte gegen den Wind ankämpfen, der ihren Schleier aufblies. Fest schloß sie den Mund, und mit weit vorgebeugtem Kopf ging sie. Sie hatte die Begleitung des Obersts ausgeschlagen. »Nie mehr werde ich dies Haus betreten, nie mehr,« flüsterte sie verzweifelt, »ich Elende, ich Elende.«
Ganz belanglose Dinge fuhren ihr durch den Kopf. Es wäre schön, dachte sie, wenn ich jetzt mitten durch den Wind reiten könnte auf einem wilden Gaul, wie neulich draußen am See.
In der Pension saß man beim Tee. Fräulein von Erdmann, ein polnischer Adliger, Doktor Brosam, Frau Bender und Helene waren da. Die Herren erhoben sich, als Mely eintrat. Sie atmete noch heftig vom Treppensteigen und preßte eine Hand auf die Brust. Zerstreut nickte sie, wobei sie keinen der Anwesenden ansah, und die Zähne schauten unter den schwellenden Lippen hervor, ohne daß sie jedoch lächelte.
»Nehmen Sie vielleicht noch eine Tasse Tee, Fräulein Mirbeth?« fragte Frau Bender, und ihre großen, blauen Augen leuchteten dabei. Sie lachte fröhlich, als Mely bejahte und zeigte ihre prachtvollen Zähne.
Es entstand eine peinliche Pause, so daß Mely den Argwohn faßte, man habe sich über sie unterhalten. Darüber erschrak sie; denn nichts fürchtete sie so sehr, als das, was man hinter ihrem Rücken über sie sprach.
»Nein, welcher Sturm heute!« sagte sie endlich zögernd. Sie fing den spöttischen Blick auf, den die Erdmann mit dem Doktor wechselte, und ihr Argwohn wurde bestärkt. Wie sie in den Doktor verliebt ist, die alte Schachtel, dachte sie. Wie sie sich herausgeputzt hat über ihrem Schmutz. Sie lächelte Helene verständnisinnig zu, die, als begriffe sie nicht, mit einem kaum sichtbaren, verwunderten Kopfschütteln antwortete.
»Das ist noch gar nichts, – der Wind genügt nicht,« erwiderte der Doktor, behaglich schlürfend. »Um die ungesunde Sumpfluft unserer Zustände zu vernichten, müßte ein ganz anderer Sturm gehen.«
»Sie Sozialist!« seufzte Fräulein von Erdmann heiß und näherte ihre Hand dem Arm des Doktors.
»Sie habben abber garr keine Kälte hier,« sagte der Pole wichtig. »In Rußland – ooh! Was für Kälte, was für Kälte! Werde ick Ihnen eine Geschichte erzählen. Vorikes Jahr fahrt ein Pfarrer russischer in ein village Umgegend von Kiew. War serr kalt. Schnee so hoch und Wind eisiker. Und wie Abbend kommt, laufen, – wie sakt man: loup, des loups? –«
»Wölfe –«
»Richtik, kommen Wölfe, heulend und laufen hinter Troika herr. Wölfen werden immer gieriker und Pfarrer – was tun? Kann sich nicht helfen, was tut, wirft seine Kinder die Wölfe vor. Eins, zwei, drei Kinder, immer in große Wekstrecke, bis am Ziel war.« Der Pole sah sich herausfordernd um. »Das ist wahr, bei meine Seel,« beteuerte er, als ein Gelächter, das vom Doktor ausging und alle anderen ansteckte, ihn unterbrach. Nur Mely lachte nicht.
»Was will das heißen,« keuchte Dr. Brosam in verhaltenem Lachen. »Die Chinesen werfen ihre Kinder den Schweinen vor. Allerdings neugeboren, da sind sie zarter.«
»Nun, bei uns werden die Schweine den Kindern vorgeworfen,« meinte Helene trocken und freute sich, als das Gelächter von neuem begann.
»Da gibt es noch viel merkwürdigere Sachen,« hob der Doktor wieder an, und sein schönes, bleiches Gesicht wurde sehr ernst. »Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von dem normannischen Fischer kennen, dessen Großmutter ins Wasser gefallen war. Als er die Leiche auffand, sah er, daß sich Krebse daran festgesetzt hatten. Seitdem benutzt er seine tote Großmutter zum Krebsfang.«
»Entsetzlich – pfui! Wie können Sie so etwas erzählen!« stöhnte Fräulein von Erdmann.
Der Pole war wütend und empfahl sich bald. Mely entging es nicht, daß er einen glühenden, fragenden Blick auf sie gerichtet hatte und sie zog die Brauen zusammen. Schutzlos bin ich diesen Leuten preisgegeben, dachte sie.
»Was haben Sie denn,« wandte sich Frau Bender an sie. »Sie sind so beklommen heute, so ganz abwesend, so verstört –« Die kleine Dame hatte etwas Kindliches und Bestechendes in ihrem Wesen, das Jeden gefangen nahm.
Mely errötete tief. Sie wollte antworten, doch Dr. Brosam nahm für sie das Wort. »Ja, ich glaube, das gnädige Fräulein ist sehr launisch. Die meisten Damen sind so. Meine verstorbene Braut hatte nichts von dieser modernen Sucht, möglichst wetterwendisch zu scheinen.
Mely lachte so hart, daß sie selbst darüber erschrak. »Ihre verstorbene Braut war halt ein Tugendspiegel,« entgegnete sie achselzuckend.
»Ja, allerdings,« rief der Doktor heftig und mit flammenden Augen. Er richtete sich würdevoll auf und ließ seine kostbaren Brillanten in den Strahlen der Lampe spielen. Die Erdmann blickte entzückt an dem Hünen empor.
»Das ist ja schön,« spottete Mely. »Aber weshalb erzählen Sie das immer wieder? Das interessiert uns ja gar nicht. Wir fühlen uns ganz wohl, wenn wir auch nicht so tugendhaft sind.«
»Bitte sehr!« rief Fräulein von Erdmann entrüstet und warf giftig den Kopf zurück.
Mely verlor alle Zurückhaltung, alle Fassung. »War sie vielleicht auch eine Demokratin, diese verstorbene Braut? War sie auch für die Vermögensteilung?« Sie sprach rasch, voll Haß und Wildheit. Wie sehr mußte sie im Grund ihrer Seele verzweifelt sein, um so leidenschaftlich zu disputieren.
»Wie Sie sagen, genau wie ich!« antwortete der Doktor sanft. Er preßte seine Lippen zusammen, daß sie nur eine einzige gerade Linie bildeten.
Mely lachte wieder. »Dann trug sie vielleicht auch einen Brillantring für achtzehnhundert Mark? So viel kostet er doch, haben Sie gesagt. Und ging sie auch zu Schleich, um für sieben Mark zu frühstücken, wie Sie immer von sich erzählen –? Wie kann jemand, der so prahlt mit dem, was er hat, Demokrat sein wollen!«
Noch viel sanfter als vorhin erwiderte der Doktor: »Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, meine verstorbene Braut nicht mehr zu erwähnen. Ich will diesen trauten Namen von solchen Lippen nicht nennen hören. Sie mögen wohl vorhin recht gehabt haben mit der Tugend – ja! Man kann gesund sein ohne Tugend, jawohl! Aber gerade Sie wissen ja auch, wie die Welt dann urteilt!«
»Herr Doktor!« schrie Frau Bender empört und schlug mit der Faust auf den Tisch. Helene erhob sich und ging zum Fenster. Der Doktor saß leichenblaß da und strich sich unaufhörlich das reiche Künstlerhaar zurück.
Mely sah ihm entsetzt in die Augen, – so sehr fassungslos, daß Fräulein von Erdmann eine mitleidige Handbewegung machte. Dann stand sie auf und sagte mit erstickter Stimme: »Frau Bender –.« Es war ein Hilferuf. Aber ohne sich umzublicken, eilte sie aus dem Zimmer.
Im Korridor saß die Hauskatze auf einem Stuhl und putzte sich. Dann begegnete Mely Vidl Falk, der an seiner Tür stehen blieb, um sie vorbeizulassen. Er grüßte, doch sie beachtete ihn nicht, und er schaute ihr nach mit einem zweifelnden und verwunderten Blick.
In ihrem Zimmer setzte sie sich ans Fenster und blieb unbeweglich sitzen. Sie sah hinaus in die dunkle Novembernacht, auf die regenglänzende Straße und auf die sturmgepeitschten Bäume des Gartens. Sie schauerte zusammen und dachte: wenn ich doch meinen Shawl hätte. Dabei hätte sie nur aufstehen und zum Sofa gehen brauchen, wo er lag. Wie schön haben es andere Mädchen, sinnierte sie; sie verlieben sich und verheiraten sich. Dann sind sie glücklich. Aber sie sehnte sich durchaus nicht nach dem, was man Liebe nennt, – ganz im Gegenteil. Dies Gefühl hatte sie bisher in so abschreckender Gestalt auftreten sehen, daß sie nur Geringschätzung dafür hatte. Nur der Wunsch, beschützt zu werden, lebte in ihr, und dann zwei Empfindungen: die der Verlassenheit und eine nagende Reue.
Es klopfte und Frau Bender trat ein. »Warum machen Sie denn kein Licht, Fräulein Mirbeth?« rief sie erschrocken. Sie sah nur einen regungslosen Schatten am Fenster und ging darauf zu. Sie nahm Melys Hand und sagte herzlich: »Es tut mir so leid, Sie können mir’s gar nicht glauben. Nein, so gemein, so gemein! Regen Sie sich nur nicht auf. Ich habe ihm schon gekündigt, und morgen wird er ausziehen. Jetzt kommen Sie mit und trinken noch ein Glas Punsch mit mir und Helene.«
Mely schüttelte den Kopf. »Nein, ach nein, heute nicht.« Dann sagte sie leise und preßte die Hand der vor ihr Stehenden: »Frau Bender, es ist schrecklich, daß er das gesagt hat. O, ich schäme mich so sehr, ich schäme mich. Alle Leute glauben es, ich weiß. Aber es ist mir egal, alles ist mir jetzt gleich. Raten Sie mir, Frau Bender, was soll ich tun? Ich – –« Sie stockte, und trotz der Dunkelheit wandte sie sich ab.
Frau Bender tröstete in ihrer weichen, hinreißenden Art. Sie mußte nicht nach Worten suchen, sondern sie flossen natürlich und eindringlich von ihren Lippen. Doch Mely wurde dadurch nicht beruhigt. Je mehr die kleine Frau sprach, desto erregter wurde Mely. Die Leiden, die sie in sich verschlossen halten mußte, drückten ihr das Herz ab; denn sie hatte den Trieb, sich mitzuteilen. Frau Bender irrte auf ihr eigenes Leben ab, ja, sie verlor sich in Jugenderinnerungen. Sie vergaß, wo sie war, und berichtete mit feuriger Hingabe von ihrem Elternhaus, von ihrer Heirat und von der Flucht ihres Mannes nach Amerika. Schließlich erging sie sich in so heftigen Klagen, daß sich nun Mely genötigt sah, zu trösten und zu ermutigen. »Kommen Sie, Frau Bender, wir wollen vorgehen. Ich will noch bei Ihnen bleiben,« sagte sie, ihren Vorsatz vergessend.
»Ja, ja, trinken wir, ich werde einen famosen Punsch brauen,« entgegnete die kleine zapplige Dame, plötzlich heiter werdend.
Als sie im Korridor vor der Türe des Fräuleins von Erdmann vorbeigingen, hörten sie pathetische Worte: »Ja, lieber Doktor, das ist der blutige Hohn meines Lebens! Er schleicht hinter mir her und wird mich verschlingen. Bitte, – nein, bleiben Sie noch, Sie wissen ja, wie Sie mich beglücken, mit diesen Genieaugen, Sie Abscheulicher!«
Die Lauscherinnen verschlossen beide den Mund mit den Händen, um nicht herauszuplatzen. Dann flohen sie auf den Zehen.
Mely lachte viel und übermäßig in den zwei Stunden, die sie noch mit den Damen vom Haus verbrachte. Ja, sie trieb zum Schluß Narrenspossen, und sie schien alles vergessen zu haben, was über sie ergangen war. Sie war begeistert für diese gewinnende, gutherzige Frau Bender und diese zutrauliche, kluge Helene. Bessere Menschen gibt es gar nicht, dachte sie sich.
V.
Inhaltsverzeichnis
Am andern Morgen, es war ein Samstag, erhielt Mely ein Billet vom Oberst. Mit zitternden Händen erbrach sie das Kuvert. »Liebe Melusine,« schrieb er. »Ich bitte Dich heute zum Abendessen, da ich mittags durch den Direktor Skolny verhindert bin. Ich erwarte von Dir, daß Du auch weiterhin ein gutes Kind sein wirst. Beifolgendes Efeublatt erhielt ich einst aus Gens. Erinnerst Du Dich? Herzlichen Gruß. Wolfgang.«
Der Regen fiel in Strömen, und in den Zimmern hatte man zum ersten Mal geheizt. Als um elf Uhr die kleine Dele, Frau Benders sechsjähriges Töchterchen, aus der Schule kam, hatte sie Wangen rot wie Kirschen.
»Na, du siehst schön zerzaust aus,« sagte Mely, nahm sie bei den Armen und küßte sie ab.
»Ja, die dummen Buben laufen uns immer nach und lassen uns net in Ruh’,« entgegnete das Kind und schob die Unterlippe noch weiter heraus, als sie von Natur schon vorhing. »Ich werd’s jetzt meiner Lehrerin sagen.«
»Recht so, Schatz,« pflichtete Mely bei, die mit dem Mädchen völlig zum Kind wurde. Dele sagte auch du zu ihr.
»Ich möchte nur wissen, was sie von uns wollen,« fuhr die Kleine fort. Sie runzelte klug die Stirn. »Du,« sprang sie plötzlich ab, »heut früh hat die Puzzi Junge bekommen, hast es gesehen?«
Mely verneinte. Dele zog einen Zettel aus der Tasche, der mit den steilen, zurückgebogenen Schriftzügen Helenes beschrieben war. Es stand darauf: Die Geburt von vier gesunden Jungen zeigen hocherfreut an: Frau Puzzi, Kater Jonas. Mely lachte.
»Wundernette Katzerln sind’s,« sagte Dele und setzte sich der großen Kameradin auf den Schoß. »Viere. Ich war dabei. Ich hab’s ganz genau gesehn.« Sie kicherte geheimnisvoll und fragte dann flüsternd: »Du (sie begann fast triumphierend jeden Satz mit diesem du), kommt zu den Katzen auch der Storch?«
»Natürlich,« gab Mely zur Antwort.
»Gell, zu denen kommt der Katzenstorch?«
Als Mely laut lachte, wußte das Kind nicht, was es vor Verlegenheit anfangen sollte, und feuerrot werdend, gab es dem durch diese Fragen verblüfften jungen Mädchen einen schallenden Kuß.
Gegen Mittag wurde vor der Korridortüre ein ungestümes Bellen laut. »Jetzt kommt Pitt!« rief Mely freudig und sprang hinaus, um dem Hund zu öffnen. Es war ein Foxterrier, der dem Oberst gehörte, aber fast nur Mely gehorchte. Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten groß. Pitt wollte gar nicht aufhören, mit seinem Schwanzrestchen hin-und herzupendeln. –
Drei Tage vergingen. Mely hatte alles unterlassen, um ihre Lage irgendwie zu klären. Nicht einmal nachgedacht hatte sie darüber. »Nicht daran denken« war in solchen Fällen ihr ganzes Nachdenken, und immerfort war sie geschäftig, um sich zu betäuben. Unstät, beklommen und furchtsam verbrachte sie diese Tage.
Am Mittwoch schrieb der Oberst wieder, aber an Frau Bender. Er schrieb, daß sich Fräulein Mirbeth von ihm losgesagt habe, und daß er ihr dies mitteile, um spätere Gelddifferenzen zu vermeiden; für diesen Monat wolle er noch bezahlen, doch lehne er für die Zukunft jede Verbindlichkeit im Voraus ab.
Als Mely dies erfuhr, lächelte sie verächtlich, aber in Wirklichkeit fühlte sie sich zum Tod elend. Nun steh’ ich da und habe niemand auf der Welt, dachte sie. Kein Mensch wird sich um mich kümmern, und ich werde zu Grund gehen. Diese Frau Bender macht schon ein recht langes Gesicht. Ja, so sind eben die Leute. Dies alles dachte sie in einem Augenblick, während Frau Bender mit dem Brief vor ihr stand und sie etwas dumm anlächelte. »Losgesagt – losgesagt,« murmelte sie finster. »Ich bin halt nimmer hinüber, das ist alles.« Eine dumpfe Wut wachte in ihr auf. »Sehn Sie, Frau Bender, so werd’ ich behandelt,« sagte sie weich, als ob sie Vertrauen und Glauben suche. Aber dabei überlegte sie im Innern: lauter Feinde sind das. Diese Frau, dann Helene ja sogar das Kind, – lauter Feinde. Einem Funken gleich fiel ein verzweifelter Entschluß in ihre Seele. Ich werde schon etwas tun, schloß sie ihre Betrachtungen. Heute nachmittag, – oder nein, morgen…
Dies »Morgen« tröstete sie. Welch eine Ewigkeit, bis morgen!
Aber der nächste Tag kam und verging, auch der zweite Tag und die ganze Woche verging mit dem Trost für morgen. Sie wußte selbst nicht, wie die Stunden verflogen, so langweilig einzeln und so flüchtig im ganzen. Spät stand sie vormittags auf; dann tändelte sie mit dem Kind. Zum Lesen hatte sie keine Lust, und so nähte sie an ihren Kleidern in den langen Nachmittagsstunden. Die halben Nächte verwachte sie und träumte mit offenen Augen. Sie komponierte ganze Romane, wie sie, reich geworden, in Ansehen und Luxus lebte, eine Sklavenschar um sich. Aber für diese glücklichen Phantasien rächte sich der Schlaf durch böse Träume, die wie ein Alp auf ihr lagen, – tagelang. Es waren immer Träume, in denen sie bedroht war, in denen sie sich allein sah auf einem weiten Plan, in einem Wald, in Schluchten. Und da wurde sie verfolgt, bis sie zu müde war, um weiterfliehen zu können. –
»Nun, was wollen Sie denn jetzt beginnen, Fräulein Mirbeth?« fragte einmal Frau Bender mit demselben dummverlegenen Lächeln, mit dem sie stets von dieser Angelegenheit sprach.
»Ja was denn, was denn!« flüsterte Mely bestürzt wie ein Schuldner, der sich gemahnt und bedrängt sieht. Heute, – gewiß heute tu’ ich’s, dachte sie im Stillen. »Ach Helene,« fügte sie verzweifelt hinzu, und lehnte sich in den Fauteuil zurück, den Kopf in die gefalteten Hände legend.
Helene sah verständnislos über Melys Schulter hinweg und lächelte ebenso einfältig, wie ihre Mutter. Sie wissen alle beide, daß ich nichts habe, dachte Mely. Wo ist jetzt diese ganze Liebenswürdigkeit und Freundschaft? Sie redete sich in einen bitteren Menschenhaß hinein. »Sie brauchen keine Angst zu haben, Frau Bender,« sagte sie kühl. »Sie werden durch mich um nichts kommen.«
»Fassen Sie das nicht so auf, Fräulein, »entgegnete Frau Bender mit großer Herzlichkeit. »Ich bin nur besorgt um Sie, Wie schlecht sehen Sie aus, ganz mager sind Sie im Gesicht geworden. Sie müssen doch etwas tun, irgend etwas!«
Mely antwortete nichts. Sie nagte an ihrer Unterlippe, daß die Haut riß. Mit weitgeöffneten Augen saß sie da und blickte nach oben, ein Bild der Hilflosigkeit.
Kurze Zeit darauf kleidete sie sich an und ging fort. Bald überfiel sie die Müdigkeit, und ihr Gesicht hatte einen klagenden und bekümmerten Ausdruck. Das leuchtende Blaß ihrer Haut unter dem schwarzen Schleier hatte etwas Krankhaftes, und auch ihr lässiger Gang hatte gleichsam dies Klagende, Zielunbewußte. Sie fühlte Hunger und suchte ein vornehmes Restaurant im Innern der Stadt auf. Aber als das Essen vor ihr stand, sah sie, daß sie sich getäuscht hatte, denn sie brachte keinen Bissen hinunter. Sie bemerkte mit Schrecken, daß sie fieberte; es fror sie. Rasch zahlte sie und ging, von zahlreichen, bewundernden Männerblicken verfolgt.
Sie betrat ein Waffengeschäft und kaufte einen sechsläufigen Revolver für fünfzehn Mark. Sie ließ sich den Mechanismus erläutern und dann bestieg sie eine Droschke. Es hatte zu regnen begonnen, und der Regen war mit Schneeflocken vermischt. Sie hatte Kopfschmerz und ihre Zähne klapperten. »Ich habe nichts mehr zu leben,« sagte sie sich, während sie wie erstarrt im Wagen lehnte und die Beine ausstreckte. »Was soll ich noch leben, das hat ja gar keinen Wert.«
Sie stand in ihrem Zimmer, ohne daß sie wußte, wie sie heraufgekommen war. Sie erinnerte sich nicht, den Kutscher bezahlt zu haben. Lange Zeit hindurch – länger als eine Viertelstunde blickte sie in den Spiegel. Da lächelte sie bisweilen hochmütig, aber sie erschien sich fremd. Sie hatte das Gefühl, als könne sie nicht mehr das denken, was sie denken wollte. Sie dachte nicht an den Tod, den sie doch suchte, und den sie doch mehr als jeder andere Mensch fürchtete, sondern sie dachte: das Roastbeef, das ich mir da im Restaurant geben ließ, sah sehr schön aus. Schade, daß ich es nicht gegessen habe. Oder: mein Schleier hat ein großes Loch; man kann nicht mehr damit ausgehen. Oder sie hatte den Wunsch, ein Erdbeben möchte eintreten und das Haus, die Stadt möchten zerstört werden, nur damit dies langsam Erdrückende ihrer Lage ein Ende habe.
Es war dunkel geworden. Sie zündete die Kerze an. Der Regen klatschte an die Scheiben. Im Korridor machte Dele mit einer Spielgenossin großen Lärm. Die Hausfrau hantierte in der Küche. Alles war verstimmend, freudlos, hoffnungslos für die Sinne Melys. Sie glaubte jetzt ganz ruhig zu sein, und sie sagte sich das auch. Ja, sie sagte es leise vor sich hin und verwunderte sich noch im Stillen darüber. Bald aber schlug ihr das Herz wie ein Hammer so kräftig, es schlug zum Zerspringen. Sie wollte die Tür verriegeln, doch fand sie, daß sie es schon vorhin getan hatte. Sie lachte einmal laut auf, ohne zu wissen weshalb. So eine Dunkelheit herrschte in ihren Gedanken.
Plötzlich nahm sie die Schußwaffe in die Hand und sagte dabei laut: »Es ist ja ein Unsinn, aber ich tu’s doch.« Ihr Arm zitterte heftig; eigentlich war es kein Zittern, sondern ein Auf-und Niederfahren, genau im Takt der Herzschläge. Sie war wie besinnungslos. »Das Licht sollte ich auslöschen,« flüsterte sie. »Aber nein, nein, nein,« entschied sie dann trotzig, »es mag brennen bleiben.« Und sie nickte der Flamme flüchtig zu.
Sie spannte den Hahn und drückte. Es knackte wohl, aber der Schuß ging nicht los. Sie wartete einige Sekunden. Sie war verstört, einer Ohnmacht nahe. Sie probierte am Schloß der Waffe, aber ihre Bemühungen waren erfolglos.
Sie setzte sich aufs Sofa. Die Füße waren bleischwer. Die alte Unruhe und die alte Angst kamen wieder. »Nun, ich werde morgen zu dem Verkäufer gehen und den Revolver untersuchen lassen,« beschloß sie achselzuckend. Sie wußte genau, daß sie diesen Vorsatz nicht ausführen würde.
Man klopfte an die Tür. Die Magd bat zum Abendessen. Mely, froh, daß ihr Alleinsein ein Ende habe, kleidete sich rasch um, verlöschte die Kerze und ging hinaus.
Als sie das Eßzimmer betrat, sah sie einen jungen Mann am Tisch sitzen. Frau Bender stellte vor: »Herr Falk – Fräulein Mirbeth.«
VI.
Inhaltsverzeichnis
Herr Falk hat sich entschlossen, bei uns zu essen,« erklärte Frau Bender. »Er will seine Einsamkeit endlich ein bißchen verlassen.«
Mely antwortete mit einer höflichen Grimasse. Sie betrachtete ihren grauen Schlafrock und ärgerte sich, daß sie nicht eleganter erschienen war. »Wo ist denn Fräulein von Erdmann heute?« fragte sie.
»Herr Doktor Brosam besucht mit ihr das Theater,« erwiderte Frau Bender lachend. »So zum Abschied, wissen Sie. Ach, sie liebt ihn doch so,« flötete sie mit komischer Innigkeit.
»Ja, denken Sie, und nicht einmal ein Liebesdrama wird aufgeführt,« sagte die boshafte Helene.
»Wir bekommen jetzt eine noch ältere Dame, ein Fräulein von Mahnke,« erzählte die Hausfrau. »Auch eine Gelehrte oder so was Ähnliches.«
»Hoffentlich nur was Ähnliches, denn etwas Schlimmeres gibt es nicht,« bemerkte Falk. Er hatte bis jetzt seine junge Nachbarin noch nicht betrachtet. Nun sah er sie an, wandte aber sofort den Blick wieder ab.
»Wie werden Sie da erst über mich urteilen!« sagte Mely.
»Warum?«
»Fräulein Mirbeth malt,« erläuterte Helene, das letzte Wort ironisch betonend.
»Ach, eigentlich nur ein wenig. Ich lerne ja noch,« setzte Mely hinzu. »Ich habe nicht viel Talent und nicht viel Lust. Aber ich muß,« fügte sie rasch bei, als sie den erstaunten Blick des jungen Mannes bemerkte. »Ich muß,« wiederholte sie schüchtern. »Man muß doch etwas sein.«
»So–o! – Was malen Sie? Porträt?«
»Landschaft – nur Landschaft,« sagte sie mit blitzenden Augen, denn der geringschätzige Ton seiner Stimme reizte sie. »Sie wollen wohl auch, daß die Frauen stumpfsinnig bei der Kocherei und bei der Näherei bleiben?« fragte sie, schon erschreckend über ihre Kühnheit.
»Nein, nein,« entgegnete Falk stirnrunzelnd. »Sie müssen schon verzeihen« – er errötete und machte eine linkische Geste – »aber ich meine, wen es dazu treibt, der soll’s treiben. Das ist ja selbstverständlich. Ich spreche ungern darüber, weil man immer dieselben Dinge sagen muß. Gewiß, die Frau soll nicht beschränkt sein in dem, was sie tut, aber auf zehn talentvolle Männer wird doch höchstens eine talentvolle Frau kommen, die es auch um der Sache willen tut. Bei den meisten Frauen ist die Beschäftigung mit Wissenschaft und Kunst nichts als eine verfehlte Heirat. Aber das ist ja alles so oft gesagt worden und so selbstverständlich.«
»Ja, Sie haben recht,« pflichtete Mely bei. Sie sah Vidl Falk ein wenig träumerisch an, ohne sich dessen bewußt zu werden. Durch ein verstecktes Lächeln, das um seine Lippen spielte, erwachte sie gleichsam, und errötend pickte sie mit den Fingern die Brotkrumen vom Tischtuch.
Das Mahl ging unter gleichgültigen Gesprächen zu Ende.
»Sie sehen sehr abgespannt aus, Fräulein,« sagte Falk beim Tee zu Mely. »Als ob Sie eine große Fußreise gemacht hätten.«
»Ja, ich habe Kopfweh,« entgegnete sie rasch mit gesenkten Lidern. Seltsam, aufs neue, aufs quälendste erwachte gerade in diesem Augenblick die Reue in ihr. Die Worte Falks erwärmten sie. So vergessen von aller Welt erschien sie sich, daß diese in fast besorgtem Ton gemachte Bemerkung, die doch möglicherweise eine bloße Redensart sein konnte, ihr wie eine Liebkosung erschien. Sie preßte die Hand an die Stirn, wie um zu beweisen, daß sie große Schmerzen habe.
Frau Bender hatte um Entschuldigung gebeten. Sie lag auf dem Diwan und war dort eingeschlafen. Helene, in der altjüngferlichen Haltung, die ihr oft eigen war, saß im Stuhl zurückgelehnt und hörte zu, bald Beifall lächelnd, bald grundlos errötend. Eine Riesenrose aus Kreppstoff hing über dem Milchglassturz der Hängelampe und hüllte die eine Hälfte des Raumes in Dunkelheit. Der Diwan mit der schlafenden Frau Bender, das Pianino, die Türe nach dem Schlafzimmer der Familie und ihre braune Portieren, ein Stahlstich nach einem Hobbema und ein Genrebildchen von Horstik, – das alles lag in Dämmerung. Falk rauchte, und der blaue Dunst schwebte in Schlangenlinien, in feinen Schleiern, in verschnörkelten Figuren, gegen das Licht, über welchem er, von dem heißen Luftstrom erfaßt, blitzschnell nach der Decke emporwirbelte.
»Haben Sie sehr große Schmerzen?« fragte Falk. »Ich kann sie lindern. Oft schon hab’ ich das getan. Ich brauche nur die Hand auf Ihre Stirn zu legen.«
»Nein –?«
»Gewiß, – gewiß,« beteuerte er und seine Augen funkelten. Er stand auf und stellte sich vor Mely hin. Dann nahm er ihre beiden Hände in seine beiden und forderte sie auf, ihn unverwandt anzublicken. Sie zögerte lange, mit scheuem Lächeln streifte sie die überlegen dreinschauende Helene, und endlich wagte sie es, den jungen Mann anzusehen. Aber sie ertrug es nicht, sie mußte den Blick zu Boden senken. Auch schämte sie sich, daß sie gelogen hatte, denn in Wahrheit hatte sie gar keine Schmerzen. Doch es war, als ob sein Blick sie zwänge die Augen aufzuschlagen, und sie gehorchte. Sie begegnete seinem Blick und ein paar Sekunden lang sah sie ihn ganz starr an. Dabei lag etwas Staunendes in ihren Augen und zugleich etwas Flehendes.
Er nahm nun ihre zwei Hände in seine Rechte. Ihre Hände waren kalt wie Stein und glatt und trocken. Mit seiner Linken bedeckte er ihre Stirn. Da schüttelte sie energisch den Kopf, und unwillig stand sie auf. Falk war bestürzt, aber nur deshalb, weil er nicht länger in diese glänzenden Augen sehen konnte, in denen sich der Augapfel so überaus rein von dem milchigen Weiß des übrigen Auges abhob.
»Sehen Sie nur her!« rief Mely am Fenster, Helene und Falk traten zu ihr und schoben die Gardine zurück. Der erste Schnee war gefallen. Er bedeckte die Dächer und die ganze Straße und die Höfe und die Gärten, wie Konditoreiwaren mit Zucker bestreut sind. Auch der Mond stand am Himmel, gerade zwischen zwei Schloten eines Nachbarhauses. Alles war grün von seinem Licht.
Wie fremd fühlte sich Mely ihren früheren Leiden gegenüber! Es war ihr zu Mute, als lägen Jahre dazwischen. Nicht daß sie gewaltsam die Augen vor Gefahren geschlossen hätte, – sie sah keine Gefahren mehr. Sie kam sich auch gar nicht mehr vereinsamt vor. So schnell wechselte ihre Stimmung, so sehr konnte sie sich der Behaglichkeit eines Moments hingeben.
»Haben Sie immer noch Kopfschmerz?« fragte Falk.
Sie verneinte und schämte sich aufs neue ihrer Lüge. Dabei fragte sie sich, warum sie eigentlich gelogen und warum ihr diese Lüge gerade jetzt peinlich sei. Wieviel Lügen hatte sie schon gesagt, ohne viel nachzudenken. »Sie wollten mich wohl hypnotisieren?« fragte sie, den jungen Mann furchtsam anblickend.
»Bei Ihnen wär’ es nicht schwer,« erwiderte er. »Wollen Sie?«
»Nein, niemals!« rief sie erschrocken. »Nicht wahr, da kann man einem alle Geheimnisse entlocken?«
»O –!« machte Falk.
Jetzt denkt er sicher, ich sei dumm, dachte Mely. Ich sehe es deutlich an seinem Lächeln. Bah, das macht ja nichts.
»Es ist komisch,« meinte Helene, »wenn man so dasteht wie jetzt und man schaut hinaus und es ist alles so ruhig, da wünscht man sich doch etwas. Oder, – wie will ich sagen, man fühlt sich besser als in andern Stunden, nicht?«
Wenn sie so sprach, ernst und nachdenklich, berührte alles sympathisch an ihr. Man fühlte, daß es aufrichtig war, was sie sagte, und war ihr dankbar, daß sie dadurch das Innige der Stimmung vermehrte. Sie war klug.
»Das ist wahr,« antwortete Falk. »Ihnen sieht man zum Beispiel an, was Sie wünschen.«
»Nun was – was?« drängte sie ein wenig kokett und als sei sie überzeugt davon, daß niemand in ihr Innerstes einzudringen vermöge.
»Ich halte Sie für sehr ehrgeizig.«
»Das mag sein,« bestätigte Helene geschmeichelt und blickte Falk dankbar an. »Ja, das bin ich auch,« fuhr sie nach einer Pause eifrig fort. »Ich möchte etwas anderes als andere.«
»Und das wäre –?«
»Ich möchte vielleicht zu meinem Vater, – möchte ihm bei seinen Arbeiten behilflich sein, – Sie wissen ja, er ist Bildhauer, ich möchte vielleicht selbst – ach Gott, was möchte man denn nicht!« brach sie ab, die Worte fast singend. Es schien, als bereue sie, so offen gewesen zu sein. Aber immer noch lag diese Dankbarkeit gegen Falk in ihrem Gesicht, als hätte er bewiesen, daß er ihre Natur richtig beurteile und als hätte er durch diese harmlose Äußerung ungewöhnlichen Scharfsinn verraten. »So viel möchte man, so viel!« wiederholte sie, halb sehnsüchtig, halb ironisch.
Sie möchte, aber sie tut nichts, dachte Mely. Den ganzen Tag faulenzt und träumt sie und ihre Mutter mag sich quälen und abarbeiten. Nicht einmal etwas nähen, nicht einmal bügeln mag sie. »Aber warum zürne ich ihr?«fragte sie sich gleich darauf. »Vielleicht weil sie etwas Kluges gesagt hat?« Ja, warum zürnte sie ihr?
»Können Sie auch über mich etwas sagen?« fragte sie den jungen Mann, indem sie die Ellbogen auf die Knie stützte und sich weit vorbeugte.
Wieder konnte Falk in ihre Augen blicken, die gespannt und furchtlos auf ihn gerichtet waren; und er vergaß darüber fast, zu antworten. Er wurde verwirrt und strich die schwarzen Haarsträhnen aus der Stirn. Er stotterte: »Ich – ich halte Sie für sehr vertrauensselig und – nun ja – für sehr vertrauensselig,« schloß er, als könne dies eine Wort alle andern in ihrer Charakteristik ersetzen.
Sie lächelte. »Der Herr Oberst sagt immer, ich sei schrecklich mißtrauisch,« sagte sie leise.
»Der Herr Oberst, – wer ist das?«
»Das – das ist – mein Vormund.« Ein dunkler Schatten fiel gleichsam über sie und machte sie unruhig.
»Sind Sie hier geboren?« fragte Falk.
»Nein, ich bin Fränkin. Unterfranken ist meine Heimat. Dort in den Weinbergen, – in Sommerhausen…«
»Da sind wir ja Landsleute, auch ich bin Franke. Und Sie haben keine Eltern mehr? Auch keine Geschwister?«
Beides verneinte sie. Und es trieb sie, die neue Lüge wahrscheinlicher zu machen. »Ganz allein hab’ ich immer gespielt als Kind,« erzählte sie. »Meine Eltern ließen mich gar nicht mit andern Kindern spielen. Immer vom Fenster aus hab’ ich zugesehn, wenn die andern so vergnügt waren, – wie eben Kinder vergnügt sind. Und ich durfte nicht mittun. Es ist merkwürdig, – gerade jetzt träum’ ich so oft von der Kinderzeit, – aber ganz genau, wie es damals war. Ich seh’ meine Mutter noch mit ihrem schwarzen, dicken Haar und dem Scheitel in der Mitte. Meine Mutter hatte nämlich herrliches Haar, ganz blauschwarz. Wie oft hat sie mich für nichts und wieder nichts geprügelt. Sie war jähzornig, gerade wie ich. Und denken Sie, davon träum’ ich oft so deutlich, gerade von den Prügeln.«
»Träumen Sie denn nicht auch von schönen Dingen? Vom Heiraten zum Beispiel –? Nein? Und Sie denken auch nicht daran?«
»Jetzt nimmer, früher. Früher, als ich noch dreizehn Jahre alt war oder vierzehn, da dacht’ ich mir immer: Wie schön wird es sein, wenn ich einmal zwanzig alt bin. Da könnte ich dann heiraten. O, es wäre fein.«
Sie lachten.
»Haben Sie denn auch ein Ideal gehabt?« fragte Falk. »Das gehört doch dazu. Ein Dichter oder ein Raubritter, wie?«
Mely ging auf den Scherz ein. »Ach nein,« sagte sie melancholisch. »Ich hätte am liebsten einen Katecheten mögen.«
»O, wie komisch! Das ist wenigstens originell! Haben Sie immer so aparte Wünsche?« –
Es war spät geworden, und Mely erhob sich, um zu gehen. Sie drückte Falk und Helene die Hand, und zündete dann ihre Kerze an, die auf der Kommode stand, und die sie allabendlich dorthin stellte.
In ihrem Zimmer angelangt, war das erste, was sie tat, dies: sie nahm den Revolver, der auf dem Tisch lag, und versteckte ihn sorgfältig in ihrem Wäscheschrank. Dann setzte sie sich auf den Rand des Bettes, stützte die Arme rückwärts auf die Kissen und sah mit halbgeschlossenen Augen ins Licht. »Haben Sie große Schmerzen – ich kann sie lindern,« sagte sie leise vor sich hin und klemmte die Unterlippe zwischen die Zähne. Jedes Wort, das an diesem Abend gefallen war, hätte sie wiederholen können. Warum bin ich denn nur so heiter? dachte sie. Warum ist mir so leicht? – –
Halb vier Uhr schlug es auf den Türmen, da lag sie noch mit offnen Augen und blickte in die Finsternis. Alle ihre Romane hatte sie schon durchlebt, den Millionenpalast und die Sklavenschar, und die abenteuerlichen Ritte, wobei sie vom Pferde fiel und von einem stolzen Grafen und seiner Mutter gepflegt wurde. Sie konnte keinen Schlaf finden. »Ich möchte einmal so recht von Herzen glücklich sein,« flüsterte sie in ihr Kissen, und sie drückte einen Kuß auf das weiße Linnen. Das war das letzte, woran sie sich am andern Tag noch erinnern konnte.
VII.
Inhaltsverzeichnis
Aus dem Tagebuch Vidl Falks.
10. November.
Weshalb ich eigentlich ein Tagebuch führe, darüber habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Liest man später die Konterfeis von Stimmungen und Hoffnungen, diese scheinbar so zwanglosen, mit müder Eleganz hingeworfenen Aperçus, so liegt darin etwas so Lächerliches, wenigstens für mich. Eitelkeit, Eitelkeit spöttelt jede Zeile, eitle Selbstbespiegelung. Aber ich bin ja ein nutzloser Mensch. Alle sagen es, die mich kennen. So muß es doch wahr sein. Ich möchte doch wissen, welchen Eindruck ich auf andere mache, ob ich ihnen komisch erscheine, oder unbedeutend, oder dämonisch. Wer weiß, vielleicht gerade dämonisch. Das ist ein hübsches Wort. Man empfindet ordentlich Sehnsucht, es zu sein. Aber wie, wie wird man dämonisch, wie macht man das? – Ich muß doch eigentlich ein ganz hübscher Mensch sein. Der Spiegel beweist ja nichts, aber mein Schnurrbart gleicht vielen Schnurrbärten, welche für hübsch gelten. Meine Augen sind sehr geschmackvoll; ich bin zufrieden mit ihnen.
Ein Schwärmer bin ich schon. Ich habe zu nichts Lust, als zum Nichtstun. Und wie anstrengend ist das bisweilen. Oft kommt mir der Gedanke, warum bin ich so allein? Es ist ja kindlich, darüber zu klagen, aber andere haben ein Vaterhaus, elterliche Sorge umgibt sie, sie wissen, daß jemand da ist, der sich um sie kümmert. Nichts dergleichen ward mir. Ich würde ja ganz gern allein bleiben, aber alles fängt an, mir so nüchtern zu werden. Ich habe häufig das Bedürfnis zu schlafen, tagelang, wochenlang, und ich begreife kaum, warum ich so eifrig mit aller Kraft dem Studium zugedrängt habe. Das Studium ist leer, und es ist die Wissenschaft von der Unwissenheit, besonders was die Medizin anbelangt. Auch beirrt mich das Fachmäßige, Doktrinäre, das Buchstabenrecht in der Wissenschaft. Ich möchte etwas, das mich aufregt, das mich zittern macht, das mich in Bangnis versetzt, kurz etwas, das ich nicht weiß und das ich nicht definieren kann.
15. November.
Ich lese die letzte Eintragung und sage mir, daß dies für einen dreiundzwanzigjährigen Menschen sehr naiv ist. Zum wenigsten ist es ein Zeichen großer Schwachheit.
Wenn nur dieses Wirtshausleben nicht wäre! Das zerstört alles Gesunde und alle Befriedigung über die Arbeit. Aber den ganzen langen Tag und den langen Abend dazu allein im stillen Zimmer und die Gedanken und der Kopfschmerz und das ewige Regengeplätscher und die Aussicht, daß es jahre-, jahre-, jahrelang so bleiben soll, das ist auch zerstörend. Freilich, ich bin jung und wir Jungen sollten darauf bedacht sein, weniger zu lamentieren und mehr zu arbeiten. Statt Freude darüber zu empfinden, daß wir allein sind, vergießen wir Tränen. Wie absurd und sündhaft, daß ich bisweilen wünsche, krank zu sein, nur damit Jemand um mich sei, der sich bemüht um mich, dem man mehr ist, als eine Figur, um: ›Ergebener Diener!‹ oder: ›Wünschen zu speisen?‹ zu sagen. Wenn ich einmal reich sein werde – Traum der Träume – will ich mir ein Schloß im Schwarzwald bauen und mit einem Freund oder einer Freundin dort leben. Aber kann es Jemand geben, der sich mit mir befreundet? Ich muß zu dumm sein, zu unbedeutend, zu häßlich – oder bin ich am Ende das verborgene Veilchen? Der Gedanke ist so poetisch.
17. November.