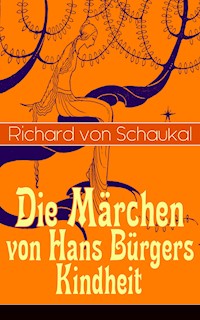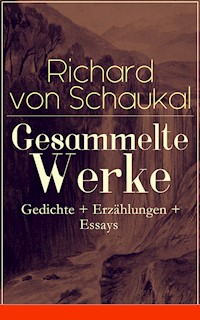Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Gesammelten Werke von Richard von Schaukal bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben und die Gedanken dieses bedeutenden Autors. Mit über 120 Titeln in einem Band ist dieses Buch eine umfassende Sammlung von Schaukals literarischem Schaffen. Von Lyrik bis zu Prosa, von Romantik bis zu Realismus, spiegeln seine Werke die Vielseitigkeit seines Schreibstils wider. Schaukal wird oft als einer der bedeutendsten Dichter des Wiener Fin de Siècle angesehen und seine Werke zeichnen sich durch ihre tiefe Melancholie, Sinnlichkeit und Intensität aus. Richard von Schaukal war ein österreichischer Schriftsteller, der eng mit anderen bekannten Autoren wie Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal verbunden war. Seine persönlichen Erfahrungen und sein feines Gespür für Emotionen prägen seine Werke und machen sie zu zeitlosen Meisterwerken der deutschsprachigen Literatur. Schaukals Gesammelte Werke sind ein wichtiges Dokument der österreichischen Literatur- und Kulturgeschichte und bieten einen einzigartigen Einblick in die Vielfalt der Wiener Moderne. Den Lesern, die an der österreichischen Literatur des Fin de Siècle interessiert sind, wird die Lektüre der Gesammelten Werke von Richard von Schaukal wärmstens empfohlen. Diese umfassende Sammlung bietet nicht nur einen Einblick in das Leben und Werk dieses bedeutenden Autors, sondern auch eine Reise durch eine der faszinierendsten Epochen der deutschsprachigen Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1348
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Werke
(Über 120 Titel in einem Buch)
Books
Inhaltsverzeichnis
Erzählungen:
Eros Thanatos
Eros
Wieder, wie jährlich, hatte der alte Gärtner zur Feier des Namenstages der verehrten Herrin schon in früher Morgenstunde ein stattliches Blumengewinde auf der Terrasse vorbereitet, diesmal ein buntes Tableau, nicht ohne Geschmack an einer ganz mit weißen Blüten umkleideten Staffelei befestigt. Alsbald auch huschte neugierig die Jungfer herbei, den festlich gedeckten Frühstückstisch zu prüfen. Der Kammerdiener konnte sich's nicht versagen, ihr, wie sie sich so über das zierliche Arrangement der Tassen und Teller beugte, von hinten, nicht eben allzu sanft, an die enggemiederte Taille zu greifen, daß sie vor Kitzel kichernd zurück- und ihm fast in die rasch auseinandergebreiteten Arme fuhr. Die schöne Gräfin hatte das fürwitzige Spiel bemerken müssen. Jetzt trat sie, um eine stürmischere Entwicklung der Szene zwischen dem Gesinde zu verhindern, vernehmlich rauschend durch die verglaste Flügeltüre hervor. Sie schien es nicht zu achten, daß sich der peinlich überraschte Diener mit einem unter tiefem Bückling stotternd vorgebrachten Glückwunsch aus der Sache zu ziehen unternahm, so gut oder so schlecht es ihm der leidige Moment eingegeben hatte. Auch daß die Zofe mit unwilliger Pantomime dem Verdachte des Einverständnisses zu wehren versuchte, geruhte die Herrin nicht zu bemerken. Der Bediente entfernte sich betreten, indem er die beiden Lakaien an den Tisch wies.
Eben erschien auch von der Gartenseite her der Graf. Er kam hastig über die Treppe. Die Anwesenheit des Gebieters hemmte den Schritt des Kammerdieners im geräumigen Saale. Er blieb, halb noch zum Gehen gewendet, mehr über die Achsel zurück als geradeaus schauend, einen Augenblick unschlüssig stehen, sein Verschwinden verzögernd, nicht ohne der Zofe, die ihm schmollend gefolgt war, eine Grimasse zu schneiden.
Der Graf küßte seiner Gemahlin die lässig ihm entgegengehobene Rechte und rückte sich mit einigem Geräusch an ihre Seite. Der Gräfin entging seine Befangenheit nicht. Doch im Nu auch hatte sich der Gewandte wieder gefunden; mit zärtlichem Lächeln sprach er von dem heutigen Fest, das der Morgen, der Park mit ihnen zu feiern schienen, indem sie, der Gattin zugunsten, in rauschender Schönheit durch heitere Anmut die freudigen Stunden verherrlichten. Auch ermangelte er nicht, aufmunternd ihr ein Geschenk auf dem damasten glänzenden Tischtuch näherzuschieben, eine kostbare Vase von erheblichem Gewicht. Sie zeigte auf blauem Grund in flacherhabener Biskuitbildung eine mythologische Begebenheit: Daphne, wie sie, von Apollo verfolgt, schon unter seinen begehrenden Händen sich in den rettenden Lorbeerbaum verwandelt.
Nachdenklich blieb der schimmernde Blick der Gräfin an den zarten weißen Figürchen haften: dämmernd tauchte das merkwürdige Geschick der Nymphe vor dem träumenden Geiste der blauäugigen Frau herauf. Die Worte des redseligen Gemahls klangen an ihrem Ohr vorbei ...
Sehr zupaß geriet diesem der Gratulationsbesuch des Kapitäns, der, seine Annäherung durch ein vernehmliches Schnauben, wie es Kurzatmigen eigen ist, verkündend, die zur Linken des leichten Tisches gelegene Treppe soeben heraufstieg. Der mächtige Blumenstrauß, den er mit strahlendem Antlitz der von ihm schon ob ihres Standes nach Gebühr Verehrten überreichte, die schickliche Ansprache, die er mit schön gedämpfter Herzlichkeit – dies war sein Hauptstück – vor ihren sanft errötenden Wangen hielt, gaben dem Grafen die Überlegenheit und damit die gute Laune wieder. Ein mit der vollen Hand dem breiten Rücken des Gratulanten aufgezielter kräftiger Schlag, den der Geschmeichelte in ehrfürchtiger Freundschaftlichkeit – auch ein von ihm gern betontes Element gelassenen Umgangs – schmunzelnd entgegennahm, leitete ein scherzhaftes Gespräch ein, das bald zu reichlich zwei Dritteilen der frohe Gast mit aufgestutztem Übermut bestritt. Der Kapitän war kein Jüngling mehr, und seine besten Jahre verdarb ihm, der sich, ein weicher Adorant, durch schwärmende Melancholie in manchem Zirkel manches Herz, freilich nicht auf lange Dauer, zu gewinnen verstanden hatte, ein übermäßig gewölbter Bauch. Fettleibigkeit ist ein bequemer Anlaß zu wohlfeilem Spott, der, so harmlos er vorgebracht scheint, der verwundenden Schneide nicht entbehrt, ja, grausamer verletzen mag als etwa ein derberer, nicht an so unwillig ertragene Mängel geknüpfter Scherz. Der Kapitän war eine unverwüstliche Zielscheibe. Er bot sich sogar wie ein zur Entwürdigung geborener Sklave Freunden, die Edelleute von einigem Ansehen vorstellten, aufmunternd selbst dar. Diesmal erbat er sich von der Hausfrau die gnädige Erlaubnis, einen jungen Kameraden, den Fähnrich von Turneck, präsentieren zu dürfen – der Kapitän präsentierte nur Adelige von geprüfter Abstammung –, erhielt sie und die schmeichelhafte Gewähr überdies, den neuen Ankömmling gleich zum Mittagstisch mitzubringen. Er ging, und Graf Paris versäumte die Gelegenheit nicht, ihn zu begleiten und sich so einer Unterredung zu entziehen, die, wenn sie sicherlich auch nicht auf das Wesentliche gesteuert hätte, doch durch den Mangel an Unbefangenheit ihm unbequem zu werden drohte.
Auf dem unter ihren behaglichen Tritten knirschenden Kies des Vorgartens angelangt, schlang er leicht seinen behenden Arm in den massiveren des Freundes und ließ sich mit höflicher Aufmerksamkeit von ihm die Anstalten verraten, die zur Erhöhung der Festfreude für den Abend geplant wären. Man wollte, erfuhr er, die Gräfin durch eine musikalische Darbietung ergötzen, die im Park am Flusse nach Einbruch der Dunkelheit bei dem flackernden Scheine weniger Fackeln nur gleichsam aus dem Stegreif sich auftun sollte. Die Grundzüge der im übrigen der Laune, der Einbildungskraft und Geistesgegenwart ungezwungener Akteurs zu überlassenden Szene seien von Gurnemann entworfen.
»Natürlich«, bemerkte lächelnd der Graf. Der Kapitän fiel sofort ein: »Und er spielt und singt auch den Prolog.«
Gurnemann, ein junger Diplomat, der fürstlich H...schen Mission am Hofe zu K. zugeteilt, war dem Älteren, wenn nicht verhaßt, doch lästig, da er, nicht ohne offenbaren Erfolg und mit noch größerer Bewußtheit dieses Erfolges, bei der Gräfin, obwohl selbst verheiratet, kokett die Rolle des begünstigten Amoroso mimte. Niemand in dem kleinen Kreise hatte seine Ausnahmestellung unbemerkt bleiben können. Verstand es doch der auf körperliche Vorzüge eitle, vorlaute Gurnemann, seine neidenswerte Beziehung jederzeit in wenig angenehme Erinnerung zu bringen, teils indem er, einigermaßen plump, Ansprüche des nah Vertrauten geltend machte, teils durch eine Art von Hüteramt, das er sich über den engeren Verkehr des gräflichen Hauses angemaßt hatte.
In der Seele des Grafen erhob sich mit immer lebhafteren Farben das Bild des frühen Morgens. An der Seite des erregt auf ihn los sprechenden Freundes schreitend, befand er sich in Gedanken bei der samtäugigen Dame, die ihn heut endlich erhört hatte. Er sah sie im dämmrigen Alkoven – das Licht des von jubelnden Vögeln angekündigten Tages drang durch die im kühlen Luftzug schwankenden Leinwandvorhänge der Fenster herein –, ihr aufgelöstes tiefschwarzes Haar, das dünne Seidenhemd, halb herabgeglitten von den matten runden Schultern, den nackten Fuß, wie er in dem rosa Pantöffelchen zierlich wie in einem Blütenkelch verschwand. Sein Herz zog sich zusammen im Nachgefühl der beseligenden Stunde, die er, über den Balkon, ein schon Erwarteter, eingestiegen, im Rausch der lange verhaltenen Begierde genossen hatte. Fast wandelte ihn die frevle Lust an, den Begleiter, den er sich treu ergeben wußte, in das köstliche Geheimnis einzuweihen, Frau Jolanthe Gurnemann, die spröde, habe ihn, Paris, liebend in ihre Arme geschlossen, unter dem melancholischen Sebastian des Da Vinci, den auch der Kapitän einmal im hellgemusterten Schlafgemach hatte bewundern dürfen, da die Kunst alle Räume weiht und Gönnern eröffnet. Nicht verhehlen freilich konnte sich der Graf, daß ihm, dem sattsam Verwöhnten, diesmal zu gutem Teile Eitelkeit zum Erfolge verholfen hatte. Er mochte, ohne tiefere Leidenschaft, wie er sich fand, das Weib bemitleiden, das, nachdem es seinen wunderbaren Körper ihm nicht verweigert hatte, ein Leben lang mit unausbleiblichen Selbstvorwürfen der Erinnerung an eine kaum bedankte Übereilung nachzuhangen verurteilt schien. Denn die reizende, reiche und auch geistig begabte Frau hatte, ohne den Taumel gebäumter Sinne, wenn nicht zur Rechtfertigung, doch zur Erklärung des entscheidenden Schrittes in Anschlag bringen zu dürfen, eigentlich nur einer Laune, einer kecken und also um so sicherer später sie zu peinigen geeigneten Laune, sich mit trotzig geschlossenen Lidern überlassen, die den Empfänger beschenkte, ohne ihn zu bereichern. Was bedeutete die charmante Episode in seinem, welche Epoche mußte das Abenteuer in ihrem Leben vorstellen!
Da Paris den Kapitän offenbar noch eine Strecke Weges begleitet hatte, begab sich die Gräfin, gefolgt von ihren Hunden, in den Park hinauf. An einer schattigen Stelle waren einige Stühle um einen zierlichen Tisch zu einer kleinen Gruppe versammelt. Sie ließ sich da mit einem in Seide gebundenen Buch nieder. Doch ihre Gedanken verweilten nicht auf den Zeilen ...
Dort überraschte die lang Hingestreckte die Baronin Lisa, ihre Gutsnachbarin, gleichfalls eine hohe Gestalt, doch nicht von der kräftigen Fülle der Gräfin, vielmehr überaus zart und bei ihrer ungewöhnlichen Größe fast zu schlank, strohblond und aus grauen verschatteten Augen unfroh vor sich hinblickend.
Sie setzte sich neben die Freundin und spielte vertraut mit den Hunden. Von Lisa wußte die Gräfin, daß ihr Paris nicht gleichgültig war. Sie hätte mehr, hätte wissen müssen, daß bis vor kurzem noch weit draußen im Land ein überaus verliebtes Pärchen bei sicheren Herbergsleuten nachmittäglich sich zusammenzufinden pflegte ...
Nicht nur zu gratulieren, war die Baronin gekommen. Der regen Eifersucht der vernachlässigten Geliebten hatte nicht verborgen bleiben können, was der stumpferen Gattin entgangen war. Und was jene peinigte, daran sollte diese nicht ungekränkt vorüberwandeln dürfen. Haß gegen die Ruhe der schöneren Partnerin an dem Ungetreuen – Lisa empfand seine Untreue als ein Verbrechen, und nur an ihr selbst begangen – stieg, je schwieriger sich die heikle Aufgabe gestaltete, in der Illegitimen auf, die nicht einmal das Recht besitzen sollte, sich in der empörendsten Weise für verraten zu halten, sich offen zu beklagen. Mit der heitersten Unbefangenheit fing sie an. Ob Gurnemanns kämen? Natürlich doch? Wann wären die Überlästigen nicht zu finden, zu empfinden gewesen! Der Gräfin war hier zugleich – es galt ein größeres – eine scharfe Sonde ins Herz gesenkt. Sie konnte nicht verteidigen, wo sie, was Max Gurnemann, den Amoroso, betraf, Argwohn gegen sich selbst vermuten mußte. Sie befand sich einen Augenblick unschlüssig über die Farbe der zu erteilenden Antwort. Doch die unleidliche Frau mochte tragen, was sie deren Gatten aufzubürden in leiser Dankbarkeit für seine zärtliche Dienstwilligkeit sich verwehrte. Und so fanden die Damen einander darin einig, daß Frau Jolanthe Gurnemann ein widerliches Geschöpf sei, kokett ohne das natürliche Maß der Schicklichkeit, zudringlich ohne Berechtigung, anspruchsvoll ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer. Es war eben nicht zu verkennen, daß ihr, der Tochter des geadelten Pächters, im letzten Grunde der Takt mangle, den an der Unerbetenen entbehren und mit solcher Entbehrung aus Höflichkeit sich abfinden zu müssen man keine zwingenden Gründe gelten lassen wollte. Ja, daß sie – rasch entschlossen spielte Lisa ihren Trumpf aus – unverschämt nach den Männern angle, sei der Gipfel ihrer Anmaßung. Wie unangenehm der teuersten Freundin ihre Bemühungen um Graf Paris sein müßten! ... Die Baronin harrte der Wirkung ihrer mit dem Tone des herzlichsten Bedauerns, wobei sie die Hände der vor ihr Ruhenden teilnehmend ergriff, ausgesprochenen Worte. Die grauen verschatteten Augen hätten verraten, was ihre Worte zu verbergen nach einem langjährigen Hofleben nur zu geschickt waren, wenn nicht die Gräfin, im bitteren Vorgefühl, wie nun einmal der Tag auf das ärgerlichste zu verlaufen bestimmt sei, nach dem Auskunftsmittel geforscht, der boshaft Teilnehmenden die ganze Last überzuwälzen, und dabei instinktiv ihre eigenen Blicke gleichsam nach innen hätte sinken lassen. Konnte sie auch der Nebenbuhlerin aus Stolz nicht zugeben, daß sie eine wäre, sie fand ein Wort, das die zu ihrer Plage allzu Kinderreiche kränken mußte: »Mein Mann beschäftigt mich«, sagte sie spitz, »nicht so uneingeschränkt wie der deine dich, meine Liebste.« Der Baronin schoß das Blut in das magere Gesicht. Ihre ganze Haltung ließ sie fallen und rief: »Und der deine betrügt dich uneingeschränkt, mein Schatz!« Die Gräfin hatte sich in dem geräumigen Armstuhl halb erhoben. Die Stirne vorgesenkt, die blauen Augen sprühend, rief sie: »Willst du dich etwa selbst damit brüsten, weil niemand anders ihm seine Geschmacklosigkeit neidet?« Den persönlichen Schimpf mit ihrer schneidendsten Waffe parierend, fuhr die Beleidigte auf: »Wohl magst du's Geschmacklosigkeit heißen, die Gurnemann mit den kärglichen Überresten eines Feuers zu beglücken, das in der Ehe trübe genug brennt!«
Unglückseligerweise erschien in diesem Augenblick, da die beiden Frauen wie Fechter im Ausfall einander gegenüber hielten, Graf Paris. Das gewohnte lose Scherzwort erstarb ihm auf den Lippen, als er mit dem geübten Blick des stets auf der Hut Schleichenden die Situation übersah. Die Baronin, hochgerötet, stand gehfertig. Er ergriff ihre Hand – jetzt galt es, mehr als die Stimmung einer Stunde: galt, die Bequemlichkeit vielleicht einiger Wochen zu retten, das fühlte er –, küßte sie galant und zwang sie sanft=gebieterisch an seine Seite. »Geheimnisse, Liebling?« rief er der Gattin zu, die sich langsam in den einer Ruhebank ähnlichen Sessel zurücksinken ließ, und zog die Baronin mit sich fort. Außer Hörweite von seiner Frau gelangt, begann er, die Baronin heftig mit dem Arm an sich pressend: »Was gibt's, was hast du, Lisa? Eine Eifersuchtsszene mit Elviren?« »Abscheulicher!« – noch zitterte die Erregung in der gegen ihren Willen von der vernichteten Gegnerin also hastig Hinweggezerrten – »Ich verbiete Ihnen, mich so zu nennen!« »Warum, meine Göttin?« Er war stehengeblieben. Seine klugen kleinen Augen drückten maßloses Erstaunen aus. »Was hab' ich verbrochen – außer an ihr, die du, Böse, jetzt eben so schonungslos, scheint's, mißhandelt hast?« »Was Sie verbrochen haben, Graf Paris? Sie wagen es, mich zu fragen?« »Ich wage es«, rief der Graf, der längst bei sich festgestellt hatte, daß Lisa der frühmorgendliche Besuch bei Jolanthen verborgen geblieben sein mußte. »Ich wage es.« »Ich aber habe keine Lust, in den Schlamm zu treten, du – Sie Wüstling!« sprudelte die Wütende. Lächelnd versuchte er, sie zu fassen. Sie sprang vor der Berührung wie rasend zurück. Er drängte nach. Sie stand an einem Boskett, in das der Weg abzweigend mündete. Sie hineinzwingen, ihr an den Hals fallen, ihr Mund, Stirn, Wangen, Hals und Augen mit heftigen, stürmenden Küssen bedecken, war die jähe Tat eines sieghaften Willens.
An ihrer Brust flüsterte er: »Innigstgeliebte, banne deine schöne Eifersucht! Du weißt doch, daß ich einzig dir gehöre!« Es gelang ihm, sie unter fortwährenden Liebkosungen zu beschwichtigen. Arm in Arm verließen sie das Boskett, Lisa mit sich selbst nicht im reinen, verlegen, willenlos. Er bat sie inständig, mit Gabriel, ihrem Gatten, zur Mittagstafel unbedingt zu erscheinen. Er werde bis dahin alles bei Elviren in Ordnung gebracht, eine förmliche Versöhnung vorbereitet haben. Er half ihr in die Sänfte, er drängte sich mit halbem Oberkörper ihr nach und ließ eine Weile seine schmeichelnde Hand auf ihrem Knie aufruhen. »Leb wohl, meine geliebte Lisa«, flüsterte er. Und nachwinkend noch: »Auf Wiedersehen!«
Dem langsam Zurückwandelnden ward einigermaßen bange bei dem Gedanken, nun vor der Gattin erscheinen zu müssen. Er verzögerte seinen Schritt noch mehr. Aber der in allen Ränken und Abenteuern Erfahrene fand bald den Weg zum Erfolg. An der Windung, die zu ihrem Sitz geleitete, begann er zu laufen. Atemlos scheinbar stand der Geschmeidig=Hochgewachsene vor Elviren. Er kniete nieder. Er stützte seine langen gebräunten Hände auf ihre Schenkel, die sie unwillkürlich wegschob. »Elvire, meine Liebste, was hast du?« rief er. »Du siehst einen unglücklichen Gatten im Staub vor deiner Majestät!« Das theatralische Pathos wagte er mit seinem harmlosen Lächeln, mit einer übertriebenen Geste der Verzweiflung zu begleiten.
»Ihr habt gestritten? Sie scheint erbittert, nur mit Mühe ist es mir gelungen, sie zu bewegen, daß sie wiederkehre. Ich habe versprochen, Versöhnung zwischen euch zu stiften. Hilf dem Unseligen, der nicht ahnt, was die Unzertrennlichen hat entzweien können!«
Der Gräfin war reichlich Zeit geblieben, zu bedenken, womit die Leidenschaft Lisas sie überschüttet hatte. Unzählige Male hatte sie sich wiederholt, daß diese nicht so hätte handeln können, wenn sie nicht Gewißheit besäße, und hundertmal hatte sie selbst dem widersprochen. Nun lag ihr Mann vor ihr, den sie scheute, vor dessen überlegener Klugheit, dessen Spott der Enggeistigen immer bangte. Sie war in ihren Entschließungen noch nicht fertig, schwankte zwischen Stolz, Ingrimm und Zweifel. Er nützte den Moment. »Die arme Lisa hat dir gewiß, nicht wahr, eine Eifersuchtsszene gemacht? Die gute Seele! Sie liebt mich eben heiß –.« Er lächelte boshaft. »Du siehst, wie behutsam ich ihre Hoffnungslosigkeit karessiere. Denk doch, Liebste, Süße, wie traurig es der Verblühten ums Herz sein mag. So oft sie dich sieht, meine strahlende Aphrodite, wird ihr karger Leib von Neid geschüttelt. Gönn ihr die Wonne eines kleinen Wutanfalls. Bedenke, die Frau hat sieben Kinder an ihrem dürftigen Busen genährt.« Dieses Argument verfehlte seine Wirkung. »Und ich keines!« Keuchend hatte sie es herausgestoßen. Dunkle Röte überzog ihr Antlitz. Die blauen Augen schimmerten. Aus seiner Ungeschicklichkeit gestaltete der Graf die zärtliche Schlinge, mit der er nun die in Tränen – Bitterkeits- und Nerventränen – Gelöste, eine Taumelnde, einfing. Einen Arm um den schluchzenden Leib gelegt, auf sie einsprechend zärtlich-gedämpft wie auf ein Kind, führte der Gewandte die Rat- und Willenlose. Die kaum getrockneten Zähren mit vorgeneigtem Haupt, so gut es anging, bergend, schritt sie nun rasch an der stummerstaunt aufblickenden Jungfer vorbei in das innerste ihrer Gemächer. Doch sich der Abspannung hinzugeben, ließ ihr der kundige Gatte nicht Zeit, wohl wissend, daß es jetzt auf rasche Übergänge ankäme, jähen Szenenwechsel. Er schickte die Zofe sofort hinter ihr drein, selbst noch in der Türe mit sorglos heiterer Stimme mahnend, sich bei der Toilette nicht zu versäumen.
* * *
Die Tafel war im Freien hinter dem Schloß gedeckt. Der Platz der Gräfin glich einer Blumenlaube. Man hatte eine dreiteilige chinesische Tapetenwand mit Gewinden bekränzt. Die zuhöchst angesteckten, lauter rote Rosen sammelten sich wie ein Dach über dem Sitze. Der Kammerdiener war, nach einem letzten beherrschenden Blick über die Tafel hin, zu melden gegangen, daß man bedient sei. Die Gesellschaft befand sich, in Gruppen aufgelöst, in dem höher gelegenen Teil des alten Parkes. Die Herren boten den Damen die Hand und geleiteten sie die sanft absteigenden Wandelwege hinab, an getürmten Felsgruppen vorbei. Vor einem auf der Muschel blasenden pausbäckigen Götterknaben blieb Frau Gurnemann stehen, das schlohweiße Musselinkleid über dem weißen Seidenstrumpf zierlich mit der Linken gerafft: »Er bläst heute den Triumph Ihrer Ehe, Gräfin Elvire.« Sie wandte das kecke Profil über die Achsel weg nach der Angesprochenen, die der Baron führte. Der Graf, mit der Baronin voran, hielt. Die Baronin sagte laut: »Man hört ihn nicht.« Niemand konnte die heftige Röte entgehen, die die Wangen der Gräfin heiß bis in die Schläfen hinauf überflog. Sie zwang sich zu einem Lächeln. Die große schöne Frau fand kein Wort der Entgegnung. Der Baron winkte seiner Gattin verlegen= mißbilligend zu. Der Graf blickte Jolanthen an. Sie hielt den Blick aus ...
Die rote Reihe der Lakaien faßte die Sessellehnen und neigte die gepuderten Locken.
Der Fähnrich von Turneck wandte bei Tische kein Auge von der Gräfin. Er schob sogar die weitgebauschte Vase, die ihm den vollen Ausblick auf sie hemmte, etwas zur Seite. Doch errötete er, da er sich sofort seiner Ungeschicklichkeit bewußt geworden war ... Der Kapitän hatte es sich nicht nehmen lassen, ihn der Hausfrau selbst aufzuführen. Es war ein zarter Junge. In seinem regelmäßigen frischen Gesicht glänzten die Augen wie dunkle Früchte. Er hatte die kleinsten Füße, die wohl je ein Fähnrich besessen haben mochte. Kaum um eine Spanne waren sie länger als die der stattlichen Gräfin. Als sie ihm die Hand reichte – der Aufruhr der bekämpften Bewegung stand ihr wie eine Flamme unter den Wimpern –, zitterte diese einen Augenblick. Der Fähnrich nahm es als ein gutes Omen. Er küßte die schmale Hand inniger, als es die Gräfin sonst gestattet haben würde. Jetzt saß er in lodernder Glut und trieb, da er des Weines nicht schonte, die Lohe nur immer höher und höher empor. Er liebte begehrend, mit dem wilden Willen rascher Jugend.
Gurnemann seinerseits ward zusehends verstimmter. Er, der gewohnt war, in gelassener Muße selbstgefällig der Gräfin zu huldigen, der in Duetten ihr als Sänger, dann wiederum, das Buch in der Hand, aus dem er Hymnen und Oden vorlas, als ein Gestalter, ein Dichter fast sich ihr genähert hatte – so erschuf er den Augenblick –, fand sich heute wie von einem Feind bedrängt. Unruhig wandelte sein Blick die Tischgenossen entlang. Seine gepflegte Hand zerknüllte das weiße Gebäck. Sein Fuß, ermutigt durch den Kampf um das Vorrecht, wagte sich an den Seidenpantoffel der Nachbarin. Hastig, empört, gewarnt vor diesem Gatten des verdächtigsten Weibes, zog die Gräfin das schlanke Bein zurück. Gurnemann erbleichte. Er fühlte einen Sieger über sich ... Da trank mit ehrerbietiger Neigung, doch die verhaltene Leidenschaft im Blick und um die sanft gebräunte Lippe, der Fähnrich der Hausfrau zu. Sie dankte, indem sie an ihrem Glase nippend hinüberschaute. Gurnemann schien es ein Einverständnis. Er rückte den Stuhl ab ... Der Kapitän bestritt aufgeräumt das Tischgespräch. Er höhnte über die täppischen Sitten mancher dem Kreise nicht unbekannt gebliebener Landstädter. Nie war er herber, als wenn er verurteilte, was er selbst an sich einst zu überwinden gehabt hatte. Graf Paris leitete den Kaskadenbach persönlichen Spottes in das behagliche Bett allgemeinerer Verhältnisse. Da kam an den Fähnrich auch die Gelegenheit, sich lauter vernehmen zu lassen. Er sprach hinauf zur Stirnseite, befeuerte seinen Witz an beifälligen Blicken. Die Gräfin ließ auf dieser Insel lauterer Kraft die Seele ausruhen. Ihr ekelte heute vor dem Kapitän, Gurnemann haßte sie geradezu. Der Unglückselige unternahm es gar, in vertraulichem Flüsterton sie gewissermaßen an Beziehungen zu mahnen, die sie eben jetzt durchaus nicht gelten zu lassen gelaunt war. Mit erhöhter Stimme, kalt, ja schneidend, mit einem verachtenden Blick strafte sie ihn, lieferte den Flüsterer der allgemeinen Aufmerksamkeit in peinlicher Weise aus. Frau Gurnemann nahm es mit Genugtuung auf. Sie ahnte dieses schöne Bild ichsüchtigen Friedens verschattet, vielleicht zerstört. Ihrem eitlen Mann gönnte sie jede Demütigung, um so mehr, als sie ihm gegenüber, den sie nicht gern ertrug, sich schuldig zu fühlen tief begründeten Anlaß, aber nicht die geringste Lust empfand. Die Baronin zürnte Paris noch immer, daß sie sich hatte zu einer Versöhnung willig finden lassen, so kalt gemessen diese auch vor sich gegangen war. Der junge Vikar am unteren Ende der langen Tafel – es saßen noch unterschiedliche Gäste daran – beobachtete stumm die Runde. Kaum daß er hie und da auf offenbar mitleidige Fragen seiner Nachbarin, einer hochgewachsenen Base des Hausherrn, antwortete, die ihn durch ihre dunkeläugige, sicher=kalte Gegenwart verwirrte. Komtesse Fanni hatte allen Grund, sich über ihren zweiten Nachbar, den knabenhaften Fähnrich, zu beklagen, der, unruhig nach oben hin gewendet, ihrer kaum achtete. Den Kapitän aber, der sich ihr oft vertraut lächelnd zuneigte, mochte sie längst nicht leiden. Sie ahmte sonst gerne nach, wie er hochtönende Namen mit Behagen aussprach, als genösse er saftige Speise.
Im nachmittagskühleren Gange zwischen beschnittenen grünen Wänden längs dem weitgestreckten Becken der Neptunfontäne war es Gurnemann gelungen, Seite an Seite mit der Gräfin, sie ihren Schritt etwas verzögern zu machen. Aber als er, neuerlich unbesonnen, schüchterne Vorwürfe wagte, enteilte sie ihm und nahm mit Bestimmtheit den Arm des erbebenden Fähnrichs.
Gurnemann stand, kurzhalsig, hochschultrig, einen Augenblick still. Dann machte er scharf auf den Hacken kehrt und schritt trotzig entschlossen hinweg ... Am Flusse ward Anstalt zur Theaterunternehmung getroffen. Er mischte sich anordnend unter die Bediensteten, geriet mit dem Kapitän in leichten Streit, schrie einen Bootsknecht unwirsch an und brach sich an einem Laternenpfahl des Gerüstes den schön gespitzten Nagel des rechten Zeigefingers. Nun war seine Wut völlig.
Am Arm der schweigenden Gräfin war der Fähnrich – er zitterte von der Zehe bis zum Scheitel, der Schweiß drohte aus allen Poren ihm hervorzubrechen –, unwissend, ob er führte oder geführt werde, in den dunkelsten Teil des weitläufigen Parkes gelangt. Seine Gedanken waren, wie eine Tigerkatze alle ihre Sehnen zum Sprunge spannt, auf das einzige Ziel gerichtet: diese wunderschöne Frau zu besitzen oder – so schoß seine Jugend kopfüber durchs Ziel – den Tod zu finden. Die bis an die Grenze des Wahnsinns stürmende Erregung seiner Pulse hatte sich der sonst so ruhigen Frau mitgeteilt. Auch ihr Blut brannte. Sie war sich des Aufruhrs ihrer aus dem Schlaf gescheuchten Sinne nicht bewußt. Unmut gegen den Verräter von Gemahl und die willigen Frauen, seine Mitschuldigen, erfüllte sie. Ihr unklares Denken schloß immer mit dem tragischen Refrain »Rache«. Der Fähnrich schwieg. Als ob er gefühlt hätte, daß ihm, öffnete er nur den Mund, das Herz entschlüpft wäre, hielt er den immer drängender emporsteigenden Feind im Busen krampfhaft nieder. Daß dieser stärker wäre als sein bangender Wille – seine Feigheit, nannte er es knirschend –, wußte er schon. Wollüstig ließ er ihn heranwachsen. Seine Augen verdunkelten sich von innen heraus, als er an einer Wendung des Weges der Gräfin zögernd um die Profillinie herum und vom Ohr hinab in den Nacken sah, hinter dessen weichem Flaum die Sonne, sich langsam senkend, brannte. Befangen wandte die Hohe den schlanken Hals. Da trafen ihre Augen die seinen. Sie hielten einander fest. Noch kämpfte jedes mit Widerständen. Aber siegreich blieben diese fester und fester zusammenwachsenden Blicke ...
Er hielt sie in seinen Knabenarmen und weinte vor schmerzendem Glück. Der Gräfin schlug das Herz bis in den Hals. Sie hatte die Augen geschlossen, ließ eine flammende Dunkelheit wie einen Vorhang niederrauschen über Ereignisse, deren jähen Sturz aufzuhalten sie sich nicht für fähig hielt. Wie eine Ertrinkende verschwand sie in den Wogen einer nie geahnten Leidenschaft ... In ihm aber jubelte eine grelle Fanfare, und unwillkürlich sang er leise mit einer heiseren Stimme, die aus den kochenden Tiefen der Sinne stieg, die stürmenden Takte eines Reiterliedes. Wie er sie ergriffen, wie er diesen unter dem knisternden Atlas gleich dem Edelwild mit den Flanken zitternden Leib sich unterworfen hatte, der sich an ihn drängte, als suche er eins zu werden mit der stählernen Härte seines überschlanken Körpers: er wußte es nicht. Es war Raub, wie Feuer raubt, aufbäumend, lodernd, verzehrend ... Nun saß sie, die als eine Diana seiner Einbildungskraft erschienen war, abweisend in ihrer majestätisch=kühlen, Lächelns ungewohnten, großlinigen Art, aufgelöst, ein sanftes, seliges Kind, auf seinen Knien, das sonst so frei und gebietend getragene Haupt an seiner Brust, die warmen Finger um sein Handgelenk geschmiegt, haltlos, stumm schluchzend in der Seligkeit der unbedingten Hingabe. Das Weib in Gräfin Elvire war erwacht, nackt lag es, mit weichen Gliedern, zärtlich, dankbar, demütig am Herzen des Lebens ... Die Sonne stand tiefer zwischen den leise bewegten Baumkronen. Plätschern erhob sich. Und wie sie nun beide den glückgebrochnen Blick in süßer Müdigkeit an der Urne hinanstreifen ließen, in die aus einem bronzenen Löwenhaupte das reine ruhige Wasser fiel, tauchte langsam die Welt herauf, lautlos, schattenhaft wachsend, und beschloß den unermeßlichen Horizont des Gefühls. Da fuhr die Gräfin mit beiden Händen zum verstörten Haarbau empor ...
Der Graf, in Gesellschaft Jolanthens, fühlte sich einigermaßen unbequem. Ihm war es darum zu tun, die Baronin völlig auszusöhnen. Daran hinderte ihn Frau Gurnemann. Die Eitle war nicht willens, mit einer Alkovenbuhlschaft sich zu bescheiden: sie verlangte Triumph im vollen Sonnenlicht der Sozietät. Der Graf seinerseits war nicht abgeneigt, die leicht Eroberte der Baronin hinzuopfern, dachte er doch die Zugängliche leicht wieder vom Augenblick und seinen Wonnen zu überzeugen. Mehr war ihm an der Baronin Freundschaft zu seinem Haus als an der Amour gelegen, die ihn flüchtig mit der Gurnemann verband. Die Baronin und seine Frau sollten im Leben noch eine gute Strecke zusammengehen. Wohin die Woge die hübsche Jolanthe werfen mochte, war ihm im Innersten gleichgültig. Schon spitzte sich die Situation wieder bedenklich zu. Die Gräfin war verschwunden. Die Baronin mußte sich für doppelt vernachlässigt halten, um so mehr, als sie ein Opfer gebracht hatte, das schwer und schwerer ihr Selbstbewußtsein belastete. Aber auch Frau Gurnemann empfand, daß heute mehr auf dem Spiele stand als körperliche Zuneigungen: ihre Stellung in diesem Kreise. Sie hatte sich – so war es ihr, noch dunkel zwar, doch langsam immer deutlicher gegenwärtig – durch die Hingabe nicht, wie sie vielleicht vorübergehend hatte glauben mögen, den Grafen Paris und sein Haus gesichert, hatte im Gegenteil – ihr kleines braunes Gesicht überzog die wachsende Röte des Unmuts – durch dieses Ausgleiten der sorgfältigst gepflegten Beziehung in ihrem Kern geschadet. Es galt, alles zu retten. So kämpften beide Frauen einen heftigen Kampf gegeneinander, indem sie, jede für sich, die Ereignisse des Tages, mehr instinktiv als verstandesmäßig, überflogen. Der Graf stand mitten darin und empfand die drohende Schwüle der geballten Atmosphäre. Entschlossen verließ er Jolanthen, sich der Baronin anzutragen. Er verschaffte der Verblüfften einen offenbaren Sieg, indem er sie am Arm mit rascheren Schritten weiterführte. Die Niederlage war für Frau Gurnemann vollständig, da sie sich dem Kapitän überlassen fand, indem der Baron es vorzog, mit Gräfin Fanni zu plaudern: er war Frau Jolanthen gegenüber seiner selbst nie ganz sicher. Der Kapitän, verdrießlich, aus den Regionen des Geblütes in das der Geduldeten zu geraten, wie denn gesellschaftliche Streber immer äußerst empfindlich gegen Ballast sind, schritt stumm neben der Gurnemann einher. Ihrem Gatten waren einige der jüngeren Herren an den Fluß gefolgt. Der Rest der Gäste verweilte in den Gewächshäusern. Der Pfarrer hatte sich, unbehaglich, verzogen.
So kam es, daß Gurnemann, als er, die Gesellschaft ans Wasser zu holen, zurückkehrte, niemand im Rondell fand. Verstimmt und unschlüssig ging er umher. Er stieß auf den Fähnrich, den die Gräfin, plötzlich gewarnt, gebeten hatte, sich möglichst unbefangen zu den übrigen zu gesellen.
Sie selbst war auf einem Umweg in das Schloß gelangt und saß nun erschöpft vor dem Spiegel des Trumeaus. Die Fenster standen offen. Das Abendrot brannte über den Gipfeln der Platanen. Ein leichter Lufthauch strich herein. Sie schloß träumend die Augen. Ein paar verwelkte Blumen glitten aus dem Gürtel unterm Busen ...
Der Fähnrich sprach krampfhaft auf Gurnemann ein. Als dieser nach der Gräfin fragte, erhielt er eine verlegene Antwort. Ein Argwohn, den seine Eitelkeit sich nicht eingestehen mochte, stieg in dem Übelgesinnten auf. Schon kündete Fackelschein vom Flusse her den Beginn der Darstellung. Ein Chor erscholl. Graf Paris sammelte die kleine Gesellschaft. Man fahndete nach der Hausfrau. Niemand wollte sie gesehen haben. Der Graf sandte einen Bedienten ins Schloß. Frau Gurnemann trat an ihn heran, gewillt, ihn nicht mehr freizugeben. Er wich ihren fast drohenden Blicken aus. Doch hielt sie sich an seiner Seite. Der Kapitän bot der Baronin den Arm und war sofort in den aufgeräumten Ton geraten, der Wissenden ankündigte, er befinde sich in der ihm genehmen Atmosphäre. Die Gräfin erschien. Gurnemann, bleich vor Aufregung, stellte sie mit seinen Augen zur Rede. Ängstlich verfolgte der Fähnrich ihre Bewegungen. Zwischen jener leidenschaftlichen Szene und dieser Begegnung lag eine Ewigkeit.
Man war an das Ufer gelangt. Sitze warteten der Gäste. Die Bedienten hielten Mäntel in Bereitschaft. Die Fackeln warfen einen zitternden Schein auf die trägen Fluten. Eine Fähre legte an. Gurnemann zögerte ... Da wandte sich die Gräfin. Nur ein Augenblick war es, aber wie ein Tiger hinter ihm her, hatte Gurnemann ihn gepackt, diesen flüchtigen Blick, der zärtlich-vertraut den Fähnrich suchte. Der Gräfin schlug das Herz gewaltig. Sie wußte von der Gefahr, sah den ergrimmten Feind. In Gurnemanns Antlitz waren alle Muskeln gestrafft. In dieser Qualminute fand die sonst so Unberatene, was einzig taugen konnte: sie ließ ihr Auge in dem Gurnemanns verweilen, zwang sich mit übermenschlicher Anstrengung zu einem Lächeln. Gurnemanns Krampf entspannte sich. Noch zögerte er. Da gewann ihr Lächeln Sicherheit. Der Kopf schwindelte ihm. Und das Lächeln warb ... Aber auch Frau Gurnemann, der sich Graf Paris geschickt entwunden hatte, war dieses Lächeln nicht entgangen. Sie sah ihres Gatten Unterliegen, sah die Schöne, Gehaßte als Siegerin über den kleinen, verachteten Mann. Wehrlos stand sie. Ihr Busen flog ... Der Kapitän mahnte jovial den Hauptakteur an seine Rolle. Gurnemann sprang auf die Fähre. Die Gräfin ließ sich völlig ermattet in einen der leichten Stühle nieder. Der Graf trat vor und kündigte, ihre Hand ergreifend und küssend – sie ließ sie ihm willenlos –, mit launigen Worten das Spiel an ... Kaum hatte er einige Sätze gesprochen, als ihn ein Geräusch von der Fähre her unterbrach. Man strengte sich an, zu sehen, was es gäbe. Die Fähre war in den Schatten gelangt. Gurnemann, in der heftig erregten Stimmung, die ihn bezwang, war, auf dem Floße vorwärts eilend, zur Bewegung des langsam wieder herangeruderten Fahrzeugs in Gegensatz geraten und gestrauchelt ... »Es ist nichts!« rief er hinüber, da der Graf mit mächtiger Stimme – er schleuderte seine Unruhe so von sich – anfragte.
Die Fähre schwamm näher. In einem weißen Mantel stand Gurnemann an der Längsseite. Die Mandolinen begannen. Sonst herrschte Schweigen. Nur die Wellen kämpften gurgelnd gegen das Hindernis der durch das Einstemmen der Ruderstangen gestauten Plätte.
Während Gurnemann sang, bemühte er sich, das Dunkel am Ufer zu durchdringen, das bei dem verstärkten Scheine der an Bord der schwimmenden Bühne allmählich reichlicher entzündeten Fackeln drüben nur immer tiefer ward. Einen Augenblick glaubte er den Fähnrich zu erkennen, dessen schmales Gesicht sich hinter den Schultern der Gräfin hervorbog. Er deutete den Knechten an, näher anzufahren. Der Nachtwind rauschte durch die Kronen der alten Bäume. Wie magnetisiert verfolgte die Gräfin Gurnemanns Bewegungen. Die Worte seines Liedes verklangen vor ihren Ohren. Die Fülle dieser Stunden machte ihr Herz heftiger und heftiger schlagen. Sie fühlte ihre Sinne schwinden. Die Schatten der Fackeln tanzten über dem Wasser. Die Bäume schienen sich bis auf sie herabzuneigen. Drohend schimmerte ihr Gurnemanns gespenstisch blasses Antlitz entgegen. Mit einem leisen Aufschrei sank sie in Ohnmacht ... Wie ein Rasender drängte Gurnemann an den Rand der Fähre. Er sah den Fähnrich zu Füßen der Gräfin. Die Leute schienen ihm nicht schnell genug zu rudern. Mit einem verzweifelten Satz erreichte er das Ufer, glitt darin aus und versank im Wasser. Nun drängte alles zum Flusse. Den Jüngling von seiner Frau fortschiebend, versuchte Graf Paris, die Bewußtlose zu sich zu bringen. Der Kapitän hatte eine Ruderstange erfaßt, an der er die Fähre rascher heranzog. Gurnemann schien unter diese geraten zu sein. Der Fähnrich, ausgeschlossen von der Geliebten, im allgemeinen Tumult seiner selbst kaum bewußt, warf sich in den Strom. Es gelang ihm, Gurnemann zu erfassen, den der weiße Mantel, schwer ihn umwindend, hemmte. Atemlos, den Mund voll Wasser, gurgelnd, klammerte sich dieser an ihn an. Da drang gerade die Fähre mächtig gegen die Ringenden. Gurnemann hatte den Fähnrich an der Kehle gepackt. Wie im Wahnsinn drückte er zu. Der Jüngling sank unter. Die Fähre – an der jetzt Gurnemann sich fing – ging über ihn hinweg. Die trampelnden Schiffer schrien. Mit Zischen verlöschten einige Fackeln stürzend im Wasser ...
Als die Gräfin die Augen aufschlug, erblickte sie den schnell geborgenen Toten. Man hatte den Mantel über seinen Körper gebreitet, die gräßlich verzerrten Züge noch nicht bedeckt. Neben der Leiche stand Gurnemann, vor Kälte zitternd. Der Kapitän, mit gesenkten Mundwinkeln – er spielte den Ergriffenen, obwohl er es war –, hielt eine Fackel ...
Das Stelldichein
Der Marquis de Troailles, ein blutjunger Attaché der französischen Mission in Wien, genoß das heitere Leben der hellen Stadt mit der bewunderungswürdigen Ausdauer eines neu Angekommenen. Seine anmutige Erscheinung, der Liebreiz der feinen Züge, die etwas von einem vortrefflich gezogenen Pferd besaßen, seine bei aller Gewandtheit bescheidene Höflichkeit, nicht zuletzt auch der Ruf großer Reichtümer – er war der einzige Sohn ihn vergötternder Eltern – schufen ihm bald die angenehmsten Verbindungen. Und bereits besaß der vielfach Gerühmte, heimlich Beneidete auch einen nicht zu verachtenden Feind, was das Interesse, das man an dem schönen Fremden nahm, nur noch steigern konnte. Ohne viel nach bestehenden Beziehungen zu fragen, hatte der Marquis unter anderen der Gräfin Fanny Hohenmauth, der Gattin eines hohen Funktionärs der Monarchie, seine begehrende Huldigung zu Füßen gelegt und, gewöhnt, nicht allzu lange zu tändeln, nachdem er der entzückenden Frau ein paarmal an drittem Orte begegnet war, sie allein zu Hause zu finden die günstigste Gelegenheit wahrgenommen. Durch die düsteren Spiegelsalons mit den vom Fußboden aufreichenden chinesischen Vasen und den vergoldeten Pfeiler-Konsolen war er, vom Lakaien geführt, in das Boudoir der Gräfin gelangt, die ihn – sie hatte sich eigentlich überraschen lassen – etwas verlegen empfing. Gräfin Fanny wußte, warum sie bangte. Es war die Stunde, da sie jeden Augenblick George Seymours Besuch gewärtigen mußte. Dies aber war der Gebieter der reizenden Dame. Nachdem sich der Marquis mit einem Blick vergewissert hatte, daß sie allein sei, küßte er der Gräfin mit zarter Inbrunst die schmale Hand, und, indem er sie in der seinen behielt, sah er, das von einer leichten Röte überhauchte Jünglingsantlitz erhebend, mit einem seiner schmachtendsten Blicke in die kornblumenblauen Augen. Ihre Befangenheit stieg, da er sich mit der Sicherheit des geborenen Frauensiegers auf ein Knie niederließ und an die leis Erschauernde folgende Worte richtete: »Gräfin, Sie sehen, daß ich alles auf der Degenspitze trage: Ehre, Leben und Herz. Ich liebe Sie vom ersten Augenblick an, da ich das Glück gehabt hatte, Sie zu schauen. Ich bin Ihrer mit allen Gedanken des Tages und der Nacht. Ich kenne kein anderes Ziel als Sie. Hier lege ich mein Geschick in Ihre kleinen Hände!« Nach diesen in gedämpftem Tonfall und rasch, aber deutlich gesprochenen Worten erfaßte der Marquis auch die andere Hand der Dame, vereinte beide sanft, indem er sie mit der Rechten umfaßte, und legte die Linke leicht an die Stelle, wo unter dem Spitzenjabot sein junges Abenteurerherz pochte. Da schlug die kleine Stutzuhr auf dem weißen Marmorkamin die vierte Stunde. »Stehen Sie auf, Marquis«, sagte die Gräfin mit einer Stimme, in der dem Knienden Verheißung zu beben schien, »stehen Sie auf! Es könnte jemand kommen.« Der Marquis jedoch, ohne sich von der Stelle zu rühren, rief: »Sagen Sie, ob Sie mich lieben können, Gräfin, ob ich Sie lieben darf!« Da dem durch die Angst geschärften Gehör der Gräfin soeben aus den anstoßenden Gemächern nahende Schritte vernehmbar wurden, entwand sie mit einer vom Entsetzen gestärkten Bewegung des Oberkörpers ihre Hand der Umklammerung des ungestümen Liebhabers, und, indem sie einen Schritt zurücksprang, flüsterte sie, nur um diesen gefährlichen Auftritt zu beendigen, mit geschlossenen Augen – der Marquis deutete das Zeichen günstig –: »Vielleicht.« Sofort stand er auch wieder auf seinen Füßen, schob den Degen zurecht und legte die Hand auf die Lehne eines mit lilarotem Damast überzogenen Fauteuils. Die Schritte erklangen nun unmittelbar hinter seinem Rücken. Er wandte sich um. Der Bediente meldete Mr. George Seymour, und der Gemeldete folgte ihm fast auf den Fersen. Der Marquis sah ihn an und erkannte in ihm seinen Feind.
George Seymour war ein hochgewachsener Mann von einigen Dreißig. Vollendet war die Schmalheit seiner Hüften, vollendet die Breite seiner Schultern, auf denen ein runder mächtiger Nacken saß. Dieser trug einen dämonischen Kopf. Das Gesicht hatten Leidenschaften zerrissen. Der Mund schien eine aufgebrochene Spalte. Die unsteten Augen zwang Willenskraft.
Die Gräfin war einer Ohnmacht nahe. Die beiden Diplomaten begrüßten einander kalt. Und als der Marquis nach einem kurzen gleichgültigen Gespräch ging, schlug jener, der sich wieder gesetzt hatte, gelassen Bein über Bein. Diese Bewegung erfüllte den Scheidenden mit einer unsäglichen Wut.
Zwei Tage darauf bei einer großen Cour sagte der Marquis zu der schönen Gräfin: »Gräfin, ich will nichts wissen von einem Nebenbuhler. Aber auf daß Sie sicher seien, habe ich mit Ihrer Kammerfrau ein Abkommen getroffen.« Die Gräfin erbleichte. Die Kühnheit solchen Vorgehens war ihr wie eine Verheißung gewalttätiger Ereignisse.
Das Einverständnis mit der Kammerzofe hatte sich einfach genug erzielen lassen. Der Bediente des Marquis war beauftragt worden, noch an demselben Abend, als Hector de Troailles der Gräfin seinen ersten, so ungewöhnlichen Besuch abgestattet hatte, sich dem Mädchen zu nähern und ihr die Liebe seines Herrn anzutragen. Er hatte den Befehl zur vollsten Zufriedenheit beider Teile ausgeführt. Er konnte alsbald dem Marquis berichten, daß Pepi, die übrigens ein äußerst liebenswürdiges Geschöpf wäre, sich der Ehre solcher Zuneigung völlig bewußt sei. Darüber, wie sein Gebieter dazu gekommen sein mochte, ihrer gewahr zu werden, hatte dem Verschlagenen der Augenblick hinweghelfen müssen. Er beließ der Angelegenheit den Rosenschimmer eines duftigen Geheimnisses, was das junge Ding nur um so sehnsüchtiger zu stimmen geeignet war.
Am dritten Tage nach jenem ersten Besuch, gegen elf Uhr nachts, fand sich der Marquis, der durch seinen Bedienten alle Wege hatte ebnen lassen, unter den Arkaden des zweiten Hofes im Palais Hohenmauth ein. Eine einsame Laterne beleuchtete den langen Korridor, der zu den Küchen und Gesinderäumen führte. Den dunklen Mantel zusammennehmend, trat der Jüngling in den Hof. Rund um den mit Steinen gepflasterten inneren Raum liefen, wie im Vorderhaus, in nahezu doppelter Stockhöhe Galerien.
Er hatte nicht allzu lange gewartet, als ein leichter Schritt aus der Tiefe des finsteren Korridors sich vernehmen ließ. Zaghaft kam Pepi heran und fühlte sich alsogleich zärtlich umfangen. Das Mädchen unter die Leuchte ziehend, wo er es mit einem prüfenden Blick musterte, sagte der Marquis: »Meine süße Kleine, wo ist deine Kammer?« Nach dieser kurzen Ankündigung eines romantischen Liebesunternehmens, das der Zofe seit zweimal vierundzwanzig Stunden den Kopf benahm, und nachdem er sie noch herzhaft abgeküßt und an sich gepreßt hatte, gab er ihr durch eine entschiedene Wendung seines Körpers zu verstehen, daß er nunmehr mit ihr zu gehen bereit sei. Das arme Ding, das sich beileibe nicht eines so raschen Verlaufs des Abenteuers versehen hatte, versuchte einige Abwehr. Aber der energische Arm des jungen Mannes zwang sie zu einer kleinen Wendelstiege, die von oben her düster erleuchtet war. Ohne weiteren Widerstand, willenlos, ließ sie sich von dem mit der Örtlichkeit bald Vertrauten führen. Der Marquis genoß in den sanften Armen dieser demütigen Magd seiner Wünsche ein anmutiges Vergnügen, das ihm um so gefälliger dünken mußte, als er das Manöver mit der Kammerjungfer eingeleitet hatte, ohne im entferntesten die Möglichkeit eines so annehmbaren Genusses zu gewärtigen.
Einige Tage hatte er seine bescheidene Kleine mit den Abfällen sozusagen einer großen Passion zu beglücken gewußt, als er die Zeit für gekommen erachtete, das Abenteuer in seinem Sinne zu nutzen. Mittlerweile war er auch in anderer Richtung nicht müßig gewesen. Er hatte sich wieder einmal, und zwar zur Stunde, da Seymour bei der Gräfin sich einzufinden pflegte, im Boudoir der verehrten Frau gezeigt und nicht versäumt, den schweigsamen Engländer, den er diesmal durch Beharrlichkeit mit ihm fortzugehen nötigte, in der Vertrauen einflößenden Sorglosigkeit frischer Jugend auf das charmante Verhältnis aufmerksam zu machen, das ihm durch einen liebenswürdigen Zufall im Hotel Hohenmauth sich ergeben hätte. Der Unglückliche ahnte nicht, daß Seymour durch diese Mitteilung, hinter der er nichts anderes als eine Finte zu argwöhnen imstande war, nur um so wachsamer seinen Schritten nachzuspüren bewogen ward. Er glaubte, alles getan zu haben, den schwerfälligen Gefährten über einen etwaigen Verdacht zu beruhigen, dessen völlige Grundlosigkeit darzutun die unumwundene Aufklärung ihm bei seiner Menschenunkenntnis genügend schien.
Bei einer Pirutschade war es, daß sich der Marquis, der, mit den anderen Kavalieren wetteifernd, Gräfin Fanny die üblichen Huldigungen dargebracht hatte, scheinbar harmlos herantretend, indem sich der Wagen wieder in Bewegung setzte, diese schnellen Worte ihr fast ins Ohr zu flüstern unterfing: »Gräfin, ich werde morgen nacht gegen zwölf in Ihrem Schlafgemach auf Sie warten.« Während die Lipizzaner in immer rascherem Trabe sich den anderen Gespannen anschlossen, hatte die Gräfin an der Seite ihres schwerhörigen Gatten Zeit, über die Kühnheit dieser Ankündigung sich zu beruhigen. Selbstverständlich würde sie dem mehr als tollen Unternehmen zu steuern wissen. Der Abend des kommenden Tages war einem großen Empfang geweiht, den der spanische Botschafter den Vertretern der Mächte und der Elite der Gesellschaft gab. Spät genug angesetzt, mochte sich das Fest, wenn sich die Mitglieder des Hofes zurückgezogen hatten, wohl weit über Mitternacht erstrecken. Immerhin war es von dem Marquis eine Vermessenheit sondergleichen, mit der Neigung des Grafen zu langwierigen Spielpartien rechnend, eine verhältnismäßig so frühe Stunde zum Stelldichein unter dem ehelichen Dache seiner Dame zu wählen. Die Gräfin ertappte sich in einiger Verlegenheit bei Erwägungen über die Möglichkeiten, nicht etwa wie der Marquis von seinem frevelhaften Beginnen durch energische Zurechtweisung abzubringen wäre, sondern wie die Ausführung des in seiner Verruchtheit so verführerischen Unternehmens sich wohl gestalten würde. An diesem Nachmittag ergab sich keine Gelegenheit, den Marquis zu warnen; denn schon hatte sich die zuerst beabsichtigte schroffe Zurechtweisung des jungen Mannes in mißbilligenden Tadel, dieser aber im Verlaufe der stummen Erörterung in eine dem Leichtsinnigen nicht vorzuenthaltende Warnung verwandelt, ohne daß die Gräfin sich dieses Umschwunges ihrer Anschauung völlig bewußt geworden wäre.
Als Gräfin Fanny am anderen Tag erwachte und ihr auf silberner Platte von Pepi das Frühstück serviert wurde, fiel ihr – es war hoher Mittag – das für diese Nacht bevorstehende Ereignis ein und, indem sie sich eines früheren andeutenden Wortes des Marquis, das sie anfangs wohl verblüfft hatte, später jedoch von ihr im geselligen Taumel wieder vernachlässigt worden war, entsann, glaubte sie, ein übriges getan zu haben, wenn sie dem Mädchen mit strengen, aber nicht weiter bei der peinlichen Sache verweilenden Worten die gefährliche Betrauung verwiese. Kaum aber hatte sie der mit gesenkten Augen sie bedienenden Zofe auch nur den Namen des Marquis genannt, als das Mädchen, sich und sein vermeintliches süßes Geheimnis verraten wähnend, weinend der Gräfin zu Füßen fiel und sie um Gottes und aller Heiligen willen beschwor, ihre Gnade ihr nicht zu entziehen. Die Verwirrung der Magd deutete die Gräfin in ihrem Sinne, sie verbat sich jedes weitere Wort, verwies Pepi ernstlich ihre Unvorsichtigkeit, und, innerlichst gerührt über die mutige Hartnäckigkeit des schönen Jünglings, der sich wirklich schon aller Mittel und Wege, zu seinem Ziele zu gelangen, versichert zu haben schien, entließ sie sie mit der zweideutigen Weisung, in Hinkunft ihr eigenes Wohlergehen besser im Auge zu behalten. Keinen Moment war ihr bewußt geworden, daß, hätte das Mädchen wirklich als die vertraute Unterhändlerin des Marquis vor ihr gestanden, die Herrin ihren Zorn ganz anders hätte zeigen müssen. Pepi entfernte sich mit Zittern. Ein Briefchen am Morgen von dem findigen Bedienten ihr zugesteckt, hatte den Besuch des vornehmen Geliebten für diese Nacht in Aussicht gestellt. Sie wußte sich keine Möglichkeit, den Besuch hintanzuhalten, war aber entschlossen, den Marquis diesmal nicht in ihre Stube einzulassen. »Diesmal«, wiederholte sie sich. Denn mit heißem Erröten mußte sich das arme Ding gestehen, daß ein jäher Abbruch der süßen Verbindung ihr Herz auf Lebensdauer versehren würde.
Der Abend kam heran. Die Gräfin ließ sich von Pepi beizeiten ankleiden. Im hohen Spiegel des Trumeaus fing sie gelegentlich scheue Blicke der Zofe auf, die zu bemerken sie sich selbst verwehrte. Während Pepi mit bebenden Fingern das reiche Haar ordnete, waren die Gedanken der beiden Frauen bei dem kühnen Abenteurer, der unterdessen, von Seymour zur Besichtigung eines aus England eingetroffenen jungen Pferdes eingeladen, das unruhige Tier auf der Reitbahn zwischen seinen Schenkeln auf die aus seinen Muskeln noch zu entwickelnden Fähigkeiten prüfte. Mit verschränkten Armen, lauernden Blickes, stand der Besitzer inmitten des mit feinem Sand bestreuten Kreisrundes, während langsam die Frühlingsdämmerung einfiel. Durch einen seiner Spione war er in Kenntnis des von dem Franzosen mit Pepi für heute verabredeten Stelldicheins, und argwöhnisch wie nur je der an die Bequemlichkeit einer andauernden Liaison gewöhnte Liebhaber einer nicht eben unzugänglichen Frau, hatte er dieses wie jedesmal seine besonderen Vermutungen. Auch war sein Plan schon zum Entschlusse gereift. So oft der Marquis das Kammermädchen aufsuchte, hatte George Seymour die Gräfin, die er fast täglich zu sehen Gelegenheit hatte, nicht aus den Augen gelassen. Auch war ein Bedienter des Hauses bestochen, der über die Zusammenkünfte zu berichten hatte.
Strahlend in Jugend und Schönheit, der die innerliche Erregung einen neuen Reiz verlieh, erschien die Gräfin auf der spanischen Botschaft. Sie war so umringt, daß geraume Zeit weder Seymour noch der Marquis sich ihr zu nahen in die Lage kamen. Der Engländer sagte, als er ihr die Hand küßte – nur der Apostolische Nuntius hielt sich neben ihr, ein paar jüngere Herren waren, als sie den Günstling kommen sahen, nicht ohne Scheu vor dem berühmten Fechter zurückgetreten –: »Der Kutscher hat Ordre.« In den Diensten der Gräfin stand seit einigen Wochen ein englischer Kutscher, den Seymour dem Grafen abgetreten hatte, jenem blind ergeben, todsicher. Es war das Übereinkommen getroffen worden, daß der Kutscher die Gräfin an gewissen Abenden, wenn ihr Mann dem geliebten Spiel oblag, auf eine Stunde zu Seymour führte, dann aber, wofern er den Grafen nicht abholte, leer nach Hause fuhr, während sie später zur pünktlich festgesetzten Heimkehr einen von Seymour bereitgehaltenen Wagen bis an die Hinterpforte des Palais benutzte. Seit Wochen schon hatte der alternde Gatte die Gemächer seiner jungen Frau zur Nachtzeit nicht besucht. Übrigens waren diese kurzen nächtlichen Zusammenkünfte eine Gunst, die die vor Seymours Jähzorn zitternde Gräfin ihm nicht abzuschlagen wagte, obgleich sie jedesmal mehr tot als lebendig heimkehrte.
Die Ankündigung hatte sie wie ein Blitzstrahl getroffen. Sie behielt so viel an Geisteskraft, ihm nicht sofort abzusagen, was wohl nur Unheil hätte stiften können. Aber ihr Kopf rang nach einer annehmbaren Ausflucht, die sich im Verlaufe des vorgeschrittenen Abends würde ins Treffen führen lassen. Als sie nach dem spät servierten Souper mit qualverdunkelten Blicken ihren Herrn suchte, war er nicht zu entdecken. Er hatte sich bereits in seine Wohnung begeben, denn er hielt weitere Verabredungen nicht für nötig. »Heut haben Sie Ihre Seladons bald verlassen, teuerste Gräfin«, sagte eine näselnde Stimme neben ihr, als sie, die Hand an die hoch wogende Brust gedrückt, einen Augenblick geistesabwesend auf ihre Fußspitzen starrte. Es war eine alte Exzellenz, die sich diese Vertraulichkeit gegen die junge Frau herausnahm. Sie lächelte mit ihren schimmernden Zähnen. Sie sann. Was tun, um Gottes willen, was tun! Denn daß auch der Marquis seiner Ansage sich getreu erweisen würde, stand ihr über jedem Zweifel.
Dieser hatte, ohne sich von jemand zu verabschieden, seinen Wagen bestiegen, und sich zu einer Straßenkreuzung fahren lassen, die, in einiger Entfernung des Hotels Hohenmauth, abgelegen genug war, das Ziel der Fahrt zu verbergen. Zu Fuß – er entließ den Kutscher – setzte er den Weg fort, alle Glückseligkeit des Freibeuters im Herzen. Bald stieg die dunkle Masse des alten Hauses vor ihm auf. Die Toreinfahrt stand offen. Der Pförtner schlief wie gewöhnlich. In seinen Mantel gehüllt, glitt der Marquis an der gegenüberliegenden Wand vorbei durch einen Gang zum zweiten Hofe. Wieder sah er über sich das hohe Kreisrund der altertümlichen Emporen, deren eine – das wußte er – vor dem Schlafgemach der Gräfin gelegen war. Der Mond hatte einen Hof. Der heftige Frühlingswind gelangte nicht hinab in den stillen Kessel, aber die am Himmel treibenden Wolken verrieten seine junge drängende Kraft.
Pepi, die in dem oberen Stock an einem der aneinanderstoßenden Glasfenster der geschlossenen Galerie, voll Bangen, geharrt hatte, erschien aufgeregt hastig. »Die Gräfin weiß alles«, stieß sie aus keuchender Brust hervor. »Du hast ihr doch nicht gestanden?« rief der Marquis. Das Mädchen mußte sich erst besinnen, ob und was sie gestanden haben mochte. Sie erinnerte sich wirklich nicht mehr des Inhalts der demütigen Unterredung, obwohl ihr alle Begleitumstände bis auf den Glanz der durch ihre Hand gleitenden Haarflechten ihrer Herrin bewußt waren. Nach einigen schlecht genug versinnlichten Kreuzfragen hatte der Marquis sich soweit vergewissert, daß die Dame seiner Wünsche nicht etwa in die allzu fleischlichen Umwege eingeweiht wäre, die ihn zum Ziele zu führen bestimmt waren. Der Eifersucht des Weibes in der Gräfin hätte er seine Sache nicht ausliefern wollen. Als er nach einigem Sträuben in Pepis Kammer angelangt war, verlangte er, wie von einer plötzlichen Neugierde gestachelt, das Schlafzimmer der Gräfin zu sehen. Im Gefühl doppelten Unrechts gegen die Herrin, die sich ihr im besonderen erst heute so gütig erwiesen hatte, ließ ihn das Mädchen ein. Er verweilte lang im Anblicke der einzelnen Gegenstände des schweigenden, von Weiß beherrschten Raumes. Stumm hielt die Zofe Wacht über allzu vorwitzige Blicke des unbefugten Besuchers. Da er eine dritte Türe bemerkte – die eine führte zum Ankleidezimmer, die zweite in einen kleinen Vorraum, an den sich das vordere Stiegenhaus schloß –, wollte er wissen, wohin man durch sie gelange. Pepi öffnete, und ruhige Mondeshelle drang in das Gemach, umspülte das bereitete Bett. Sie traten auf eine Art von verglaster Altane, eine der Emporen, die um den Hof sich reihten. Er sah durch das Fenster – es stand halb offen – in eine ziemliche Tiefe auf die Steinfliesen des zweiten Hofes hinab. In diesem Augenblick erscholl ein dumpfes Rollen hinter Mauern. »Die Gräfin!« rief das Mädchen erschreckt. Auch den Marquis hatte dieses Geräusch merkwürdig ins Herz getroffen. Es war nicht die gewohnte sieghafte, nur nach Erfüllung durstige Zuversicht, die in dem Auflauschenden ihre stolzen Flügel breitete, es war wie die dumpfe Ahnung eines ungewissen Schicksals, das ihn überschattete. Auch stieg plötzlich die Erinnerung an das gütige Gesicht seiner fernen Mutter wie eine mahnende Vision vor seinen inneren Augen auf. – Schon aber hatte die Kammerfrau ihn fast fußfällig beschworen, das Schlafzimmer augenblicklich zu verlassen. Er zögerte. Er konnte sich nicht trennen von der Ruhe dieser erwartenden Wände, dem schlichten Betpult, auf dessen dunkelbrauner Diele sie ihre tägliche Andacht verrichten mochte, dem schneeigen Bett, auf dem das Mondlicht flutete. Da man im Korridor unten eine Glastür gehen hörte, erzitterte das Mädchen am ganzen Körper, und indem sie ihre Bitte eindringlicher und ihre eigene gefährdete Person in den Vordergrund schiebend wiederholte, wollte sie den Marquis, an den sie sich, wenn er nicht an ihrer Brust lag in der Stille der Nacht, kaum heranwagte, leis an der Schulter in das Nebengemach drängen. Er aber war, als hätte er Zeit und als ginge ihn die ganze Sache nichts an, in seltsamen Heimatsgedanken, zu denen ihn der trotz den wilden Wolken mild leuchtende Mond stimmte, wieder durch die geöffneten Türen auf die Altane getreten und stand, die Hand auf die Fensterbrüstung gelegt, in den Anblick des lichtgebadeten Hofes versunken. Diesen Moment benutzte die vor Sorge um ihre Sicherheit ganz außer Besinnung gebrachte Kammerzofe, hinter ihm die Tür zu schließen und mit einer raschen Bewegung auch alsogleich zu versperren. Er sah sich auf der Empore unmittelbar vor dem Schlafzimmer mit sich selbst und dem Mond eingeschlossen. Er klopfte, aber er hörte wieder eine Tür gehen und unterließ die Wiederholung des vorläufig wohl vergeblichen Versuches, das Mädchen an sein Versäumnis zu mahnen.
Pepi war der Gräfin entgegengeeilt, die, unfähig, sich den Gefahren zu stellen, die ihr aus dem Zusammentreffen der beiden Rivalen drohten, ihren Gatten durch das Vorschützen einer plötzlichen Unpäßlichkeit vermocht hatte, vom Spieltisch, unwillig genug, aber nach außen höflich wie immer, sich zu ungewohnter Zeit zu erheben und sie auf ihre dringende Bitte nach Hause zu begleiten. Der von Seymour, den er fürchtete wie den Teufel, angewiesene Kutscher hatte, da er also den Grafen ins Schloß zu bringen sich genötigt sah, sofort nach seiner Ankunft im Stalle die Pferde einem der schlaftrunkenen Stallburschen übergeben und war spornstreichs zu dem Engländer gelaufen, ihn über das Geschehnis aufzuklären. Seymour, dessen Wagen im Hofe hielt, ließ den Mann, nachdem er seine Meldung, ohne ein Wort zu erwidern, entgegengenommen hatte, stehen, wo er stand, und fuhr unverzüglich zum Hotel Hohenmauth. Er ließ den Wagen ihn erwarten, als handelte es sich um eine Staatsvisite, und begab sich, ohne Degen, mit seinen festen Schritten zum Portier. Dort ließ er sich die Rückkunft des Grafen und der Gräfin bestätigen, dankte kalt für die Auskunft und schritt, als wäre es heller Tag, ruhig durch den Gang, durch den der Marquis gekommen war, in den zweiten Hof. Der Pförtner, der sich längst abgewöhnt hatte, sich über die Absichten gewisser Herren Gedanken zu machen, blickte ihm kopfschüttelnd nach, doch da er den Wagen halten sah, dessen Laternen ihren Schein in die Einfahrt sandten, während das Schnauben der Pferde im Gewölbe widerhallte, sprach er sich mit einer unwillkürlichen Handbewegung von aller Schuld frei und trollte sich wieder zu seinem Weibe, ihr für den Rest der Nacht die Betreuung des Hotels überlassend.
Seymour, der, sowie er sich dem mondbeschienenen Platz näherte, sich wieder in die Wächterrolle fand, die er seit einiger Zeit angenommen hatte, blieb unter dem Hoftor stehen und musterte sorgfältig mit dem scharfen Auge des Jägers zuerst den Hof selbst, dann seine Umgebung. Langsam hob er seine Blicke zu den Emporen. Voll beschienen vom Mond stand, noch immer träumend – denn die Gräfin hatte, ihre Furcht kaum bemeisternd, bei ihrem Gatten verweilt –, oben hinter den Scheiben der gegenüberliegenden Altane der Marquis. Seymour erkannte ihn sofort. Unwillkürlich fuhr seine Hand nach dem Platze der gewohnten Waffe. Aber er ließ sie alsbald sinken, denn ein unheimlicher Gedanke war mit der Deutlichkeit einer Erscheinung plötzlich vor ihm aufgetaucht. Leise verließ er seinen Posten und stieg, vorsichtig Schritt vor Schritt setzend, die Treppe, die ins erste Stockwerk führte, hinauf. Von dem kleinen Vorplatze zweigte ein schmaler Gang ab. Er durchschritt ihn, betrat ein Zimmer, in dem eine Wanne stand, und befand sich mit einer Wendung nach rechts in dem hinten an das Schlafgemach der Gräfin anstoßenden Raum, durch den die Kammerzofe gewöhnlich, indem sie einige Garderobestätten passierte, über eine kleine Wendeltreppe unmittelbar aus ihrer im Erdgeschosse gelegenen Kammer sich zu ihrer Herrin begab. Hier hielt Seymour und überlegte. Entweder wartete der Marquis auf die allgemeine Ruhe im Hause, oder er war hinausgetreten, während die Gräfin sich entkleidete. Die Stille im Schlafgemach beruhigte ihn über diese Annahme. Fanny war noch nicht in ihrem Zimmer eingetroffen. Er erinnerte sich, daß er ja wie ein Rasender herangefahren war; seit der Nachricht des Kutschers waren keine zehn Minuten verstrichen. –