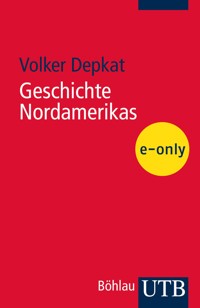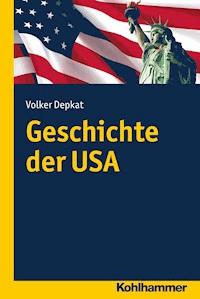
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
The United States of America are the only remaining superpower in an increasingly confusing world at the start of the twenty-first century. This volume discusses the stages of the country's rise to the status of world power and analyses the USA's fascinating and complex history on the basis of several fundamental subjects. The survey starts with the experiment of establishing a democracy, which was initiated through revolution and is unfinished even today. The USA's development to become a superpower enjoying world hegemony was equally uneven - a rise that has also acquired missionary aspects under the banner of the 'empire of liberty'. Another focus in the account is the way in which new, decidedly American values and a modern, consumption-oriented, technology-saturated lifestyle - the 'American way of life' - emerged from contact in North America between the widest possible variety of cultures and ethnic groups. This lifestyle by no means levelled out the existing ethnic and cultural pluralism of American society. With topics revolving around politics, society, business and culture, the book reveals the lines of historical development in the USA that have been and continue to be signposts for the modern world.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Depkat
Geschichte der USA
Verlag W. Kohlhammer
Für Simon
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-018797-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-026744-2
epub: ISBN 978-3-17-026745-9
mobi: ISBN 978-3-17-026746-6
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
I Voreuropäische Zeit und Kontaktphase
1 Die ersten Amerikaner
2 Indianische Lebensformen
3 Entdeckungsgeschehen
II Das koloniale Britisch Nordamerika
1 Koloniale Experimente
Die Kolonien des Südens
Die Kolonien Neuenglands
Die Kolonien des Mittleren Atlantiks
Grundmuster britischer Kolonisation
2 Die Anfänge der Sklaverei
3 Indianer und Weiße
III Revolution (1763–1787/88)
1 Imperiale Krise und Eskalation des Steuerstreits 1763–1773
2 Wende zur Revolution 1774/76
3 Die vielen Kriege des Amerikanischen Revolutionskrieges
4 Die Geburt des modernen Konstitutionalismus
Verfassungsgebung in den Einzelstaaten
Verfassungsgebung auf Bundesebene
5 Die revolutionäre Gesellschaft
6 Die »kritische Periode« und die Verfassung von 1787/88
IV Frühe Republik und Bürgerkrieg 1789–1865
1 Behauptung der Union nach innen und außen 1789–1815
2 Territoriale Expansion, inneres Wachstum und
Manifest Destiny
3 Demokratisierung der Republik
4 Marktrevolution und Industrialisierung
5 Herren und Sklaven im Alten Süden
6 Sektionaler Konflikt und föderale Krise
7 Der Bürgerkrieg als »zweite Revolution«
V Der Durchbruch der Moderne 1865–1914
1
Reconstruction
. Die Wiedereingliederung des Südens
2 Die Besiedlung des Westens und das Ende der
Frontier
3 Die industriekapitalistische Metamorphose der USA
4 Die Herausbildung der industriellen Gesellschaft
Die amerikanische Arbeiterklasse
Die amerikanische Mittelklasse
5
New Immigration
und neue ethnische Pluralität
6 Kommunikations- und Verkehrsrevolution
7 Urbanisierung und die Ausdifferenzierung des städtischen Raums
8 Die Widersprüche der industriellen Moderne und soziale Reform
9 Imperialismus und Industrialisierung
VI Die USA im »kurzen 20. Jahrhundert« (1914–1990)
1 Die USA im Ersten Weltkrieg
Politische Neutralität und wirtschaftliche Verflechtung
Over There
– Die amerikanischen Truppen in Europa
Over Here
– Staat, Wirtschaft und Gesellschaft im Krieg
Der schwierige Friede von Versailles
2 Paradoxe Zwischenkriegszeit
Prekärer Wohlstand und Great Depression
Die Paradoxien der Moderne
Vom
American Individualism zum New Deal
Neutralität und
demokratischer Internationalismus
3 Die USA im Zweiten Weltkrieg
Kriegführung in Europa und Asien
Innere Wandlungsprozesse
Alliierte Nachkriegsplanungen
4 Wandel der Rassen- und Geschlechterordnungen 1914–1945
New Negroes
Neue Frauen
5 Fronten des Kalten Krieges
Die Entstehung des Kalten Krieges
Die Anfänge des Kalten Krieges in Asien
Konsolidierung der Fronten in Europa
Krisenherde und Konflikte des Kalten Krieges
Entspannungspolitik, Re-Eskalation und Ende des Kalten Krieges
6 Wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Wandel 1945–1991
Die wirtschaftliche Entwicklung
Die Entfaltung der Wohlstandsgesellschaft
Bürgerrechtsrevolutionen
Die Ordnung der Geschlechter
7 Phasen der Innenpolitik im Kalten Krieg
Innenpolitik im Zeichen des New Deal Konsens 1945–1968
New Left
und
New Right
VII Die USA im 21. Jahrhundert
1 Außenpolitik
Der Erste Irakkrieg
US-Außenpolitik im Zeichen des
Enlargement
9/11 und der
War on Terror
Der Afghanistankrieg
Der Zweite Irakkrieg
Der Nahostkonflikt
2 Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wandlungsprozesse
Wirtschaftswachstum und prekärer Wohlstand
Demographische Entwicklungen
Wertewandel und Kulturkämpfe
Medienrevolution
Umweltzerstörung und Umweltschutz
3 Innenpolitik
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1 Quellen
2 Nachschlagewerke und Hilfsmittel
3 Gesamtdarstellungen
4 Epochen
4.1 Präkolumbanisches Amerika
4.2 Koloniales Amerika
4.3 Die Amerikanische Revolution
4.4 Frühe Republik (1789–1861)
4.5 Bürgerkrieg und Reconstruction
4.6 Durchbruch der Industriellen Moderne, Gilded Age und Progressive Era
4.7 Die USA im Ersten Weltkrieg
4.8 Die USA zwischen den Weltkriegen (1918–1941)
4.9 Die USA im Zweiten Weltkrieg
4.10 Die USA im Kalten Krieg
4.11 Die USA im 21. Jahrhundert
5 Themen
5.1 Native American History
5.2 Außenpolitik und Internationale Beziehungen
5.3 Rechts- und Verfassungsgeschichte
5.4 Wirtschafts- und Sozialgeschichte
5.5 Migrationsgeschichte
5.6 African American History
5.7 Ethnien
5.8 Gender History
5.9 Geschichte Neuenglands
5.10 Geschichte des Südens
5.11 Geschichte der Frontier und des Westens
5.12 Urban History
5.13 Umweltgeschichte
5.14 Religionsgeschichte
Vorwort
Auch wenn die Vorstellung vom geschichtslosen Amerika in Deutschland tief verwurzelt ist, so haben die USA durchaus eine Geschichte, und diese soll in ihren Grundzügen für ein allgemein interessiertes deutsches Publikum erzählt werden. Die Geschichte der USA ist so lang wie kompliziert und in jeder ihrer Phasen faszinierend. Diese Faszination besteht darin, dass die USA das älteste Land der Moderne sind, dessen spezifische Modernität sich in Umrissen bereits in der Vormoderne ausprägte. Viele Akteure, keinesfalls nur weiße, angelsächsische und protestantische Männer, prägten die Geschichte der USA, die sich in einer bunten Vielfalt von natürlichen und sozialen Räumen in Nordamerika und anderswo entfaltete. Diese Räume waren immer auch Kontaktzonen, in denen unterschiedliche Kulturen, Ethnien und Nationalitäten spannungsreich aufeinandertrafen und miteinander agierten. Das Ergebnis waren vielfältige und in viele Richtungen gehende Formen des Kulturtransfers, die einerseits neue, dezidiert amerikanische Wertideen und Lebensweisen produzierten. Andererseits aber erreichten die USA auf diese Weise einen Grad an kultureller Diversität, der es schwer macht, von der amerikanischen Kultur als einem in sich geschlossenen, einheitlichen und gleichgerichteten Phänomen zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb ist die Geschichte der USA eine Geschichte fortlaufender sozialer Konflikte im Spannungsfeld von Hegemonie und Marginalität, Einheit und Vielfalt, Einschluss und Ausschluss.
So facettenreich und vielschichtig die Geschichte der USA auch ist, sie lässt sich durchaus auf bestimmte Grundlinien und Hauptthemen zurückführen. Da ist zunächst das Thema von den USA als revolutionär begründetes und bis heute nicht abgeschlossenes Experiment in Sachen Demokratie. Dieses markierte im ausgehenden 18. Jahrhundert den Beginn einer möglichen, durch Grundrechtsliberalismus, Konstitutionalismus und Volkssouveränität definierten politischen Moderne. Für die Durchführung ihres Demokratieexperimentes konnten die Amerikaner nur sehr bedingt auf europäische Vorbilder, Traditionen und Verfahren zurückgreifen. Sie mussten deshalb ihren Weg buchstäblich im Gehen finden, und dieser Weg war steinig. Die Etablierung, die Ausgestaltung und der wiederholte Umbau einer freiheitlich-liberalen, parlamentarischen Demokratie in einem föderal organisierten Flächenstaat war ein von scharfen Konflikten strukturierter Prozess, in dem Krise und Transformation eng ineinander verschlungen waren. Diese spannungsgeladene Konstellation formierte einerseits eine Vielzahl von Reformbewegungen, die die fortlaufende Ausweitung demokratischer Selbstbestimmungsrechte im Lichte des revolutionären Ideals von »Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness« vorantrieben. Andererseits jedoch entfaltete der Grundsatzstreit über die Ausgestaltung der auf universalen Grundwerten beruhenden Demokratie mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) ein selbstzerstörerisches Potential, das das mit großen Hoffnungen gestartete Experiment in Sachen Demokratie fast beendet hätte.
Die aus kolonialen Anfängen revolutionär begründete amerikanische Demokratie stieg im Laufe ihrer Geschichte zur Welt- und Supermacht auf. Das ist das zweite große Thema, von dem hier berichtet werden soll. Dieser Aufstieg war nicht selbstverständlich, auch wenn es vielen heute so scheinen mag. Zwar wurde das Experiment in Demokratie von Beginn an mit Erwartungen künftiger nationaler Größe gestartet, doch begriffen die Gründerväter es auch als ihre Aufgabe, mit den Traditionen und Konventionen der krieg- und gewaltgebärenden europäischen Großmachtpolitik zu brechen und die Außenpolitik insgesamt auf eine neue, friedliche Basis im Kontext einer neuen Weltordnung zu stellen. Dieses von einer unverkennbar missionarischen Dynamik getragene Bestreben war gekoppelt an eine Politik der Expansion zur Gründung eines Empire of Liberty, die sich zunächst auf den nordamerikanischen Kontinent konzentrierte und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg in die Welt ausgriff. In den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts, in denen Europa, das bisherige Zentrum der Welt, sich selbst zerstörte, stiegen die USA zur Welt- und Supermacht auf. Nach 1945 waren sie einer der beiden zentralen Akteure in der bipolaren Welt des Kalten Krieges, der mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 endete. Anschließend agierten die USA als einzig verbliebener Hegemon in einer grundlegend veränderten Welt, in der neue, durch ethnischen Nationalismus, religiösen Fundamentalismus und Terrorismus geprägte Konfliktkonstellationen entstanden. Diese stellten Washington vor ganz neue Herausforderungen, die mit den bekannten Instrumenten, Verfahren und Strategien der bisherigen Außenpolitik nur unvollkommen zu bewältigen waren.
Das dritte große Thema der US-amerikanischen Geschichte ist die Entfaltung der amerikanischen Moderne, also einer spezifischen Variante des industriell-urbanen Lebensstils in einer sich in den USA früher als anderswo formierenden Konsumgesellschaft. Auch diese Entwicklung ist nicht selbstverständlich. Die mit der Unabhängigkeitserklärung der USA am 4. Juli 1776 eingeläutete politische Moderne begann in einer noch vorindustriellen, agrarisch geprägten Lebenswelt, und einige der revolutionären Gründerväter wie Benjamin Franklin und Thomas Jefferson hätten diese agrarische Republik gerne dauerhaft erhalten. Sie wollten eine Industrialisierung der USA verhindern, weil die aus der Industrialisierung notwendig folgende industrielle Klassengesellschaft viel zu viele abhängige und arme Menschen hervorbringen würde, mit denen sich republikanische Freiheit unmöglich erhalten ließe. Individuelle Unabhängigkeit im weitesten Sinne war ihrer Meinung nach die Voraussetzung für das Gelingen des demokratischen Experimentes. Die Entfaltung einer durch Industrie, Urbanität, Massenkonsum, Bürokratie, Mobilität, Pluralität und Säkularität gekennzeichneten sozio-ökonomischen Moderne ist also ein ganz eigenes Thema der US-Geschichte.
Die Entfaltung dieser Moderne ging einher mit sozialen Transformationsprozessen, die die agrarisch geprägte Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zunächst in eine industrielle Klassengesellschaft verwandelten und diese dann zu der durch Massenkonsum geprägten postindustriellen Wohlstandsgesellschaft der Gegenwart weiter entwickelten. In diesem Gesellschaftstyp arbeitet die Mehrheit der Arbeitskräfte als Angestellte in Dienstleistungsberufen, sind soziale Hierarchien primär durch den Grad der Teilhabe am Konsum von industriell produzierten Fertigwaren bestimmt und ist Armut die Erfahrung einer Minderheit. Zwei neue soziale Formationen entstanden im Zuge dieser gesellschaftlichen Entwicklung, und zwar einerseits die Industriearbeiter, also die Blue-Collar Workers, und andererseits die Angestellten, die White-Collar Workers. Letztere bilden den Kern der amerikanischen Middle Class und ihren durch Aufstiegsmentalität, Bidlungsbewusstsein, Mobilität und Konsum geprägten Lebensstil, der bei vielen als der Inbegriff des American Way of Life schlechthin gilt.
Das vierte große Thema der US-amerikanischen Geschichte ist die fortlaufende Pluralisierung und Diversifizierung einer von Beginn an pluralen Gesellschaft. Die Geschichte der US-Gesellschaft lässt sich nur als die Geschichte eines sich in seiner ethnisch-kulturellen Zusammensetzung wiederholt transformierenden Ensembles verschiedener Gesellschaften schreiben. In diesem schillernden gesellschaftlichen Mosaik war Ungleichheit in jeweils zeitspezifischen Konstellationen stets durch Geschlecht, Rasse, Ethnizität und Klasse definiert. Migration, freiwillige oder wie im Falle der African Americans erzwungene, ist in seiner Bedeutung für die Geschichte der USA kaum zu überschätzen. Neben den verschiedenen europäischen Einwanderergruppen, die seit dem 16. Jahrhundert nach Nordamerika kamen und deren Demographie sich im Verlauf der Zeit wiederholt grundlegend wandelte, stellen die Indianer, die African Americans, die Asiaten und schließlich die Hispanics wichtige Akteure des Migrationsgeschehens dar. Es ist kennzeichnend für die Geschichte der US-Gesellschaft, dass sie einerseits durch Prozesse der Amerikanisierung, also der freiwilligen oder erzwungenen Assimilation an den jeweils hegemonialen American Way of Life, und andererseits durch Strategien des Beharrens auf ethnisch-kultureller Eigenständigkeit der verschiedenen Gruppen strukturiert ist.
Das fünfte und letzte große Thema der US-Geschichte, wie sie hier erzählt werden soll, ist die Enfaltung einer durch freiheitlich-demokratische Grundwerte bestimmten, in sich vielfältig schillernden und im Kern modernen Kultur, eines hedonistischen, konsumorientierten und technologiegesättigten Way of Life also, der zentral im umfassend verstandenen Gedanken der individuellen Selbstbestimmung ankert. Phänomene und Entwicklungsprozesse der amerikanischen Kultur lassen sich ohne Bezug zur demokratischen Herrschafts- und Gesellschaftsordnung der USA nicht angemessen verstehen. Das Zusammenspiel von Demokratie und Marktwirtschaft formierte eine spezifisch amerikanische Popular Culture, die die in Europa geläufigen Unterscheidungen zwischen Eliten- und Volkskultur, Ernst und Unterhaltung, Form und Funktion sowie Kunst und Kommerz überwand. Die Manifestationen dieser amerikanischen Kultur – die Romane Ernest Hemingways oder Toni Morrisons, das Theater von Tennessee Williams oder Edward Albee, die Pop Art von Andy Warhol, die Musik von Elvis und Bob Dylan, Madonna und Beyoncé sowie vor allem die zahllosen Kinofilme und Fernsehserien – fanden im 20. Jahrhundert zunehmend in der ganzen Welt ihr Publikum. In der Folge verschränkten sich kulturelle Praktiken und Produkte der USA überall in der Welt mit lokalen Traditionen zu etwas Neuem. Überall kam es zu hoch komplexen Prozessen der produktiven Anpassung, Anverwandlung und auch Neuerfindung tatsächlich oder vermeintlich »amerikanischer« Produkte und Verhaltensweisen, so dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine globale Popkultur mit regionalen Variationen entstand, die tatsächlich immer weniger »amerikanisch« war.
Von all‘ diesen Themen auf den Achsen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur soll in diesem Buch in gebotener Kürze und angemessener Differenzierung berichtet werden. Nachdem ich in meiner eher experimentellen Geschichte Nordamerikas. Eine Einführung (Köln 2008) die Geschichte der USA in kontinentaler Perspektive reflektiert habe, kehre ich mit diesem Werk nun zu einem eher konventionell nationalgeschichtlichen Ansatz zurück. Das mag wegen der anhaltenden Diskussionen über die Internationalisierung und Transnationalisierung der Geschichtsschreibung im Zeitalter der Globalisierung unzeitgemäß erscheinen. Gleichwohl haben auch nationalgeschichtliche Ansätze angesichts der tatsächlichen historischen Wirkmächtigkeit von Nationalstaaten weiterhin ihre Berechtigung. Schließlich geht es in der Debatte um transnationale Geschichte nicht darum, den Nationalstaat als Subjekt und Objekt der Geschichte wegzudiskutieren, sondern vielmehr darum, die Kategorie des Nationalen zu verkomplizieren, indem einerseits die Offenheit nationaler Systeme betont und andererseits ihre vielfältigen Verflechtungen mit der Welt reflektiert werden. Dies kann man machen, indem man die Geschichte einer Weltregion oder sogar der ganzen Welt schreibt. Man kann transnationale Verflochtenheit aber auch in nationalgeschichtlicher Perspektive sichtbar machen. Insofern ist diese Geschichte der USA kein Bruch mit dem kontinentalen Ansatz, den ich zuvor verfolgt habe; sie komplementiert ihn eher, und doch steht dieses Buch zunächst und vor allem für sich selbst.
Die Arbeiten an ihm begannen vor rund zehn Jahren, und viele Menschen haben mitgeholfen, sie zu einem Abschluss zu bringen. Da sind zunächst die zahllosen Studierenden, die mit mir in einer bunten Reihe von Lehrveranstaltungen Aspekte und Themen der amerikanischen Geschichte kritisch diskutiert haben. Von ihnen habe ich viel mehr gelernt als sie ahnen. Ein großer Dank gebührt Andreas Osterholt, Miles Hookey, Katinka Uppendahl, Liv-Birte Buchmann, Katharina Matuschek und Tamara Heger, die im Laufe der Jahre als studentische Hilfskräfte Kapitelmanuskripte kritisch gelesen, Literatur recherchiert und Fakten überprüft haben. Gleichwohl bleiben alle Fehler in diesem Buch allein meine. Besondere Verdienste um dieses Werk hat sich Alexander Hackl erworben, der als einziger alle Kapitel sorgfältig Korrektur gelesen und deren Qualität mit seinem ausgeprägten Sprachgefühl, seinen breiten Kenntnissen, seiner akribischen Genauigkeit und seiner intellektuellen Hingabe deutlich gehoben hat. Ein besonderer Dank gebührt meiner Lektorin im Kohlhammer Verlag, Monica Wejwar, die dieses langwierige Projekt mit ausdauerndem Wohlwollen, schwäbischem Gleichmut und nie nachlassendem Interesse bis zum letzten Tag ihres Berufslebens begleitet hat. Mit dem Ausscheiden von Frau Wejwar übernahm Dr. Daniel Kuhn und hat mit seinem engagierten Lektorat noch viele Verbesserungen vorgeschlagen.
Auch dieses Buch, das die verdiente einbändige USA-Geschichte von Hans Guggisberg im Programm des Kohlhammer-Verlags ersetzen soll, habe ich in meinen viel zitierten »Nebenstunden« und meist am Wochenende geschrieben, weil es im gegenwärtigen Hochschulsystem, in dem Forschungsleistung in Drittmitteln gemessen wird, ja gar nicht mehr vorgesehen ist, dass Professoren noch selbst Bücher schreiben. Ich will mir dies aber nicht nehmen lassen. Den Preis für dieses Berufsethos hat wieder einmal meine postmoderne Kleinfamilie bezahlt, die auf mich Schreibtischhocker allzu oft verzichten musste und dies mit Geduld ertragen hat, meistens jedenfalls. Als kleiner Trost sei dieses Buch unserem Fußballersohn Simon gewidmet.
Regensburg, im Herbst 2015
Volker Depkat
I Voreuropäische Zeit und Kontaktphase
1 Die ersten Amerikaner
Die Frage, wer die ersten Amerikaner waren, ist akademisch und identitätspolitisch brisant. Diese Brisanz hat sich in dem Maße erhöht, in dem der lange Zeit dominante Entwurf nationaler Identität, der die USA als ein im Kern weißes, angelsächsisches und protestantisches Land definierte, im Zuge der sogenannten Culture Wars in Frage gestellt worden ist. Mit dem Begriff ist eine in den 1950/60er Jahren mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung einsetzende Serie politisch-sozialer Kontroversen bezeichnet, durch die bislang marginalisierte ethnische Gruppen ihre eigene Sicht auf die Geschichte der USA formulierten und ihr Recht auf Eigenart jenseits des White, Anglo-Saxon, Protestant (WASP) Konsenses einforderten. Diese Entwicklung hat nicht nur die Augen geöffnet für die vielfältigen Einflüsse und Faktoren, die die US-amerikanische Kultur über Jahrhunderte geprägt haben. Sie hat auch die Frage nach den Geschichtsanfängen in Nordamerika neu gestellt und dem präkolumbischen Amerika, das heißt dem Amerika vor der Ankunft von Christoph Columbus im Jahr 1492, neue Relevanz verliehen.
Bis vor kurzem noch hätte eine Darstellung zur Geschichte der USA mit der Ankunft der ersten Europäer in Nordamerika eingesetzt. Das waren – je nach Perspektive und Ansicht des Historikers – entweder die ersten europäischen Entdeckungsreisenden, die um 1500 das Gebiet der späteren USA erstmals erkundeten, oder die ersten englischen Siedler, die sich am Beginn des 17. Jahrhunderts dauerhaft an der nordamerikanischen Atlantikküste niederließen. Die zentralen Daten in diesem Zusammenhang sind das Jahr 1607, das die Gründung von Jamestown, Virginia erlebte, und das Jahr 1620, in dem die puritanischen Pilgerväter auf der Mayflower im späteren Massachusetts anlandeten und Plymouth Plantation gründeten. Die indianischen Kulturen Nordamerikas bildeten in diesen Geschichtsbildern lange Zeit nur den Hintergrund, vor dem sich die von europäischen, zumal angelsächsischen Siedlern getragene und vorangetriebene Geschichte des Landes abspielte. Deshalb tauchten die Indianer in den einschlägigen Geschichtswerken erst dann auf, wenn sie im Begriff waren, durch das scheinbar unaufhaltsame Vordringen der europäisch-amerikanischen Lebensform verdrängt zu werden. Dieser Vorgang wurde dann meist als »Zivilisierung« einer ursprünglichen »Wildnis« beschrieben, als deren integraler Bestandteil die Indianer erschienen. Mit dieser Geschichtsdeutung untrennbar verknüpft ist die von den europäischen Siedlern selbst formulierte Ansicht, dass der nordamerikanische Kontinent bei ihrer Ankunft im Wesentlichen »leer« und »unberührt« gewesen sei. Allenfalls eine kleine Zahl von Jägern und Sammlern, die in isolierten Kleingruppen zusammenlebten, habe ihn bevölkert, und diese indianischen Gesellschaften seien seit ihren archaischen Anfängen im Kern unverändert geblieben. Erst die europäisch-amerikanische Besiedlung markierte demnach den Beginn von Geschichte auf dem Gebiet der späteren USA.
Dass das präkolumbische Amerika lange als »dunkle Zeit« erscheinen konnte, hat jedoch nicht nur etwas mit kulturell geprägten Perspektiven und Sinnstiftungsprozessen zu tun, sondern auch mit der Quellenlage. Eine auf schriftliche Zeugnisse fixierte Geschichtswissenschaft fand bei den indianischen Kulturen Nordamerikas nur wenig, aus dem sich ihre Geschichte bis zur Ankunft der Europäer rekonstruieren ließ; die in mündlichen Kulturen lebenden präkolumbischen Indianer haben nicht viel Schriftliches hinterlassen. Auch die Archäologie, das zweite große Materialreservoir der Geschichtswissenschaft, half im Falle Nordamerikas zunächst kaum weiter. Die Siedlungsformen der Indianer waren vielfältig, aber flüchtig im Charakter. Grashütten und Holzhäuser, Zelte und Erdhügel sind nicht sehr dauerhaft. Städte und Monumentalbauten, wie sie für die mittel- und südamerikanischen Indianerkulturen charakteristisch sind, gab es in Nordamerika bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht. Cahokia, in der Nähe des heutigen St. Louis, Missouri gelegen, war die einzige Stadt, die in Nordamerika vor dem 16. Jahrhundert bestand. Auch die im heutigen Nationalpark Mesa Verde im Südwesten Colorados gelegenen Großsiedlungen der Anasazikultur stellen spektakuläre Ausnahmen dar. In der Regel beschränken sich die von der Archäologie gefundenen Zeugnisse der materiellen Kultur auf Speerspitzen, Töpfe, Krüge, Hügelgräber samt Grabbeigaben, Schmuck, Feuerstellen sowie Fels- und Sandzeichnungen. So sprechend dieses Material im Einzelfall auch ist, für eine umfassende Rekonstruktion der amerikanischen Geschichte bis 1491 ist das zu wenig.
Erst seitdem sich die Geschichtswissenschaft die Erkenntnisse und Methoden der Linguistik, der Klima- und Umweltforschung, der Anthropologie, der Geographie, der Epidemiologie, der Genetik und der Entwicklungsbiologie zu eigen gemacht hat, ist einiges an Licht in die vermeintlich dunkle Zeit des präkolumbischen Nordamerika gekommen. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus – und das ist auch nach wie vor die plausibelste Theorie – dass Amerika während der letzten Eiszeit (ca. 33 000-10 700 v. Chr.) von Asien aus besiedelt worden ist. Wie und wann genau dies geschah, ist jedoch Gegenstand heftiger Kontroversen. Viele Theorien gehen davon aus, dass die ersten Amerikaner zu Fuß kamen, und zwar über eine Landbrücke zwischen Asien und Nordamerika in der Beringstraße. Auf dieser gelangten die ersten Menschen, die als eiszeitliche Großwildjäger den Mammuts, Mastodonten, Hirschelchen und Bisons nachzogen, nach Amerika. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ersten Amerikaner bereits um 13 000 v. Chr. in Beringia, der breiten Steppenebene zwischen dem heutigen Russland und Amerika, sowie Alaska angelangt waren, doch war ihnen der weitere Weg durch die riesigen Eismassen versperrt, die damals Kanada bedeckten. Mit der am Ende der letzten Eiszeit einsetzenden allmählichen Erwärmung des Klimas entstand entlang des Yukon-Flusses ein eisfreier Korridor, der ihnen den Weg über das kanadische Eisschild ins zentrale Tiefland Nordamerikas eröffnete.
Diese Theorie erhielt belastbare Beweise als in den 1930er Jahren in der Nähe der Stadt Clovis, New Mexico, steinerne Speerspitzen und andere steinzeitliche Jagdwerkzeuge gefunden wurden, die sich mit der C-14-Methode auf die Zeit von etwa 11 500 bis 10 900 v. Chr. datieren ließen. Das war der Beleg für eine paläoindianische Kultur, deren charakteristisch geformte Projektilspitzen aus Feuerstein in den folgenden Jahren auch an anderen Orten der USA gefunden wurden. Deshalb wurde die Clovis-Kultur bis in die 1980er Jahre hinein als die erste paläoindianische Kultur überhaupt gesehen. Sie breitete sich um 10 000 v. Chr. rasch im Gebiet der heutigen USA aus und gründete zentral in der Jagd auf eiszeitliches Großwild. Allerdings spielte auch das Sammeln von Früchten, Samen und Wildpflanzen eine wichtige Rolle.
Die » Clovis-These« wurde jedoch vielfach kritisiert. Diverse DNA-Analysen legten in den 1990er Jahren einen früheren Beginn der paläoindianischen Einwanderung nach Amerika nahe. Im Jahr 1994 kamen die Genetiker Douglas Wallace und James Neel nach der DNA-Analyse von 18 räumlich weit auseinanderlebenden zentralamerikanischen Indianergruppen zu dem Schluss, dass deren genetische Stammmütter bereits vor zwischen 28 000 und 20 000 v. Chr. nach Amerika eingewandert waren. Drei Jahre später ergaben die Analysen von Sandro L. Bonatto und Francisco M. Bolzano aus Porto Allegre, Brasilien, dass die ersten Amerikaner Asien bereits zwischen 41 000 und 31 000 v. Chr. verlassen haben mussten, also noch vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit.
Diese Ergebnisse, so unterschiedlich sie waren, befeuerten die seit längerer Zeit bereits geführte Diskussion über den Verlauf der paläoindianischen Migration. Die Forschungen des Sprachwissenschaftlers Joseph H. Greenberg kamen Mitte der 1980er Jahre zu einem unerwarteten Ergebnis: Nachdem er die verwirrende Vielfalt der rund 1200 Indianersprachen nach linguistischen Abstammungsverhältnissen untersucht und festgestellt hatte, dass sie sich in drei Sprachfamilien einteilen ließen, stellte er die These auf, dass sich die Migration in drei, zeitlich weit auseinander liegenden Wellen vollzogen habe. Greenberg stützte damit einerseits die » Clovis-These«, behauptete aber auch, dass die Clovis-Kultur nur auf die erste von insgesamt drei paläoindianischen Wanderungsbewegungen zurückgehe.
Greenbergs Drei-Wanderungen-Theorie löste heftige Kontroversen aus und motivierte unter anderem auch die genetischen Analysen der 1990er Jahre. Die schon erwähnten Bonatto und Bolzano kamen am Ende ihrer Untersuchungen zu dem Schluss, dass es nur eine asiatische Migrationswelle gegeben habe. Die von Asien nach Alaska gewanderte Gruppe habe sich dort geteilt. Ein Teil sei südlich weiter gezogen, während die anderen in Beringia geblieben seien, wo es sich damals gut habe leben lassen. Dort seien sie dann vom Eis für fast 20 000 Jahre eingeschlossen worden und dann in mehreren Wellen weitergezogen, als das Klima wärmer wurde. Demnach wurde Amerika von nur einer Gruppe von Paläoindianern besiedelt, dies aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So widersprüchlich die Ergebnisse und Theorien auch sind, sie müssen sich nicht unbedingt alle gegenseitig ausschließen. Die » Clovis-These« allerdings, die einen relativ späten und einmaligen Eintritt der Indianer am Ende der letzten Eiszeit postuliert, scheint inzwischen kaum noch haltbar zu sein. Vieles deutet darauf hin, dass die indianischen Kulturen in der westlichen Hemisphäre seit 20 000 vielleicht sogar schon seit 30 000 Jahren bestehen, dass die ersten Amerikaner auf mehreren Wegen auf den Kontinent gelangten und dass verschiedene Gruppen dies zu verschiedenen Zeiten taten.
Auf die Clovis-Kultur folgte die Folsom-Kultur, benannt nach den 1927 in der Nähe von Folsom, New Mexico, gefundenen steinernen Speerspitzen, die deutlich kleiner und filigraner gearbeitet waren als die Clovis-Projektile und die sich per C14-Methode auf zwischen 8900 und 8200 v. Chr. datieren ließen. Die gefundenen Zeugnisse deuten darauf hin, dass die Paläoindianer nun kleineres Wild jagten, vor allem Bisons, aber auch Waschbären und Hasen. Das Sammeln von Wildpflanzen, Früchten und Samen gewann an Bedeutung, und die zahlreichen in Höhlen gefundenen Mahlsteine zeigen, dass die Paläoindianer pflanzliche Nahrung zuzubereiten wussten. Als das eiszeitliche Großwild vor rund 12 000 Jahren auszusterben begann, vollzog sich der Wandel von den Großwildjagdkulturen zu einfacheren, nichtsesshaften Jäger-, Fischer- und Sammlerkulturen. Die weitere Ausdifferenzierung der indianischen Lebensformen in ganz verschiedene Kulturen fand ab ca. 2500 v. Chr. statt. Zwar blieben die nordamerikanischen Indianer im Vergleich zu denen Süd- und Mittelamerikas relativ rückständig, doch prägten sich im ersten Jahrtausend vor Christus auch in einigen Teilen Nordamerikas komplexere Lebensformen aus, und einige von ihnen entwickelten sich bis zum Beginn der europäischen Expansion an die Schwelle zur Hochkultur.
So umstritten die Forschungsergebnisse zur Geschichte des präkolumbischen Nordamerika im Einzelnen auch sind, sie deuten alle in eine Richtung: Am Vorabend der europäischen Expansion waren die indianischen Gesellschaften größer, älter und auch komplexer als lange Zeit angenommen.
2 Indianische Lebensformen
Nordamerika im Jahr 1491 war ein sich entwickelnder, sehr diverser Ort mit einer schillernden Vielfalt an indianischen Kulturen. Tausende von Sprachen wurden gesprochen, ganz unterschiedliche Formen der sozialen Organisation und des Wirtschaftens hatten sich ausgeprägt, und die religiösen Vorstellungen und Kulte deckten ein breites Spektrum ab. Einige indianische Gesellschaften lebten in dauerhaften Siedlungen umgeben von großen Mais-, Bohnen- und Kürbisfeldern. Andere zogen als nomadische Jäger und Sammler umher und wohnten in Grashütten oder Zelten, wieder andere Indianerkulturen stützen sich ausschließlich auf den Fischfang. Handelsnetze waren teils weit geknüpft. So sind beispielsweise Kupferschmuck aus dem Gebiet der Großen Seen im Südosten der USA gefunden worden, oder Muschelsorten vom Atlantik weit im Westen. Einige Gegenden in Nordamerika, vor allem die Küstenregionen im Osten und im Westen waren dicht besiedelt, die Great Plains hingegen waren vor der Einführung des Pferdes durch die Europäer im 16. Jahrhundert so gut wie menschenleer.
Die Anthropologie hat diese bunte Vielfalt indianischer Lebensformen mit dem Konzept des Kulturareals geordnet und klassifiziert. Ein Kulturareal ist ein Gebiet, dessen Indianerkulturen viele spezifische Gemeinsamkeiten aufweisen und sich zugleich markant von den Indianerkulturen in anderen Regionen unterscheiden. Damit wird unterstellt, dass die Vielfalt indianischer Lebensformen als Ergebnis hochkomplexer kultureller Anpassungsprozesse an die verschiedenen natürlichen Umwelten Nordamerikas zu begreifen ist. Allerdings sollte dies nicht zu einem deterministischen Denken führen, das die indianischen Lebensformen als allein durch die natürlichen Umweltbedingungen bestimmt sieht. Indem die Indianer ihre Lebensform an die Umweltbedingungen anpassten, wirkten sie zugleich auch wieder auf die natürliche Umwelt zurück. Nordamerika im Jahr 1491 war alles andere als ein unberührter, im Zustand ursprünglicher Wildnis verharrender Ort. In der anthropologischen Forschung kursieren mehrere Vorschläge zur Einteilung Nordamerikas in Kulturareale, die sich im Detail vielfach unterscheiden, die jedoch die zentralen Grundlinien gemeinsam haben. Folgende indianische Kulturareale sind demnach zu benennen: (1) die arktische Region, (2) die subarktische Region, (3) die Nordwestküste, (4) Kalifornien, (5) das Plateau und das Große Becken, (6) der Südwesten, (7) die Great Plains und (8) das östliche Waldland. Dieser Gliederung liegt im Kern der ethnographische Zustand aus der Zeit um 1500 zu Grunde, doch spiegelt sie auch Verhältnisse wider, wie sie sich ab etwa 2500 v. Chr. in ganz Nordamerika zu entwickeln begannen.
Das arktische Kulturareal umfasst das Küstengebiet von Westalaska bis Ostgrönland, die Aleuten und die Inseln des arktischen Archipels. In dieser extrem lebensfeindlichen Umwelt lebten die Aleuten und Inuit. Deren Kultur prägte sich zunächst in verschiedenen, eher unverbunden nebeneinander bestehenden Lokalvarianten aus, erfuhr dann aber mit der sich zwischen 1000 und 1200 n. Chr. von Alaska aus ausbreitenden Thule-Kultur einen Homogenisierungsschub, der zu einer relativ einheitlichen Inuit-Kultur entlang der arktischen Küste führte. Lebensform und Sozialstruktur der Inuit-Gesellschaft ankert in einer auf Jagd und Fischfang basierenden Subsistenzwirtschaft. Karibu, Robben, Walrosse und Wale bildeten in regionaler Differenzierung die wichtigste Nahrungsgrundlage. Mit dem Kayak und anderen Booten, dem von Hunden gezogenen Kufenschlitten, der Harpune, der Tranlampe und nicht zuletzt dem Iglu entwickelte die Inuit-Kultur ausgeklügelte technische Hilfsmittel, die das Überleben in der arktischen Tundra ermöglichten. Der Tauschhandel mit Karibu-Fellen und Robbenöl verband die Küsten-Inuit mit den im Binnenland lebenden Inuit-Gruppen, lange bevor die ersten Europäer nach Nordamerika kamen. Neben individuellen Handelsverbindungen lassen sich vor allem für Alaska auch überregionale Handelsmärkte feststellen, auf denen mit Waren aus allen Teilen der Arktis gehandelt wurde.
Die Gesellschaften, die sich im arktischen Kulturareal entwickelten, waren nur wenig komplex. Größere Stämme oder noch weiterreichende politische Einheiten gab es nicht. Das zentrale Element sozialer und politischer Ordnung war die Großfamilie und ihre blutsverwandtschaftlichen Beziehungen. Weit verstreute kleine Lager und dörfliche Siedlungen waren charakteristisch für die indianischen Lebensformen in der Arktis. Den sozialen und religiösen Mittelpunkt einer jeden Siedlung bildete das Qarigi oder Qasgiq, das Versammlungs-, Wohn- und Schlafhaus der Männer und Knaben einer Siedlung. Hier wurden Kontakte gepflegt, Boote und Jagdutensilien ausgebessert und die Séancen der Schamanen abgehalten. Der Platz der einzelnen Männer im Qasgiq wurde durch ihre soziale Stellung bestimmt, die über Alter, Ehestand und Reichtum definiert war. Insgesamt waren diese Siedlungseinheiten Solidar- und Jagdgemeinschaften mit flacher Hierarchie. Die größeren Beutetiere wurden als der gemeinsame Besitz aller betrachtet, während die kleineren zwischen den Jägern und anderen Mitgliedern der Siedlungsgemeinschaft geteilt wurden.
Entlang der pazifischen Küste von Südostalaska bis Nordkalifornien entfalteten sich seit etwa 4000 v. Chr. auf dem schmalen Landstreifen zwischen den Kordilleren und dem Meer die Überflussgesellschaften der Nordwestküsten-Indianer. Sie lebten fast ausschließlich vom Fischfang und bauten um ihn herum eine hochkomplexe und sehr effiziente Fischerkultur auf. Die zahlreichen Küstenflüsse und das Meer lieferten Fische im Überfluss, so dass der pazifische Nordwesten im Jahr 1491 mit zu den am dichtesten besiedelten Regionen Nordamerikas gehörte. Die Nordwestküsten-Indianer siedelten zumeist in Dörfern mit Häusern aus Zedernholz. Der Überfluss an Nahrungsmitteln in Kombination mit weitgehender Sesshaftigkeit führte zur Ausbildung komplexer gesellschaftlicher Strukturen mit vergleichsweise stark ausgeprägter sozialer Schichtung. Die dörflichen Gemeinschaften waren mit Klan- oder Sippenverbänden identisch. In ihnen gab es Häuptlinge, die als Oberhaupt die Gemeinschaft führten. Es gab eine meist aus den engeren Verwandten der Häuptlinge bestehende Führungselite, das einfache Volk und schließlich, als unterste Rangstufe, Sklaven, die gewöhnlich Kriegsgefangene waren. Rang und Prestige dokumentierten sich in der Fähigkeit, über Nahrungsmittel und Gebrauchsgüter, Sklaven und Luxusartikel zu verfügen. Die vergleichsweise weit vorangeschrittene soziale Differenzierung lässt sich auch an den hochentwickelten kunsthandwerklichen Fähigkeiten der Nordwestküsten-Indianer ablesen. Ihre Tierplastiken auf Masken und Totempfählen sind genauso berühmt wie ihre Reliefdarstellung und ihre Malerei. Dieser hohe Stand der Kunst deutet darauf hin, dass es Spezialisten gab, die von der Aufgabe der gemeinschaftlichen Nahrungsbeschaffung entbunden waren, um sich ganz dem Kunsthandwerk widmen zu können.
Zwischen der bewaldeten Küste Kaliforniens und der Sierra Nevada erstreckte sich das Kulturareal der kalifornischen Indianer. Hier gab es in voreuropäischer Zeit dichte Eichenwälder, so dass die Eichel als Hauptnahrungsmittel und eine um sie herum organisierte intensive Sammelwirtschaft charakteristisch für die indianischen Gesellschaften dieses Kulturareals waren. Hinzu kamen im Binnenland die Jagd sowie an den Flüssen und entlang der Küste der Fischfang. Die meisten Sammler im Gebiet des heutigen Kalifornien waren sesshaft und siedelten in Dörfern. Typisch waren autonome, verwandtschaftlich gefügte Lokalgruppen mit einem Häuptling an der Spitze. Dieser besaß jedoch eine vergleichsweise geringe Autorität; sie beruhte vielfach auf seiner religiösen Funktion als Hüter sakraler Gegenstände.
Das Gebiet zwischen dem Kaskadengebirge und der Sierra Nevada im Westen und den Rocky Mountains im Osten bildete das Kulturareal für die Indianerkulturen der Plateaus und des Großen Beckens. Es erstreckte sich von British Columbia über die heutigen Staaten Washington und Montana, Teile von Oregon und Idaho in das von Utah und Nevada gebildete Große Becken und reicht im Süden bis an das Colorado-Plateau heran. In dieser Trockensteppe wuchsen Büschelgräser und Kräuter, im Süden auch Kakteen und Yuccas. Dichtere Wälder gab es nur in den höheren Gebirgslagen. Der Norden bot vielfältige Möglichkeiten zum Fischen und Jagen. Hinzu kamen das Sammeln von Wildwurzeln und zahlreiche Beerenarten. Im Süden hingegen war die Natur karg. Deshalb bildeten Pinyon-Nüsse und Grassamen die Hauptnahrungsquelle der dort lebenden Indianer. Hinzu kam die Jagd auf Kleinwild, vor allem Hasen und Antilopen. Die Sozialstruktur der nicht-sesshaften Wildbeutergesellschaften dieses Kulturareals war labil, die Gesellschaften waren politisch und sozial kaum integriert. Hier verhinderte die ökonomisch notwendige Aufteilung in kleine und kleinste Sammelgruppen die Bildung größerer Gemeinschaften mit komplexeren Führungsstrukturen.
Im nordöstlichen Waldland, also auf dem riesigen Gebiet, das vom Sankt-Lorenz-Strom im Norden bis zum Cumberland-Fluss im Süden und vom Mississippi im Westen bis zur mittleren Atlantikküste reicht, lebten die Indianer zweier Sprachfamilien, die Irokesen und die Algonkin. Der dichte Mischwald, der dieses Gebiet vor der Ankunft der Europäer bedeckte, bot ein breites Angebot an Wildpflanzen sowie ein artenreiches Wildbret. Die zahlreichen Flüsse und der Atlantik steuerten eine große Vielfalt an Fisch bei, doch waren die meisten indianischen Bewohner des nördlichen Waldlandes Bodenbauern. Mais, Kürbis und Bohnen waren die Hauptanbaupflanzen in diesem Gebiet, manchmal wurde auch Tabak kultiviert. Die Indianer des nordöstlichen Waldlandes siedelten charakteristischerweise in Dörfern entlang der großen Flüsse. Ihre Siedlungen waren oft durch komplexe Netzwerke von Hauptsiedlungen, vorgelagerten Weilern und Jagdstützpunkten verbunden. Die Algonkin bauten sich kuppelförmige Wigwams, während die Irokesen in großen, rechteckigen Langhäusern mit Giebel- oder Tonnendach wohnten. Allerdings waren diese indianischen Siedlungsformen nicht so dauerhaft wie die europäischen: Wenn die Felder erschöpft waren, siedelten sich die indianischen Bodenbauern an anderer Stelle neu an. Dieses Wanderfeldbauerntum führte zu den komplexesten, stabilsten und raumgreifendsten Formen der politischen und sozialen Organisation im präkolumbischen Nordamerika. Das historisch wirkmächtigste Ergebnis dieser regionalen Bundestradition war die Konföderation der Irokesen, zu der sich die fünf Stämme der Onondaga, Mohawk, Oneida, Seneca und Cayuga um 1570 zusammenschlossen.
Das Kulturareal des südöstlichen Waldlandes erstreckt sich über das heutige North und South Carolina, Georgia, Alabama und Florida bis in Teile von Louisiana und Mississippi hinein. Auch die hier lebenden Indianer waren erfolgreiche Ackerbauern. Von Mexiko her war der seit etwa 1000 v. Chr. belegte Maisanbau in das südöstliche Waldland vorgedrungen. Jagd und Fischfang bereicherten ihren Speiseplan, so dass sich hier vergleichsweise große Gesellschaften ernähren konnten. Die indianischen Gesellschaften des südöstlichen Waldlandes waren sesshaft, und ihre Sozialordnung war hochkomplex und funktional differenziert. Das Kunsthandwerk war hier ähnlich hoch entwickelt wie an der Nordwestküste. Bereits um etwa 500 n. Chr. entstand im südöstlichen Waldland mit der Mississippi-Kultur eine bedeutende überregionale Kultur, die sich durch befestigte Siedlungen mit monumentalen Kultbauten und weitverzweigten Handelsbeziehungen sowie einen hohen Grad an politischer Organisation und scharf ausgeprägte soziale Hierarchien auszeichnete. Jedes größere Dorf hatte mit der Plaza ein kultisches Zentrum, wo sich neben den Zeremonial- und Versammlungshäusern auch der Ballspielplatz befand. Mit Cahokia brachte die Mississippi-Kultur die erste und einzige Stadt im präkolumbischen Nordamerika hervor. Gleichwohl ist über die politisch-territoriale Organisation der südöstlichen Waldlandstämme kaum etwas bekannt.
Wenngleich sich eine breite Vielfalt von Sozialformationen feststellen lässt, sind klar ausgebildete Hierarchien für die Gesellschaften des Südostens charakteristisch. Die Spitze wurde von einem oftmals erblichen Friedenshäuptling gebildet, der vielfach in seiner Person auch das Amt des höchsten Priesters vereinte. Ihm zur Seite stand eine fest etablierte Adelsschicht, die gleichermaßen politische wie religiöse Funktionselite war. Darunter gab es eine große Zahl gewöhnlicher Indianer, während Sklaven die unterste Schicht der sozialen Hierarchie bildeten. Besonders deutlich hatte sich diese theokratisch strukturierte Gesellschaft bei den Natchez und anderen Indianern des unteren Mississippi-Tales ausgeprägt. Die Natchez zelebrierten einen Sonnenkult und verehrten ihren als Gott geltenden obersten Häuptling als »Große Sonne«. Dieser Sonnengottglauben erfüllte staatsreligiöse Funktionen; er wurde von einer adligen Priesterkaste verwaltet, die zugleich auch die politische Führungsschicht der Gesellschaft war.
Der Nordwesten des heutigen Mexikos, die US-Bundesstaaten Arizona und New Mexico sowie die südlichen Teile von Utah und Colorado bildeten das südwestliche Kulturareal. Locker gestellte Büsche, Krüppelbäume, Yucca-Palmen und zahlreiche Kakteenarten prägen diese Trockensteppe, in der Wassermangel das existentielle Grundproblem schlechthin darstellt. Von allen Kulturarealen Nordamerikas enthielt der Südwesten das wohl breiteste Spektrum indianischer Lebensformen. Es reichte von halbnomadischen Jägern und Sammlern bis hin zu hochentwickelten sesshaften Gesellschaften, die Ackerbau betrieben und zu diesem Zweck ausgeklügelte künstliche Bewässerungssysteme entwickelten. Als einzige in Nordamerika kannten die Indianer des Südwestens bereits in voreuropäischer Zeit die Weberei.
Die Bodenbauer des Südwestens lebten entweder in Lehmhäusern oder in Pueblos, also in mehrstöckigen Komplexen von über- und nebeneinander gebauten kastenförmigen Häusern, die in präkolumbischer Zeit wohl keine Fenster besaßen und deren Eingang sich auf dem Dach befand. Nur über Leitern, die im Verteidigungsfall weggezogen wurden, konnte man das Innere der Pueblos erreichen. Auch die berühmten Cliff Dwellings von Mesa Verde sind eine Variante der Pueblo-Kultur.
Die politische und soziale Organisation der südwestlichen Indianerkulturen war kleinteilig. Jedes Pueblo und jede Siedlung war ein unabhängiger, hierarchisch strukturierter politisch-sozialer Verband. Eine Vereinigung der einzelnen Pueblo-Gemeinschaften zu größeren Verbänden lässt sich für den Südwesten nicht feststellen. An der Spitze eines Pueblos standen auf Lebenszeit gewählte Kultpriester, die sogenannten Kaziken, denen jeweils zwei Vertreter an die Seite gestellt waren. Zusammen bildeten der Kazike und seine beiden Vertreter die politische und kultische Führungsspitze des Pueblo-Verbandes.
Ab etwa 1300 n. Chr. kam es im Südwesten zu einem tiefgreifenden demographischen Strukturwandel. Von Norden her wanderten athapaskisch sprechende Stämme ein. Sie hatten sich von ihren Sprachverwandten in Nordwestkanada getrennt und waren am Ostrand der Rocky Mountains in das weitläufige Steppenland eingewandert. Im Kern rekrutierte sich diese Wanderungsbewegung aus Navajo und Apachen. Beides waren ursprünglich reine Jäger- und Sammlerkulturen, doch während die Apachen dies bis zum Beginn der Kontaktperiode mit den Europäern und darüber hinaus auch blieben, übernahmen die Navajo von den Pueblo-Indianern den Bodenbau, wurden sesshaft und gingen in frühkolonialer Zeit durch die Übernahme europäischer Haustiere (Ziege, Schaf, Rind, Pferd) erfolgreich zur Viehzucht über. Die Apachen hingegen blieben halbnomadische Wildbeuter, die weiterhin Bisons jagten und Früchte, Nüsse sowie Wurzeln sammelten.
Für das Bild vom nordamerikanischen Indianer als bisonjagendem, federschmucktragendem, tomahawkschwingendem, in Tipis wohnendem und überaus kühnem Reiterkrieger sind die indianischen Lebensformen des Kulturareals der Great Plains bis zum heutigen Tag prägend. Dabei ist dies die historisch jüngste und zugleich kurzlebigste aller indianischen Kulturformationen Nordamerikas. Sie entstand überhaupt erst im 17. Jahrhundert, als die Indianer das Pferd von den Europäern übernahmen.
Das Areal der Great Plains umfasst ein riesiges Steppen- und Savannengebiet, das sich von Zentralkanada im Norden bis zum Rio Grande im Süden, und vom Ostrand der Rocky Mountains bis zum Westrand des Mississippitales erstreckt. Diese große Ebene lässt sich noch einmal unterteilen in das Grasland der Prärien, das sich westlich des Mississippi durch die heutigen Staaten North und South Dakota, Minnesota, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma bis nach Arkansas erstreckt, und in die westlich sich daran anschließende Steppe der eigentlichen Plains.
In voreuropäischer Zeit waren die Plains das wohl am spärlichsten bevölkerte Gebiet Nordamerikas. Im Winter war sie mit Ausnahme eines dauerhaft bewohnten Gebietes im Süden so gut wie menschenleer, weil sich die Indianer in ihren Winterquartieren in den Tälern entlang der westlichen Berge und in den angrenzenden Waldgebieten aufhielten. Erst im Frühjahr gingen sie zur Bisonjagd auf die offenen Plains. Sie wohnten charakteristischerweise in Tipis, den berühmten kegelförmigen Stangenzelten mit einer Plane aus Bisonhäuten, die vielfach für die indianische Behausung schlechthin gehalten wird.
War in den Plains ein Ackerbau rein klimatisch schon nicht möglich, so ist für die Prärien der Anbau von Mais seit etwa Christi Geburt belegt. Um 1000 n. Chr. entstand in den südlichen Teilen eine Präriedorf-Kultur sesshafter Bodenbauern, von denen die Pawnee die bekanntesten sind. Die Prärie-Indianer bauten Mais, Bohnen, Kürbisse, Melonen und Tabak an. Insgesamt entstand auf den Prärien bereits in voreuropäischer Zeit eine dem östlichen Waldland vergleichbare indianische Kulturformation. Allerdings waren die Prärieindianer zu einem Gutteil auch von der Bisonjagd abhängig. Im Spätsommer und Winter gingen ganze Dörfer oder auch nur einzelne Gruppen gemeinschaftlich auf Bisonjagd. Als mobile Behausung diente ihnen das Tipi, das vor der Einführung des Pferdes von Hunden gezogen wurde und deshalb auch kleiner war als die Tipis des 18. und 19. Jahrhunderts. Außerhalb der Jagdsaison lebten die Prärie-Indianer in festen Siedlungen. Die nördlichen und zentralen Präriestämme wohnten in befestigten Dörfern aus großen, kuppelförmigen Erdhäusern; die südlichen Stämme der Prärien hingegen bauten Grashütten oder Holzhäuser. Im Allgemeinen waren die Siedlungen um einen großen Platz gruppiert, der religiös-kultischen Zwecken diente; daneben gab es große Versammlungshäuser, in der unter anderem der Stammesrat tagte.
Mit den nomadischen Jägern der Plains und den sesshaften Bodenbauern der Prärien bestanden somit bis ins 17. Jahrhundert hinein zwei ganz unterschiedliche Indianerkulturen auf dem Gebiet der Great Plains. Dann jedoch brachten die Spanier, als sie von Mexiko her kommend in das heutige Texas und New Mexico vordrangen, Pferde mit und richteten in Santa Fé und San Antonio Gestüte ein. Bereits in den 1630er Jahren gelangten die südlichen Ute und die Comanchen in den Besitz der Reittiere und machten sich daran, selbst Pferde zu züchten. Bald schon begann ein reger inner-indianischer, in Süd-Nord-Richtung verlaufender Pferdehandel, der dazu führte, dass die meisten Präriestämme bis etwa 1750 über Pferde verfügten. Das Pferd bedeutete einen ungeheuren Mobilitätsgewinn für die Indianer, die den Bisonherden nun einfacher und schneller folgen konnten. Ebenso erleichterte das Pferd den Transport von Menschen und Materialien. Insgesamt bewirkte dies auf den Great Plains einen großen Homogenisierungsschub: Alle dort lebenden Indianer wurden nun zu nomadischen Bisonjägern, selbst jene, die, wie beispielsweise die Cheyenne, bis dahin sesshafte Bodenbauern gewesen waren. Auch zogen jetzt zahlreiche Stämme aus den Prärien, dem östlichen Waldland und dem Nordwesten dauerhaft in die Plains, um dort Bisons zu jagen. Damit wurden die indianischen Gesellschaften der Great Plains vollständig vom Bison abhängig; sie aßen das Fleisch, stellten aus dem Fell und Leder Kleidung, Mokassins und die Zeltplane der Tipis her, drehten aus der Bisonwolle Stricke und Schnüre, nutzten die Bisonmägen als Wasserbehälter und gebrauchten die Sehnen der Bisons als Nähmaterial und für ihre Bogensehnen. Aus den Knochen machten sie Schaber, Spachtel und Ritzinstrumente, die Bisonhörner dienten als Schmuck auf der Pelzkappe und aus den Klauen kochten sie Leim. Kurz: es gab kein Teil des Bisons, das nicht irgendwie gebraucht und verarbeitet wurde. Diese vollständig vom Bison abhängige Lebensform war hochgradig fragil; sie verschwand als das Bison ausgerottet wurde.
Innerhalb der Vielfalt der indianischen Lebensformen des präkolumbischen Amerika, die hier in groben Zügen skizziert worden ist, werden einige gemeinsame Strukturen sichtbar, durch die sich indianische Herrschafts- und Gesellschaftsformen insgesamt von den europäischen unterschieden. Ins Auge sticht zunächst die hohe Bedeutung der auf Blutsverwandtschaft gründenden Großfamilie als Grundeinheit der sozialen Organisation. Untereinander waren die Großfamilien zu Klanen vernetzt, doch war dieses Netz in einigen Regionen sehr viel dichter geknüpft als in anderen. Mit Großfamilie und Klan sind die beiden zentralen Ordnungseinheiten indianischer Gesellschaften benannt, über die das Zusammenleben organisiert und Konflikte ausgetragen wurden. Der Grad sozialer Hierarchie hing vom Grad der Sesshaftigkeit ab; gänzlich hierarchielose indianische Gesellschaften gab es nicht.
Für die politische Organisation der Indianer ist festzustellen, dass es bis auf einige Ausnahmen keine großräumigen und interregional eng verknüpften Herrschaftsgebilde im präkolumbischen Nordamerika gab. Raumgreifende, durch eine mit weitreichenden administrativen Befugnissen und exekutiven Eingriffsrechten ausgestattete Zentralgewalt integrierte politische Herrschaftsverbände gab es außerhalb des nordöstlichen Waldlandes nicht. Und selbst dort war der Grad an Machtkonzentration relativ gering. Charakteristisch für die Organisation von Herrschaft bei indianischen Gesellschaften ist deshalb nicht die monokratische Machtkonzentration, sondern eher die Vermischung von Macht in einem horizontal wie vertikal weit verzweigten System von Ratsgremien mit unterschiedlich weit reichenden Befugnissen. Im Kern war Herrschaft bei den Indianern somit lokal konfiguriert und Macht eher dezentral organisiert. In vielen nordamerikanischen Stämmen gab es eine politische Gewaltenteilung zwischen Friedens- und Kriegshäuptlingen. Während der Friedenshäuptling in erster Linie für den Zusammenhalt des Stammes verantwortlich war, übernahm in Kriegszeiten ein Kriegshäuptling die Führung eines Stammes. Insgesamt ist festzustellen, dass nordamerikanische Indianer-Häuptlinge in der Regel keine Autokraten waren, sondern primär die Aufgabe hatten, in ihrer Gruppe den Frieden zu erhalten, für Ordnung zu sorgen und das Überleben ihrer Gruppe zu sichern. Die eigentliche Macht lag vielfach bei einem Stammesrat, der sich aus Männern zusammensetzte, die sich in Krieg und Frieden bewährt hatten und deshalb hoch angesehen waren.
Ein letztes charakteristisches Merkmal sei hervorgehoben: Die indianischen Gesellschaften waren nicht nur Überlebens- und Solidargemeinschaften, sondern auch Kultgemeinschaften, in denen spirituelle Autorität und soziale Hierarchie untrennbar miteinander verbunden waren. Der Verlust der Eliten zog deshalb leicht die Destabilisierung der gesamten Ordnung nach sich. Die Glaubensvorstellungen der Indianer waren so vielfältig wie die indianischen Lebensformen selbst. Was sie freilich alle verbindet, ist, dass sie sich kaum in die Begrifflichkeit des Christentums oder einer anderen Weltreligion übersetzen lassen. Bei aller Vielfalt sind den religiösen Vorstellungswelten der Indianer einige strukturelle Gemeinsamkeiten zu eigen. Da sind zunächst die indianischen Kosmogonien, also die Lehren von der Entstehung, der Organisation und der Entwicklung der Welt. Diese gründen in der Idee eines unauflöslichen Seinszusammenhangs, der die Menschen mit der belebten und unbelebten Natur zu einem komplexen Netzwerk von Familienbeziehungen verbindet. Indianische Kosmogonien verstehen das Verhältnis von Menschen und Tieren wie auch das von Menschen und Bäumen, Bergen, Flüssen oder Sternen als Verwandtschaftsbeziehung, die wechselseitige Rücksichtnahme erfordert. Die menschlichen Lebensformen werden in diesem Denken zu integralen Bestandteilen einer Umwelt, die Kultur und Natur gleichermaßen umfasst. Doch geht dieser alles umgreifende Seinszusammenhang weit über die materiell-sichtbare Welt hinaus. Er bezieht die immateriell-unsichtbare Welt mit ein, denn die Toten und die Noch-Gar-Nicht-Geborenen, die Geister und Götter stehen allesamt ebenfalls in einer Beziehung zu den jeweils lebenden Generationen.
Indianische Kosmogonien sehen die Welt durchdrungen von der allgegenwärtigen Kraft des Heiligen. Das erklärt den Reichtum an teilweise hochgradig spezialisierten Riten und Zeremonien, die den indianischen Alltag strukturieren, denn in diesen religiösen Akten wird die zeitlose Verbindung zwischen dem Einzelnen, seiner Gruppe, dem Universum und dem Heiligen hergestellt, erneuert und aufrechterhalten. Es gab so gut wie keinen Aspekt des täglichen Lebens der nordamerikanischen Indianer, der nicht religiös-rituell durchsetzt war. Selbst scheinbar rein weltliche Handlungen haben eine religiöse Dimension, denn die Ordnung des Universums kann angesichts der Allpräsenz des Heiligen bereits durch ein geringfügiges Fehlverhalten gestört werden. Diese Form der Religiosität war untrennbar mit dem Land verbunden, das die Indianer bewohnten. Es waren die Berge und Flüsse einer bestimmten Gegend, auf denen die religiösen Kulte der Indianer beruhten, viele der Jagdriten waren auf der Fauna einer Region gegründet, andere religiöse Praktiken machten sich an den jeweiligen Anbaupflanzen fest. Diese enge Bindung der Religiosität an eine spezifische Umwelt hatte nicht nur zur Folge, dass den nordamerikanischen Indianern der europäische Begriff des Privateigentums fremd war. Sie hatte vielmehr auch die Konsequenz, dass indianische Religiosität nicht so ohne weiteres an anderen Orten »lebbar« war. Deshalb war die Vertreibung der Indianer aus einer Gegend vielfach gleichbedeutend mit der Zerstörung der Grundlagen ihres religiösen Lebens und damit ihrer Kultur.
3 Entdeckungsgeschehen
Christoph Kolumbus war nicht der erste Europäer in Amerika. Die Wikinger waren schon rund 500 Jahre vor ihm da gewesen, als sie nämlich im Zuge der großen skandinavischen Expansion des 9./10. Jahrhunderts zunächst bis nach Grönland und dann auch nach Neufundland vorstießen. Der aus Island wegen Totschlags ausgewiesene Erich der Rote fand im Jahr 982 Grönland. Kurz danach entstanden an der dortigen Westküste zwei Streusiedlungen mit etwa 300 Höfen und 4000 Einwohnern, die rund 400 Jahre existierten. Von Grönland aus fuhren die Wikinger bis mindestens 1347 regelmäßig auf das nordamerikanische Festland, um Holz zu holen. Im Jahr 1000 strebten sie unter der Führung Leif Erikssons, ein Sohn Erichs des Roten, die Gründung dauerhafter Siedlungen in Neufundland an. Diese Niederlassungen der Wikinger bestanden jedoch offenbar nicht sehr lange, denn bis zum Beginn der europäischen Expansion im 16. Jahrhundert waren sie längst vergessen.
Eine neue, auf den bis dahin gültigen Landkarten gar nicht verzeichnete Welt wollte niemand im Europa des 15. Jahrhunderts entdecken. Es ging vielmehr darum, neue Seewege nach Indien zu finden, um daraus einerseits ökonomische Vorteile zu ziehen und andererseits Ansehen, Ruhm und Ehre zu gewinnen. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts begann Portugal mit der Erkundung westlicher Seerouten auf dem Atlantik, entdeckte Madeira, die Kanaren sowie die Azoren und unterwarf sie der portugiesischen Herrschaft. Im Jahr 1488 segelte Bartolomeu Diaz im Auftrag der portugiesischen Krone die afrikanische Atlantikküste nach Süden entlang, um das Kap der Guten Hoffnung herum und ein Stück in den indischen Ozean hinein. Neun Jahre später nahm Vasco da Gama dieselbe Route noch weiter nach Osten und gelangte nach Kalkutta. Damit war er der erste Europäer, der auf dem Seeweg nach Indien gelangt war. Um diesen Seeweg zu sichern, errichtete Portugal ein ganzes System von Befestigungsanlagen und Handelsstützpunkten entlang der afrikanischen Küste, und war dadurch in der Lage, den Handel mit Afrika und Asien zu kontrollieren und den bis dahin führenden italienischen Stadtstaaten Venedig und Genua den Rang streitig zu machen. Um ökonomisch nicht ins Hintertreffen zu geraten, bemühten sich andere europäische Handelsmächte in Zusammenarbeit mit einzelnen Entdecker-Abenteurern wie Christoph Kolumbus einer war, alternative Seewege nach Asien zu finden.
Kolumbus, im italienischen Genua geboren, war ehrgeizig, militant katholisch und einer der talentiertesten und kühnsten Seefahrer seiner Zeit. Getrieben von der Idee, einen westlichen Seeweg nach Asien zu finden, hatte er die Schriften von Marco Polo, Ptolemäus, Toscanelli und anderen Gelehrten verschlungen. Weil er selbst nicht genügend Geld hatte, um eine Expedition zur See auszurüsten, und auch keine privaten Sponsoren fand, wandte er sich an die Monarchen Europas mit der Bitte um Unterstützung. Die portugiesische Krone lehnte sein Ersuchen ebenso ab wie die englische und die französische, weil ihnen das Unternehmen als viel zu gewagt, zu teuer und nur wenig erfolgversprechend erschien. Beim spanischen Königspaar Ferdinand und Isabella stieß er jedoch nach mehreren Fehlschlägen auf offene Ohren. Die Aussicht, das portugiesische Monopol auf den Asienhandel zu brechen, war in ihren Augen unwiderstehlich, und selbst wenn Kolumbus die Seeroute nach Asien nicht fand, so entdeckte er doch vielleicht neue Inseln im Atlantik die ähnlich lukrativ waren wie die Kanaren oder die Azoren. Deshalb investierten Ferdinand und Isabella viel Geld in das Projekt des Kolumbus, so dass dieser am 3. August 1492 mit 90 Mann auf den drei Schiffen Santa Maria, Pinta und Santa Clara von Palos de la Frontera aus in See stechen konnte. Die Expedition segelte zunächst auf der bekannten Route zu den Kanaren und nahm dort Kurs nach Westen. Nach nur 36 Tagen erreichte Kolumbus am 12. Oktober 1492 die Insel Guanahani, die er San Salvador taufte. Von dort aus segelte er in südlicher Richtung weiter und fand die westindischen Inseln. Anschließend machte er sich auf den Heimweg und kehrte im März 1493 nach Spanien zurück.
Die Nachrichten von Kolumbus’ Entdeckungen verbreiteten sich dank einer so gezielten wie effizienten Medienarbeit rasch in ganz Europa. Dies löste eine rege Entdeckertätigkeit einzelner seefahrender Abenteurer aus, die gezielt von den Königshäusern in Spanien, Portugal, Frankreich und England unterstützt wurden. Die Modalitäten des Entdeckungs- und Inbesitznahmeverfahrens wiesen dabei überall vergleichbare Strukturen auf: In der Regel vergaben die Kronen von Spanien, Portugal, Frankreich und England Privilegien an interessierte Privatleute, die dann die Expeditionen organisierten und durchführten. Die Privilegien garantierten ihren Inhabern den Besitz des neu entdeckten Landes unter königlicher Oberhoheit und das Handelsmonopol in diesem Gebiet, sahen aber zugleich eine Beteiligung der Krone am Gewinn vor. In einer gemeinsamen Aktion von privater Initiative und staatlicher Förderung wurden so weitreichende Herrschaftsrechte in der »Neuen Welt« vergeben und Besitztitel begründet.
Das Entdeckungsgeschehen konzentrierte sich zunächst auf Mittel- und Südamerika, doch war auch der nördliche Teil der Hemisphäre von Beginn an im Blick der europäischen Entdecker. Dabei bestimmten zwei Dinge ihr Interesse an Nordamerika: die Suche nach Gold- und Silberschätzen, die denen in Süd- und Mittelamerika vergleichbar waren, und die Suche nach einer Nordwestpassage nach Asien. Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Atlantikküste Nordamerikas und zum Teil auch schon das Innere des Kontinents von Europäern bereist und erforscht. Portugal machte in Nordamerika den Anfang. Wohl im Jahr 1499 entdeckte der Portugiese Joào Fernandes Lavrador Grönland wieder und nannte es Tiera des Lavrador (Lavradors Land). 1501 ging sein Landsmann Gaspar Corte Real in der Gegend von Neufundland verloren, ebenso 1502 sein ihn dort suchender Bruder Miguel. Unter Führung von Juan Fagundes versuchte Portugal in den folgenden Jahren sogar, in Neufundland eine Siedlung zu gründen, doch war dem Unternehmen auf Cape Breton kein Erfolg beschieden. Allerdings entwickelte sich Neufundland im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts zu einem sehr ertragreichen Fischfanggebiet, in dem vor allem portugiesische und französische Fischer ihre Sommer verbrachten und zu diesem Zweck kleine Holzhaussiedlungen als Sommerlager errichteten.
In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts beteiligten sich auch die Spanier an der Erkundung Nordamerikas. Sie stießen von Haiti und Kuba aus über den Golf von Mexiko nach Nordamerika vor. So entdeckte Juan Ponce de León im Jahr 1513 Florida. 1521 segelte Francisco de Gordillo die nordamerikanische Küste bis nach South Carolina nordwärts, und 1524 erkundete der Spanier Estévan Gómez im Auftrag des spanischen Königs Karl V. die nordamerikanische Küste zwischen Maine und der Sankt-Lorenz-Mündung. Im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts erkundeten spanische Expeditionen das nordamerikanische Festland auf dem Landweg. Dabei stießen sie tief in das Landesinnere des Kontinents vor. Hernando de Soto startete im Jahr 1539 in Florida seinen bis 1542 dauernden ausgedehnten Expeditionsmarsch durch den Südosten der heutigen USA. Dabei gelangte er über das Mississippigebiet bis ins heutige Oklahoma und von dort bis zur texanischen Küste am Golf von Mexiko. Etwa zur gleichen Zeit stieß Francisco Vázquez de Coronado vom mexikanischen Festland aus in den Südwesten der heutigen USA vor; zwischen 1540 und 1542 gelangte er über das heutige Arizona und New Mexico bis hinein nach Kansas und erreichte sogar den Missouri. Allerdings führten alle diese Aktionen zu keiner nachhaltigen Durchdringung Nordamerikas durch Spanien.
Anfangs machte auch England beim Wettlauf der europäischen Mächte um den amerikanischen Kontinent mit. Im Jahr 1496 nahm Heinrich VII. von England den Venezianer Giovanni Caboto, der auf der Insel John Cabot hieß, in seine Dienste und rüstete ihn für eine Expedition nach Amerika aus. Cabot erreichte 1497 Neufundland, glaubte aber, sich in China zu befinden. Ein Jahr später brach er zu einer weiteren Expedition auf, von der er jedoch nicht wiederkehrte. Danach verlor England für rund 70 Jahre das Interesse an einem weiteren Engagement in Amerika und griff aufgrund der Reformation und außenpolitischer Überlegungen gegenüber Spanien erst im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts wieder ins Geschehen ein. Zu dieser Zeit wurden in England die Stimmen lauter, die meinten, England solle eigene Niederlassungen in Nordamerika gründen, um dort nicht ins Hintertreffen zu geraten. Zur treibenden Kraft der Kolonisierungsbemühungen entwickelte sich Sir Humphrey Gilbert, der sich bei der Krone zielstrebig um ein Entdeckerpatent bemühte. Am 11. Juni 1578 erhielt er von der englischen Königin eine bis zum 11. Juni 1584 gültige Charter (ein königliches Patent, das dem Landnehmer besondere Rechte zur Ausbeutung des Landes zusicherte), die ihn zur Inbesitznahme und Besiedlung allen unbesetzten Landes zwischen Labrador und Florida ermächtigte und ihm das Handelsmonopol sowie die Rechte eines Vizekönigs in diesem Gebiet verlieh. Das war der Beginn der offiziellen Kolonialpolitik Englands in Nordamerika. Nachdem Gilbert fünf Jahre lang vergeblich versucht hatte, die Küste Nordamerikas zu erreichen, segelte er 1583 nach Neufundland und nahm es für die englische Krone in Besitz. Von dieser Reise kehrte er jedoch nicht mehr in seine Heimat zurück.
Gilberts Erbe war sein Halbbruder Sir Walter Raleigh, der, ähnlich militant anti-katholisch eingestellt wie Gilbert, bei Elisabeth I. ebenfalls in hoher Gunst stand. Er bemühte sich erfolgreich um die Verlängerung der Gilbert gewährten Charter um weitere sechs Jahre und erreichte zugleich, dass sie nun auf seinen, Raleighs, Namen ausgestellt wurde. Am 25. Mai 1584 kam die Königin dieser Bitte nach, und Raleigh begann sofort mit der Vorbereitung für eine Expeditionsreise nach Nordamerika. Noch im Sommer 1584 entsandte er zwei Schiffe, die einen geeigneten Platz für die Gründung einer Siedlung finden sollten. Bei Roanoke Island im heutigen North Carolina fanden sie einen solchen Siedlungsplatz, der auch strategisch günstig gelegen war, weil er sehr nah an die spanischen Besitzungen in Florida heranreichte und damit eine ideale Operationsbasis für Kaperfahrten oder weiter gehende militärische Abenteuer bot. Umgehend ließ Raleigh den Bericht seiner Kundschafter drucken, und die auf Raleighs Wunsch vom anglikanischen Geistlichen Richard Hakluyt verfasste Schrift A Discourse Concerning Western Planting tat ein Übriges, um die Stimmung in England für ein Kolonialabenteuer zu bereiten. Am 9. April 1585 verließen die von Raleigh gesponserten Sir Richard Grenville und Ralph Lane mit sechs Schiffen und 600 Leuten England, um in Roanoke die erste englische Siedlung zu gründen.
Zunächst wurden die Europäer von den Indianern freundlich empfangen und mit Lebensmitteln versorgt. Doch bereits im Winter hatten sich die europäisch-indianischen Beziehungen ins gerade Gegenteil verkehrt. Die englischen Siedler waren vollständig von der Versorgung durch die Indianer abhängig und erwarteten auch, dass die Indianer ihnen Lebensmittel brachten. Das stellte eine existentielle Belastung für die Indianer dar, die gerade genug hatten, um sich selbst zu versorgen. In den daraus entstehenden Konflikten töteten die englischen Siedler mehrere Indianer. Zahlreiche Konflikte innerhalb der englischen Siedlergemeinschaft verschärften die Situation, und die wiederholten Attacken der Spanier taten ein Übriges. Als Sir Francis Drake im Sommer 1586 vor Roanoke aufkreuzte, gingen viele Siedler mit ihm zurück nach England. Die Versorgung der Siedlung blieb schwierig; der offene Konflikt mit Spanien hinderte englische Schiffe wiederholt daran, die Kolonie mit Nachschub zu versorgen, und als dann endlich eine Nachschubexpedition 1590 in Roanoke ankam, fand sie die erste englische Siedlung auf dem nordamerikanischen Kontinent verlassen vor.
Es führt also keine direkte Linie von der »Entdeckung« Amerikas durch Kolumbus zur Gründung dauerhafter englischer Kolonien in Nordamerika. Allerdings begründeten die europäischen Mächte durch die Entdeckungsfahrten Rechts- und Besitzansprüche in Nordamerika, die sie penibel auf Landkarten dokumentierten. Weil Nordamerika damit immer mehr zu einem Ort wurde, auf dem die Konkurrenz der europäischen Mächte ihre Fortsetzung fand, gingen Entdeckungsfahrten und Siedlungsprojekte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine immer engere Verbindung ein. Freilich war diesen Siedlungsprojekten im 16. Jahrhundert noch keine lange Dauer beschieden. Deshalb ist es sinnvoll, die Jahre von 1492 bis 1607 als eigene Zeit zu reflektieren, in der die Zukunft Nordamerikas sehr offen war.
II Das koloniale Britisch Nordamerika
1 Koloniale Experimente
Mit der Gründung von Jamestown, Virginia, am 13. Mai 1607 begann ein neuer Abschnitt der amerikanischen Geschichte. Die relative Einheit dieser Epoche ist durch die Etablierung und das rasche Wachstum dauerhafter englisch-europäischer Siedlungen auf dem Gebiet der späteren USA sowie die Ausbildung eines funktionierenden Regierungs- und Verwaltungssystems im Kontext des englischen Herrschaftsverbandes bestimmt. Diese Periodisierung lässt zwar außer Acht, dass die Spanier mit St. Augustine, Florida, bereits 1565 die erste dauerhafte europäische Siedlung auf dem Gebiet der späteren USA ins Leben riefen. Gleichwohl scheint es gerechtfertigt, das Jahr 1607 an den Anfang der amerikanischen Kolonialgeschichte zu setzen, denn die Amerikanische Revolution, die am Ende der Kolonialzeit steht, erwuchs aus den historischen Kontexten und Erfahrungen des britischen Herrschaftsbereiches in Nordamerika. Gleichzeitig liegen einige der stärksten Wurzeln der Kultur des Liberalismus, der Selbstregierung und des ethnisch-religiösen Pluralismus, die einen Gutteil der spezifischen Modernität der USA ausmachen, im Grund des kolonialen Britisch Nordamerika.
Gleichwohl sollten Historiker sich davor hüten, die Jahre von 1607 bis 1763 als bloße Vorgeschichte der amerikanischen Nationalgeschichte, die mit der Unabhängigkeitserklärung der USA am 4. Juli 1776 beginnt, zu reflektieren, so wie es bis etwa 1980 meist getan worden ist. Seitdem ist kaum eine historische Periode derart grundlegend neu bewertet worden wie die Kolonialzeit. Im Zentrum stehen nunmehr die soziale, kulturelle, ökonomische und regionale Vielfalt des kolonialen Nordamerika sowie die politisch-sozialen Konflikte innerhalb und zwischen den einzelnen Kolonien. Auch sind die vielfältigen Beziehungs- und Verflechtungsgeschichten der Kolonien sowohl mit Europa und Afrika als auch mit den Indianern und anderen nicht-englischen Gesellschaften und Kulturen Nordamerikas ins Blickfeld gerückt. Vor allem aber wird die Offenheit der historischen Entwicklung in Britisch Nordamerika nun stärker betont. Etwas überspitzt könnte man formulieren, dass inzwischen die Amerikanische Revolution das Phänomen ist, das vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte als eher unwahrscheinlich problematisiert werden muss.
Von zentraler Bedeutung für den Prozess der englischen Kolonisation Nordamerikas ist der Begriff der Siedlungskolonie. Damit ist ein ganz eigener Typus von Herrschaft benannt, der die spezifische Eigenart der Entwicklung des kolonialen Britisch Nordamerika gerade auch im Unterschied zum spanischen, portugiesischen und französischen Nordamerika zu einem Gutteil erklärt. Eine Siedlungskolonie ist ein überseeisches Herrschaftsgebiet, das von Beginn an für die systematische Besiedlung durch eine große Zahl europäischer Einwanderer vorgesehen war. Dieser Besiedlungsprozess wurde vom Mutterland militärisch zwar begleitet, die militärische Eroberung ging jedoch der Koloniegründung nicht voraus. Vielmehr sollte die Besiedlung der Kolonien die militärische Eroberung überflüssig machen; es ging um die Beherrschung von Territorium durch Siedler, nicht durch Soldaten. Siedlungskolonien zielten auf die langfristige, profitorientierte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und des in großen Mengen verfügbaren, billigen Landes ab. Die europäischen Einwanderer sollten das Land urbar machen und es dann landwirtschaftlich nutzen. Damit wird die Verwandlung von ökonomisch nutzloser »Wildnis« in nutzbares Agrarland durch die Arbeit der eingewanderten Siedler zum erklärten Ziel von Siedlungskolonien. Anders als im spanischen und portugiesischen Herrschaftsbereich wurden die Arbeitskräfte im kolonialen Britisch Nordamerika nicht aus der indianischen Bevölkerung, sondern aus der europäischen Einwanderung rekrutiert.