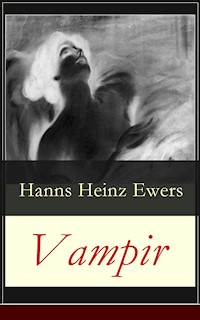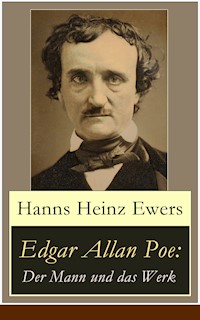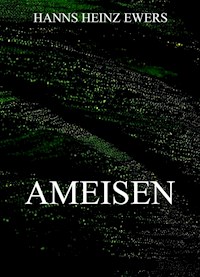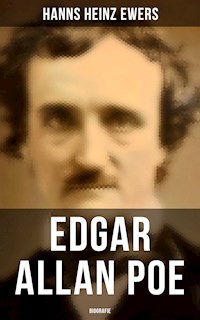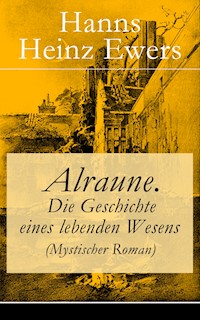3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ewers ist ein Meister des Phantastisch-Makabren, des Bizarr-Gräßlichen. In seinen Novellen kreist er um Liebe und Tod als Zentralthemen – bei ihm wird auf ungewöhnliche, entsetzliche Art geliebt und gestorben. Ewers schildert mit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen die Nachtseiten menschlicher Psyche. Er schildert Charaktere, die Grauen erwecken, die schaudern lassen und in ihrer Abseitigkeit dennoch faszinieren. Vor allem mit seiner »Alraune« machte Ewers Furore. Doch nicht weniger interessant, ja vielleicht teilweise noch bemerkenswerter sind seine Erzählungen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Ähnliche
Hanns Heinz Ewers
Geschichten des Grauens
FISCHER E-Books
Inhalt
Die vorliegenden Erzählungen wurden, in leicht gekürzter Form, den Bänden ›Die Besessenen‹ (1909), ›Nachtmahr‹ (1922) und ›Der Zauberlehrling‹ (1910), entnommen, alle erschienen im Georg Müller Verlag, München.
Der schlimmste Verrat
Man nannte ihn: Stephe. Das kam, weil sein Vorgänger so hieß; da hatte der alte Totengräber, viel zu faul, sich an einen andern Namen zu gewöhnen, dem neuen Gehilfen gesagt: »Ich nenn’ dich Stephe.«
In Ägypten geschah das. Nicht am Nil – im Staate Illinois. Im südlichen Teil: der heißt »Ägypten«, weil ein wildes Gemisch schlechter Rassen dort durcheinander wohnt. Schlechter, niederer Rassen – oder doch was der Amerikaner so ansieht: Kroaten, Slowaken, Ungarn, Tschechen, Walachen, Slowenen, Russen, Griechen, Italiener und Ukrainer. Aber der Yankee kennt diese Namen nicht; er hört nur, daß sie alle nicht englisch sprechen, sondern irgendein wirres Durcheinander – das ist wie in Babel nach dem Turmbau. Und Babel, ja, das war in Ägypten, nicht wahr? Oder doch irgendwo daherum in der Nähe. Darum nennt er das weite Land Ägypten.
Der Amerikaner ist der Herr. Ihm gehört das Land, ihm alle die Bergwerke und Hütten und Zechen. Die »Ägypter« sind seine Sklaven. Die Negersklaven im Süden sind frei seit einem halben Jahrhundert – sie brauchen nicht mehr zu arbeiten; die Weißen aber, die Europa ausspie, die müssen arbeiten. Und wenn sie nicht wollen, wenn sie streiken, dann läßt der Herr Maschinengewehre auffahren. Schießt ein paar Dutzend tot, sperrt andere ins Zuchthaus – im Namen der Freiheit. In Ägypten und überall im Land.
Freilich, einige der Ägypter sind klug. Sie scharren ein wenig Geld zusammen, dann mehr und noch mehr. Werden schließlich selbst Amerikaner und Herrn. Freigelassene: nicht sozial gleichberechtigt, o nein – aber doch wirtschaftlich. Und die sind die schlimmsten; die verstehn es am besten, auch den letzten Saft aus den Sklaven herauszupressen.
Der Name der kleinen Stadt, vor der Stephe wohnte, klang gar nicht ägyptisch. Auch nicht englisch, auch nicht indianisch. Klang deutsch: Andernach. Hier hatten einmal pfälzische und rheinische Bauern gesessen vor langen Jahren – kein Mensch wußte mehr, wann das gewesen war. Aber sie waren längst fortgezogen, eine Familie um die andere, als die Industrie kam und mit ihr die Ägypter. Und nur ganz wenige der alten Siedler waren zurückgeblieben, zwei, drei deutsche Namen: die waren auch längst Amerikaner geworden. Reiche Herrn.
Dennoch: die Stadt sah anders aus, als alle andern ringsum. Keine Holzbaracken, keine Wellblechhütten. Richtige Ziegelsteinhäuser, mit Reben bewachsen; Gärten drumherum, Apfelbäume, Birnbäume, Kirschbäume. Die niederen Rassen begriffen recht gut den Unterschied; zerstörten nichts; bauten hinzu, Häuser und Gärten; fühlten sich ein wenig als Menschen in Andernach – viel, viel mehr, als irgendwo sonst im Ägypterland.
Draußen, vor der Stadt, lag der Friedhof. Der war noch deutscher als die Stadt. Große Eichen standen da und manche Trauerweiden. Fast in der Mitte, einen kleinen Hügel hinauf, lagen die deutschen Gräber, und man las die Namen: Schmitz, Schulze und Huber. Sehr einfach alle Steine, aber gut gepflegt, so daß der Efeu, der allen Boden deckte, sie nirgends überwucherte. Eigentlich gehörte der Friedhof niemandem, keiner Glaubensgemeinschaft und keinem der Stämme der Ägypter. Die benutzten ihn alle – und bezahlten dafür an den alten Totengräber: der war der Herr. Zweimal im Jahr zahlte ihm die Bank der Stadt einen Scheck aus, aus Chicago überwiesen, oder war es aus San Francisco? Als die Deutschen wegzogen, verkauften sie, einer um den andern, Haus und Garten – aber den Friedhof nicht. Den konnte keiner verkaufen – und so erwarb ihn auch niemand. Aber einer aus Andernach, irgendein Schmitz oder Huber oder Schulze, der längst gestorben war, hatte ein gutes Vermächtnis gemacht: dessen Zinsen erhielt für seine Arbeit der alte Totengräber. So war er der Platzhalter von Toten, die für sich selber zahlten, war der Herr in seinem Land – und als solchen betrachteten ihn die Ägypter. Er verkaufte ihnen Grabstätten, nahm viel oder wenig, wie er grade wollte, schrieb Kreuze und Steine und Säulen nach seinem Geschmack und aus seiner Werkstatt vor.
Ein Böhme war er, Pawlaczek hieß er. War früh hinüber gekommen, hatte hier noch gehaust mit den Deutschen und war nun lange schon der Älteste in der Stadt. Sein Tschechisch hatte er vergessen durch vierzig lange Jahre, dann mühsam wiedergefunden, als die Ägypter kamen. Und sein Deutsch und Englisch warf er in einen Topf und machte einen fettigen Brei daraus. Er hatte eine Werkstatt für Grabsteine und darin fünf italienische Steinmetzen. Hatte sechs Gärtner und ebensoviel Totengräber.
Einer davon war Stephe.
Stephe war kein Ägypter. Stephe war Amerikaner. Er hieß eigentlich Howard Jay Hammond, stammte aus Petersham, Mass.; zählte dreiundvierzig Jahre, als ihm dies geschah.
Der, der es niederschrieb, bruchstückweise, wie er es herausholte von Stephe, der es zum Teil selbst miterlebte, war Jan Olieslagers aus Limburg. Holländischer Nationalität also – doch ein Vlame. Und, in Kultur und Erziehung, deutsch. In deutschem Interesse hatte er während des Krieges gearbeitet, galt dann, als die Vereinigten Staaten auch losschlugen, als sehr verdächtig. Rechts und links wurden die Deutschen im Lande verhaftet und ins Gefängnis geworfen, viele davon seine guten Freunde. Jan Olieslagers sehnte sich wenig nach dem Zuchthaus – hielt es für angebracht, eine Zeitlang von Neuyork zu verschwinden.
So kam er nach Andernach ins Ägypterland. Große Farbwerke waren bei der Stadt, dort stellte sich Olieslagers vor. Er verstand nur herzlich wenig von Chemie – aber er verstand es gut, den Anschein zu erwecken, als ob er etwas verstehe. Er kannte, sehr oberflächlich nur, den leitenden Direktor von Neuyork her; der wußte, daß er »Doctor« angeredet wurde und irgendwas mit der deutschen Sache zu tun hatte. So glaubte er einen sehr guten Fang zu tun: einen großen deutschen Chemiker, der manches Geheimnis kannte. Dafür konnte man schon eine Weile die Hand über ihn halten – was lag an dem einen Deutschen? Hier in Andernach konnte er gewiß kein Unheil anrichten. Freilich, seinen Vorteil nutzte er aus, zahlte dem neuen Chemiker nur knapp das, was zum Leben eben notwendig war, wies ihm ein kleines Zimmer in der Fabrik an.
Jan Olieslagers lungerte im Laboratorium herum, rührte nicht eine Hand. Endlich zur Rede gestellt, erklärte er, daß er nicht daran denken würde, unter jemandem zu arbeiten. Er müsse seine eigenen Räume haben – und niemand dürfe ihm hineinpfuschen. Und so groß war, hier wie überall im Lande, die Hochachtung vor deutscher Wissenschaft, daß man seinen Wünschen nachkam, alles tat, um baldmöglichst große Erfolge durch ihn zu erzielen.
Ein gutes Gedächtnis hatte der Vlame. Schnappte schnell Worte auf, griff ein paar schöne Phrasen; las sich bald aus den Büchern der Fabriksbibliothek eine buntlappige Gelehrsamkeit zusammen. Dann sandte er Bestellungen aus – aus aller Welt mußte dieses und jenes besorgt werden. So zog er die Wochen hin und die Monate.
Er verkehrte mit niemandem. Nur zum Abend ging er aus, sich die Beine zu strecken – kam dann gewöhnlich zum Friedhof.
Dort hatte er Stephe kennengelernt.
Aus dem, was Jan Olieslagers niederschrieb, ist diese Geschichte gemacht.
Jan Olieslagers saß mit Stephe manchen Abend auf der Steinbank unter dem alten Lindenbaum. Stephe hatte ein Geheimnis – das ärgerte den Vlamen. Er fühlte es: es war ein Besonderes; so wollte er’s gerne wissen. Aber Stephe sagte überhaupt nicht viel; durch Stunden saßen die zwei, ohne ein Wort zu sprechen. Olieslagers konnte nicht recht heran an den Kerl. Er suchte, suchte und fand nirgends eine Tür. Stephe trank nicht, rauchte nicht, kaute nicht und mit Weibern hatte er schon gar nichts. – Was kann man machen mit so einem?
Was Jan Olieslagers hinzog zu Stephe, hätte er in diesen Monaten schwer sagen können. Es war nichts Auffallendes an ihm. Wenn er jemals einen Paß gebraucht hätte, hätte man hineingeschrieben: Haar – braun. Stirne, Nase, Kinn, Ohren – gewöhnlich. Doch war er hübsch – etwas war da, das ihn hübsch machte.
Eines war gewiß: etwas gab es, das diesen Menschen unablässig beschäftigte. Das war immer da, stärker manchmal und oft nur ganz schwach – aber es verließ ihn nie. Oder nur dann, wenn es, in seltenen Intervallen, Jan Olieslagers gelang, Stephes Gedanken auf etwas anderes zu lenken. So, wenn Stephe, abgebrochen, ohne Zusammenhang, seinem schwachen Gedächtnis kleinste Brocken aus seinem früheren Leben sich entreißen ließ.
Ja, aus Massachusetts stammte er; von methodistischen Eltern. Hatte nicht viel gelernt, kam früh weg, trieb sich überall im Lande herum. War alles gewesen, was man so sein kann, ohne etwas zu können. Liftjunge, Geschirrwäscher, Zettelverteiler, Heizer auf einem Dampfer der großen Seen, Kuhjunge in Arizona, Platzanweiser in Kinos. Er hatte in allen möglichen Fabriken gearbeitet und in ebensovielen Farmen, von Vancouver bis San Augustin und von Los Angeles bis Halifax. Nirgends hatte er es lange ausgehalten; war dazwischen immer wieder herumgezogen als Streikbrecher und als Landstreicher. Jetzt aber, seit über zwei Jahren schon, hatte er seinen Beruf entdeckt: dieser Job in Andernach gefiel ihm gut, hier würde er bleiben sein Leben lang.
Wie Stephe das sagte, flackerten kleine Flämmchen in seinen Augen, und über die Lippen kroch mühsam ein Lächeln. Dann saß er wieder und sann und sprach kein Wort.
Olieslagers begriff: hier war es. War das schwere, siebenmal vergitterte Tor – und dahinter kauerte das seltsame Tier.
Dann kam die Musterung. Alle Männer mußten sich melden zum Militär, von achtzehn bis zu fünfundvierzig Jahren.
Stephe wurde unruhig – und diese Unruhe steigerte sich mit jedem Tag. »Warum willst du nicht Soldat werden?« fragte Olieslagers. Stephe schüttelte den Kopf, sehr entschlossen. »Nein«, brummte er, »nein.«
Und ein andermal sagte er: »Das ist es – ich will nicht weg von hier.«
Sonntag morgens klopfte er an die Tür des Laboratoriums, schloß sie sorgfältig, überzeugte sich, daß der Vlame allein war. Dann kam er heraus mit seinem Anliegen. Am Mittwoch müsse er sich stellen. Da möge der Doktor ihm was geben, daß er krank erscheine. Untauglich. Er wolle nicht fort von hier. Könne nicht.
Jan Olieslagers überlegte nicht lange, sagte ihm zu im Augenblick. Nur eine Bedingung stellte er: zum Entgelt müsse Stephe ihm sagen, was denn eigentlich ihn hier festhalte?
Stephe schielte zu ihm hinauf; mißtrauisch genug. »Nein«, sagte er endlich. Und ging. Am nächsten Tag suchte ihn Olieslagers auf dem Friedhof auf. Diesmal sprach er lange auf ihn ein, versuchte ihn zu überreden mit allen Künsten. Aber Stephe wollte nicht.
»Schau!« rief der Vlame. »Du hast ein Geheimnis. Ich bin neugierig, ich will es wissen. Also sag mir’s. Das kostet nichts. Und am Mittwoch ist kein Mensch zum Soldaten untauglicher als du.« Stephe schüttelte ruhig den Kopf. Stand auf von der Bank.
Aber am anderen Morgen war er sehr früh im Laboratorium. Er zog Scheine aus der Tasche, zweihundertdreißig Dollars, erspartes Geld. Der Vlame wies ihm die Tür.
Dann, zum Abend, kam der wieder auf den Friedhof. Er traf Stephe nicht auf der gewohnten Bank, so wartete er eine Zeitlang, ging dann, ihn zu suchen. Fand ihn endlich, auf einem frischen Grab sitzend, vor sich hin brütend. Er rief ihn an: »Komm, Stephe.«
Stephe rührte sich nicht. Da ging der Vlame nahe heran, schlug ihn auf die Schulter. »Steh auf! Komm! Ich will dir geben, was du haben willst!«
Langsam erhob sich der Totengräber. »Gleich?« fragte er. »Morgen ist Ziehung.«
Der Vlame nickte. »Wächst Digitalis irgendwo?« – Stephe verstand ihn nicht. – »Fingerhut, meine ich.« Stephe führte ihn, brach die Blüten auf das Geheiß des Vlamen.
»Wo wohnst du?« fragte Jan Olieslagers.
Stephe ging voraus. Sie kamen, mitten im Totengarten, an das kleine steinerne Beinhaus. Stephe zog einen großen Schlüssel aus der Tasche, schloß auf.
Sie traten ein. In einer Ecke standen ein paar Spaten, Hacken und Schaufeln, hinten lagen leere Säcke. Sonst war nichts in dem Raum. –
»Hier wohnst du?« fragte der Vlame.
Stephe schloß eine zweite Tür auf, die in ein kleines Zimmer führte. »Hier«, nickte er.
Ein Feldbett, ein kleiner Tisch, ein paar Stühle, ein Waschbecken auf einem. Ein alter Koffer, ein zerbrochener Kleiderständer, ein kleiner Eisenofen. Nichts hing an den Wänden.
»Hast du Spiritus?« fragte Olieslagers. »So koch dir einen Tee von dem Zeug. Trink ihn, ehe du zu Bett gehst.« Er erklärte ihm genau, wie er es machen solle, auch wie er sich benehmen müsse bei der ärztlichen Untersuchung.
Stephe wiederholte alles, laut und mehrmals. Dann sperrte er den Koffer auf, nahm sein Geld, bot es ihm nochmals.
Der Vlame schüttelte den Kopf. »Laß nur, Stephe. Ich tu’s für dich, weil ich dein Freund bin!«
Ging hinaus.
Draußen lief ihm Stephe nach. Seine Hand hielt ein kleines Korallenhalsband. – »Wollen Sie das, Herr?« Jan Olieslagers betrachtete es. »Wo hast du’s her?« lachte er. »Von einer Braut?«
Stephe nickte.
»Und wo ist sie?« fragte der Vlame.
»Tot«, sagte Stephe.
Olieslagers gab es ihm zurück. »Neapolitanerin«, murmelte er, »eine aus Ägypterland.« Aber er fragte nicht weiter. »Behalt’s, Stephe, als Andenken! – Ich will nichts, ich sagte dir’s ja! Nicht einmal dein Geheimnis – wenn du’s nicht von selber sagst. Vergiß nicht, was du tun mußt – und viel Glück auf morgen. Komm zu mir ins Laboratorium und erzähl mir.«
Dann ging er fort mit langen Schritten.
Spät genug kam Stephe zu ihm hinauf. Er war bleich und zitterte, aber ein zufriedenes Grinsen lag über seinem Gesicht. »Frei!« rief er.
Der Vlame beglückwünschte ihn. »Setz dich, mein Junge! Und nun wollen wir das Gift möglichst schnell wieder herausbekommen aus dem Leib – oder doch unschädlich machen!« Er hatte keine Ahnung, ob das nötig sei, oder was er zu diesem Zwecke tun solle. Aber er dachte sich: Alkohol kann gewiß nichts schaden. Und vielleicht auch wird’s ihn gesprächig machen.
So mischte er Whisky. Stephe trank, schluckte ein Glas nach dem andern wie Medizin. Aber er sprach kein Wort. Der Vlame war enttäuscht genug, doch ließ er sich’s nicht merken. Er redete ihm zu, wie einer kranken Kuh, schenkte ihm immer von neuem ein; zwang ihn, erstaunliche Mengen hinunterzugießen. Stephe trank.
Als er ging, bedankte er sich. Seine Zunge lallte und sein Leib torkelte, die Beine versagten den Dienst. Aber nur sein Leib war betrunken; was er sagte, war ganz vernünftig. Olieslagers hörte ihn auf der Treppe hinfallen, kam ihm nach und richtete ihn auf. Dann faßte er ihn fest um den Leib und schleppte ihn mühsam nach Hause.
Als sie am Friedhofstor waren, riß sich Stephe zusammen. »Danke, Herr«, sagte er.
Nie las Stephe ein Buch, nie eine Zeitung. Alles was außerhalb des Friedhofs zuging, war ihm vollständig gleichgültig. Er wußte: irgendwo in der Welt war Krieg. Wer Krieg führte und warum und wozu, das interessierte ihn nicht.
Doch hatte er von nun an für alles, was seinen Freund anging, ein gewisses Interesse, das schließlich so weit ging, daß er sogar Fragen stellte. Was er in der Stadt treibe? Warum er hier sei? Ob er viel Geld verdiene?
Olieslagers gab ihm Bescheid. Klar, einfach, so daß Stephe es bald begriff. Sicher fühlte er, daß der ihn nie verraten würde.
Aber es war bei dem Vlamen nicht etwa ein Wunsch, sich auszusprechen. Es war etwas anderes. Stephe war besessen von einem Gedanken – und jeden Tag mehr kitzelte es Jan Olieslagers, den herauszufinden. Es war, als ob er selbst von dieser Sucht besessen sei. Er fühlte, daß ihm sein Fragen nichts helfen würde, so hütete er sich wohl, diese verrückte Lust zu zeigen, die dennoch das einzige war, das ihn tagtäglich zum Friedhof trieb. Nie stellte er eine Frage, nie machte er eine leiseste Anspielung. Als aber der Totengräber ihn fragte, gab er ihm genaue Antwort, gab sich ihm ganz in die Hand. »Sieh, Stephe«, sagte er, »das ist mein Geheimnis. Ich sag dir’s, weil du mein Freund bist und weil ich dir traue.«
Stephe nickte. Er begriff recht gut: wenn man einen Freund hat, muß man ihm vertrauen. Aber er sagte dennoch nicht ein Wort.
Dann kam der Tag, wo es aus war mit der Herrlichkeit im Laboratorium. Der Direktor hatte den Vlamen rufen lassen und ihm gesagt, daß er nun endlich Resultate sehen müsse. Nichts sei bisher geschehen, rein gar nichts! Er stellte ihm das glatte Ultimatum: entweder müsse er in der nächsten Woche beweisen, daß er arbeiten wolle – daß er das könne, daran zweifelte der Direktor auch jetzt keinen Augenblick. Oder aber: er werde ihn verhaften lassen. Er habe sich genau erkundigt in Neuyork, wisse gut, was er getrieben habe in den letzten Jahren.
Also, er möge sich entscheiden. Und er möge bedenken, daß die Fabrik noch eine neue Anzeige gegen ihn machen würde: daß er nämlich sich hier eingeschmuggelt habe, um chemisch-militärische Geheimnisse herauszubekommen. Das sei schon nötig – irgendwie müsse man ja seinen Aufenthalt erklären.
Jan Olieslagers, eigentlich nur verwundert, daß sich diese Unterredung nicht schon vor Monaten abspielte, blieb sehr gelassen.
»Sie haben recht, Herr!« sagte er. »Und da ich nur wählen kann zwischen dem Zuchthaus und der Möglichkeit, Ihnen etwas Positives zu leisten, so müßte ich ein Narr sein, wenn ich das Zuchthaus vorziehn würde. Nur: eine Woche ist zu wenig. Ich benötige vier Wochen.«
»Ich gebe Ihnen zwei Wochen, Herr, und nicht einen Tag länger«, sagte der Direktor. »Guten Morgen!«
Noch vierzehn Tage also – der Vlame war ganz zufrieden damit. Nur Zeit – und jeder Tag war ein Gewinn. Er schloß sich ein in sein Laboratorium. Rauchte. Las.
Am Abend war er auf dem Friedhof. Er erzählte Stephe alles, Wort für Wort, wie es sich zugetragen hatte.
»Ich muß fort!« schloß er.
»Wenn ich nur eine Ahnung hätte, wie und wohin!«
Er überlegte laut; Stephe nickte zuweilen oder schüttelte den Kopf. Warf auch wohl ein Wort ein oder stellte eine Frage.
»Kanada?« schlug er vor.
Olieslagers lachte. »Ist auch im Kriege. Auf derselben Seite, wie die Staaten – die beiden sind eins heute. Und die mexikanische Grenze ist so besetzt, daß kein Hund durchkommt! Nein, ich muß schon im Lande bleiben, irgendwo unterkriechen in einer großen Stadt. Wenn ich nur nicht so gottverdammt bekannt wäre! Hunderttausend bezahlte Geheimagenten arbeiten im ganzen Lande – und ein paar Millionen freiwillige Spione helfen ihnen – mich suchen sie schon seit fast einem Jahr.«
Die beiden fanden nichts. Als der Vlame ging, preßte ihm Stephe – zum ersten Male – die Hand.
Am andern Abend wartete Stephe auf ihn auf der Bank. »Ich hab’s durchgedacht, Herr,« sagte er. »Sie müssen nicht weg. Sie müssen hier bleiben!«
Der Vlame sah ihn erstaunt an. »Hier? Wo hier?«
Stephe fuhr mit dem Arme im Kreis herum. »Hier!« wiederholte er. »Drei Gehilfen sind eingezogen worden. Der Alte nimmt Sie sofort; wird froh sein, eine Hilfe zu bekommen.«
»Als was?« fragte Olieslagers. »Als – Totengräber?«
Stephe nickte.
Der Vlame lächelte. Das schien so dumm nicht. Totengräber? Nun, dazu waren wenigstens keinerlei Spezialkenntnisse notwendig, wie zum Chemiker!
Und im Augenblicke sah er die Art, wie er den Sprung machen konnte.
Zwölf Tage Zeit – bah, das war übergenug!
Sie sprachen lange an diesem Abend. Ließen keinen kleinsten Umstand außer acht. Und nur über einen Punkt stritten sie hin und her: das war, wer die neuen Kleider bezahlen sollte, die Stephe kaufen sollte. Der Vlame wollte es nicht zugeben, aber Stephe setzte seinen Willen durch: er würde sie zahlen mit seinem eigenen Gelde. Würde sie dem Freunde schenken.
Früh am Morgen machte der große Chemiker Dr. Jan Olieslagers eine kleine Explosion in seinem Laboratorium, die wenig Schaden anrichtete, aber recht laut knallte. Die Leute liefen zusammen und schlugen an die verschlossene Tür; auch der Direktor war mit ihnen. Als die Türe endlich geöffnet wurde, fanden sie den Vlamen mit völlig verbundenem Kopfe; nur Nase, Augen und Stirne schauten heraus.
»Was ist geschehen?« fragte der Direktor.
Olieslagers hielt die Tür in der Hand. »Kommen Sie herein«, antwortete er. »Aber keiner außer Ihnen!« Er drängte die andern zurück und verschloß die Tür. »Was geschehn ist? Was in jedem Laboratorium jeden Tag geschehn kann! Verbrannt hab’ ich mich!«
»Ich werde den Arzt schicken«, rief der Amerikaner.
»Sie werden den Teufel schicken!« entgegnete ihm der Vlame. »Glauben Sie, ich habe jetzt Zeit, mich mit Ärzten abzugeben? – Zwölf Tage habe ich noch – zwölf Tage – und ich bin fertig dann, verlassen Sie sich drauf! Alles andere geht Sie nichts an – ob ich mir die Schnauze verbrenne, kann Ihnen verdammt gleichgültig sein!«
»Gut, Herr, gut!« lachte der Direktor. »Ganz, wie Sie wollen! – Brauchen Sie Hilfskräfte?«
»Keine Katze soll mir reinkommen!« schrie der andere. »Das fehlte mir noch gerade!« – Dann besann er sich. »Eins wäre mir lieb, Herr! Ich gehe nun zwölf Tage lang nicht hinaus aus diesen Räumen, geben Sie Anweisung, daß mir Essen, Trinken und was ich wünsche, hierhergebracht wird. Und daß alle meine Anordnungen gleich befolgt werden – vor allen andern.«
Der Direktor nickte. »Soll geschehn, Herr!« – Er ging zur Türe, wandte sich noch einmal zurück. »Wenn Sie das fertig bringen, – es soll Ihr Schade nicht sein, Herr!«
Jan Olieslagers schloß sorgfältig hinter ihm. »Aber wenn du’s nicht herauspressen kannst – sperrst du mich ins Zuchthaus, was?«
Er verhängte die Fenster sorgfältig, dann nahm er das Tuch vom Gesicht.
Zwölf Tage lang saß Jan Olieslagers in seinem Zimmer, aß, trank, rauchte und las. Er hatte nicht viele Wünsche; aber der Direktor schickte ihm Whisky, Wein, Zigaretten und allerhand Delikatessen. Der Verband lag ihm stets dicht zur Seite und er legte ihn sorgfältig um, jedesmal, ehe er die Tür öffnete.
Nichts rührte er an, von all dem Zeug, das herumlag auf dem Tisch. Nur einen kleinen Spiegel hatte er hinübergenommen vom Schlafzimmer. Den griff er auf, alle paar Stunden, beobachtete sorgfältig, wie die Bartstoppeln ihm auf dem Kinn, den Lippen, den Wangen sprossen. Mit Genugtuung stellte er fest, daß sie viel dunkler waren als das blonde Haupthaar und viel schneller wuchsen, als er geahnt hatte.
Am Freitag nachmittag schickte er dem Direktor einen kurzen Brief. »Kommen Sie morgen zwölf Uhr zu mir ins Laboratorium.«
Der Direktor kam – und fand nichts. Jan Olieslagers war fort mit ein paar Sachen. Die Anzeige wurde sofort erstattet, und man suchte sehr scharf nach dem Vlamen, überall in den achtundvierzig Staaten.
Überall – nur nicht auf dem kleinen Friedhof von Andernach.
Jan Olieslagers war in der Nacht übersiedelt kurz vor Sonnenaufgang. Stephe erwartete ihn, half ihm sofort beim Umkleiden. Ein paar plumpe Soldatenschuhe, dicke Hosen, blauer Sweater, Jacke, Mütze und Overall lagen bereit.
Sie verbrachten ein paar Stunden damit, das alles ein wenig angeschmutzt, gebraucht erscheinen zu lassen. Sowie der alte Totengräber aus seinem Hause kam, ging Jan Olieslagers auf ihn zu, bot ihm seine Dienste an.