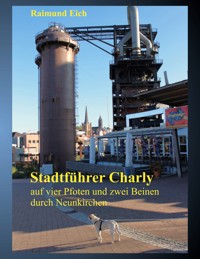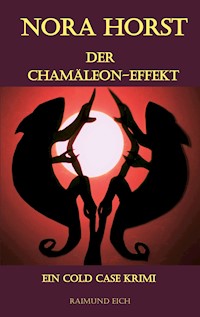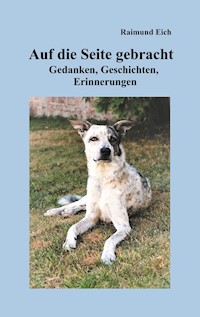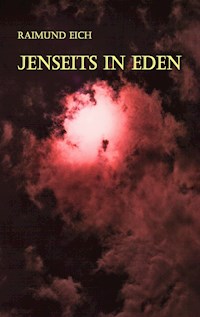Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Freund Hein schleicht schon ums Haus, hieß es früher, wenn jemand im Sterben lag. Heute spricht niemand mehr gerne vom Tod, schon gar nicht vom Tod als Freund. Die meisten von uns verdrängen lieber das unausweichliche Schicksal, das uns alle ausnahmslos einmal ereilen wird. Den Tod umgibt etwas Mysteriöses und Geheimnisvolles. Ob nach dem Tod alles aus ist oder ob es nicht doch ein Jenseits und ein Leben nach dem Tod gibt, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. In zwölf spannenden Geschichten versucht der Autor, den Schleier, mit dem sich der Tod umgibt, ein wenig zu lüften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Raimund Eich, Jahrgang 1950, lebt im Saarland.
Neben zwei Tatsachenromanen sowie einigen Büchern mit heiteren und besinnlichen Gedichten und Geschichten hat er einige Werke veröffentlicht, in denen er sich insbesondere mit gesellschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Themen befasst. Hierin lässt er auch naturwissenschaftliche und technische Aspekte in sehr anschaulicher Form mit einfließen. Daraus resultieren einzigartige Bücher, spannend, dramatisch, informativ und unterhaltsam zugleich.
Gewissheit, ob mit dem Tod alles aus ist oder ob es doch irgendwie weitergeht, erhalten wir erst dann, wenn es zu spät ist, um für unser Leben davor die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen.
Raimund Eich
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Ich freue mich auf den Tod
Das Tor seines Lebens
Rübezahl
Schlaflos
Ich möchte mit dir zu den Sternen fliegen
Non Stop ins Paradies
Manni
Drei Rätsel
Bruchstücke
Wartesaal zum Jenseits
Mama, ich komme jetzt
Nicky
Nachwort
Anhang
VORWORT
Gevatter Tod schleicht schon ums Haus oder Freund Hein kommt pünktlich und hat noch nie jemand vergessen!, so etwa formulierte es in früheren Zeiten gerne der Volksmund. Der Tod wurde bewusst als eine möglichst freundlich gesinnte Person charakterisiert, die unser irdisches Dasein zwar irgendwann beendet, der man aber damit wenigstens das Beängstigende oder Grausame nehmen wollte.
Heute spricht dagegen niemand mehr gerne vom Tod, vom eigenen wohlgemerkt. Während die Medien keine Gelegenheit auslassen, den Tod in Form von reißerischen Schlagzeilen über mörderische Kriege, blutige Anschläge, gewaltige Naturkatastrophen und spektakuläre Unfälle kommerziell geradezu auszuschlachten, führt er ansonsten eher ein Schattendasein und beschränkt sich auf Todesanzeigen, die man mit zunehmendem Alter immer ausgiebiger studiert, um anhand der Geburts- und Todesdaten klammheimlich sinnlose Vergleichsrechnungen über die eigene Restlaufzeit anzustellen. Man möge mir als Techniker, diese zugegebenermaßen etwas saloppe Formulierung verzeihen.
Gedanken über den eigenen Tod zu verschwenden oder gar mit anderen darüber zu reden ist heutzutage verpönt, selbst dann, wenn Freund Hein schon im Anmarsch ist oder gar vor der Tür steht und der oder die Betroffene auf dem Sterbebett sich gerne in einem offenen Gespräch seine Ängste davor von der Seele reden würde. Stattdessen verharmlosen, vertrösten und beschönigen wir und versuchen allzu oft, mit hohlen Sprüchen sinnlos Lebensmut zu entfachen, den Todgeweihten aufzumuntern oder ihn und uns vom Thema abzulenken. Helfen wir ihm oder uns auch damit? Ich fürchte, nein, wobei ich mich selbst von einem derartigen Fehlverhalten nicht freisprechen kann.
Warum also dieses konsequente Verdrängen von etwas, das uns allen ausnahmslos selbst noch bevorstehen wird? Ganz einfach, wir haben Angst vor dem, was danach kommt, falls überhaupt etwas danach kommt, woran immer mehr Menschen zu zweifeln scheinen. Wir haben zunehmend den Glauben an einen göttlichen Schöpfer und das ewige Leben verdrängt, was uns früher in der Kirche, in der Schule und im Elternhaus förmlich eingetrichtert wurde. Gerade in westlichen Kulturkreisen lässt sich das in einem für mich beängstigendem Ausmaß feststellen, wie die nicht endend wollende Flut von Kirchenaustritten belegt, die man allzu gerne mit Kirchenskandalen begründet, aber insgeheim eher die eingesparte Kirchensteuer im Auge zu haben scheint, ohne das offen zugeben zu wollen.
Sicherlich sind Skandale weiß Gott kein Anreiz, um sein sauer verdientes Geld auch noch in kirchliche Einrichtungen zu stecken, die uns armen Sündern gerne Wasser predigen und selbst liebend gerne den besten und teuersten (Mess)Wein saufen oder weitaus schlimmere Schandtaten begehen. Ohne dies auch nur im Geringsten beschönigen zu wollen, bleibt allerdings festzustellen, dass menschliches Fehlverhalten auch vor keiner weltlichen Institution Halt macht, ganz gleich, ob es in der Politik, in Ämtern und Behörden, in Unternehmen, in Vereinen oder in der eigenen Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis ist. Warum treten wir dann nicht konsequenterweise auch überall dort aus, wo Menschen sich anderen gegenüber versündigen? Die Antwort fällt auch hier nicht schwer, weil beispielsweise oft keine Möglichkeit dazu besteht, zumindest keine ohne negative Folgen für einen selbst. Ich kann nun mal nicht die Zahlung von Steuern ohne Sanktionen einstellen, weil der Staat unfähig oder korrupt ist. Ich kann nun mal nicht die Arbeit verweigern, weil ich dem Chef oder den Kollegen nicht über den Weg traue, ohne meinen Job ganz zu verlieren. Ich kann nun mal nicht meinen Lebenspartner schamlos ausnützen, belügen oder betrügen, ohne damit die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Beispiele genug, finde ich.
Warum also ausgerechnet Kirchenaustritte? Ganz einfach, weil sie völlig legitim und zudem kostensparend sind. Die logische Konsequenz und liebend gerne nach außen kommunizierte Rechtfertigung für viele ist daher, mit dem Kirchenaustritt gleich auch den Glauben über Bord zu werfen und damit auch den Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod.
Dass der menschliche Körper nach dem Tod selbst im schönsten Sarg verwest, sofern er nicht eingeäschert wird, vermag sicherlich niemand zu bestreiten. Aber den Menschen macht nun mal mehr aus als nur Fleisch und Blut. Wenn wir die Rechnung ohne unsere Seele und unseren Geist aufmachen, ist es nur die halbe Wahrheit, weil diese nicht verfaulen können wie Körperorgane. Unser Geist und unsere Seele charakterisieren uns Menschen aber weit mehr als unser körperliches Aussehen, das ohnehin alterungsbedingt einem ständigen Wandel unterliegt.
Wer allerdings davon überzeugt ist, dass mit dem Tod des Körpers unweigerlich auch der Geist und die Seele aufhören zu existieren, der wird jeden Ansatz von spirituellen Gedanken als Unfug oder Schwachsinn abtun. Es gibt keinen Gott, und nach dem Tod ist ohnehin alles aus, wer kennt nicht diese weit verbreitete Meinung, mit der man sich auch bedenkenlos über sittliche und moralische Grundsätze hinwegsetzen kann. Für jedermann unverkennbaren gesellschaftlichen Fehlentwicklungen mit verheerenden Folgen für uns alle wird so Vorschub geleistet.
Sicher, man kann den Glauben an einen Gott oder an ein Weiterleben nach dem Tod nicht unter Beweis stellen. Ein k.O.-Kriterium also? Keineswegs, denn es wird genauso wenig gelingen, das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Glauben, ob so oder so, ist und bleibt, wenn man so will, letztlich Glaubenssache!
Natürlich kann man die in der Bibel beschriebene Wiederauferstehung von Jesus Christus nach seinem schrecklichen Tod am Kreuz bezweifeln, ebenso wie millionenfache Nahtod- und außerkörperliche Erfahrungen oder „angebliche“ Botschaften aus dem Jenseits und Berichte über Begegnungen mit Geistwesen. Alles nur Hirngespinste, Halluzinationen oder schamlose Lügen? Aber auch darauf vermag niemand eine unumstößliche Antwort zu geben.
Mit anderen Worten, wir müssen uns entscheiden, dafür oder dagegen. Wer selbstherrlich behauptet, er glaube grundsätzlich nur das, was er mit eigenen Augen sehen oder mit eigenen Ohren hören kann, der müsste zwangsläufig auch die Existenz von Schallwellen und elektromagnetischen Feldern in Frequenzbereichen, die für unsere Körperorgane nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, leugnen, ebenso wie Träume oder Gedankenreisen zu den entferntesten Orten im Weltall, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Mehr noch, der müsste auch in Abrede stellen, dass beim Blick in den nächtlichen Sternenhimmel Trugbilder von Planeten aus längst vergangenen Zeiten auf unsere Hornhaut projiziert werden und diese Himmelskörper möglicherweise schon gar nicht mehr existieren.
Warum sollten wir also die Existenz eines göttlichen Schöpfers und eines ewigen geistigen Lebens, von der seit Anbeginn der Menschheit in allen Kulturkreisen die Rede ist, kategorisch verneinen? Wäre es nicht viel sinnvoller, sich etwas intensiver damit zu beschäftigen und das Für und Wider sorgfältig abzuwägen? Was verliere ich eigentlich, wenn ich mich dem Glauben verschreibe und er sich am Ende doch als unzutreffend erweisen sollte? Nichts, lautet die einfache Antwort darauf! Und was verliere ich, wenn ich den Glauben an irgendetwas oder irgendwen zu Lebzeiten verleugne, mich über alle sittlichen Werte und Grundsätze hinwegsetze und sich das dann irgendwann doch als Fehler erweisen sollte?
Ich für meinen Teil habe mich jedenfalls für den Glauben entschieden, und ich freue mich - Sie werden es mir kaum glauben - sogar auf den Tod, womit ich natürlich Gefahr laufe, spätestens jetzt von Ihnen als völlig verrückt eingestuft zu werden. Ob ich denn keine Angst vor dem Sterben habe?, wollen Sie wissen. Und ob, sehr große Angst sogar, um ehrlich zu sein, denn keiner von uns weiß schließlich, wann und wie uns der eigene Tod ereilen wird, ob wir sanft entschlummern oder blitzartig dahingerafft werden, was sich wohl jeder wünschen würde, oder ob wir lange und schwer zu leiden haben, was keiner gerne mitmachen möchte. Nein, diesbezüglich unterscheide ich mich wohl kaum von meinen Mitmenschen. Aber das Sterben und der Tod sind nun mal nicht das Gleiche. Das Sterben ist der auf uns alle unweigerlich zukommende Übergang ... ins Nichts oder in ein geistiges Weiterleben ohne körperliche Belastungen und Einschränkungen. Ich würde mir jedenfalls nichts mehr wünschen als Letzteres, und deshalb glaube ich auch zugegebenermaßen gerne daran. So gesehen freue mich darauf, was mir tatsächlich bereits in meinem irdischen Dasein „unterm Strich“ mehr gibt als alle leider meistens relativ kurzfristigen irdischen Freuden, die auch ich keinesfalls missen möchte.
Genug der Vorrede, die mir aber zum besseren Verständnis der folgenden Geschichten über den Tod notwendig erscheint. Falls Sie darüber hinaus gerne noch etwas mehr über grundsätzliche spirituelle Fragen in Form von interessanten, spannenden und unterhaltsamen Büchern erfahren möchten, dann schauen Sie doch bitte mal in den Anhang zu diesem Buch.
Ich wünsche Ihnen eine anregende und spannende Lektüre bei meinen Geschichten vom Tod.
Raimund Eich
ICH FREUE MICH AUF DEN TOD
Ich freue mich auf den Tod!, hörte ich auf der Parkbank neben mir jemand vor sich hin sagen, der mich mit dieser ungewöhnlichen Bemerkung völlig aus meinen Gedanken riss, die bereits seit Tagen um die bevorstehende Sitzung in der Konzernzentrale kreisten. Der Vorstand hatte mich als leitenden Angestellten dorthin zitiert, in meiner Funktion als Niederlassungsleiter eines kleineren Betriebes, etwa einhundert Kilometer vom Stammsitz in Mannheim entfernt. Schwerpunkt derartiger Kappensitzungen, wie ich sie insgeheim zu nennen pflegte, weil sie sich für mich zumindest überwiegend aus einer Ansammlung von karrieregeilen Alleswissern mit Nichtskönnerqualitäten zusammensetzten, die keinerlei Ahnung vom harten Tagesgeschäft hatten und sich ausschließlich auf Zahlen konzentrierten. Auf betriebswirtschaftliche Zahlen wohlgemerkt, wobei sie auf negative oder rote Zahlen, die ihrem Status, ihrem Einfluss und letztlich auch ihren horrenden Gehältern zum Nachteil gereichen könnten, wie der Teufel auf Weihwasser zu reagieren pflegten. Und diesbezüglich stand mir ein schwerer Gang nach Canossa bevor, der mich schon seit Tagen nicht mehr zur Ruhe kommen ließ.
Seit fast drei Jahren war ich für die relativ kleine Niederlassung im überschaubaren Saarland zuständig. Wir produzierten dort Komponenten für die Fertigungstechnik. Der alte Leiter, der mich nach dem Studium als seinen Assistenten eingestellt hatte, setzte vor seinem Ausscheiden alle Hebel in Bewegung, damit ich seine Nachfolge übernehmen konnte. Wir waren ein bestens eingespieltes Team, das größten Wert auf Qualität, Liefertreue und Kundenservice legte und damit auch einen guten Ruf bei unseren Kunden hatte. Ich war im Grunde genommen glücklich mit meiner Position in der zweiten Reihe, die mir einerseits viel abverlangte, mich aber letzten Endes nicht zu sehr mit der Last der Verantwortung erdrückte, wie sie der Nummer eins in erster Linie zufiel. Ich tat mich offen gestanden schon immer schwer damit und hatte insofern auch keinerlei Karriereambitionen. Der Alte glaubte jedoch, dass es nach ihm keiner besser machen könne als ich, und er wollte mir damit wohl auch einen Schub nach vorne geben. Hätte ich etwa nein sagen und mich davor drücken sollen? Nein, denn dazu wäre ich viel zu stolz gewesen. Auch das in mich gesetzte Vertrauen tat mir gut und stärkte mein Selbstbewusstsein, zumindest für eine ganze Weile, bis leider auch auf Vorstandsebene personelle Veränderungen meine bis dahin halbwegs heile Arbeitswelt ins Wanken brachten, denn von nun an wurde der Unternehmenserfolg ausschließlich an Zahlen gemessen, an schwarzen Zahlen selbstverständlich. Folglich galt es für alle Unternehmen in unserer Gruppe, an allen Ecken und Enden zu sparen, an Personal, an Betriebsausstattung, an Werkzeugen, an Materialien und an vielem mehr.
Für eine begrenzte Zeit lassen sich damit zwar Wunschzahlen generieren, aber dann schlagen die Zeiger in die andere Richtung aus. Unzufriedene Mitarbeiter, schlechte Qualität, verärgerte Kunden und letztlich ausbleibende Aufträge sind die unausweichliche Folge. Aber dann sind die Herren des Vorstandes mit ihren Fünfjahresverträgen längst schon über alle Berge zu neuen Ufern aufgebrochen, um dort in gleicher Weise Unheil anzurichten.
Ich wusste das und versuchte daher, soweit als möglich, meinen Mitarbeitern und unseren ursprünglichen Qualitätsansprüchen auch weiterhin gerecht zu werden. Mit anderen Worten, ich ließ mich nach wie vor mit guten Argumenten von notwendig erscheinenden Investitionen in die Entwicklung, Produktion oder Qualitätssicherung überzeugen mit der Folge, dass mein Betrieb peu a peu auf der betrieblichen Erfolgsleiter nach unten rutschte. Und dafür musste ich mich heute vor dem versammelten Vorstandskollegium rechtfertigen, was mir wohl kaum gelingen würde. Die zu erwartenden Folgen für unseren Betrieb und auch für mich quälten mich derart, dass ich am liebsten davongelaufen wäre. Aber wohin? Und so saß ich nun da, irgendwo in einer großen Parkanlage auf einer Holzbank, und versuchte, die verbleibende Zeit bis zum Termin in etwa zwei Stunden totzuschlagen, weil ich vor lauter Angst, zu spät zu kommen, viel zu früh angereist war. Ein herrlicher Frühsommertag mit angenehmen Temperaturen und einem strahlend blauen Himmel, vor dem nur ab und an eine schneeweiße Schäfchenwolke träge dahinsegelte. Ein schattiges Plätzchen im Grünen mit hohen Büschen und noch höheren Bäumen, deren dichtes Laub den Straßenlärm angenehm dämpfte. Vor mir weitläufige Wiesen. Der Sommerwind malte Wellen ins halbhohe Gras. Fast ein grünes Meer, in dem Blumeninseln zu schwimmen schienen. Diese traumhaft schöne Kulisse passte so gar nicht zu der albtraumhaften Begegnung mit dem Vorstand, die mir heute noch bevorstand.
Und jetzt hörte ich auf der Parkbank nebenan jemand sagen: Ich freue mich auf den Tod! Wer mochte das sein? Ein Verrückter, oder gar ein Selbstmörder? Verstohlen warf ich einen Blick zur Seite. Dort saß ein alter Mann in zerschlissen und ungewaschen aussehenden Kleidern, das Gesicht halb von einem altmodischen Pepitahut mit Schottenmuster und einem grauen Vollbart verdeckt. Passend dazu eine hässliche Nickelbrille, die wohl schon ausgeleiert war und ihm bei jeder Kopfbewegung auf die Nasenspitze herunterrutschte. Seine Hände zitterten, als er wohl etwas aus seiner Jackentasche zu nehmen versuchte. Er schien mich überhaupt nicht wahrzunehmen und führte offenbar Selbstgespräche, von denen ich allerdings nur Ich freue mich auf den Tod mitbekommen hatte.
Irgendwie hatte ich Mitleid mit dem alten Mann, stand auf, packte meine Aktentasche und setzte mich neben ihn.
„Suchen Sie etwas? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein?“, fragte ich.
Er blickte auf und sah mir in die Augen. Sein faltiges Gesicht wirkte aschfahl. „Oh ja, junger Mann, in der rechten Innentasche meiner Jacke ist eine Schachtel mit Tabletten, aber ich kriege sie einfach nicht raus. Irgendetwas klemmt da. Könnten Sie es bitte mal versuchen?“
„Selbstverständlich“, erwiderte ich und griff in die Innentasche der Jacke. Die Naht am Boden der Tasche war aufgerissen und die Tabletten ins Jackenfutter gerutscht. Ein schnell lösbares Problem für mich. „Hier bitte“, sagte ich und reichte ihm die Schachtel, die er zitternd zu öffnen versuchte. „Darf ich Ihnen auch dabei helfen?“
Er nickte. „Zwei davon muss ich einnehmen.“
Ich zog zwei Tabletten aus der Packung und reichte sie ihm. „Brauchen Sie nicht auch etwas zu trinken, damit sie besser runterrutschen?“
„Wäre nicht schlecht. Wenn sie so freundlich wären“, sagte er und deutete hinter sich.
Als ich mich umdrehte, sah ich etwa zwanzig Meter hinter uns am Wegrand einen von Moos überzogenen alten Steinbrunnen, in den aus einem angerosteten Stahlrohr Wasser plätscherte. Sehr vertrauenerweckend sah die Brunnenanlage nicht gerade aus. „Ist das auch Trinkwasser, und wie soll ich es transportieren?“, fragte ich den Alten.
Er nickte, griff in den Abfallbehälter direkt neben der Parkbank und zog mit sicherem Griff eine leere Bierflasche heraus. „Hier, das müsste eigentlich gehen, oder?“
Ich ging zum Brunnen und spülte die Flasche erst einmal gründlich aus, bevor ich sie mit Wasser füllte.
„Danke, junger Mann, das ist sehr nett von Ihnen. Wie heißen Sie denn?“
„Reichmann, Peter Reichmann“, erwiderte ich und schob ein „danke für den jungen Mann, aber ich bin schon fast Fünfzig“ nach.
„Soso, schon fast Fünfzig“. Der Ansatz eines Schmunzelns war bei ihm zu erkennen. „Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich schon neunundachtzig bin, dann dürfen Sie mir gerne den jungen Mann abnehmen. Alles ist relativ im Leben, auch das Alter.“
„Wohl war. Was sind das für Tabletten?“
„Herztabletten“, erwiderte er, „ohne die geht ´s leider nicht mehr ... und mit denen auch nicht.“
Ich stimmte spontan in das meckernde Lachen des Alten ein und erwiderte: „Sie müssen sie aber trotzdem einnehmen.“