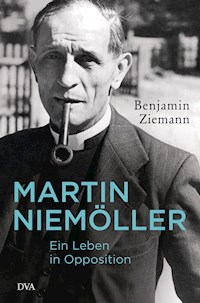28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie Deutschland wurde, was es ist Benjamin Ziemann beschreibt Deutschlands Geschichte als Entwicklung sozialer Teilsysteme. Diese Perspektive, inspiriert von Niklas Luhmann, ermöglicht verblüffende Einsichten in die Dynamik, aber auch die Fragmentierung der modernen Gesellschaft seit 1880. Funktionsbereiche wie Kunst, Massenmedien und Sport wurden autonom – und zugleich war es auch für eine Diktatur wie das »Dritte Reich« nicht mehr möglich, die Gesellschaft komplett zu steuern. »Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft verfügt nicht über eine Kommandozentrale, von der sich die gesamte Gesellschaft überblicken und steuern lässt. Noch hat sie ein ethisches Zentrum, das moralische Wertnormen verbindlich festlegen kann. Sie ist vielmehr, wie Niklas Luhmann es formuliert hat, ›eine Gesellschaft ohne Spitze und ohne Zentrum‹. Warum das so ist, davon handelt dieser Band.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Benjamin Ziemann
Gesellschaft ohne Zentrum
Deutschland in der differenzierten Moderne
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverabbildung: © picture alliance / akg-images | akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962338-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011423-0
www.reclam.de
Inhalt
1. Einleitung: Zur Geschichte der differenzierten Moderne
2. Gesellschaft ohne Zentrum. Differenzierung im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914
Ein Primat der Politik?
Das System der Massenmedien
Macht die Bezahlung von Arztrechnungen gesund?
Systembildung in der Erziehung
Der Eigenwert der Kunst
Die weitere Ausbildung des positiven Rechts
Grenzen und Blockaden funktionaler Differenzierung
Folgeprobleme funktionaler Differenzierung
Die Politik als Zentrum des Kaiserreichs?
Fazit
3. Die Differenzierung der deutschen Gesellschaft 1880 bis 1980. Eine Skizze
Selbstbeschreibungen in der Zeit der Weimarer Republik
Funktionale Differenzierung in Diktaturen: »Drittes Reich« und DDR
Strukturelle Kopplungen
Protestbewegungen und ihr Code
Differenzierung als Perspektive für eine erneuerte Gesellschaftsgeschichte
4. Funktionssysteme im »Dritten Reich«. Ein Problemaufriss
Ausschluss der Juden aus Funktionssystemen
Bedingungen und Grenzen politischer Steuerung
Die Bedeutung von Erfolgsmedien: Macht, Geld, Wahrheit und Recht
Die staatliche Kontrolle der Massenmedien
Erziehung – ein entbehrliches Funktionssystem?
Die gelenkte Marktwirtschaft und die Inflationierung des Erfolgsmediums Geld
Der NS-Doppelstaat und das Rechtssystem
Fazit
5. Differenzierung als Verlust und Gewinn: Die katholische Kirche in der Bundesrepublik
Säkularisierung als Differenzierung
Die katholische Kirche nach 1945 – »Siegerin in Trümmern«?
Gebietsmission als Beobachtung funktionaler Differenzierung
Der soziographische Blick auf die Gesellschaft
Rollendifferenzierung von Priestern und anderen Seelsorgekräften
Differenzierung kirchlicher Grundfunktionen
Von der Funktion zur Leistungsabgabe: die Caritas
Kirchliche Beratungsarbeit und der Trend zur therapeutischen Kommunikation
Säkularisierung: Verlustgeschichte oder Gewinn an pastoraler Kompetenz
6. Der Code des Protests. Friedensbilder in westdeutschen Friedensbewegungen, 1945–1990
Protestbewegungen als soziale Form
Der Friede und sein Gegenteil: Formen und Symbolisierungen
»Kampf dem Atomtod«
Die Ostermarschbewegung
Antiamerikanismus als Rahmung
Von der Opferrolle zum Aktivismus
Die Protestbewegung auf dem Weg zu einer friedlichen Welt
Die Bezeichnung des Friedens im Code der Protestbewegung
Fazit
7. Die Codierung des modernen Sports
Turnen und Turnbewegung im Kaiserreich
Der sozialdemokratische Arbeitersport
Katholische Sportvereine
»Sport« als Import aus England
Grenzen der Ausdifferenzierung des Sports vor 1914
Der Erste Weltkrieg als Zäsur
Sport in der Weimarer Republik: Expansion und Differenzierung
Boxen in der Weimarer Republik
Die Krise des Arbeitersports und das Vordringen des Leistungsvergleichs
Die Durchsetzung des Wettkampfprinzips im »Dritten Reich«
Ausdifferenzierung des Sports nach 1945
Gibt es Sport erst in der Moderne?
Was ist das Bezugsproblem des Sports?
Der Ausschluss von Tieren als Aspekt der Ausdifferenzierung des Sports
Die Relevanz des Codes für den Sport
8. Die Metaphorik des Sozialen. Soziologische Selbstbeschreibungen der Gesellschaft im 20. Jahrhundert
Verzeitlichung und Verwissenschaftlichung in der Moderne
Die Rolle der Soziologie bei der Produktion von Selbstbeschreibungen
Die Gesellschaft als Organismus
»Eigengesetzlichkeit« als begriffliche Formel für Differenzierung
Der Erste Weltkrieg: Entdifferenzierung im Zeichen nationaler Einheit
Die Metapher der sozialen Rolle
Der Funktionalismus nach Talcott Parsons
1968 und die Kritik am Strukturfunktionalismus
Fazit
9. Ausblick: Probleme funktionaler Differenzierung in der Gegenwart
Wechselseitige Belastungen der Funktionssysteme
Gewinner und Verlierer unter den Funktionssystemen
Die bedrohte Autonomie der Kunst
Der »Kampf« der Wertordnungen und die »Anarchie der Werte«
Danksagung
Personenregister
1. Einleitung: Zur Geschichte der differenzierten Moderne
Seit 1900 setzte sich das Wettbewerbsprinzip in vielen Mannschaftssportarten durch. Ein wichtiger Wendepunkt dafür war das Jahr 1903, in dem erstmals eine deutsche Fußball-Meisterschaft ausgespielt wurde. Doch noch am Ende der Weimarer Republik verweigerten sich die meisten sozialdemokratischen Arbeitersportvereine dem Wettbewerb. Das Gleiche galt für die Sportmannschaften des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, des auf dem Papier überparteilichen, tatsächlich aber eng mit dem sozialistischen Arbeitermilieu verwobenen Veteranen- und Republikschutzverbands mit einer Millionenmitgliedschaft. Als die Handballmannschaft des Reichsbanner-Gaus Hamburg 1930 die Einladung erhielt, gegen die Handballer des Reichsbanners in Bremen zu spielen, legten die Hamburger Sozialdemokraten großen Wert darauf, dass dieses Spiel nicht als eine »Meisterschaft« annonciert werden solle. Aus »Prinzip«, so ließ man die Reichsbanner-Kameraden in Bremen wissen, würde man an einem »Wettbewerb« jeglicher Art nicht teilnehmen.1
Am Sonntag, dem 17. Mai 1931, absolvierte Martin Niemöller seine Probeanstellung in Berlin-Dahlem. Bei diesem Ritual machte sich die evangelische Kirchengemeinde mit ihrem neuen Pfarrer vertraut, der in diesem wohlhabenden Berliner Vorort die dritte Pfarrstelle übernahm. Eine Lokalzeitung berichtete über die Predigt des später als Leitfigur der Bekennenden Kirche weltberühmten Pfarrers, aus Niemöllers Worten habe ein »lebendiger, energieerfüllter Kampfwille« gesprochen. Mit dieser Energie wandte er sich unter anderem, so der Zeitungsbericht, gegen das »Vordringen der Eigengesetzlichkeit auf allen Gebieten«.2
Im April 1945 gingen die Blütenträume der Nationalsozialisten von einem »Tausendjährigen Reich« endgültig ihrem Ende entgegen. Zugleich arbeitete die deutsche Justiz auf Hochtouren. An vielen Orten waren Amtsgerichte völlig unbeeindruckt von den Zeitumständen damit beschäftigt, für die jeweiligen Kläger ausgebliebene Mietzahlungen einzutreiben, sich um die Schulden von kleinen Gewerbetreibenden zu kümmern und andere im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 geregelte Streitfragen zu klären.3
Was haben diese drei Episoden gemeinsam, und was verbindet sie mit dem Thema dieses Bandes, der differenzierten Moderne? In allen drei Fällen geht es um funktionale Differenzierung und damit um ein grundlegendes Strukturprinzip der modernen Gesellschaft. Die sozialistischen Arbeitersportler im Reichsbanner verweigerten sich dem Code Gewinnen/Verlieren, mit dem sich der moderne, am Wettbewerb orientierte Sport als ein Teilsystem der Gesellschaft ausdifferenziert hat. Sport war für sie ein Teil der proletarischen Geselligkeit und zugleich ein Zeichen der Zugehörigkeit zum sozialistischen Milieu. Die kalte Logik eines Systems, in dem es in erster Linie um Gewinnen und Verlieren ging, lehnten sie ab.
Martin Niemöller teilte diese Besorgnis über die wichtigste Konsequenz funktionaler Differenzierung. Sie führt zur Herausbildung von spezifischen Feldern, die in ihren internen Operationen autonom sind und jeweils einer eigenen Rationalität folgen. Protestantische Theologen wie Ernst Troeltsch hatten dafür um 1900 den Begriff der »Eigengesetzlichkeit« entwickelt. Wie andere liberale Theologen sah Troeltsch darin eine Chance: Die christliche Tradition konnte produktiv neu interpretiert werden, wenn sie die jeweils spezifische Rationalität der modernen Wissenschaft, Wirtschaft und anderer Funktionssysteme anerkannte. Der konservative Lutheraner Niemöller sah darin hingegen eine große Gefahr. Denn mit dem »Vordringen der Eigengesetzlichkeit« war die christliche Religion nicht länger in der Lage, verbindliche Normen für Erziehung und Massenmedien, Wirtschaft und Politik zu prägen.
Schließlich folgten die Gerichte auch im »Dritten Reich« dem positiv gesetzten, in Gesetzen niedergelegten und damit ausdifferenzierten Recht, und zwar bis in die Stunde der Niederlage hinein. Für die Unterdrückung ihrer politischen Gegner entwickelten die Nationalsozialisten einen außerhalb juristischer Normen operierenden »Maßnahmenstaat«, wie der Politologe Ernst Fraenkel bereits 1941 argumentierte.4 Gerade im bürgerlichen Recht hingegen, wo es um Verträge und andere Rechtsbeziehungen zwischen Privatleuten geht, änderten sich im »Dritten Reich« zwar manche Rechtsnormen. Das funktional ausdifferenzierte Rechtssystem folgte hier jedoch weiterhin – weitgehend – seiner eigenen Binnenrationalität, und zwar unabhängig davon, ob die Richter nun NSDAP-Parteimitglieder waren oder nicht.
Funktionale Differenzierung, die Ausbildung von spezialisierten Feldern oder Teilsystemen wie Massenmedien, Wirtschaft, Erziehung, Recht und Sport, ist eine wichtige Signatur der Moderne. Dementsprechend ist für viele Soziologen die Weiterarbeit an der Theorie funktionaler Differenzierung ein wichtiger Bestandteil ihres täglichen Geschäfts. Sie greifen dabei auf einen Strang der soziologischen Fachdiskussion über die Moderne zurück, der ihre Disziplin seit ihren Anfängen um 1900 begleitet hat. Heute als Klassiker verstandene Soziologen wie Émile Durkheim in Frankreich, Herbert Spencer in England sowie Max Weber und Georg Simmel in Deutschland stehen am Beginn dieser Tradition.5 Vor allem im deutschen Sprachraum hat Niklas Luhmann der Diskussion über funktionale Differenzierung wichtige neue Impulse gegeben. Im Aufbau seiner soziologischen Systemtheorie, die er seit den späten 1960er Jahren entwickelte, nimmt die Analyse funktionaler Differenzierung einen zentralen Platz ein.
Für Luhmann war funktionale Differenzierung der Schlüssel zum Verständnis der modernen Gesellschaft. Er verband die ältere Diskussion in seinem Fach auf innovative Weise mit dem von ihm entwickelten Konzept der Codierung von Kommunikation. Ein jeweils spezifischer binärer Code trägt für Luhmann entscheidend zur Ausdifferenzierung und Stabilisierung von Funktionssystemen bei. Denn damit können sie sich von ihrer gesellschaftlichen Umwelt unterscheiden und intern Komplexität aufbauen. Für Luhmann war somit die Unterscheidung von System und Umwelt leitend. Der Code markiert die Leitdifferenz, die Kommunikationen innerhalb eines Systems anleitet. Dementsprechend geht es in der Wissenschaft erst dann um ihr eigentliches Geschäft, die Erzeugung von wahren Aussagen, wenn sie sich in ihrer Arbeit allein am Code wahr/falsch orientiert, statt sich in der Forschung durch religiöse, moralische oder politische Gesichtspunkte beeinflussen zu lassen.6 Ein Funktionssystem muss noch weitere Strukturen aufbauen, um operieren zu können. Dazu gehören vor allem die nötigen Programme, um den Code anzuwenden. In der Wissenschaft sind dies etwa Methoden und Theorien.7
Luhmanns Theorie, das muss man betonen, ist nicht der einzige Referenzpunkt für Soziologen, die sich mit funktionaler Differenzierung auseinandersetzen. Gerade im englischen Sprachraum ist der Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons, mit dem auch Luhmanns eigene Arbeit begann, bis heute wichtig.8 Aber in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts haben sich viele namhafte deutsche Soziologen mit dem Problem der funktionalen Differenzierung auseinandergesetzt und dabei an die Ideen Luhmanns angeknüpft, etwa in Arbeiten zur Soziologie der Religion oder der Wissenschaftssoziologie.9 Wichtig sind auch die Überlegungen von Armin Nassehi zu den Folgen funktionaler Differenzierung in der Gegenwart.10
Den Ausgangspunkt für meine eigenen Überlegungen bildet ein Problem. Von welcher konkreten Gesellschaft redet Luhmann eigentlich, wenn er über das Vordringen des Musters funktionaler Differenzierung spricht, und in welchem Zeitraum spielt sich dies ab? Dabei handelt es sich um einen Prozess, so viel wird schnell klar, und zwar um einen, der weit bis in die Frühe Neuzeit, also die Zeit von etwa 1500 bis 1800, ja zuweilen sogar bis in das Mittelalter zurückreicht. Gerade in der Frühen Neuzeit, das ist ein wichtiges Argument von Luhmann, gab es semantische Umstellungen und Innovationen, die über die hierarchische Differenzierung hinausweisen. Auf der Ebene der gelehrten Semantik, also in den Traktaten und gelehrten Diskursen der Juristen, Theologen und Pädagogen, zeigen sich von 1500 bis 1800 vielfältige Bemühungen, die Autonomie von Teilsystemen vorwegnehmend zu begründen.11 Dafür nur ein Beispiel: »Die Autorität, nicht die Wahrheit macht das Gesetz«, schrieb Thomas Hobbes 1668 in seinem Buch Leviathan. Mit dieser folgenreichen Feststellung leitete Hobbes einen Prozess ein, der zur »Differenzierung von Theologie und Jurisprudenz« und damit zu einem Recht führte, in dem es nicht mehr um Wahrheit, sondern letztlich allein um die Geltung positiv gesetzter Rechtsnormen ging.12
Ungeachtet dieser Umstellungen in der Semantik blieben die Gesellschaftsstrukturen bis in das frühe 19. Jahrhundert hinein hierarchisch, waren durch das Oben und Unten von sozialen Ständen gegliedert. Frühmoderne Kleiderordnungen, je nach Stand spezifische, abgestufte Rechte – so auch noch im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen Staaten aus dem Jahr 1794 – und die soziale Abstufung der nach Ständen getrennten Kirchenbänke beim sonntäglichen Gottesdienst sind anschauliche Beispiele dafür.13 Daraus können wir schließen, dass der Übergang zur funktionalen Differenzierung auf der Ebene der Strukturbildung um 1800 beginnt. Ab etwa 1880 ist dann in Deutschland die differenzierte Moderne voll ausgebildet. Ihre wichtigsten Strukturprinzipien sind bis in die Gegenwart gültig. Zumindest hat Luhmann selbst massive Kritik an der Vorstellung einer sogenannten Postmoderne geäußert. Diesen Begriff wies er als eine modisch ausgeschmückte Neubeschreibung einer in ihrem Kern identischen Moderne mit großem Nachdruck zurück.14
Funktionale Differenzierung war und blieb für Luhmann die wichtigste Strukturbildung der modernen Gesellschaft. Denn erst damit wird eine ihrer großen Leistungen möglich: In einer funktional differenzierten Gesellschaft kann eine Fülle von Problemen gleichzeitig bearbeitet werden. Das setzt die Kraft zur Spezifizierung frei. Im Wissenschaftssystem, um nur ein Beispiel zu nennen, lassen die Universitäten die aus dem Mittelalter überlieferte Einteilung in vier Fakultäten (Philosophie, Theologie, Medizin und Jurisprudenz) endgültig hinter sich. Neue Disziplinen bilden sich aus, in den Natur- wie in den Sozialwissenschaften, und jede dieser Disziplinen generiert selbst wieder neue Subdisziplinen, die auf neue Probleme und Forschungsfragen reagieren. Die rasante Dynamik wissenschaftlich-technischer Neuerungen, die sich nicht erst mit der Computertechnik zeigt, wäre ohne diese Differenzierungsform unmöglich.
Doch auch wenn man den Gedanken ernst nimmt, dass funktionale Differenzierung für das Verständnis der Moderne zentral ist, sind Luhmanns Ausführungen zu diesem Thema aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive unbefriedigend. Da ist von der »Ausdifferenzierung von Funktionssystemen« zu lesen, wird über deren »Autonomie und strukturelle Koppelung« gesprochen und die Differenz von »Organisation und Gesellschaft« behandelt.15 Die hochgradig abstrakte Anlage all dieser Kategorien und ihrer Erläuterung ist bei Luhmann Programm, denn es geht ihm um soziologische Theorie. Sein Ziel ist es, der Soziologie ein Forschungsprogramm zu verordnen, das alle Gegenstände erfassen kann. Seine Theorie soll dazu beitragen, alle soziologischen Themen empirisch behandeln zu können. Er selbst hat davon gesprochen, dass in seiner soziologischen Theorie »der Flug« allein »über den Wolken stattfinden« müsse und mit einer »geschlossenen Wolkendecke zu rechnen« sei.16 Mit dieser Metapher vom Soziologen als einem Piloten, der nur mit Hilfe seiner Instrumente fliegt, ohne die wirkliche Welt unter ihm zu sehen, möchte Luhmann – durchaus berechtigt – vor dem übereilten Sprung in die empirische Konkretion warnen.
Aber irgendwann endet auch der längste Interkontinentalflug. Und wenn der an den Strukturen der Gesellschaft Interessierte auf das Vorfeld des Flughafens tritt, möchte er wissen, ob die Realität am Boden zumindest in den Grundzügen dem Bild entspricht, das die Theorie hoch über den Wolken entworfen hat. Das gilt gerade dann, wenn man dieses Interesse ins Historische wendet und danach fragt, wann, wo und mit welchen Folgen sich die Muster der funktionalen differenzierten Moderne durchgesetzt haben. Auf solche Fragen erhält man bei Luhmann selbst und in den im Anschluss an ihn vorgelegten Arbeiten nur wenige Antworten. Eine Vernachlässigung historischer Fragestellungen ist dafür verantwortlich. Systemtheorie war und ist in erster Hinsicht soziologische Theorie und nur zu einem geringen Grad historische Soziologie.17
An diesem Punkt setzt der vorliegende Band ein. Ich versuche darin, wichtige Aspekte des Prozesses der funktionalen Differenzierung am Beispiel der deutschen Gesellschaft von 1880 bis 1980 aufzuzeigen. Mein Ansatz ist der eines Historikers, weshalb ich primär auf empirischer Basis argumentiere.18 In welcher Form setzte sich funktionale Differenzierung als wichtiges Strukturmuster der modernen Gesellschaft durch? Welche Felder oder Teilsysteme waren die Vorreiter dieser Entwicklung? Wie verändert sich unser Bild der deutschen Gesellschaft im Kaiserreich bis 1918, wenn wir uns auf die Dynamik der Differenzierung konzentrieren? Welche Probleme warf das Strukturmuster funktionaler Differenzierung auf, nachdem es sich weitgehend durchgesetzt hatte, und welche Widerstände rief es auf den Plan? Weiterhin ist zu fragen, in welcher Beziehung die funktional differenzierte Moderne zur destruktiven Energie der Gesellschaft in der NS-Zeit von 1933 bis 1945 steht. Der soziologischen Systemtheorie ist nicht zu Unrecht vorgeworfen worden, sie interessiere sich bestenfalls am Rande für die Frage, ob und wie die Dynamik der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts auf Strukturmuster der Moderne zurückgeht.19 Dieses wichtige und komplexe Thema kann ich hier zwar nicht systematisch erörtern. Aber ich will die Frage behandeln, ob der NS-Staat funktionale Differenzierung tatsächlich komplett unterbrach, wie allgemein behauptet wird, oder ob er sich nicht auch mit diesem für die Moderne so wichtigen Ordnungsmodell arrangieren musste.20
Mit Blick auf die Bundesrepublik wird niemand bestreiten, dass ihre Gesellschaft »modern« ist. Das heißt aber nicht, dass die für die Zeit bis 1945 aufgeworfenen Fragen damit gegenstandslos wären, im Gegenteil. Darin unterscheidet sich mein Ansatz von der klassischen Modernisierungstheorie, die sich bei Historikern vor allem in den 1970er Jahren einiger Beliebtheit erfreute. Diese Theorie postulierte Kriterien für den Übergang von einer traditionalen, vormodernen Gesellschaft zu einer modernen. Andere Historiker kritisierten daran nicht nur die holzschnittartige Vorstellung von »der« Vormoderne, die dem zugrunde lag. Sie wiesen auch auf die normative Grundlage der Theorie hin, in der alles auf ein klares, positiv besetztes Ziel zulief. Modernisierung endete in einer westlichen Moderne, die nicht zufällig genauso aussah wie die amerikanische Gesellschaft der 1960er Jahre.21 Ich knüpfe an die Diskussion um die historische Entwicklung der Moderne im Buch an, verwende aber den Begriff der Modernisierung nicht, der Tradition und Moderne unterscheidet. Ich bin dagegen gerade für die Zeit nach 1945 daran interessiert, wie sich die moderne Gesellschaft weiter verändert und neue Problemlagen aufwirft, die sich aus dem »modernen« Muster der funktionalen Differenzierung ergeben statt aus traditionalen Überhängen.22
Für die Zeit nach 1945 knüpft mein Band auch an eine Diskussion an, die der Zeithistoriker Hans Günter Hockerts angestoßen hat. Hockerts unterscheidet eine Zeitgeschichte, die sich auf die »Nachgeschichte« vergangener Probleme fokussiert, von einer, die sich als »Vorgeschichte heutiger Problemkonstellationen« versteht.23 Themen wie die Wiedergutmachung von NS-Opfern, die Entnazifizierung und überhaupt der gesamte Komplex der politisch-moralischen Hinterlassenschaft der beiden deutschen Diktaturen lassen sich so als »Nachgeschichte« vergangener Probleme verstehen. Hockerts verweist darauf, dass mit dem Blick auf die Vorgeschichte heutiger Problemkonstellationen auch ein Perspektivenwechsel verbunden ist. Als Beispiel nennt er das Wirtschaftswachstum. Aus der Perspektive der Großen Depression der späten 1920er Jahre löste es Probleme wie die Massenarbeitslosigkeit und damit verbundene soziale Konflikte. Aus dem Blickwinkel einer Vorgeschichte der Gegenwart wird hingegen sichtbar, dass unkontrolliertes Wachstum tiefgreifende ökologische Probleme erzeugt, die katastrophale Folgen haben.24 Problematische Nebenfolgen können auch dann entstehen, wenn sich Institutionen auf die funktional differenzierte Moderne einlassen und die »Eigengesetzlichkeit« der Funktionsbereiche anerkennen. Das hat etwa die katholische Kirche getan, als sie im Zweiten Vatikanischen Konzil ihre antimoderne Grundhaltung aufgab und es sich zur Aufgabe machte, die »Fremdperspektive« der nicht zur Religion gehörenden Funktionsbereiche in ihre Verkündigung zu integrieren.25 Das war ein gewaltiger, geradezu epochemachender Schritt in die Moderne. Aber war es nicht zugleich der Sprung in eine potentiell »gefährliche Modernität«? Denn die Anpassung an deren Strukturprinzipien, so lässt sich argumentieren, erschwerte zugleich die erfolgreiche Verkündigung des christlichen Glaubens, indem sie das Mysterium des Glaubens rationalisierte.26
Das Beispiel der katholischen Kirche zeigt, dass sich die Durchsetzung und die Folgen funktionaler Differenzierung letztlich nur im globalen Maßstab systematisch analysieren lassen. Dabei geht es zum einen um die Frage, ob nicht besser von unterschiedlichen Formen und Varianten der Moderne zu sprechen ist, die nicht alle dem westlichen, europäischen Modell folgen müssen, das sich seit etwa 1800 ausbildete.27 Zum anderen geht es darum, ob aus der Globalisierung des 19. Jahrhunderts eine Weltgesellschaft hervorgegangen ist, die gerade darauf basiert, dass funktional definierte Felder wie Wirtschaft, Massenmedien, Wissenschaft und auch Religion über nationale Grenzen hinweg in einer dichten globalen Vernetzung operieren.28 Der Historiker Jürgen Osterhammel hat in seinen bahnbrechenden Arbeiten gezeigt, wie sich das Konzept der funktionalen Differenzierung für eine historische Analyse der Globalisierung im 19. Jahrhundert fruchtbar machen lässt.29
Vor diesem Hintergrund ist die Rede von einer national umgrenzten »deutschen« Gesellschaft zunächst nicht mehr als eine heuristische Fiktion, also eine in der Wirklichkeit so nicht aufzufindende, für Forschungszwecke benutzte Vorstellung. Gleichwohl ermöglicht sie wichtige Einsichten, zumal die Durchsetzung und Form der differenzierten Moderne in manchem nationalspezifischen Mustern folgte. Dies zeigt sich beispielweise in der zeitlichen Verzögerung gegenüber Großbritannien und den USA, mit der sich der Sport als Funktionssystem in Deutschland ausdifferenzierte.30 Auch die Beobachtungen und Beschreibungen dieser Moderne fanden überwiegend in nationalen Diskussionsgemeinschaften statt.31 Schließlich – und dieses Argument scheint mir besonders wichtig – war die deutsche Gesellschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts maßgeblich durch zwei Diktaturen geprägt. Sowohl NSDAP als auch SED mussten auf die Herausforderung reagieren, welche das Muster funktionaler Differenzierung für ihr Ziel der politischen Steuerung der Gesellschaft bedeutete. An dieser Stelle wird auch deutlich, warum der oft vorgebrachte Einwand, die Theorie funktionaler Differenzierung sei teleologisch, haltlos ist. Denn der Differenzierungsprozess steuert nicht unausweichlich auf ein vorgegebenes Ziel zu. Vielmehr stemmten sich die beiden deutschen Diktaturen – in jeweils unterschiedlicher Form – gegen dieses Differenzierungsmuster.32
Ich konzentriere mich also, im Wissen um die Grenzen dieses Zugriffs, aber zugleich im Bemühen um Anschaulichkeit und Konkretion, auf Fallstudien zur deutschen Gesellschaftsgeschichte von 1880 bis 1980. Ich tue dies in der Hoffnung, damit wichtige Facetten der funktionalen Differenzierung als historischer Prozess zu verdeutlichen. Zugleich will ich so einen Beitrag zur Vorgeschichte der Gegenwart jener Moderne liefern, in der wir in Deutschland heute leben. Der Begriff der Moderne ist, wie oft notiert wurde, sowohl ein »Kampfbegriff« zur Markierung theoretischer Positionen als auch eine mit positiver Wertladung versehene Vorstellung.33 In historischen Analysen lässt sich dennoch nicht darauf verzichten. Dabei kommt es vor allem darauf an, Moderne nicht als einen Katalog von Merkmalen wie Industrie, Städtewachstum oder das Vorhandensein eines Bürgertums zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um eine Kategorie, die das Nachdenken über die Form der heutigen Gesellschaft ermöglicht und den Blick auf die Unterscheidungen lenkt, die für ihr Operieren zentral sind.34 Ich verwende das Konzept der Moderne also nicht als einen Epochenbegriff, sondern als einen Problembegriff, der die Aufmerksamkeit für eine bestimmte Fragestellung schärft.35 Meine Hoffnung ist, dass der ungewohnte Blick, den der Fokus auf funktionale Differenzierung eröffnet, neue Einsichten in die deutsche Geschichte seit 1880 ermöglicht. Die sozialhistorische Forschung zur Frühen Neuzeit von 1500 bis 1800 hat sich seit längerem mit Gewinn von Niklas Luhmanns Gesellschaftstheorie inspirieren lassen.36
Ich verstehe funktionale Differenzierung als ein Thema, das an der Schnittstelle von Soziologie und Geschichtswissenschaft angesiedelt ist. Das spiegelt sich auch im Aufbau dieses Bandes wider. Es geht in erster Linie um die historische Analyse von Differenzierungsmustern, wobei es sowohl um die Gesellschaft insgesamt geht – mit allen konzeptionellen Problemen, die dieses kleine Wort »insgesamt« aufwirft – als auch um die spezifische Perspektive einzelner Funktionssysteme. Ein wichtiges Thema ist das der Codierung. Mit dem Begriff des »Codes« bezeichnet Luhmann jene zentrale Unterscheidung, mit der Funktionssysteme ihre Operationen steuern und ihre Grenzen markieren: wahr/unwahr, krank / nicht krank, Recht/Unrecht, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Code ist somit von zentraler Relevanz für die Selbstbezüglichkeit, die funktionale Differenzierung ermöglicht und trägt.37
Diese Perspektiven prägen auch die Struktur des Buches. Der erste Teil des Bandes enthält historische Fallstudien. Zunächst analysiere ich die Dynamik funktionaler Differenzierung im Kaiserreich. Dabei wird deutlich, wie modern die deutsche Gesellschaft um 1900 bereits war und wie sehr sie unserer heutigen Gegenwart ähnelt. Das dritte Kapitel skizziert im historischen Längsschnitt wichtige Differenzierungsmuster der deutschen Gesellschaft von 1880 bis 1980. Im vierten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf den Jahren des »Dritten Reiches« 1933–1945. Dabei diskutiere ich, wie das NS-Regime auf funktionale Differenzierung reagierte und versuchte, sich ihre Dynamik zunutze zu machen. Daraus ergeben sich zugleich neue Perspektiven im Hinblick auf die wichtige Frage, auf welcher sozialen Grundlage die NS-Herrschaft basierte. Kapitel 5 ist den Auswirkungen funktionaler Differenzierung auf Religion und Kirchen gewidmet. Hier knüpfe ich in modifizierter Form an das Säkularisierungskonzept an. Am Beispiel der katholischen Kirche in der Bundesrepublik hebe ich hervor, dass Verlusten durch Differenzierung auch ein Gewinn an pastoraler Kompetenz gegenübersteht.
Der zweite Teil dieses Bandes bietet historische Fallstudien zur Codierung. Am Beispiel der Friedensbewegungen in der Bundesrepublik zeige ich, dass auch Protestbewegungen einen kommunikativen Code benutzen. Mit seiner Hilfe unterscheiden sie sich von ihrer gesellschaftlichen Umwelt. Zugleich dient er ihnen dazu, das Thema zu verdeutlichen, auf das sich ihr Protest richtet. Wie sich ein Funktionssystem herausbildet, diskutiere ich im Detail am Beispiel des Sports im siebten Kapitel. Der Sport ist nicht nur deshalb ein interessantes Beispiel, weil seine Ausdifferenzierung historisch gesehen relativ spät erfolgte. Zugleich kann ich – auch in Auseinandersetzung mit der soziologischen Diskussion – verdeutlichen, warum der Code des Sports dafür entscheidend war.
Der dritte Teil widmet sich der Verwendung des Differenzierungsbegriffs in der Soziologie. Dabei zeige ich auf, dass das Wissen um funktionale Differenzierung um 1900 nicht nur in Deutschland im Zentrum soziologischer Selbstbeschreibungen der Gesellschaft stand, von Durkheims Theorie der Arbeitsteilung bis hin zu Max Webers Vorstellung miteinander konkurrierender Wertsphären. Am Ende des Bandes steht ein kurzer Ausblick auf Probleme und Folgen funktionaler Differenzierung in der Gegenwart.
Die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft verfügt nicht über eine Kommandozentrale, von der sich die gesamte Gesellschaft überblicken und steuern lässt. Noch hat sie ein ethisches Zentrum, das moralische Wertnormen verbindlich festlegen kann. Sie ist vielmehr, wie Niklas Luhmann es formuliert hat, »eine Gesellschaft ohne Spitze und ohne Zentrum«.38 Warum das so ist, davon handelt dieser Band.
2. Gesellschaft ohne Zentrum. Differenzierung im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914
In die historische Debatte um das 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich ist erneut Bewegung gekommen.39 Auf der einen Seite steht eine optimistische Lesart, welche das Kaiserreich im »Aufbruch in die Moderne« sieht. Als wichtigste Indizien für diese These gelten neben dem trotz mancher Konjunkturschwankungen anhaltenden Boom der industriellen Wirtschaft die zahlreichen »Aufbrüche« und »Reformen« in den Bereichen der Sozialpolitik, Geschlechterverhältnisse und Gesundheitsfürsorge. Der spätestens seit 1890 auf breiter Front hervortretende Reformeifer – so diese Lesart – bezog seine Kraft aus der Zivilgesellschaft, also den zahlreichen Vereinen und Verbänden, in denen sich reformbereite Bürgerinnen und Bürger zusammenschlossen. Aber der bei weitem wichtigste Faktor war die »Massenpolitisierung«.40 Diese wiederum basierte – daran besteht kein Zweifel – auf dem bereits 1867 für die Wahlen zum Reichstag des Norddeutschen Bundes eingeführten allgemeinen, gleichen und direkten Männerwahlrecht. Dieses inklusive und egalitäre Wahlrecht war damals ein revolutionärer Schritt – nur Griechenland, Frankreich und, auf der Ebene der Kantone, die Schweiz praktizierten zu diesem Zeitpunkt ein ähnlich progressives Wahlrecht. Seine Ausübung schliff habituelle Muster der Unterordnung ab: Katholiken gaben ihre Stimme nicht mehr automatisch katholischen Aristokraten, sondern stattdessen Priestern, die mit populistischer Rhetorik für die kleinen Leute sprachen. Kleinstädtische Wähler folgten nicht mehr blind den Wahlempfehlungen der konservativen Beamten. Erst das progressive Reichstagswahlrecht machte schließlich den Aufstieg der Sozialdemokratie zur stärksten Partei nicht nur an den Wahlurnen, sondern auch im Reichstag 1912 möglich. Die antiquierten, auf dem Stand von 1871 eingefrorenen Wahlkreisgrenzen hatten ihn bis dahin zwar verzögern, aber nicht aufhalten können.41
Auf der anderen Seite stehen jene Historiker, welche trotz aller Demokratisierungstendenzen die autoritäre Grundstruktur des politischen Systems betonen. Zu deren Merkmalen zählt etwa die konstitutionelle Sonderstellung des Militärs und die trotz der zunehmenden Aufgabenlast des Reichstages ausbleibende Parlamentarisierung. Der Reichskanzler und die anderen Mitglieder der Reichsleitung waren bis zum Oktober 1918 allein vom Vertrauen des Kaisers abhängig, nicht aber vom Votum der Reichstagsmehrheit. Hinzu kam die auf dem Papier unpolitische, in der Realität aber konservativ-autoritäre »Beamtenherrschaft« und nicht zuletzt die »Radikalisierung« des neuen »Reichsnationalismus«. Dies sind nur einige Stichworte dieser negativen Bilanz der Reformfähigkeit der wilhelminischen Politik.42 Gegen eine allzu optimistische Lesart des vom allgemeinen, gleichen und geheimen Reichstagswahlrecht ausgehenden Wandels haben sich auch Kenner der Wahlgeschichte des Kaiserreichs gewandt. Sie weisen auf die andauernde Dominanz ungleicher, nach Besitz oder Vermögen unterscheidender Wahlrechtssysteme in den Bundesstaaten hin, von denen das grotesk ungerechte Dreiklassenwahlrecht für den preußischen Landtag nur ein besonders notorisches Beispiel war. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es in Bundesstaaten wie Hamburg (1906) und Sachsen (1896) Versuche gab, die Stellschrauben anzuziehen und ein noch stärker ungleiches Wahlrecht einzuführen. In diesem Sinne hat der Historiker James Retallack mit guten Gründen von »Wahlen ohne Demokratie« gesprochen.43
Ein Primat der Politik?
In dieser Debatte haben beide Seiten gute Argumente. Vieles spricht allerdings dafür, dass es eine tiefgreifende politische Reformblockade im Kaiserreich gab. Ungeachtet der vielfältigen Revisionen, welche die Forschung in den vergangenen beiden Jahrzehnten am älteren Bild der sozialhistorischen Ursachen eines »deutschen Sonderweges« vorgenommen hat, bleibt die Beharrungskraft der reformfeindlichen Kräfte ein zentrales Element der Politikgeschichte des Kaiserreichs.44 Dabei ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, dass die Entscheidung Berlins im Juli 1914, den deutschen Juniorpartner Österreich-Ungarn bei der Entfesselung eines europäischen Krieges zu unterstützen, auch durch die mangelnde parlamentarische Kontrolle der Machtzentralen des Kaisers und der Reichsleitung ermöglicht wurde.
Fraglich ist allerdings, ob diese Blockade des politischen Systems zum Maßstab für ein Gesamturteil über die Geschichte der Gesellschaft des Kaiserreichs gemacht werden kann. Ein wichtiger Vertreter der pessimistischen Lesart wie Hans-Ulrich Wehler hat der Politik eine zentrale Stellung in der deutschen Gesellschaft zugewiesen. Sie sei zusammen mit den sie tragenden sozialen Kräften »ausschlaggebend« für den Sonderweg gewesen. Für den fehlgeleiteten Umgang mit Modernisierungskrisen, der das Kaiserreich auszeichnete, sei die Politik in »entscheidendem Ausmaß« ursächlich. Deutlicher lässt sich der von Wehler vertretene Primat der Politik in der Gesellschaft kaum formulieren.45
Diesem Urteil möchte ich hier widersprechen, und zwar gerade mit Blick auf den von Wehler so maßgeblich vorangetriebenen Versuch, die deutsche Geschichte als Gesellschaftsgeschichte zu analysieren. Denn die deutsche Gesellschaft hat im späten 19. Jahrhundert entscheidende Schritte hin zur funktionalen Differenzierung getan. Diese Entwicklung macht es unmöglich, die deutsche Gesellschaft um 1900 als eine kompakte Einheit zu verstehen. Fehlentwicklungen und Deformationen eines Teilsystems können somit nicht umstandslos der Gesamtgesellschaft zugerechnet werden. Sie können damit auch nicht das Urteil über diese Epoche bestimmen. Funktionale Differenzierung, die Unterscheidung von selbständigen Feldern der Gesellschaft, ist ein wichtiges strukturelles Kriterium für die Modernität des Kaiserreichs, indem sie spezifischen Funktionen dienende soziale Praktiken und Felder freisetzte und damit die gesellschaftliche Komplexität steigerte. In dieser Betonung der Relevanz von funktionaler Differenzierung für die Modernität einer Gesellschaft unterscheidet sich mein Ansatz auch von der optimistischen Lesart des Kaiserreichs, bei der es vor allem um Reformen und Emanzipationsprozesse geht.
Mir kommt es im Folgenden vor allem auf die Dynamik an, die in der Geschichte des Deutschen Kaiserreichs von dieser Form der Ausdifferenzierung ausging. Dafür greife ich fünf Beispiele heraus: die Massenmedien, das Gesundheitssystem, den Sport, die Erziehung und die Kunst. Zunächst zu den Massenmedien, die im 19. Jahrhundert in erster Linie die Tageszeitungen umfassten. Dass die enorme Ausweitung des Marktes für Tageszeitungen die Epoche des Kaiserreichs buchstäblich zum »Zeitalter der Massenpresse« machte, ist keine neue Feststellung. Der Blick auf die rapide Steigerung der Auflagenzahlen und die innere Diversifizierung dieses Marktsegments, das 1914 nicht weniger als 4200 Tageszeitungen umfasste, macht das klar. In Wehlers skeptischer Deutung des Kaiserreichs geht es vor allem um die politische Tendenz der Presse. Zwar hätten liberale Blätter aus den Presseimperien der Verlage Ullstein und Mosse die konservative Tagespresse im Hinblick auf Breitenwirkung und Rezeption auf den »zweiten Rang« verwiesen. Gegenüber dem autoritären politischen Herrschaftssystem sei die liberale Presse aber im Zustand »politische[r] Ohnmacht« verblieben.46 Aber ist mit einem solchen, auf die politische Wirkung zielenden Urteil die gesellschaftsgeschichtliche Relevanz der Tagespresse hinreichend erfasst? Ein anderes Bild ergibt sich, wenn wir mit einem differenzierungstheoretischen Blick die besonderen Zugangsweisen zur sozialen Welt als das entscheidende Kriterium für die Modernität des Kaiserreichs verstehen.
Das System der Massenmedien
Aus dieser Perspektive wird erkennbar, dass die gedruckte Massenpresse im wilhelminischen Kaiserreich, insbesondere die Tageszeitungen, mit der enormen quantitativen Ausbreitung auch einen qualitativen Sprung vollzog. Die Medienberichterstattung differenzierte sich als eine eigenständige Form des Zugangs zur sozialen Realität aus. Als Institution, die Nachrichten in gedruckter Form zusammenstellte und verbreitete, hatte die Presse eine bis in die Frühe Neuzeit zurückreichende Vorgeschichte. Aber erst während des Kaiserreichs machte sich der spezifische Modus der Selektion und Verbreitung von Informationen im Medium der Tagespresse nachdrücklich als ein gesellschaftlicher Eigenwert geltend.47 Nun erst führte die Presse, wie jedes ausdifferenzierte Teilsystem der Gesellschaft, zu einer Verdoppelung der sozialen Welt unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Im Fall der Tageszeitungen war dieser Gesichtspunkt die Information, die praktisch im Moment ihrer Verbreitung bereits veraltet war und damit als Nichtinformation umgehend neuen Nachrichten Platz machen musste.48 Dieser Code der Massenmedien, der berichtenswerte Informationen erzeugt und zugleich veralten lässt, war etwas Neues. Die spezifische Temporalität und Sozialität dieser durch Massenmedien konstituierten Welt war am deutlichsten sichtbar und erfahrbar in der urbanen Welt der großstädtischen Metropole und vor allem in der Reichshauptstadt Berlin.
Berlin war im Jahrzehnt nach 1900 die Stadt mit der größten Dichte an Tageszeitungen in Europa. In der gedruckten Information der Zeitungen entstand jeden Tag aufs Neue eine »Wörterstadt«, wie der Historiker Peter Fritzsche formuliert hat. Diese »Wörterstadt« trat der realen, gebauten Stadt nicht nur ergänzend zur Seite, sondern überlagerte sie zunehmend und repräsentierte sie. Die besondere Flüchtigkeit und Eindringlichkeit der Inszenierungen des metropolitanen Lebens in Text und Bild der Presse pulsierte in ihrem eigenen, differenzierten Rhythmus, nämlich dem der täglich mehrfach, am Mittag, am Abend und nochmals in der Nacht erscheinenden Sonderausgaben. Ein klassisches Beispiel dafür war die seit 1904 bei Ullstein publizierte BZ am Mittag, die auf Telefonberichten basierte. Diese Blätter waren durch die Suche nach Aktuellem und Sensationen geprägt. Es blieb den Leserinnen und Lesern überlassen, was davon für sie interessant war. Eine Lektüreanweisung gab es nicht. Die in der Berliner Tagespresse gesellschaftliches Eigenleben gewinnende »Wörterstadt« avancierte nicht zuletzt deshalb bereits in den Augen zeitgenössischer Beobachter zu einem wichtigen Referenzpunkt für die Erfahrung und Beschreibung von Modernität, da sie in der Fülle ihrer Meldungen und anderen Berichts- und Meinungsformate eines bestätigte: Die Großstadt, in der verschiedenste soziale Prozesse zur selben Zeit ablaufen, ist selbst ein wichtiges Exempel funktionaler Differenzierung.49
Die Ausdifferenzierung eines Funktionssystems und seiner spezifischen Perspektive auf die soziale »Welt« wird von seiner eigenen Innendifferenzierung reflektiert. Zugleich treibt diese den Differenzierungsprozess weiter voran.50 Die Vervielfältigung der funktionalen Perspektiven in der modernen Gesellschaft bringt es mit sich, dass jede von ihnen in Kontakt mit allen anderen tritt. In der modernen Tagespresse des wilhelminischen Kaiserreichs zeigte sich dies unter anderem durch die zunehmende Binnendifferenzierung der Blätter in Sparten und Ressorts. Neben der Politik gewannen dabei das Feuilleton, die Wirtschaft, Lokales und nicht zuletzt auch Berichte über den Sport an Umfang und Bedeutung.51 Der spektakelhafte, auf theatralische Effekte und Episoden eingespielte Duktus der Berichterstattung in den Berliner Zeitungen entzog sich eindeutigen politischen Zuschreibungen. Das zeigt etwa die berühmte Köpenickiade des Schustergesellen Wilhelm Voigt, der im Oktober 1906 mit einer vom Kostümverleiher besorgten Hauptmannsunform eine Gruppe von Soldaten unter sein Kommando brachte und mit ihnen im Rathaus der Stadt Köpenick, damals noch ein Vorort von Berlin, die Herausgabe von Bargeld erzwang. Die Köpenickiade ist kein Beleg für die Kraft und Reichweite eines autoritären Sozialmilitarismus, als der sie oft interpretiert worden ist. In der Berichterstattung der Hauptstadtpresse war sie in erster Linie eine theatralische Posse unter vielen anderen. Die Köpenickiade bot einen Anlass zum Lachen, und nur deshalb konnte sie überhaupt auf die stets begrenzte, von den Tageszeitungen medial vermittelte Aufmerksamkeit des großstädtischen Publikums hoffen.52
Die rasche Ausdifferenzierung der Massenmedien als in sich geschlossenes System im wilhelminischen Kaiserreich hatte eine wichtige Folge. Die Zeitungen waren nun täglich auf der Suche nach Sensationen, und ihr Publikum erwartete, dass sie solche zum Frühstück lesen konnten. Damit war eine wichtige Voraussetzung für die Skandalisierung von Verstößen gegen als verbindlich geltende Normen und Werte gegeben, ob in sexueller oder in politischer Hinsicht. Die Kette der Skandale, welche die politische Geschichte des Kaiserreichs seit 1900 nicht nur begleiteten, sondern auch vorantrieben, ist lang. Sie reicht von der Eulenburg-Affäre in den Jahren 1907 bis 1909, der Daily Telegraph-Affäre 1908 – danach verschwand der stark in seinem Ansehen beschädigte Kaiser Wilhelm II. weitgehend aus dem öffentlichen Leben –, bis hin zur Zabern-Affäre 1913 und dem Kornwalzer-Skandal 1913/14, in dem die korrupte Zusammenarbeit zwischen der Firma Krupp und den für Rüstungsaufträge zuständigen Beamten der Heeresverwaltung ans Tageslicht kam.53 Die Berichterstattung über diese Skandale ließ sich auch rechtlich nicht mehr eindämmen oder gar kontrollieren. Staatliche Restriktionen der Presse hatten die deutschen Printmedien zwar das gesamte 19. Jahrhundert hindurch in ihrer Entfaltung eingeschränkt. Nach 1900 waren sie aber nicht mehr in der Lage, die Dynamik der Massenmedien nennenswert zu behindern. In der Praxis war der »Freiraum der Presse« für eine ungehinderte Berichterstattung in Deutschland nicht mehr geringer als in Großbritannien, das für seine liberale Handhabung der Presse bekannt war.54
In der Summe dieser Skandale zeigte sich eine Entwicklung, die für das Kaiserreich typisch war, zugleich aber Folgen bis in die Gegenwart hat. Im semikonstitutionellen Verfassungsgefüge des Kaiserreichs waren Kaiser und Reichsleitung gegenüber dem Parlament und den Parteien nicht verantwortlich. Wohl aber mussten sie, direkt oder indirekt, auf die massenmedial produzierten und vergrößerten Skandale reagieren. Das politische System war damit seit 1900 eng an die Massenmedien gekoppelt. Dessen Akteure beobachteten sich selbst permanent im Spiegel der Tagespresse. Sie lasen Tageszeitungen und reagierten auf deren Informationen.
Macht die Bezahlung von Arztrechnungen gesund?
Auch im Hinblick auf die Krankenbehandlung brachte gerade die Zeit des Kaiserreichs entscheidende Entwicklungen, die zur vollständigen Ausdifferenzierung eines Gesundheitssystems führten.55 Ich verwende diesen Begriff der Einfachheit halber, obwohl man strenggenommen von einem System der Krankenbehandlung sprechen müsste. Denn das Bezugsproblem ist die Behandlung von Krankheiten, nicht aber die Gesundheit. Ärzte können nur mit Krankheiten etwas anfangen, und krank ist deshalb auch der positive Anschlusswert des Codes »krank / nicht krank«.56 Von einem Gesundheitssystem im engeren Sinne lässt sich erst dann sprechen, wenn sich neben der Behandlung von Krankheiten auch deren Prävention – und damit die Aufrechterhaltung der Gesundheit – zu einem wichtigen Schwerpunkt aller medizinischen Bemühungen entwickelt. Im Zuge dieses Prozesses verschiebt sich zugleich der Fokus von der direkten Einwirkung auf den Körper darauf, »Kommunikationserfolge« so zu erzielen, dass Individuen gesundheitsschädliche Verhaltensweisen zurückfahren oder aufgeben.57 Gesundheitsaufklärung und Prävention wurden aber erst in der Weimarer Republik wichtige Elemente der Rationalisierung von Einstellungen zum Körper, etwa in der Sexualhygiene.
Ein wichtiger Faktor für die Ausdifferenzierung dieses Systems im Kaiserreich waren die immensen Fortschritte im Bereich der medizinischen Wissenschaft. Mit der Identifizierung von Krankheitsursachen, neuen Methoden der Diagnostik und spezifischen Therapien waren gerade deutsche Mediziner hier weltweit führend. Diese Fortschritte stießen zugleich eine weitreichende Spezialisierung innerhalb der Medizin an. Fachrichtungen wie Orthopädie, Dermatologie und Kinderheilkunde entwickelten eigene Universitätskliniken, Lehrbücher und Fachgesellschaften.58 Eine solche Binnendifferenzierung eines Systems lässt sich sowohl als Indikator wie als weitere Triebkraft seiner eigenen Ausdifferenzierung verstehen. Der wichtigste Faktor für die rasante Ausdifferenzierung des Gesundheitssystems bis 1914 waren allerdings Veränderungen in den Berufsrollen, die dieses System trugen, und zwar vor allem, einen Begriff von Talcott Parsons aufgreifend, in der »Leistungsrolle« der Ärzte – denen die Patienten in einer in das System nur passiv eingebundenen »Publikumsrolle« gegenüberstehen.59 In dem ihm eigenen ironischen Duktus hat der Soziologe Niklas Luhmann einmal formuliert: »Auch die Zahlung von Arztrechnungen macht ja nicht gesund. […] Wer hier nicht unterscheiden kann, kann sich in der heutigen Gesellschaft nicht adäquat orientieren.«60 Diese Feststellung trifft differenzierungstheoretisch zu. Aber historisch gesehen war es gerade die Zahlbarkeit von Arztrechnungen, die der Ausdifferenzierung des Gesundheitssystems einen entscheidenden Schub vermittelte.
Doch der Reihe nach. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts handelte es sich bei den Ärzten noch keineswegs um eine in sich geschlossene Profession, sondern um eine Ansammlung verschiedenster Berufe mit teils sehr groben praktischen, teils eher spekulativen Fertigkeiten. Neben Wundärzten, Badern, Barbieren und allen möglichen Laienheilern standen die sogenannten »gelehrten Ärzte«. Sie hatten das Studium an einer medizinischen Fakultät absolviert, wiesen aber angesichts des damaligen Wissens nur eine spekulative Kompetenz auf. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sorgten staatliche Eingriffe zumindest in Preußen dafür, dass sich aus dieser Vielzahl von Berufen eine einzige Profession herausschälte, in die akademische Medizin und Chirurgie integriert waren. Mit der Bildung eines »Einheitsstandes« 1852 setzten die Ärzte als Praktiker ein Berufsmonopol durch, das andere Gruppen wie Bader und Barbiere dauerhaft ausschloss. Erst auf dieser Grundlage konnte die bereits angesprochene Binnendifferenzierung durch Spezialisierung in Gang kommen. Zugleich wurde die universitäre Ausbildung verwissenschaftlicht und mit dem praktischen Jahr ein berufsbezogenes Element eingeführt.61 Wie dieser kurze Überblick zeigt, folgte die Differenzierung und Professionalisierung der Ärzteschaft nicht dem Muster der Trennung von Funktionen, bei dem eine multifunktionale Rolle auf verschiedene Berufe aufgeteilt wird. Vielmehr gab es auch gegenläufige Prozesse wie die »Integration« verschiedener Aufgaben zu einem »neuen Beruf« und die »Absorption« von bestimmten praktischen Elementen in andere.62
Eine weitere entscheidende Triebkraft für die Ausdifferenzierung des Gesundheitssystems war dann aber die Nachfrage, und zwar – dies war entscheidend – die »zahlungsfähige« Nachfrage.63 Diese entstand mit der Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung für gewerbliche Arbeiter 1883 im Zuge der Bismarck’schen Sozialpolitik. Dank einiger folgender Gesetzesnovellen wuchs die Zahl der Versicherten bis 1900 bereits auf 18 Prozent der Bevölkerung an. Dabei sind allerdings die mitversicherten Familienmitglieder nicht eingeschlossen, denen viele Krankenkassen nach der Bildung entsprechender Rücklagen ebenfalls Leistungen gewährten. Hinzu kamen gerade in den Großstädten viele freiwillig Versicherte. Bezieht man auch noch die Knappschaftskassen mit ein, so waren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg unter Einschluss der Mitversicherten etwa die Hälfte aller Deutschen Mitglied einer Krankenkasse. Damit ging eine dramatische Steigerung der von den Kassen bezahlten Arztkosten einher, von 10,9 Millionen Mark im Jahr 1887 auf 71,3 Millionen Mark im Jahr 1909. Da die Zahl der niedergelassenen Ärzte im gleichen Zeitraum ebenfalls stark anstieg, erhöhten sich deren Einkommen jedoch nicht im selben Maße.64In dieser Phase der Professionalisierung des Arztberufes wuchsen die Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen von Ärzten, insbesondere den Allgemeinpraktikern und Fachärzten, aber gerade auch zwischen jenen, die als Kassenärzte zugelassen waren, und allen anderen. Der 1900 gebildete Hartmannbund vertrat in diesen Konflikten die Standesinteressen der Ärzte, die 1903/04 große Streiks durchführten. Erst 1913 kam es zu einer Übereinkunft, mit der die Zulassung als Kassenarzt geöffnet und die relativ freie Arztwahl der Patienten durchgesetzt wurde.65 Wie auch in anderen Funktionsbereichen sorgte hier also ein Konflikt für Ausdifferenzierung.
Für das Verständnis der Ausdifferenzierung des Gesundheitssystems entscheidend sind nun allerdings die fundamentalen Veränderungen im Verhältnis zwischen Arzt und Patient, die sich im Gefolge dieser Prozesse vollzogen. In den bürgerlichen Familien des frühen 19. Jahrhunderts war der Arzt – dessen heilende Fachkompetenz zu diesem Zeitpunkt ohnehin noch sehr begrenzt war – mehr als nur der Inhaber einer funktionalen »Leistungsrolle«. Er suchte die Familien zu Hause auf, anstatt sie in seiner Praxis zu empfangen, und war nicht nur im Krankheitsfall gefragt. Seinen bürgerlichen Patienten stand er auch in einer pastoralen Rolle und als Berater in allen Lebenslagen zur Verfügung. Mit dem Vordringen der Fachärzte, dem flächendeckenden Übergang von der Praxis des Hausbesuchs zur ärztlichen Sprechstunde und nicht zuletzt mit der enormen sozialen Ausweitung der Patientenklientel, zu der nun in rasch steigendem Maße Arbeiter zählten, änderte sich dies seit den 1880er Jahren fundamental. Nun herrschte zwischen Arzt und Patient »ein zunehmend funktional spezifisches, auf die ärztliche Aufgabe der Krankenbehandlung konzentriertes Verhältnis«. Damit ging zugleich eine andere Entwicklung einher: »Der Patient als psychosomatische Einheit geriet zunehmend aus dem Blick; er wurde zum behandlungswürdigen ›Fall‹.«66 Der Blick des Arztes richtete sich nun nicht mehr auf die ganze Person samt ihrer psychischen Befindlichkeit, sondern nur noch auf den jeweils von einer Krankheit betroffenen Körperteil oder das Organ.
In alldem zeigen sich auch für andere Funktionsbereiche der modernen Gesellschaft geltende Charakteristika. Funktionale Differenzierung führt zunächst zum Auf- und Ausbau sowie zu der Spezialisierung von jeweils systemspezifischen Organisationen. In diesem Fall zählten dazu neben den Krankenhäusern auch die Institutionen der öffentlichen Gesundheitspflege, die Krankenkassen sowie die verschiedenen Berufsverbände der Ärzte. Sie alle haben das Gesundheitssystem von seinen Anfängen in den 1880er Jahren bis in die Gegenwart zu dem am stärksten durch korporative Verbandsmacht geprägten Funktionssystem in der deutschen Gesellschaft gemacht.67 Die Ausprägung von spezifischen Berufs- und Funktionsrollen, die mit dem für das System spezifischen Code arbeiten, kommt als zweites Moment hinzu.
Systembildung in der Erziehung
Differenzierung war aber auch und gerade für die nur punktuell und zu bestimmten Zeitpunkten in das System eingebundenen Inhaber von »Publikumsrollen« folgenreich, also für Zeitungsleser und Radiohörer, Kläger und Beklagte vor Gericht, Galeriebesucher und Konsumenten, um nur einige Beispiele zu nennen. Denn diese Menschen wurden durch ihre Einbindung in ganz unterschiedliche funktionale Kontexte dort jeweils nur in einem kleinen Ausschnitt ihrer Persönlichkeit relevant. Durch die Inklusion in Funktionssysteme entstand ein »Dividuum«, also ein Mensch, der erst ungeachtet seiner Individualität als Konsument von Leistungen ernst genommen wird.68 Gerade für die Patienten im Gesundheitssystem hatte dies – buchstäblich und metaphorisch – schmerzhafte Folgen. Denn die Klagen von Patienten darüber, dass ihre eigentlichen Probleme und Symptome vom Facharzt nicht angemessen wahrgenommen würden und man im Krankenhaus als Patient anonym bleibe, sind in Deutschland genauso alt wie das moderne, ausdifferenzierte Gesundheitssystem, nämlich etwa 140 Jahre.69
Die Ausdifferenzierung des Erziehungssystems vollzog sich über dessen zentrale Institution, die Schule. In Preußen – das diese Entwicklung im Gebiet des Deutschen Bundes und später im Kaiserreich voranbrachte – war dabei der Staat die treibende Kraft. Den Zugang zur Bildung verbesserte der säkulare Ausbau der Volksschulen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Besuchten 1816 erst 60 Prozent aller schulpflichtigen Kinder in Preußen eine Volksschule, waren es 1864 bereits 93 Prozent.70 Eigentlicher Motor der Ausdifferenzierung des Erziehungssystems waren aber die höheren Schulen. Denn bevor die Nationalsozialisten 1941 die Gemeinschaftsschule einführten, waren die Volksschulen in Deutschland ganz überwiegend Konfessionsschulen und damit klerikaler Kontrolle und religiöser Beeinflussung des Unterrichts durch die beiden christlichen Konfessionskirchen ausgesetzt.
Seit dem späten 18. Jahrhundert entwickelte die an den höheren Schulen vermittelte Bildung eine Dynamik, die die ständischen Hierarchien der Gesellschaft aufsprengte, da man Individuen anhand von Leistungskriterien in das Erziehungssystem aufnahm. Den Anfang machte das Abiturreglement von 1788, also die Einführung einer Prüfung, deren Bestehen zum Universitätsstudium berechtigte. Anfangs ermöglichte es nur den Zugang zu staatlichen Stipendien und anderen universitären Vergünstigungen wie dem Freitisch. Eine allgemeine Abiturpflicht für alle Universitätsstudenten ließ sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchsetzen, das geschah erst 1834. Aber die 1788 getroffene Regelung war der erste Schritt zu einem ausdifferenzierten Bildungssystem, das den Zugang zunächst zur Universität, ab 1812 zu staatlichen Berufen und schließlich auch zu Karrieren in der Wirtschaft an schulische Berechtigungen koppelte. Es wies der Erziehung also eine Auswahlfunktion zu. Neben der Selektion stand die Regelung von zwei weiteren Bezugsproblemen am Beginn der Ausdifferenzierung des höheren Schulwesens im frühen 19. Jahrhundert. Das eine betraf die Bildungsinhalte, die in Preußen ab 1812 durch die zentrale Festlegung von Prüfungsanforderungen in einem Lehrplan definiert wurden. Nur solche Schulen, die ihn erfüllten, konnten ihre Schüler fortan zur Universität schicken. Das andere war die Ausdifferenzierung der Berufsrolle des Gymnasiallehrers durch die Einführung einer wissenschaftlichen Staatsprüfung 1810, die den Lehrerberuf vom Beruf des Theologen trennte. Bis zu diesem Zeitpunkt lehrten in Gymnasien zumeist Theologen, welche die Zeit bis zur Zuweisung einer Pfarrstelle durch die Lehrtätigkeit überbrückten.71
Aber bis weit in das 19. Jahrhundert hinein hatte das preußische Gymnasium noch eine »multifunktionale Struktur«. Es bildete sowohl Schüler aus, die bis zum Abitur dort verblieben, um ein Universitätsstudium zu beginnen, als auch jene, die bereits früher abgingen, nachdem sie mit dem erfolgreichen Abschluss einer bestimmten Klassenstufe die Berechtigung zum Eintritt in eine der hierarchisch gestaffelten Laufbahnen im Staatsdienst oder bei der Post gewonnen hatten. Auch jene, die zum Ableisten des verkürzten Militärdienstes als Einjährig-Freiwilliger bis zur Obersekunda verblieben, zählten zu diesen Frühabgängern. Zur Ausbildung eines differenzierten – und das heißt vor allem: in sich differenzierten – Systems der höheren Schulen in Preußen trugen dann in erster Linie drei Entwicklungen bei. Dazu zählten zunächst die sich über Jahrzehnte hinziehenden Anstrengungen der nichtgymnasialen Schulen – der Realgymnasien und Oberrealschulen – sowie der an ihnen beschäftigten Lehrer. Sie bemühten sich darum, die dort vergebenen Abschlüsse aufzuwerten oder der Studienberechtigung des Gymnasiums gleichzustellen. Hinzu kamen Anstöße, die von der Integration der nach dem Krieg von 1866 in den preußischen Staat eingegliederten Landesteile ausgingen. So bot die Eingliederung von Hessen-Nassau, in dem es lateinlose Realschulen gab, zusammen mit der Umbildung anderer Schultypen den Ausgangspunkt für den landesweiten Aufbau eines Strangs lateinloser höherer Schulen in Preußen. Schließlich gab es seit Ende der 1850er Jahre intensive Bemühungen der Kulturbürokratie, die Schultypen und Prüfungsordnungen in den einzelnen preußischen Provinzen zu vereinheitlichen und zu einer in ganz Preußen einheitlichen Formation zusammenzufassen.72
Dieser Prozess erreichte mit der 1882 erlassenen Unterrichts- und Prüfungsordnung für den gesamten Staat Preußen einen wichtigen Wendepunkt. Die bildungshistorische Forschung sieht deshalb die 1880er Jahre als das Jahrzehnt der »Systemkonstitution« im höheren Schulwesen.73 Seit diesem Zeitpunkt waren die drei wichtigsten Typen höherer Schulen – das klassische humanistische Gymnasium, die Realgymnasien und die lateinlosen höheren Schulen – klar gegeneinander ausdifferenziert und jeweils mit einheitlichen Lehrplänen und Prüfungsordnungen ausgestattet. Beschleunigt wurde die Herausbildung und Stabilisierung dieses Arrangements durch das rapide Wachstum der lateinlosen höheren Schulen, vor allem der neunjährigen Oberrealschule, seit den 1880er Jahren. Dabei handelte es sich um einen neuen Schultyp, der sich aber starker Nachfrage erfreute, da er eine Reihe von auf dem Arbeitsmarkt begehrten Berechtigungen verleihen konnte. In diese Ausdifferenzierung des Erziehungssystems im Bereich der höheren Knabenschulen gingen weitere Kontextfaktoren ein. Dazu zählte vor allem die Auffächerung der Wissenskultur durch das Aufkommen der Naturwissenschaften, das in den Schulen für Streit zwischen Humanisten und Realisten sorgte. Dabei gehörten auch Mathematik und Physik zu den Lehrplänen der humanistischen Gymnasien. Als eigentliches Unterscheidungskriterium erwies sich die Chemie. Sie war in den gymnasialen Lehrplänen gar nicht vertreten – im Übrigen auch noch nach 1918 –, wurde aber in den Realanstalten über die gesamte dreijährige Oberstufe hinweg intensiv unterrichtet.74
In der bildungshistorischen Forschung ist unbestritten, dass in dem Gerangel um die Ausgestaltung der verschiedenen Schultypen, das sich von 1850 bis 1890 hinzog, auch das Interesse der Eltern an der Aufrechterhaltung sozialer Rangstufen eine wichtige Rolle spielte. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass der Ausbau des höheren Schulwesens und vor allem der Rückgang der Frühabgängerzahl durch die Ausdifferenzierung verschiedener Schultypen den Zugang zu den höheren Schulen und ihren Bildungschancen insgesamt verbesserte. Auch die von Fritz K. Ringer vorgetragene These, es habe sich letztlich um eine Form segmentärer Differenzierung gehandelt, ist nicht überzeugend. Ringer hat argumentiert, dass sich im Nebeneinander von humanistischen Gymnasien und Realgymnasien letztlich nur das Nebeneinander der Teilsegmente des Bürgertums, Bildungsbürgertum und Wirtschaftsbürgertum, reflektiert, die für ihre Kinder jeweils den passenden Schultyp aussuchten. Diese These ist deshalb nicht überzeugend, weil es den Preußen lange kaum möglich war, an ihrem Wohnort eine entsprechende Auswahl zu treffen. Von den um 1900 rund 400 preußischen Städten mit mindestens einer höheren Schule boten nur 50 die Möglichkeit, das Abitur in unterschiedlichen Schultypen abzulegen, nur in 20 von ihnen gab es alle drei Typen (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule).75
Zu den Veränderungen im institutionellen Arrangement der verschiedenen Schultypen kam die weitere Professionalisierung der Leistungsrolle des Lehrers hinzu. Dabei wirkten verschiedene Faktoren zusammen und verstärkten sich wechselseitig. Wichtig war zunächst die arbeitsteilige Zergliederung des Unterrichts durch die Einführung von Jahrgangsklassen anstelle der früheren Fachklassen, die Spezialisierung der Lehrer auf bestimmte Fächer und die Definition von Stoffplänen und Leistungskontrollen. Veränderungen der Prüfungsordnungen für den Lehrerberuf und die Stärkung der pädagogisch-didaktischen Komponente gingen damit einher. In demselben Maße, in dem der Gymnasiallehrer auf die Rolle eines Vermittlers von spezifischem Wissen festgelegt wurde, gingen seine allgemeine wissenschaftliche Kompetenz und seine Teilhabe am akademischen Leben zurück. Sichtbarer Ausdruck dieses Trends war der Rückgang der Zahl promovierter Lehrer und der von ihnen veröffentlichten wissenschaftlichen Abhandlungen, unter denen aber der Anteil pädagogischer Themen zunahm. Schließlich veränderten das Wachstum der Schülerzahlen und damit die Steigerung der Schülerzahl pro Klasse den Charakter des gymnasialen Unterrichts. Der Pädagoge Wilhelm Rein erinnerte sich an seine Schulzeit auf dem Gymnasium in Eisenach um 1860. Die Schule zählte damals weniger als 100 Schüler, und so war es möglich, dass alle Lehrer und Schüler »sich näher kennenlernten«. Um 1900 hatten 31 Prozent aller preußischen Gymnasien bereits mehr als 400 Schüler. In diesen schulischen Großbetrieben – so eine zeitgenössisch gebrauchte Analogie – war die Leistungsrolle des Lehrers »sachlich spezialisierter« und wurde in »unpersönlicher« Form ausgeübt.76
Seit etwa 1880 bildete sich so in den höheren Knabenschulen ein Erziehungssystem heraus, das sich auf die Vermittelbarkeit schriftlich kodifizierter Wissensbestände konzentrierte und daraus seine Kompetenz und Eigenlogik gewann. Im Zuge dieses Prozesses verlängerte sich die durchschnittliche Verweildauer in den höheren Schulen, was den Schulen die Konzentration auf ihre pädagogische Aufgabe erleichterte. Die Anerkennung der Reifeprüfungen auch der Realgymnasien und Oberrealschulen für die Einschreibung an den Universitäten, die 1900 erfolgte, war eine weitere wichtige Etappe in der Binnendifferenzierung des Erziehungssystems. Aber erst mit dem Ende des Kaiserreichs verschwand das Privileg des Einjährig-Freiwilligen Militärdienstes. Es war an die Obersekundareife gekoppelt und damit ein Anreiz, den Besuch des Gymnasiums bereits vor dem Abitur abzubrechen. Aus diesem Grund markierte der Fortfall dieses Privilegs einen weiteren wichtigen Schritt in der Ausgestaltung des Erziehungssystems.
Neben der Aus- und Binnendifferenzierung von Massenmedien, Gesundheitssystem und Erziehungssystem ist noch der moderne, wettbewerbsorientierte Sport zu nennen. Seine Ausdifferenzierung war bis zum Ende des Kaiserreichs noch nicht abgeschlossen, machte aber bis 1914 erhebliche Fortschritte.77 Diese vier Funktionssysteme sind wichtige Beispiele dafür, dass die für das Kaiserreich typische Form der Modernität auf dem Auftauchen – die Soziologen sprechen von Emergenz – und der Verfestigung von spezifischen Zugangsweisen zur sozialen Welt basierte. Die Herausbildung dieser Funktionsbereiche war in die politische Wirklichkeit des Kaiserreichs eingebunden und von ihr in mancherlei Hinsicht beeinflusst. Zugleich bildeten diese Systeme ihre je eigene soziale Wirklichkeit aus, für deren Form und Strukturbildungen die Wertnormen des monarchischen Obrigkeitsstaates eine bestenfalls nachrangige Rolle spielten. Ausdifferenzierung im Kaiserreich war jedoch nicht nur das Ergebnis der Entstehung von neuen, funktional bestimmten Teilsystemen. Sie ergab sich auch aus der weiteren Spezialisierung von bereits bestehenden Funktionsbereichen, durch eine neue Programmierung von Feldern, die sich als sozialer und institutioneller Kontext bereits seit längerem hinreichend verselbständigt hatten.
Der Eigenwert der Kunst
Ein eindringliches Beispiel dafür bietet die auf Schönheit kaprizierte bildende Kunst, insbesondere die Malerei, da sich an ihr die Zuspitzung des Wirklichkeitsbezuges am klarsten zeigen lässt. Die Kunst hatte sich bereits seit dem späten Mittelalter als ein Feld ausdifferenziert, das durch den artifiziellen, imaginären Charakter seiner Hervorbringungen deren Beobachter dazu einlädt, den Prozess der Wahrnehmung zu reflektieren, und daraus seinen Eigenwert gewinnt.78 Zugleich bewies die Kunst mit der Möglichkeit, künstlerische Individualität bei wechselnden Stilrichtungen auszudrücken, und der Ausbildung eines sachverständigen Publikums ihre Eigenständigkeit. Die im Kaiserreich erfolgende weitere Ausdifferenzierung zeigte sich darin, wie das spezifische Bezugsproblem der Kunst – die Transformation der sinnlichen Wahrnehmung in gesellschaftliche Kommunikation – reformuliert und programmiert wurde.79 Funktionssysteme benutzen Programme, um Handlungsanweisungen für die Benutzung des in ihnen geltenden Codes bereitzustellen und dessen Zuordnung zu regeln. So hat der Philosoph Karl Popper zum Beispiel Falsifizierbarkeit als Programm für die Wissenschaft vorgeschlagen. Der Codewert »wahr«, so seine These, ließe sich niemals schlüssig nachweisen. Könne man zeigen, dass eine wissenschaftliche Theorie oder Aussage »falsch« sei – sie also falsifiziere –, dann komme man der Wahrheit näher.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verabschiedeten sich die Maler des »Berliner Impressionismus«, unter ihnen Max Liebermann, Lovis Corinth und Max Slevogt, in der Rezeption des französischen Impressionismus von den bis dahin dominierenden Darstellungskonventionen des Idealismus und Realismus. Dabei ist eine eigentümliche Dialektik zu beobachten. Einer Beschränkung in der Wahl der Sujets (bei denen Alltagsszenen aus dem Leben wie Kinder, Gärten und Straßen an die Stelle allegorischer und mythologischer Themen traten) stand eine Intensivierung des Gefühls und der Empfindung für Farbe und Form gegenüber.80 Die Impressionisten der Berliner Secession konzipierten ihre Gemälde nicht länger als Darstellung der Welt, sondern konzentrieren sich auf die Wahrnehmung selbst, auf den »Vorgang des subjektiven Sehens«, der in den Bildern mit der »Eigendynamik« der Farben zum Ausdruck gebracht werden sollte. Den nächsten, entscheidenden Schritt vollzog dann die deutsche »Kunstrevolution« des Expressionismus, der die Formelemente des Bildes (Farbe, Form der Flächen) als ein »autonomes Gefüge« gestaltete. Die Entwicklung dieser neuen, eigenständigen Formensprache stand im Zusammenhang mit der Konkurrenz in der bildlichen Darstellung, die der Kunst durch die Fotografie entstanden war. Die expressionistischen Maler reagierten darauf, indem sie den Wirklichkeitsbezug ihrer Bilder radikal subjektivierten. Der Expressionismus antwortete auf die erkennbare »Fragwürdigkeit der Welt« durch die »Setzung von Zeichen, von Sinn-Bildern mit eigener Logik«.81 Ziel dieser Kunst war es, wie Franz Marc formulierte, »ihrer Zeit Symbole zu schaffen […], hinter denen der technische Erzeuger verschwindet«.82
Der Expressionismus distanzierte sich damit radikal von einer auf die Nachahmung der sogenannten »Realität« setzenden künstlerischen Strategie. Seine experimentelle Formensprache ist nur ein, im deutschen Kontext allerdings extrem wichtiges Beispiel für die grundlegende Transformation der Kategorien von Raum und Zeit in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Selbst wer der Kunst nur einen nachrangigen Platz im Gefüge der modernen Gesellschaft einräumen möchte, kommt nicht umhin, die mit dieser Entwicklung verbundene Entwertung traditioneller Sehweisen als ein gesellschaftshistorisches Phänomen von fundamentaler Bedeutung anzuerkennen. Der künstlerische Weltbezug – und damit zugleich die Möglichkeit des Realitätsbezuges überhaupt – wurde hier in neuer, radikal subjektivistischer Form reformuliert.83 Mit guten Gründen hat der Historiker Thomas Nipperdey deshalb in einer nur scheinbar tautologischen Formulierung davon gesprochen, dass im Kaiserreich Kunst »zuerst Kunst« gewesen sei.84 In vergleichbarer Weise hat der Soziologe Max Weber in seiner berühmten »Zwischenbetrachtung« aus dem Jahr 1917, in erkennbarer Anspielung auf die künstlerische Avantgarde des Kaiserreichs und mit Bezug auf die Ausdifferenzierung der Kunst gegenüber der christlichen Religion formuliert: »Die Kunst konstituiert sich nun als ein Kosmos immer bewußter erfaßter selbständiger Eigenwerte. Sie übernimmt die Funktion einer, gleichviel wie gedeuteten, innerweltlichen Erlösung.«85 Die Kunst im Kaiserreich formulierte den jedem Funktionssystem zugrundeliegenden Selbstbezug, also das Problem der Selbstreferentialität, damit auf neue Weise.86
Als Beispiel für einen ähnlichen Zusammenhang sei hier an den sogenannten Werturteilsstreit erinnert. Die Mitglieder des sozialreformerischen Vereins für Socialpolitik trugen ihn seit 1905 auf dessen Jahrestagungen aus. Im Kern ging es darum, ob Wissenschaftler mit ihrer Expertise für die Sozialpolitik maßgebliche und verbindliche politische Werturteile formulieren konnten oder nicht. In den Gutachten, die alle namhaften Kontrahenten in diesem Streit für eine 1913 stattfindende Ausschusssitzung des Vereins vorlegten, fand er seinen Höhepunkt und Abschluss.87