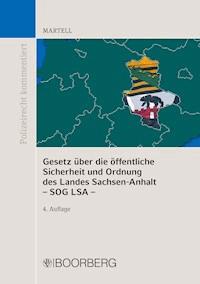
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt – SOG LSA – E-Book
Jörg Martell
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Neue Regelungen – kompetent erläutert Das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt hat in den letzten Jahren zahlreiche Änderungen erfahren, z.B. • durch Art. 1 des Gesetzes über die Neuregelung der Erhebung von telekommunikations- und telemedienrechtlichen Bestandsdaten vom 10.10.2013 (GVBl. LSA S. 494), Neubekanntmachung vom 20.5.2014 (GVBl. LSA S. 182, 380) und • durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 (GVBl. S. 559). Der Autor hat diese Regelungen in den vollständig überarbeiteten Kommentar eingearbeitet. Auch neu erlassene Verwaltungsvorschriften und die neuesten Entwicklungen in Rechtsprechung und Literatur sind berücksichtigt. Für die Praxis Der Kommentar ist eine verlässliche Entscheidungshilfe und wichtige Arbeitsgrundlage für • Polizeibehörden und -dienststellen, • Regierungspräsidien, • Kommunalverwaltungen, • Rechtsanwälte und • Verwaltungsgerichte. Die Kommentierung ist an den Bedürfnissen der Polizei und der Verwaltungsbehörden ausgerichtet. Der Gesetzestext wird klar, präzise und leicht verständlich erläutert. Eine Vielzahl von Beispielsfällen vermittelt dem Leser die nötige Sicherheit bei der praktischen Anwendung der Vorschriften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 750
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt – SOG LSA –
mit Erläuterungen
Jörg Martell
Ministerialdirigent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt
1.–3. Auflage auch
Kurt Meixner
Leitender Ministerialrat a.D.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
4. Auflage, 2016
Print ISBN 978-3-415-05766-1 E-ISBN 978-3-415-05798-2
© 1992 Richard Boorberg Verlag
E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Titelfoto: © RBV/Markus Götze/Martina Berg – Fotolia
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresdenwww.boorberg.de
Vorwort zur 4. Auflage
Seit dem Erscheinen der 3. Auflage des Kommentars zum SOG LSA ist ein ungewöhnlich langer Zeitraum vergangen. Es hat daher in der Zwischenzeit zahlreiche Gesetzesänderungen gegeben. Allein bis zum Zweiten Ergänzungsblatt wurde das Gesetz wie folgt geändert:
Art. 5 des Gesetzes zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften vom 21.8.2001 (GVBl. LSA S. 348), Art. 26 des Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes Rechtsbereinigungsgesetz) vom 7.12.2001 (GVBl. LSA S. 540, 544), Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 10.7.2003 (GVBl. LSA S. 150), Neubekanntmachung vom 23.9.2003 (GVBl. LSA S. 214).
Danach erfolgten folgende Änderungen und eine Neubekanntmachung:
Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Landeskostenrechts und des Gesetzes über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt vom 14.2.2008 (GVBl. LSA S. 58), Art. 2 Abs. 26 des Gesetzes zur Neuordnung des Landesbeamtenrechts vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648), Art. 2 des Gesetzes zur Anpassung landesrechtlicher Verjährungsvorschriften vom 18.5.2010 (GVBl. LSA S. 340), Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 26.3.2013 (GVBl. LSA S. 145), Art. 4 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 26.3.2013 (GVBl. LSA S. 134, 143), Art. 1 des Gesetzes über die Neuregelung der Erhebung von telekommunikations- und telemedienrechtlichen Bestandsdaten vom 10.10.2013 (GVBl. LSA S. 494), Neubekanntmachung vom 20.5.2014 (GVBl. LSA S. 182, 380), Art. 9 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17.6.2014 (GVBl. LSA S. 288, 340), Art. 7 des Gesetzes zur Änderung archivrechtlicher Vorschriften vom 3.7.2015 (GVBl. LSA S. 314, 318), Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 (GVBl. LSA S. 559), Art. 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Justizvollzugs in Sachsen-Anhalt vom 18.12.2015 (GVBl. LSA S. 666, 711).
Dies machte eine sehr gründliche Überarbeitung nötig, um auch weiterhin ein dem aktuellen Rechtsstand und der aktuellen Rechtsprechung entsprechendes modernes Hilfsmittel anzubieten.
Kurt Meixner, von der 1. bis zur 3. Auflage Mitkommentator, hat die Mitarbeit an diesem Werk beendet. Dass es überhaupt das Licht der Welt erblickte, war wesentlich ihm zu verdanken, denn da das SOG LSA in der Erstfassung dem hessischen SOG weitgehend nachgebildet war, hatte er als Beamter des hessischen Innenministeriums die Idee zu diesem Kommentar.
Im März 2016
Der Verfasser
Inhalt
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
Einführung
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
Erster Teil: Aufgaben und allgemeine Vorschriften
§ 1 Aufgaben der Sicherheitsbehörden und der Polizei
§ 2 Aufgaben der Polizei
§ 2a Aufgaben der Gefahrenvorsorge
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Geltungsbereich
§ 5 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§ 6 Ermessen, Wahl der Mittel
§ 7 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen
§ 8 Verantwortlichkeit für den Zustand von Tieren und Sachen
§ 9 Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme
§ 10 Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen
§ 11 Einschränkung von Grundrechten
§ 12 Legitimationspflicht
Zweiter Teil: Allgemeine und besondere Befugnisse
§ 13 Allgemeine Befugnisse
§ 13a Geltung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger
§ 14 Befragung und Auskunftspflicht
§ 15 Erhebung personenbezogener Daten
§ 16 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen sowie an gefährlichen Orten und an oder in besonders gefährdeten Objekten sowie zur Eigensicherung
§ 17 Datenerhebung durch Observation und Einsatz technischer Mittel
§ 17a Erhebung von Telekommunikations- und Telemedienbestandsdaten
§ 17b Erhebung von Telekommunikationsinhalten und -umständen
§ 17c (weggefallen)
§ 18 Datenerhebung durch Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, und durch Einsatz Verdeckter Ermittler
§ 19 Kontrollspeicherung und -meldung
§ 20 Identitätsfeststellung und Prüfung von Berechtigungsscheinen
§ 20a Molekulargenetische Untersuchungen zur Identitätsfeststellung
§ 21 Erkennungsdienstliche Maßnahmen
§ 22 Grundsätze der Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung
§ 23 Speichern, Verändern und Nutzen von personenbezogenen Daten aus strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und Verwendung von nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI übermittelten Daten
§ 23a Aufzeichnung von Telefon- und Funkgesprächen
§ 23b Ermittlung des Aufenthaltsorts gefährdeter Personen
§ 24 Unterrichtung der betroffenen Person bei der Speicherung personenbezogener Daten
§ 25 Verarbeiten oder Nutzen personenbezogener Daten zu Ausbildungszwecken, statistischen oder wissenschaftlichen Zwecken
§ 26 Allgemeine Regeln der Datenübermittlung
§ 27 Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereiches
§ 27a Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union
§ 28 Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen
§ 29 Automatisiertes Abrufverfahren
§ 30 Datenabgleich
§ 31 Rasterfahndung
§ 32 Löschung und Sperrung von Daten
§ 33 Unterbrechung und Verhinderung von Kommunikationsverbindungen
§ 34 Auskunft
§ 35 Vorladung
§ 36 Platzverweisung
§ 37 Gewahrsam
§ 38 Richterliche Entscheidung
§ 39 Behandlung festgehaltener Personen
§ 40 Dauer der Freiheitsentziehung
§ 41 Durchsuchung und Untersuchung von Personen
§ 42 Durchsuchung von Sachen
§ 43 Betreten und Durchsuchung von Wohnungen
§ 44 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen
§ 45 Sicherstellung
§ 46 Verwahrung
§ 47 Verwertung, Unbrauchbarmachung und Vernichtung
§ 48 Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses; Kosten
§ 48a Zeugenschutz
Dritter Teil: Vollzug
§ 49 Verwaltungsvollzugsbeamte
§ 50 Vollzugshilfe
§ 51 Verfahren bei Vollzugshilfeersuchen
§ 52 Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung
Vierter Teil: Zwang
Erster Abschnitt: Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterlassungen
§ 53 Zulässigkeit des Verwaltungszwanges
§ 54 Zwangsmittel
§ 55 Ersatzvornahme
§ 56 Zwangsgeld
§ 57 Ersatzzwangshaft
§ 58 Unmittelbarer Zwang
§ 59 Androhung der Zwangsmittel
Zweiter Abschnitt: Ausübung unmittelbaren Zwanges
§ 60 Rechtliche Grundlagen
§ 61 Handeln auf Anordnung
§ 62 Hilfeleistung für Verletzte
§ 63 Androhung unmittelbaren Zwanges
§ 64 Fesselung von Personen
§ 65 Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch
§ 66 Schusswaffengebrauch gegen Personen
§ 67 Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschenmenge
§ 68 Sprengmittel
Dritter Abschnitt: Kosten des Zwanges
§ 68a Kosten
Fünfter Teil: Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche
§ 69 Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände
§ 70 Art und Umfang des Schadensausgleichs
§ 71 Ansprüche mittelbar Geschädigter
§ 72 Verjährung des Ausgleichsanspruchs
§ 73 Ausgleichspflichtiger; Erstattungsansprüche
§ 74 Rückgriff gegen den Verantwortlichen
§ 75 Rechtsweg
Sechster Teil: Organisation der Polizei und der Sicherheitsbehörden
Erster Abschnitt: Polizei
§ 76 Polizeibehörden, nachgeordnete Dienststellen
§ 77 (weggefallen)
§ 78 Polizeidirektionen
§ 79 Landeskriminalamt
§ 80 Besondere Polizeibehörden; besondere Aufgabenzuweisungen
§ 81 Polizeieinrichtungen
§ 82 Aufsicht über die Polizeibehörden und Polizeieinrichtungen
§ 83 Hilfspolizeibeamte
Zweiter Abschnitt: Sicherheitsbehörden
§ 84 Allgemeine Sicherheitsbehörden
§ 85 Besondere Sicherheitsbehörden
§ 86 Aufsicht über die Sicherheitsbehörden
§ 87 Gefahrenabwehr außerhalb der Dienstzeit
Siebenter Teil: Zuständigkeiten
§ 88 Örtliche Zuständigkeit, außerordentliche örtliche Zuständigkeit
§ 89 Sachliche Zuständigkeit
§ 90 Außerordentliche sachliche Zuständigkeit
§ 91 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten anderer Länder, des Bundes und des Auslandes
§ 92 Amtshandlungen von Polizeibeamten Sachsen-Anhalts außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Landes Sachsen-Anhalt
Achter Teil: Gefahrenabwehrverordnungen
§ 93 Anwendung
§ 94 Verordnungsermächtigungen
§ 94a Sperrzeit
§ 95 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften
§ 96 Inhalt
§ 97 Formvorschriften
§ 98 Ordnungswidrigkeiten
§ 99 Inkrafttreten von Gefahrenabwehrverordnungen
§ 100 Geltungsdauer
§ 101 Beteiligung anderer Behörden und Dienststellen; Änderung und Aufhebung von Gefahrenabwehrverordnungen
§ 102 Gebietsänderungen; Neubildung von Behörden
Neunter Teil: Kosten; Sachleistungen
§ 103 Kosten
§ 104 Sachleistungen
§ 105 Entschädigung für Sachleistungen
§ 106 Verletzung der Leistungspflicht
Zehnter Teil: Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 107 Ordnungswidrigkeiten
§ 108 Übergangsvorschrift für § 68a
§ 109 Übergangsvorschrift für Verwaltungsgemeinschaften
§ 110 Sprachliche Gleichstellung
§ 111 In-Kraft-Treten
Sachregister
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
a. A.
anderer Ansicht
a. a. O.
am angegebenen Ort
AbfG
(Bundes-)Abfallbeseitigungsgesetz
AbfZustVO
Zuständigkeitsverordnung für das Abfallrecht vom 6.3.2013 (GVBl. S. 107), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10.12.2015 (GVBl. LSA S. 610)
AB SOG
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt
ÄndG
Änderungsgesetz
AEPolG
Alternativentwurf einheitlicher Polizeigesetze des Bundes und der Länder (1978)
a. F.
alte Fassung
AG
Aktiengesellschaft
AG GVG LSA
Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 24.8.1992 (GVBl. LSA S. 648), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung und Aufhebung von Rechtsvorschriften im Geschäftsbereich des MJ vom 15.1.2010 (GVBl. LSA S. 8)
AG VwGO LSA
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung und des Bundesdisziplinargesetzes vom 28.1.1992 (GVBl. LSA S. 36), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 5.12.2014 (GVBl. LSA S. 512)
Ahlf/Daub/ Lersch/Störzer
Kommentar zum Bundeskriminalamtsgesetz, 2000
Allg.ZustVO Kom
Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht vom 7.5.1994 (GVBl. LSA S. 568), Art. 4 des Gesetzes vom 21.7.2015 (GVBl. LSA S. 369, 371)
AöR
Archiv für öffentliches Recht
AO
Abgabenordnung
Arbsch ZustVO
Zuständigkeitsverordnung für das Arbeitsschutzrecht des Landes Sachsen-Anhalt vom 2.7.2009 (GVBl. LSA S. 346)
ASOG
Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin
AsylBLG
Asylbewerberleistungsgesetz
AsylDÜVO
Verordnung über die Datenübermittlung für Asylbewerber vom 31.8.1994 (GVBl. LSA S. 944), geändert durch das Vierte Rechtsbereinigungsgesetz vom 19.7.2002 (GVBl. LSA S. 130, 142)
AsylG
Asylgesetz
At-ZustVO
Zuständigkeitsverordnung für das Atom- und Strahlenschutzrecht vom 28.8.2002 (GVBl. LSA S. 382), zuletzt geändert durch Art. 9 des Ersten Funktionalreformgesetzes vom 22.12.2004 (GVBl. LSA S. 852, 859)
AufenthG
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG)
AV
Allgemeine Verfügung
BAG
Bundesarbeitsgericht
BayVBl.
Bayerische Verwaltungsblätter
BbgPolG
Brandenburgisches Polizeigesetz
BBodSchutzG
Bundes-Boden-Schutzgesetz
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BeamtStG
Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17.6.2008 (BGBl. I S. 1010)
Belz/Mußmann/ Kahlert/Sander
Kommentar zum Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 8. Aufl., 2015
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHSt.
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BGLSA
Beamtengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648)
Bernet/Groß (Bernet/Groß/ Mende)
Polizeirecht in Hessen, Loseblattwerk, Stand April 1995
Beschl.
Beschluss
BJagdG
Bundesjagdgesetz
BKA
Bundeskriminalamt
BKAG
Gesetz über das Bundeskriminalamt
BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BKatSG
(Bundes-)Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes
BLG
Bundesleistungsgesetz
BMVg
Bundesminister der Verteidigung
BPolG
Bundespolizeigesetz
BR-Drucks.
Bundesratsdrucksache
BrSchG
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.6.2001 (GVBl. LSA S. 190), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 17.6.2014 (GVBl. LSA S. 288, 341)
BstatG
Bundesstatistikgesetz
Bull (Hrsg.)
„Sicherheit durch Gesetze?“, 1987
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfSchG
Bundesverfassungsschutzgesetz
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BWGöD
Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes
BVwVG
(Bundes-)Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
CR
Zeitschrift „Computer und Recht“
DAR
Zeitschrift „Deutsches Autorecht“
Dietel/Gintzel/ Kniesel
Demonstrations- und Versammlungsfreiheit, Kommentar zum Versammlungsgesetz, 17. Aufl., 2016
Die Polizei
Zeitschrift „Die Polizei“
DNP
Zeitschrift „Die neue Polizei“
Drewes/Malmberg/ Walter
Kommentar zum Bundespolizeigesetz, 5. Aufl., 2015
Drews/Wacke/
Gefahrenabwehr, Allgemeines Polizeirecht
Vogel/Martens
(Ordnungsrecht) des Bundes und der Länder, 13. Aufl., 2001
DRiG
Deutsches Richtergesetz
DÖV
Die Öffentliche Verwaltung
DVAuslG
Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 2983) mit Änderungen
DVBl.
Deutsches Verwaltungsblatt
DSG-LSA
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.1.2016 (GVBl. LSA S. 24)
Ebert/Seel
Kommentar zum Thüringer Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Polizei, 6. Aufl., 2012
eGen
eingetragene Genossenschaft
EGGVG
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz
EichG
(Bundes-)Eichgesetz
Erl.
Erlass oder Erläuterung
e. V.
eingetragener Verein
ESVGH
Entscheidungssammlung des Hess. Verwaltungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
Eyermann/Fröhler
Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 14. Aufl., 2014
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Art. 3 Absatz 14 des Gesetzes vom 26.7.2016 (BGBl. I S. 1824)
FAnlG
(Bundes-)Gesetz über Fernmeldeanlagen
FahrlehrerG
Fahrlehrergesetz
FGG
Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
GA
Goltdammers Archiv
Gefahren
Gefahrenabwehrverordnung zum Schutz vor gefährlichen Hunden vom 6.7.2000 (GVBl. LSA S. 444, zuletzt geändert durch Art. 28 des Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf den Euro (Drittes Rechtsbereinigungsgesetz) vom 7.12.2001 (GVBl. LSA S. 540)
GG
Grundgesetz
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesetz zu Art. 131 GG
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Art. 131 des Grundgesetzes fallenden Personen
GewO
Gewerbeordnung
GeschlKrG
Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
Göhler
Kommentar zum Ordnungswidrigkeitengesetz, 16. Aufl., 2012
Götz
Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 15. Aufl., 2013
GS
Gesetz(es)sammlung
GVBl. LSA
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GüKG
Güterkraftverkehrsgesetz
h. M.
herrschende Meinung
HMdI
Hessischer Minister des Innern/Hessisches Ministerium des Innern
HMdJ
Hessischer Minister der Justiz/Hessisches Ministerium der Justiz
HSOG
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung i. d. F. vom 31.3.1994 (GVBl. I S. 174, 284), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.10.2000 (GVBl. I S. 577)
HessVGRspr.
Rechtsprechung der Hess. Verwaltungsgerichte, Beilage zum Staatsanzeiger
Honnacker/ Beinhofer/Hauser
Kommentar zum (bayer.) Polizeiaufgabengesetz, 20. Aufl., 2014
i. d. F.
in der Fassung
IfSG
Infektionsschutzgesetz vom 20.7.2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Art. 6a des Gesetzes vom 10.12.2015 (BGBl. I S. 2229)
Immo-ZustVO
Zuständigkeitsverordnung auf dem Gebiet des Immissionsschutzrechts vom 8.10.2005 (GVBl. LSA S. 518)
i. S.
im Sinne
i. V. m.
in Verbindung mit
Jagusch/Hentschel
Straßenverkehrsrecht, 43. Aufl., 2015
JMinBI.
Justiz-Ministerial-Blatt des Landes Sachsen-Anhalt
JÖSchG
(Bundes-)Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit
JVollzGB LSA
Justizvollzugsgesetzbuch des Landes Sachsen-Anhalt vom 18.12.2015 (GVBl. LSA S. 666)
JZ
Juristenzeitung
JVEG
Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen und Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz) vom 5.5.2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10.12.2015 (BGBl. I S. 2218)
KampfM.GAVO
Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel vom 20.4.2015 (GVBl. LSA S. 167)
Kap.
Kapitel
Karnop
Recht der Gefahrenabwehr, 1998
KatSG-LSA
Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 5.8.2002 (GVBl. LSA S. 339), geändert durch Gesetz vom 28.6.2005 (GVBl. LSA S. 320)
KG
Kommanditgesellschaft
Kfz
Kraftfahrzeug
Kleinknecht/ Meyer-Goßner
Kommentar zur StPO, 59. Aufl., 2016
KO
Konkursordnung
Kopp/Schenke
Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 22. Aufl., 2016
KritV
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
KVG LSA
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.6.2014 (GVBl. LSA S. 288)
Landespressegesetz
Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198, 199)
Lebensmittel- und Bedarfsge- genständeG
(Bundes-)Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
Lisken/Denninger (Hrsg.)
Handbuch des Polizeirechts, 5. Aufl., 2012
Lit.
Literatur
LKA
Landeskriminalamt
LKV
Zeitschrift „Landes- und Kommunalverwaltung“
LSA
Land Sachsen-Anhalt
LT-Drucks.
Landtagsdrucksache
LuftVG
Luftverkehrsgesetz
Maunz/Dürig/ Herzog
Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattwerk, Stand Oktober 2015
MBI.
Ministerialblatt
Mdl, MI
Ministerium des Innern
MdJ, MJ
Ministerium der Justiz
Meixner/Fredrich
Kommentar zum Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12. Aufl., 2016
MeldDÜVO-LSA
Verordnung zur Durchführung von regelmäßigen Datenübermittlungen der Meldebehörden in Sachsen-Anhalt vom 5.10.2015 (GVBl. LSA S. 512)
MEPolG
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder, herausgegeben von Heise/Riegel, 2. Aufl., 1978
Meyer/Köhler
Das neue Demonstrations- und Versammlungsrecht, 3. Aufl., 2001
Meyer/ Borgs-Maciejewski
Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 1995
MI
Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
MJ
Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt
MRK
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4.11.1950 (Ratifizierungsgesetz vom 7.8.1952 – BGBl. II S. 686 –)
MRRG
Melderechtsrahmengesetz
MLU
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
MS
Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt
MW
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NGefAG
Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz i. d. F. vom 13.4.1994 (NiederS. GVBl. S. 172) mit Änderungen
NJ
Neue Justiz
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NSOG
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 17.11.1981 (NiederS. GVBl. S. 347) mit Änderungen
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungs-Report
OHG
Offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
Ott/Wächtler/ Heinhold
Kommentar zum Versammlungsgesetz, 7. Aufl., 2010
OVG
Oberverwaltungsgericht
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAG
Polizeiaufgabengesetz (bayer.) i. d. F. vom 14.9.1990 (GVBl. S. 397) mit Änderungen sowie Gesetz (d. ehem. DDR) über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei vom 19.9.1990 (GBl. I S. 1489) mit Änderungen
Palandt
Kommentar zum BGB, 75. Aufl., 2016
PassG
Gesetz über das Passwesen
PersAuswG
Gesetz über Personalausweise
POG NW
Polizeiorganisationsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 13.7.1982 (GV. NW. S. 339) mit Änderungen
PolG BW
Polizeigesetz für Baden-Württemberg vom 13.1.1992 (GVBl. S. 1, 596) mit Änderungen
PolG NW
Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen i. d. F. vom 24.2.1990 (GV. NW. S. 70), mit Änderungen
PolPrüffrist VO
Verordnung über Prüffristen bei polizeilicher Datenspeicherung vom 20.12.1993 (GVBl. LSA S. 2)
PostG
Gesetz über das Postwesen
Pr.
Preußisch(es)
PsychKG LSA
Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt vom 30.1.1992 (GVBl. LSA S. 88), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13.4.2010 (GVBl. LSA S. 192)
PVT
Zeitschrift „Polizei, Verkehr, Technik“
PVG
(Pr.) Polizeiverwaltungsgesetz
PStG
Personenstandsgesetz
Rasch/Schulze/ Pöhlker/Hoja/ Fischer
Kommentar zum HSOG, 5. Aufl., Stand September 2014
RDG
Rechtsdienstleistungsgesetz vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2840), zuletzt geändert durch Art. 142 VO vom 31.8.2015 (BGBl. I S. 1474, 1497)
RdErl.
Runderlass
RN
Randnummer
Redeker/v.Oertzen
Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 16. Aufl., 2014
Reg.Bl.
Regierungsblatt
RGBl.
Reichsgesetzblatt
Rommelfanger/ Rimmele
Kommentar zum Polizeigesetz des Freistaates Sachsen, 2015
Roos/Lenz
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz, 4. Aufl., 2011
RP POG
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz von Rheinland-Pfalz vom 10.11.1993 (GVBl. S. 595) mit Änderungen
Rspr.
Rechtsprechung
RVO
Reichsversicherungsordnung
s.
siehe
S.
Seite
SächsPolG
Polizeigesetz des Freistaates Sachsen i. d. F. vom 13.8.1999 mit Änderungen
SDÜ
Schengener Durchführungsübereinkommen vom 19.6.1990 – Ratifikationsgesetz vom 15.7.1993 (BGBl. II S. 1010)
SGB VIII, X
Sozialgesetzbuch, 8. und 10. Buch
SIS
Schengener Informationssystem
SprengstoffG
Sprengstoffgesetz
Spreng-ZustVO
Zuständigkeitsverordnung für das Sprengstoffrecht vom 2.7.2004 (GVBl. LSA S. 375), zuletzt geändert durch die Zuständigkeitsverordnung für das Arbeitsschutzrecht des Landes Sachsen-Anhalt vom 2.7.2009 (GVBl. LSA S. 346, 351)
StAnz.
Staatsanzeiger für das Land Hessen
Stelkens/Bonk/ Sachs
Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl., 2014
StPO
Strafprozessordnung
str.
streitig
StrG LSA
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 6.7.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2014 (GVBl. LSA S. 522, 523)
StVÄG1999
Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Strafverfahrensrechts – Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 (StVÄG 1999) vom 2.8.2000 (BGBl. I S. 1253)
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVO
Straßenverkehrs-Ordnung
StVollzG
Strafvollzugsgesetz
StVZO
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Tegtmeyer/Vahle
Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 11. Aufl., 2014
Tröndle/Fischer
Kommentar zum Strafgesetzbuch, 63. Aufl., 2016
TierGesG
Tiergesundheitsgesetz vom 22.5.2013 (BGBl. I S. 1324), zuletzt geändert durch Art. 8 Abs. 12 des Gesetzes vom 3.12.2015 (BGBl. I S. 2178)
TKG
Telekommunikationsgesetz vom 22.6.2004 (BGBl. I S. 1190, zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 24.5.2016 (BGBl. I S. 1217)
TKÜV
Verordnung über die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation (Telekommunikationsüberwachungsverordnung) vom 3.11.2005 (BGBl. I S. 3136)
TMG
Telemediengesetz vom 26.2.2007 (BGBl. I S. 251), zuletzt geändert durch. Art. 4 des Gesetzes vom 17.7.2015 (BGBl. I S. 1324, 1329)
Ule/Laubinger
Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl., 1995
Urt.
Urteil
UZwGBund
Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes
UZwGBw
Gesetz über die unmittelbare Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und zivile Wachpersonen
VE MEPolG
Vorentwurf des Arbeitskreises II der Innenminister und -senatoren vom 12.3.1986 zur Änderung des Musterentwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder, abgedruckt bei Bull (Hrsg.), Sicherheit durch Gesetze?, 1987, S. 181 ff.
Verordnung
über Polizeidirektionen und besondere polizeiliche Zuständigkeiten vom 8.5.2007 (GVBl. LSA S. 156), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.12.2014 (GVBl. S. 541)
VereinsG
(Bundes-)Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts
Verf.LSA
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.7.1992 (GVBl. LSA S. 600)
VerfSchG-LSA
Gesetz über den Verfassungsschutz im Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.4.2006 (GVBl. LSA S. 236), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3.7.2015 (GVBl. LSA S. 314, 317)
VerkMitt
Verkehrsrechtliche Mitteilungen
VersammlG LSA
Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt über Versammlungen und Aufzüge (Landesversammlungsgesetz – VersammlG LSA) vom 3.12 2009 (GVBl. LSA S. 558)
VersG
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge
Verwaltungsrecht
herausgegeben von der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, 2. Aufl., 1988
VerwRspr
Verwaltungsrechtsprechung in Deutschland
VG
Verwaltungsgericht
VGH
Verwaltungsgerichtshof
VkBl.
Verkehrsblatt (Amtsblatt des Bundesministeriums für Verkehr)
VMBl.
Ministerialblatt des Bundesministers der Verteidigung
VO
Verordnung
VollzBeaVo
Verordnung über Verwaltungsvollzugsbeamte (VollzBeaVO) vom 7.2.1992 (GVBl. LSA S. 124), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17.6.2014 (GVBl. LSA S. 288, 340)
VRS
Verkehrsrechtssammlung
VV
Verwaltungsvorschrift
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwKostG LSA
Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.6.1991 (GVBl. LSA S. 154), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.5.2010 (GVBl. LSA S. 340)
VwVfG LSA
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 18.11.2005 (GVBl. LSA S. 698, 699), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 26.3.2013 (GVBl. LSA S. 134, 143)
VwVG LSA
Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.2.2015 (GVBl. LSA S. 50, 51)
VwZG
(Bundes-)Verwaltungszustellungsgesetz
VwZG-LSA
Verwaltungszustellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 9.10.1992 (GVBl. LSA S. 715), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.1.2008 (GVBl. LSA S. 2)
WaffG
Waffengesetz
WaStrG
Bundeswasserstraßengesetz
WG LSA
Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt i. d. F. vom 16.3.2011 (GVBl. LSA S. 492)
Wolff/Bachof
Wolff-Bachof, Verwaltungsrecht, Bd. I 2016; Stober-Kluth Bd. ll, 2010
WRV
Weimarer Reichsverfassung
WStG
Wehrstrafgesetz
Würz
Das Schengener Durchführungsübereinkommen, 1997
ZDG
Zivildienstgesetz
ZFIS
Zeitschrift für Innere Sicherheit
ZPO
Zivilprozessordnung
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
ZSHG
Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes gefährdeter Zeugen (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz) vom 19.2.2007 (BGBl. I S. 122)
ZustVO Gew AIR
Verordnung über die Regelung der Zuständigkeiten im Immissions-, Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht sowie in anderen Rechtsgebieten vom 14.6.1994 (GVBl. LSA S. 636, 889), zuletzt geändert durch die Verordnung über die Zuständigkeit auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 8.10.2015 (GVBl. LSA S. 518)
ZustVO OWI
Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom 2.3.2010 (GVBl. LSA S.106), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5.3.2015 (GVBl. LSA S. 72)
ZustVO SOG
Verordnung über die Zuständigkeiten auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr vom 31.7.2002 (GVBl. LSA S. 85), zuletzt geändert durch das Gaststättengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 7.8.2014 (GVBl. LSA S. 386, 389)
Einführung
I. Geschichtlicher Überblick
Altertum, Mittelalter und Zeit des Absolutismus
1
Der Begriffsinhalt des Wortes „Polizei“ war im Laufe der Zeiten starken Veränderungen ausgesetzt. Die einzelnen rechtsgeschichtlichen Epochen haben mit ihm unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse verknüpft. Das Wort entstammt dem griechischen „Politeia“. Es bezeichnet die Verfassung des städtischen Gemeinwesens und den bürgerschaftlichen Status und fand über das römische Recht und Frankreich Eingang in die deutsche Rechtssprache des Spätmittelalters sowie der „Reichspolizeiverordnungen“ von 1530, 1548 und 1577. Der Begriff „Polizey“ wurde im Sinne eines Zustands der guten Ordnung des Gemeinwesens verstanden (Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 2/3 m. w. N.). Der Ordnung bedürftig erschienen die verschiedenartigsten Lebensbereiche (z. B. die Religionsausübung, der äußere Anstand durch Erlass von Kleiderordnungen, das Gewerbe-, Zunft- und Marktwesen).
Im Zeitalter des landesherrlichen Absolutismus war der Begriff der Polizei einem tiefgreifenden Bedeutungswandel unterworfen. Es wurde nicht nur üblich, damit bestimmte Behörden zu bezeichnen, sondern auch deren Aufgaben und Tätigkeiten unter diesem Begriff zusammenzufassen. Zur Polizei wurde die gesamte innere Staatsverwaltung nach deren Trennung von Heerwesen, auswärtigen Angelegenheiten, Finanzen und Justiz. Ihre Aufgabe war nicht nur die Gewährleistung der inneren Sicherheit, sondern auch die Förderung der „öffentlichen Wohlfahrt“ bzw. „die Beförderung der äußerlichen Glückseligkeit der Untertanen“ (Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 3 m. w. N.). Die Polizei war damit zum Herrschaftsinstrument des absolut und willkürlich regierenden Landesherrn, der Staat jener Tage wegen des Mangels an Rechtsbindung der Polizeigewalt und deren Umfangs zum „Polizeistaat“ geworden.
Aufklärung und liberaler Rechtsstaat
2
Mit der Philosophie der Aufklärung war eine Einschränkung der Staatsaufgaben und folglich eine Beschränkung des Begriffs der Polizei als innere Staatsverwaltung verbunden. Der Göttinger Staatsrechtslehrer Johann Stephan Pütter forderte 1770 in seinen „lnstitutiones Juris Publici Germanici“: Politiae est cura avertendi mala futura; promovendae saluti cura non est proprie politiae (Aufgabe der Polizei ist die Sorge der Abwendung bevorstehender Gefahren; die Förderung der Wohlfahrt ist nicht die eigentliche Aufgabe der Polizei) (Drews/Wacke/Vogel/Martens S. 4). Pütters Polizeibegriff gelangte durch Carl Gottlieb Svarez in das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten vom 1. 6. 1794. In § 10 Teil 11 Titel 17 (§ 10 II 17) hieß es:
„Die nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey.“
Die praktische Bedeutung des neuen Polizeibegriffs war allerdings gering. Die Reaktion auf das Ideengut der Französischen Revolution von 1789 führte im Zeitalter der Restauration zur Wiederbelebung des Polizeistaats und der „Wohlfahrtspolizei“. Dem preußischen Gesetz über die Polizeiverwaltung vom 11.3.1850 lag noch immer der Gedanke einer fast unbegrenzten Zuständigkeit zugrunde, die da begann, wo Kriegswesen, auswärtige Angelegenheiten, Finanzen und Rechtspflege aufhörten.
3
Zu einer nachhaltigen Einengung des herrschenden weiten Polizeibegriffs und der Abkehr vom Polizeistaat kam es erst nach der Verfestigung des liberalen bürgerlichen Rechtsstaats. In Preußen setzte das Preußische Oberverwaltungsgericht die Beschränkung der polizeilichen Befugnisse durch. In seinem Kreuzberg-Urteil vom 14.6.1882 (Pr. OVG 9, 353 ff., 384) – Gegenstand des Rechtsstreits war die Gültigkeit einer aus ästhetischen Gründen erlassenen Polizeiverordnung des Berliner Polizeipräsidenten zum Schutz des auf dem Kreuzberg zur Erinnerung an die Freiheitskriege errichteten Denkmals – stellte es unter Berufung auf § 10 II 17 ALR fest, Aufgabe der Polizei sei die Aufrechterhaltung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung, nicht aber die Förderung des allgemeinen Wohls. Bei dieser sei vielmehr „der Weg der Spezialgesetzgebung zu beschreiten“ (vgl. hierzu auch Rott, NVwZ 1982, 363).
4
Während der im preußischen Recht entwickelte Polizeibegriff in den anderen nord- und mitteldeutschen Staaten (z. B. in Oldenburg, Braunschweig, Sachsen) gewohnheitsrechtliche Anerkennung fand, erfolgte die rechtsstaatliche Beschränkung des Polizeibegriffs in den süddeutschen Staaten durch den Gesetzgeber. Die Polizeistrafgesetzbücher von Baden (1863/1871), Bayern (1861/1871), Hessen-Darmstadt (1847) und Württemberg (1839/1871) enthielten sowohl mit Strafsanktionen bewehrte Verbotstatbestände als auch Ermächtigungen zum Erlass von Polizeiverordnungen.
Weimarer Republik
5
In der Zeit der Weimarer Republik hielten Gesetzgebung und Verwaltungsrechtslehre an dem im 19. Jahrhundert entwickelten liberal-rechtsstaatlichen Polizeibegriff fest. Von der Ermächtigung zur Regelung des gesamten Polizeirechts in Art. 9 Nr. 2 WRV hat das Reich keinen Gebrauch gemacht, so dass das Polizeirecht, von Regelungen in Spezialmaterien (wie z. B. im Bereich des Verkehrsrechts, des Eisenbahn-, Strom-, Schifffahrts- und Luftverkehrsrechts) abgesehen, eine Domäne des Landesrechts blieb.
6
Während einige Länder von einer rechtsförmlichen Regelung ihres Polizeirechts absahen und sich demgemäß mit der Annahme gewohnheitsrechtlicher Ermächtigungen begnügen mussten (z. B. Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen), kodifizierten andere Länder ihr Polizeirecht erstmals (wie Thüringen mit seiner Landesverwaltungsordnung vom 9.6.1926 – GS S. 177 –) oder in geänderter Form. Die bedeutendste Kodifikation jener Zeit war das preußische Polizeiverwaltungsgesetz vom 1.6.1931 (GS S. 77). Sein § 14 lautete:
,,(1) Die Polizeibehörden haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen notwendigen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit oder den einzelnen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht wird.
(2) Daneben haben die Polizeibehörden diejenigen Aufgaben zu erfüllen, die ihnen durch Gesetz besonders übertragen sind.“
§ 14 Abs. 1 PVG umreißt als Hauptaufgabe der Polizei die Gefahrenabwehr. Diese Aufgabe ist nur von den Polizeibehörden, nicht aber von sonstigen Verwaltungsbehörden wahrzunehmen. Dagegen hatte nach § 32 der Landesverwaltungsordnung für Thüringen „die Verwaltung als Polizei die Aufgabe, von der Gesamtheit oder dem einzelnen bevorstehende Gefahren abzuwenden, durch die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gestört wird“.
Nationalsozialismus
7
Die Machtergreifung des Nationalsozialismus markierte den Beginn eines neuen totalitären Polizeistaats. Eines der wichtigsten Instrumente zur Beherrschung des Staates im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie war die bereits 1933 für Preußen errichtete Geheime Staatspolizei (Gestapo), deren Aufgabe nicht nur die Erforschung „aller staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet“, sondern auch die Verwaltung der Konzentrationslager war. Maßnahmen der Gestapo, wie z. B. die Verhängung der „Schutzhaft“, hinter der sich regelmäßig die Einweisung in ein Konzentrationslager verbarg, waren verwaltungsgerichtlicher Kontrolle entzogen (zur Aufgabenbeschreibung der Gestapo s. BVerfG, Beschl. v. 19.2.1957, BVerfGE 6, 132 ff., 208). Durch „Führererlass“ vom 17.6.1936 (RGBl. I S. 487) wurde „zur einheitlichen Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben im Reich“ ein „Chef der Deutschen Polizei“ im Reichsministerium des Innern bestellt. Mit diesem Amt wurde der „Reichsführer SS“ betraut. Ihm unterstand das Reichssicherheitshauptamt, in dem als „Sicherheitspolizei“ Kriminalpolizei und Gestapo sowie der Sicherheitsdienst (SD) zusammengefasst waren. Das Verständnis von der Aufgabe der Polizei wurde einer tiefgreifenden Wandlung unterzogen. Unter dem beherrschenden Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie wurde die Polizei bei formeller Aufrechterhaltung der überkommenen Generalklausel zum rigoros eingesetzten Büttel herabgewürdigt (vgl. in diesem Zusammenhang Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 11 ff. m. w. N.).
Besatzungsregime
8
Materielles Polizeirecht und die Polizeiorganisation wurden nach dem Zusammenbruch des Reichs wesentlich von den Besatzungsmächten beeinflusst. Ihr Ziel war neben der Entnazifizierung und Entmilitarisierung die Demokratisierung und Dezentralisierung der Polizei. Dies führte insbesondere in den Ländern der britischen und amerikanischen Zone zur Entstaatlichung (Kommunalisierung) der Polizei, zur Beschränkung der polizeilichen Befugnisse (Beseitigung der Befugnis zum Erlass von Polizeiverordnungen) und zur Entpolizeilichung einer Anzahl von Verwaltungsrechtsbereichen (z. B. des Gewerbe- und Baurechts). Maßgeblich für die polizeiliche Reorganisation war für die britische Zone die Verordnung Nr. 135 der britischen Militärregierung vom 1.3.1948 und Titel 9 der Vorschriften der amerikanischen Militärregierung „Öffentliches Sicherheitswesen“ vom 1.2.1946 i. d. F. vom 22.5.1947 mit späteren Änderungen (Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 13 ff. m. w. N.). Die französische Militärregierung verzichtete auf eine einheitliche und umfassende Reorganisation des Polizeiwesens. Sie beschränkte sich im Wesentlichen auf die Beseitigung nationalsozialistischer Vorschriften. In der sowjetischen Zone ging man von einer teilweisen Fortgeltung des preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes und der anderen Landespolizeigesetze (RN 6) aus. Weder während der sowjetischen Besatzungszeit noch später in der DDR wurden diese Gesetze ausdrücklich aufgehoben. Erst mit dem Gesetz vom 11.6.1968 über die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei (GBl. I S. 232) – VP-Gesetz – schaffte die DDR selbst eine eigenständige gesetzliche Polizeirechtsgrundlage.
II. Polizeirechtsgesetzgebung seit 1945
Ländergesetzgebung in den alten Bundesländern
9
Baden-Württemberg schuf mit seinem Polizeigesetz vom 21.11.1955 (GVBl. S. 249) einheitliche Rechtsverhältnisse für den Bereich des neugebildeten „Südweststaats“. In Bayern wurde am 28.10.1952 ein Polizeiorganisationsgesetz (GVBl. S. 285) – Neufassung vom 20.10.1955 (GVBl. S. 245) – und am 16.10.1954 ein Polizeiaufgabengesetz (GVBl. S. 237) erlassen. Berlin folgte mit dem Polizeizuständigkeitsgesetz und der Neufassung des PVG vom 2.10.1958 (GVBl. S. 959). In Hessen erging am 10.11.1954 (GVBl. S. 203) ein Polizeigesetz, das 10 Jahre später durch das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 17.12.1964 (GVBl. I S. 209) ersetzt wurde. Bremen gab sich am 15.7.1960 ein neues Polizeigesetz (GBl. S. 73). In Hamburg war bereits am 17.11.1947 ein Gesetz über die Polizeiverwaltung (GVBl. S. 73) erlassen worden. Niedersachsen hatte in seinem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 21.3.1951 (GVBl. S. 79) die früheren polizeilichen Zuständigkeiten zwischen Verwaltungsbehörden und Polizei aufgeteilt. In Nordrhein-Westfalen wurde am 11.8.1953 ein Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei (GVBl. S. 330), das auch Vorschriften zur Änderung des PVG enthielt, und am 16.10.1956 ein Ordnungsbehördengesetz (GVBl. S. 290) erlassen. Rheinland-Pfalz, das aus Gebieten preußischen, hessischen und bayerischen Rechts zusammengefügt war, erhielt am 26.3.1954 ein neues Polizeiverwaltungsgesetz (GVBl. S. 31). Im Saarland galt – auch im ehemals bayerischen Anteil – das PVG fort (Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung des Saarlandes vom 13.7.1950 – ABl. S. 793 –). Schleswig-Holstein schließlich gab sich am 23.3.1949 ein Polizeigesetz (GVBl. S. 61). Über die im Anschluss an den Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder erfolgte Polizeirechtsgesetzgebung s. RN 16, 17, 19, 21.
Bundesgesetzgebung
10
Im Gegensatz zu der in der WRV (Art. 9 Abs. 2) getroffenen Regelung wurde im GG dem Bund eine Kompetenz zum Erlass eines Gesetzes mit dem alleinigen Zweck der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht eingeräumt. Nach Art. 30, 70 GG ist vielmehr insoweit die Zuständigkeit der Länder gegeben. In bestimmten Bereichen der Gefahrenabwehr steht dem Bund eine ausschließliche, eine konkurrierende oder eine Rahmengesetzgebungskompetenz zu.
11
Zur ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 73 GG) gehören u. a. Passwesen – Art. 73 Nr. 1 GG –, Art. 73 Nr. 5 GG – (Bundesgrenzschutzgesetz), Bundeseisenbahnen und Luftverkehr – Art. 73 Nr. 6 GG – (Luftverkehrsgesetz, Luftverkehrsordnung), Zusammenarbeit des Bundes in der Kriminalpolizei sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalamtes – Art. 73 Nr. 10 GG – (Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes).
12
Zur konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 74 GG) zählen insbesondere Vereins- und Versammlungsrecht – Art. 74 Nr. 3 GG –, Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer – Art. 74 Nr. 4 GG (Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz), Waffen- und Sprengstoffrecht – Art. 74 Nr. 4a GG – (Waffengesetz, Sprengstoffgesetz), Straßenverkehr – Art. 74 Nr. 22 GG – (Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung), Abfallbeseitigung, Luftreinhaltung, Lärmbekämpfung – Art. 74 Nr. 24 GG – (Abfallbeseitigungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm).
13
Die Rahmengesetzgebung (Art. 75 GG) steht dem Bund insbesondere auf den Gebieten des Melde- und Ausweiswesens-Art. 75 Nr. 5 GG – (Melderechtsrahmengesetz, Gesetz über Personalausweise) zu. Soweit sich die vorgenannten Kompetenzen nicht unmittelbar auf die Gefahrenabwehr beziehen, wird die Gesetzgebungskompetenz des Bundes als sog. Annex-Kompetenz bejaht. Sie ist gegeben, wenn ein nicht in die Zuständigkeit des Bundes gehörendes Sachgebiet in einem untrennbaren Zusammenhang mit einem in die Zuständigkeit des Bundes fallenden Sachgebiet steht (BVerfGE 8, 143/150), Beispiel: Bahnpolizei; der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hinsichtlich der Bundeseisenbahnen nach Art. 73 Nr. 6 GG.
III. Vereinheitlichungsbestrebungen
Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder
14
In den Jahren bis 1970 hat sich das Polizeirecht in der (alten) Bundesrepublik Deutschland mit erheblichen organisatorischen und nicht unwesentlichen materiellen Abweichungen entwickelt. Bei zunehmenden länderübergreifenden polizeilichen Einsätzen steigerten sich angesichts des zu beachtenden Territorialprinzips – es ist das Recht des Landes anzuwenden, in dem polizeiliche Maßnahmen getroffen werden – die Schwierigkeiten für die zum Einsatz gelangenden Polizeibeamten. Zur Lösung dieser Schwierigkeiten sah das von der Ständigen Konferenz der Innenminister/-senatoren des Bundes und der Länder (IMK) entwickelte „Programm für die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland“ die Vereinheitlichung der Polizeigesetze vor (Abschnitt X Nr. 2 der Fassung Februar 1974). Die IMK hat den von ihrem Arbeitskreis II erarbeiteten „Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder“ (MEPolG) am 25.11.1977 beschlossen.
Alternativentwurf
15
Im Januar 1979 wurde der von dem „Arbeitskreis Polizeirecht“ (Mitglieder: Denninger, Dürkop, Hoffmann-Riem, Klug, Podlech, Rittstieg, Schneider, Seebode) erarbeitete „Alternativentwurf einheitlicher Polizeigesetze des Bundes und der Länder“ vorgelegt. Absicht der Verfasser war es, ein „Gegenkonzept“ zum MEPolG vorzustellen. Die Bedeutung des Alternativentwurfs lag insbesondere darin, dass er ein besonderes Kapitel „Informationsverarbeitung“ (§§ 37 ff.) enthielt, die im MEPolG keiner – auch nicht ansatzweisen – Regelung zugeführt worden war. Besondere Beachtung verdienten ferner die vorgeschlagenen Regelungen hinsichtlich Beobachtung und Befragung (§ 11), Erstellung von Persönlichkeitsprofilen (§ 12), Ausforschung von Veranstaltungen (§ 13) und zum Schusswaffengebrauch gegen Personen (§ 64). Wegen weiterer Einzelheiten s. Riegel, DVBl. 1979, 709.
Umsetzung des Musterentwurfs in den alten Bundesländern
16
Bereits vor der endgültigen Beschlussfassung durch die IMK über den MEPolG hatte Berlin auf der Grundlage eines Vorentwurfs das Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin vom 11.2.1975 (GVBl. S. 688) erlassen und Baden-Württemberg durch Übernahme einzelner Vorschriften des MEPolG sein Polizeigesetz in der Fassung vom 16.1.1968 (GBl. S. 61) durch Gesetz vom 3.3.1976 (GBl. S. 228) teilnovelliert.
Der MEPolG wurde in einer ersten (bis 1983 dauernden) Phase von folgenden Ländern übernommen: Bayern (Polizeiaufgabengesetz vom 24.8.1978 – GVBl. S. 561 –), Nordrhein-Westfalen (Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.3.1980 – GV.NW. S. 234 –), Rheinland-Pfalz (Polizeiverwaltungsgesetz von Rheinland-Pfalz i. d. F. vom 1.8.1981 – GVBl. S. 179 –), Niedersachsen (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 17.11.1981 – GVBl. S. 347 –), und – mit Abweichungen – Bremen (Bremisches Polizeigesetz vom 21.3.1983 – GVBl. S. 141). Im Bremischen Polizeigesetz haben Grundgedanken des AEPolG Aufnahme gefunden.
In einer zweiten Phase, die maßgeblich von dem Volkszählungsurteil des BVerfG vom 15.12.1983 (s. dazu RN 17) beeinflusst war, haben das Saarland (Saarländisches Polizeigesetz vom 8.11.1989 – Amtsbl. S. 1750 –), Hessen (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 26.6.1990 – GVBl. I S. 197, 534 –), Hamburg (Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 2.5.1991 – GVBl. S. 187 –), Berlin (Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin vom 14.4.1992 – GVBl. S. 119 –) und Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz i. d. F. vom 2.6.1992-GVOBI. Schl.-H. S. 243 – §§ 178 ff.) den MEPolG mit teilweise nicht unerheblichen Abweichungen in Landesrecht umgesetzt und hierbei auch datenschutzrechtliche Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Bund ist dieser Entwicklung – wenn auch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung – gefolgt. Anstelle des Gesetzes über den Bundesgrenzschutz vom 18.8.1972 (BGBl. I S. 1834) gilt nunmehr das in der Überschrift gleichlautende Gesetz vom 19.10.1994 (BGBl. I. S. 2978). Für den kriminalpolizeilichen Kompetenzbereich des Bundes gilt das nach langer Vorbereitung und Beratung erlassene Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (BKAG) vom 7.7. 1997 (BGBl. I S. 1650).
Weiterentwicklung des Musterentwurfs
17
Im Hinblick auf das Volkszählungsgesetzurteil des BVerfG vom 15.12.1983 – 1 BvR 209/83 u. a. – (BVerfGE 65, l ff.) hat die IMK am 23.6.1984 beschlossen, sich wegen des notwendigen Datenverbundes der Polizeibehörden des Bundes und der Länder um ein einheitliches Vorgehen bei der Informationsgewinnung und -verarbeitung zu bemühen. Der Arbeitskreis II der IMK hat daraufhin einen „Vorentwurf zur Änderung des Musterentwurfs eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder“ – letzter Stand: 12.3.1986 – (abgedruckt bei Bull, S. 181 ff.) erarbeitet. Die IMK sah in diesem Vorentwurf eine „Grundlage“ für möglichst einheitliche Vorschriften für die polizeiliche Datenerhebung und -verarbeitung in Bund und Ländern (Beschluss vom 18.4.1986). Das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 26.6.1990 – Neufassung vom 31.3.1994 (GVBl. I S. 174, 284) – lehnt sich hinsichtlich seiner datenschutzrechtlichen Regelungen an den vom Bundesfachausschuss Innen und Recht der FDP vorgelegten und vom FDP-Bundesvorstand am 21.6.1988 beschlossenen Entwurf zur Änderung des MEPolG an. Das noch von der Volkskammer für das Gebiet der früheren DDR beschlossene Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Polizei vom 13.9.1990 übernimmt bezüglich der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung im Wesentlichen die Bestimmungen des Vorentwurfs zur Änderung des MEPolG. Die Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern haben durch Gesetze vom 7.2.1990 (GV NW S. 46) – Neufassung vom 24.2.1990 (GV NW S. 40) – und 24.8.1990 (GVBl. S. 329) – Neufassung vom 14.9.1990 (GVBl. S. 329) – unter teilweiser Übernahme des Vorentwurfs zur Änderung des MEPolG ihre Polizeigesetze unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten novelliert. Das saarländische Polizeigesetz vom 8.11.1989 (RN 16), das hamburgische Gesetz über die Datenverarbeitung bei der Polizei vom 2.5.1991 (GVBl. S. 187), das baden-württembergische Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes vom 22.10.1991 (GBl. S. 625) und das schleswig-holsteinische Gesetz vom 13.2.1992 (GVBl. S. 63) enthalten ebenfalls Vorschriften über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.
IV. Polizeirechtsgesetzgebung in der DDR, während der deutschen Vereinigung und danach in den östlichen Bundesländern
18
Grundlage der Tätigkeit der Volkspolizei war das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Volkspolizei vom 11.6.1968 (GBl. I S. 232). Die Volkspolizei war ein zentralistisch ausgerichtetes Organ des Staatsapparates. Sie hatte nach § l Abs. 1 VP-Gesetz u. a. die Aufgabe, dem „zuverlässigen Schutz der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung“ zu dienen. Als „Organ der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht der Deutschen Demokratischen Republik“ hatte sie die „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ zu gewährleisten. In der DDR-Rechtssprache hatte der Wortlaut „Ordnung und Sicherheit“ jedoch eine andere Bedeutung als die überkommenen Begriffe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland. So wurde zum einen „Ordnung und Sicherheit“ als einheitlicher Begriff ohne Einzeldefinitionen verwandt. Es stellte eine Sollzustandsbeschreibung mit politischer Zielsetzung auf der Grundlage der sozialistischen Ideologie dar. „Ordnung und Sicherheit“ wurde demgemäß definiert als „ein der sozialistischen Gesellschaft wesenseigener Zustand der gesellschaftlichen Beziehungen. Dieser Zustand wird durch den zuverlässigen Schutz der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung, des sozialistischen und persönlichen Eigentums, der Gesundheit und des Lebens der Menschen vor Gefahr und Störungen charakterisiert …
Ordnung und Sicherheit als ein Ausdruck sozialistischer Lebensweise sind eng mit der sozialen Sicherheit und der Rechtssicherheit verbunden, die Wesensmerkmale des Arbeiter-und-Bauern-Staates in der DDR sind.“ (vgl. Verwaltungsrecht, herausgegeben von der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, 2. Aufl. 1988, S. 342). Die besondere politisch-ideologische Komponente des Rechtsbegriffs „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ zeigt sich deutlich in § 8 VP-Gesetz, der die Angehörigen der Volkspolizei verpflichtete, ihre im VP-Gesetz und anderen gesetzlichen Bestimmungen „festgelegten Befugnisse so wahrzunehmen, dass auf das Gestalten der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit Einfluss genommen“ werde. Die Volkspolizei hatte neben der so gefassten allgemeinen Gefahrenabwehr auch noch verschiedene Aufgaben auf verwaltungsrechtlichem Gebiet, so z. B. im Bereich des Versammlungsrechts, des Ausweis-, Pass- und Meldewesens, sowie bei der Durchführung der Polizeistundenverordnung (Verordnung über die Polizeistunde – PolizeistundenVO vom 30.6.1980 GBl. I S. 237). Des Weiteren oblag der Volkspolizei beispielsweise im Bereich des Straßenverkehrsrechts neben der Verfolgung auch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 47 Abs. 7 StVO vom 26.5.1977 – GBl. I S. 257 –, zuletzt geändert durch Verordnung vom 9.9.1986 – GBl. I S. 417 –).
Die Volkspolizei war ein zentralistisch aufgebautes Organ der sozialistischen Staatsmacht. Sie wurde durch den Minister des Innern und Chef der Deutschen Volkspolizei zentral geführt (§ 1 Abs. 2 VP-Gesetz). Dem MdI der ehemaligen DDR waren auf Bezirksebene die Bezirksbehörden der Deutschen Volkspolizei (BDVP) sowie auf Kreisebene die Volkspolizeikreisämter (VPKÄ) nachgeordnet. In Ostberlin entsprachen dem das Präsidium der Volkspolizei Berlin (PdVP) sowie die Volkspolizeiinspektionen (VPI) in den jeweiligen Stadtbezirken. Im Bereich des Landes Sachsen-Anhalt existierten Bezirksbehörden der Volkspolizei in Magdeburg und Halle.
19
Noch unter der Regierung de Maiziere wurde unter maßgeblicher Beteiligung von Polizeirechtsexperten aus den alten Bundesländern das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (PAG) vom 30.9.1990 (GBl. I S. 1489) verabschiedet. Es entspricht in weiten Teilen dem ergänzten Musterentwurf (RN 17). Auf Grund des Einigungsvertrages (vgl. Art. 4 Nr. 8 der Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Durchführung und Auslegung des Einigungsvertrages – BGBl. 1990 II, 1239, 1243 –) galt das PAG in den neuen Ländern bis zur Schaffung eigener entsprechender rechtlicher Grundlagen als Landesrecht fort, längstens jedoch bis zum 31.12.1991. Es wurde von dem Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt, das nach Verkündung am 27.12.1991 am 1.1.1992 in Kraft getreten ist, nahtlos abgelöst.
20
Zum Zeitpunkt des Beitritts der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik Deutschland wies der Vollzugsdienst der Polizei noch im Wesentlichen die geschilderte Organisationsstruktur der früheren Volkspolizei auf. Auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung vom 29.1.1991 (MBl. LSA 1991 S. 19) wurde mit Wirkung vom 1.3.1991 die vor Inkrafttreten des SOG LSA bestehende Organisationsstruktur der Polizei im Lande Sachsen-Anhalt eingeführt. Sie war im Wesentlichen deckungsgleich mit den Regelungen der §§ 76 ff. a. F. Mit RdErl. des MI vom 22.6.1994 wurde diese Organisationsstruktur im Hinblick auf die zum 1.7.1994 aufgrund der Kreisgebietsreform eintretenden Änderungen angepasst. Mit dem Gesetz zur Polizeistrukturreform vom 9.8.1995 und in dessen Umsetzung mit der Verordnung über Polizeidirektionen und besondere polizeiliche Zuständigkeiten (Anhang 3) sowie dem RdErl. des MI „Organisation der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt“ vom 24.10.1995 (MBl. LSA 1996, S. 19), der später durch den RdErl. vom 1.6.1999 (GVBl. LSA S. 965) abgelöst wurde, wurde die Organisationsstruktur der Polizei in Sachsen-Anhalt grundlegend geändert (vgl. dazu RN 22 ff.).
Durch Erlass des Ministeriums des Innern vom 7.2.1991 waren die Bezirksbehörden der Polizei in Magdeburg und Halle bereits mit Wirkung vom 17.2.1991, die Polizeikreisämter mit Wirkung vom 28.2.1991 aufgelöst worden. Das Zentrale Kriminalamt der Deutschen Demokratischen Republik, das nach der deutschen Vereinigung zunächst aufgrund einer entsprechenden Regelung des Einigungsvertrages (Anlage I, Kap. II, Sachgebiet C, Abschn. III, Ziff. 2 – BGBl. 1990 II S. 885, 917) als Gemeinsames Landeskriminalamt der neuen Bundesländer i. S. von § 3 Abs. 2 BKAG an Stelle eigener Landeskriminalämter weitergeführt worden war, ist für das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt durch das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt abgelöst worden.
21
Die östlichen Bundesländer haben zwischenzeitlich eigenständige Polizeigesetze bzw. Gesetze über die öffentliche Sicherheit und Ordnung erlassen, so Sachsen mit dem Polizeigesetz des Freistaates Sachsen vom 30.7.1991 (GVBl. S. 291), Sachsen-Anhalt mit dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.12.1991 (GVBl. S. 538), Thüringen mit dem Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei (Polizeiaufgabengesetz) vom 4.6.1992 (GVBl. S. 199), Mecklenburg-Vorpommern mit dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern (Sicherheits- und Ordnungsgesetz) vom 8.4.1992 (GVBl. S. 498) und Brandenburg mit dem Gesetz über Aufgaben und Befugnisse der Polizei im Land Brandenburg (Brandenburgisches Polizeigesetz – BbgPolG –) vom 19.3.1996 (GVBl. I S. 74); wegen näherer Einzelheiten s. Knemeyer/Müller in NVwZ 1993, 473. Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Prüfung der §§ 33, 34 BbgPolG s. BbgVerfG, Urt. v. 30.6.1999, NVwZ-RR 1999, 3703.
22
Das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.12.1991 wurde am 18.4.1994 berichtigt (GVBl. LSA S. 539), z. B. das Redaktionsversehen in § 37 Abs. 1 Nr. 1 – Leib und Leben statt Leib oder Leben – (vgl. dazu RN 5 zu § 37). Zuvor war mit § 3 des Gesetzes über die Verkündung von Verordnungen vom 9.12.1993 (GVBl. LSA S. 760) die zur Art der Verkündung der Gefahrenabwehrverordnungen in § 99 Abs. 2 a. F. bestehende vorläufige Regelung der in dem genannten Gesetz für alle Verordnungen geltenden Regelung angepasst worden. Es folgte das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 26.5.1994 (GVBl. LSA S. 616).
23
Mit Art. 1 des Gesetzes zur Polizeistrukturreform vom 9.8.1995 (GVBl. LSA S. 238) wurde die Organisationsstruktur der Landespolizei grundlegend geändert. Der vollzugspolizeiliche Aufgabenbestand wurde aus den Regierungspräsidien, die nunmehr nicht mehr Polizeibehörden sind, ausgegliedert. Stattdessen sind nunmehr – nach Auflösung der früheren Polizeiinspektionen – die flächendeckend errichteten Polizeidirektionen mit ihren nachgeordneten Dienststellen Träger vollzugspolizeilicher Aufgaben. Mit dem Änderungsgesetz wurde des Weiteren hinsichtlich der bisher bestehenden Zuständigkeitsregelung für die Gemeinden als Allgemeine Verwaltungsbehörden eine Anpassung an die seit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 3.2.1994 (GVBl. LSA, S. 164) geltende Regelung des § 77 Abs. 1 Satz 3 GO LSA vorgenommen.
Für den gemeindlichen Bereich hatte § 84 a. F. geregelt, dass die Gemeinden ab 5000 Einwohnern, im Übrigen die Landkreise zuständige Verwaltungsbehörden waren. Verwaltungsgemeinschaften waren – auch nicht für die ihr angehörenden Gemeinden – nicht die Aufgabe der Gefahrenabwehr übertragen worden. Durch den mit dem o. g. Änderungsgesetz vom 3.2.1994 neu eingefügten § 77 Abs. 1 Satz 3 GO LSA war indessen geregelt, dass Verwaltungsgemeinschaften und verwaltungsunabhängige Gemeinden unabhängig von ihrer Einwohnergröße alle Aufgaben wahrnehmen, deren Wahrnehmung an eine Einwohnerzahl von mind. 5000 gebunden ist. Bei Gelegenheit dieser Gesetzesänderung wurde auch eine durchgängige Ersetzung des Begriffs „Bezirksregierungen“ durch „Regierungspräsidien“ entsprechend dem Beschluss der Landesregierung über den Verwaltungsaufbau der Mittelinstanz vom 27.4.1993 vorgenommen.
24
Mit der Polizeistrukturreform von 2003 wurde die Struktur der Polizeireviere als Kreisdienststellen an die Kreisgebietsreform von 1994 (noch 21 Landkreise) angepasst, die dadurch weggefallenen Reviere wurden zu Polizeikommissariaten als unselbständige Einheiten der Reviere ohne Dienststellenstatus. Zahlreiche der zuvor in übermäßigem Maß dislozierten Polizeistationen wurden aufgelöst.
25
Auf Grund der Polizeistrukturreform von 2007 wurde die zuvor bestehende Anzahl von 6 Polizeidirektionen (Dessau, Halberstadt, Halle [Saale], Magdeburg, Merseburg, Stendal) auf drei reduziert (Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord, Süd und Ost), vgl. die Verordnung über Polizeidirektionen und besondere polizeiliche Zuständigkeiten vom 8.5.2007 (GVBl. LSA S. 156), zul. geändert durch Verordnung vom 16.12.2014 (GVBl. S. 541), sowie den RdErl. MI Organisation der Polizeidirektionen des Landes Sachsen-Anhalt vom 18.11.2014 (MBl. LSA S. 714). Die Revierorganisation wurde an die Kreisgebietsreform von 2007 (noch 11 Landkreise) angepasst. In Halle und Magdeburg gibt es nur noch jeweils ein Revier, die anderen Reviere sind dort Polizeistationen geworden.
26
Auf Grund der 2010 durchgeführten Gemeindegebietsreform wurden in Sachsen-Anhalt die Verwaltungsgemeinschaften abgeschafft. Demgemäß wurde im Vierten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 26.3.2013 (GVBl. LSA S. 145) durchgängig geregelt, dass allgemeine Verwaltungsbehörden die Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden sind, eine Übergangsregelung enthält § 109.
27
Aufgrund der in Art. 5 des Gesetzes zur Polizeistrukturreform enthaltenen Ermächtigung wurde das SOG LSA am 1.1.1996 neu bekanntgemacht (GVBl. LSA S. 2). Das Gesetz zur Errichtung einer Fachhochschule der Polizei und zur Änderung hochschul- und beamtenrechtlicher Vorschriften vom 12.9.1997 (GVBl. LSA S. 836) enthält in Artikel 1 das Gesetz über die Fachhochschule der Polizei, mit dem die Fachhochschule der PolizeiSachsen-Anhalt errichtet wurde. Sie löste als Aus- und Fortbildungseinrichtung den früheren Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung sowie die frühere Landespolizeischule ab; in Art. 2 des genannten Gesetzes wurde § 81 Abs. 2 entsprechend geändert. Mit § 2 Abs. 5 des Gesetzes zum Abbau von Benachteiligungen von Lesben und Schwulen vom 22.12.1976 (GVBl. LSA S. 1072) wurde in § 6 ein neuer Abs. 3 eingefügt, mit dem klargestellt wird, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, Behinderung, sexuellen Identität, Sprache, Heimat und Herkunft, Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt werden darf.
Das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 20.7.2000 (GVBl. LSA S. 444) stellte die bis dahin umfänglichste Novellierung des SOG LSA dar. Unter anderem wurde in § 14 Abs. 3 die polizeiliche Befugnis zu lagebildabhängigen Kontrollen eingeführt. Die Polizei kann danach zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität auf Bundesfernstraßen angetroffene Personen kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, dass mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung ausgehändigt werden; ferner kann sie mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. Voraussetzung für diese Maßnahmen ist, dass Lageerkenntnisse vorliegen, die den Schluss zulassen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden sollen. Befragte Personen sind verpflichtet, Angaben zur Person zu machen.
Ferner wurde in § 16 Abs. 2 die Befugnis für die Polizei eingefügt, die in § 20 Abs. 2 Nr. 1 genannten Kriminalitätsschwerpunkte (sogenannte verrufene Orte) mittels Bildübertragung offen zu beobachten.
Des Weiteren wurde im neuen § 23a hinsichtlich der Aufzeichnung von Anrufen eine ausdrückliche Ermächtigung für die Polizei in das Gesetz eingefügt. Die Vorschrift regelt des Weiteren die Aufbewahrung und Löschung der Aufzeichnungen.
In § 36 wurde in einem neuen Abs. 2 für Verwaltungsbehörden und Polizei die Befugnis zur erweiterten Platzverweisung eingeführt. Sie können danach einer Person für eine bestimmte Zeit verbieten, einen örtlichen Bereich, der ein ganzes Gemeindegebiet umfassen kann, zu betreten.
28
Aufgrund der in Art. 2 enthaltenen Ermächtigung wurde das SOG LSA am 16.11.2000 neu bekanntgemacht (GVBl. LSA S. 594).
29
Änderungen des SOG LSA danach:
Art. 5 des Gesetzes zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften vom 21.8.2001 (GVBl. LSA S. 348),
Art. 26 des Gesetzes zur Bereinigung des Landesrechts zur Umstellung auf Euro (Drittes Rechtsbereinigungsgesetz) vom 7.12.2001 (GVBl. LSA S. 540, 544),
30
Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 10.7.2003 (GVBl. LSA S. 150); durchgängig wurde der Begriff der Verwaltungsbehörden in Sicherheitsbehörden geändert. Die Befugnis zur Rasterfahndung in § 31 wurde explizit auf das Landeskriminalamt übertragen.
31
Neubekanntmachung vom 23.9.2003 (GVBl. LSA S. 214),
Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Landeskostenrechts und des Gesetzes über die Organisation der ordentlichen Gerichte im Lande Sachsen-Anhalt vom 14.2.2008 (GVBl. LSA S. 58),
Art. 2 Abs. 26 des Gesetzes zur Neuordnung des Landesbeamtenrechts vom 15.12.2009 (GVBl. LSA S. 648),
Art. 2 des Gesetzes zur Anpassung landesrechtlicher Verjährungsvorschriften vom 18.5.2010 (GVBl. LSA S. 340),
32
Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 26.3.2013 (GVBl. LSA S. 145); dies war die bisher umfänglichste Novelle des Gesetzes. Regelungen unter anderen:
Durchgängig wird der Begriff „Ministerium des Innern“ durch „das für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium“ ersetzt, ebenso „Bundesgrenzschutz“ durch „Bundespolizei“. In §§ 2a, 84 Abs. 1, 86, 89, 94, 98, 102, 102, 103 wird für die gemeindliche Ebene nur noch die Gemeinde bzw. Verbandsgemeinde als Sicherheitsbehörde festgelegt, nicht mehr die Verwaltungsgemeinschaften; eine Übergangsregelung enthält § 109. Durchgängig wird der Begriff der Regierungspräsidien durch das Landesverwaltungsamt, eingeführt durch das Gesetz zur Einrichtung des Landesverwaltungsamtes vom 17.12.2003 (GVBl. LSA S. 252), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.11.2015 (GVBl. LSA S. 554), ersetzt. Durch § 2a wird die Gefahrenvorsorge als Aufgabe der unteren Sicherheitsbehörden und des Ministeriums für Inneres und Sport benannt. In §§ 17a, 17b, 23b und 33 wurden Befugnisse zur Telekommunikationsüberwachung eingeführt. § 17a wurde geändert durch das Gesetz über die Neuregelung der Erhebung von telekommunikations- und telemedienrechtlichen Bestandsdaten vom 10.10.2013, § 17b durch dasselbe Gesetz sowie durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015. Der mit dem Vierten Änderungsgesetz eingeführte § 17c wurde im Fünften Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 aufgehoben. An mehren Stellen wurden Vorschriften zum Schutz des Kernbereichs persönlicher Lebensgestaltung eingefügt, § 17 Abs. 4a, 4b, 4c, 5a, § 17b Abs. 5, § 18 Abs. 4a. Befugnisse nach einer Ausschreibung zur verdeckten Registrierung gem. Art. 99 Abs. 1 i. V. m. Art. 104 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) wurden in §§ 20 Abs. 2 Nr. 5, 41 Abs. 2 Nr. 4 und 42 Abs. 2 Nr. 5 geregelt. § 20a ermächtigt die Einholung von DNA-Identifizierungsmustern von Personen, die sich erkennbar in einem die freie Willensbildung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befinden. § 23 Abs. 2 regelt den Umgang mit dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, § 27a die Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der neue Abs. 4 von § 39 schafft die Befugnis, eine festgehaltene Person mittels Bildaufnahmen zu beobachten. Auf Grund des neuen Abs. 6 von § 41 ist es zulässig, eine Person körperlich zu untersuchen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von ihr eine Gefahr für Leib oder Leben einer anderen Person ausgegangen ist, weil es zu einer Übertragung besonders gefährlicher Krankheitserreger gekommen sein kann. Im neuen § 94a wurde das für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sperrzeitrecht und Glücksspiele zuständige Ministerium ermächtigt, durch Gefahrenabwehrverordnung eine Sperrzeit für Schank-. und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten allgemein festzusetzen. Die in diesem Gesetz normierten Absätze 2 – 4 wurden im Fünften Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 aufgehoben.
33
Art. 4 des Gesetzes zur Änderung verwaltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 26.3 2013 (GVBl. LSA S. 134, 143); im neuen § 68a wird geregelt, dass für Amtshandlungen nach dem Ersten und Zweiten Abschnitt des Vierten Teils des Gesetztes Kosten nach §§ 74 und 74b des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erhoben werden, in der Übergangsvorschrift des neuen § 108, dass bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach § 74b Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Gebühren nach den vor dem allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung verwaltungsvollstreckungs- und verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften geltenden Regelungen erhoben werden.
34
Art 1 des Gesetzes über die Neuregelung der Erhebung von telekommunikations- und telemedienrechtlichen Bestandsdaten vom 10.10.2013 (GVBl. LSA S. 494),
Neubekanntmachung vom. 20.5.2014 (GVBl. LSA S. 182, 380),
Art. 9 des Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17.6.2014 (GVBl. S. 288, 340),
Art. 7 des Gesetzes zur Änderung archivrechtlicher Vorschriften vom 3.7.2015 (GVBl. LSA S. 314, 318),
Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 (GVBl. S. 559),
Art. 3 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Justizvollzugs in Sachsen-Anhalt vom 18.12.2015 (GVBl. S. 666, 711).
V. Grundzüge des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt Allgemeiner Überblick
35
Das SOG LSA ist nicht nur Polizeigesetz. Es enthält vielmehr die materiellen und organisatorischen Regelungen des allgemeinen Rechts der Gefahrenabwehr sowohl für die Verwaltungsbehörden, die Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen, als auch für die Polizei. Es übernimmt – von Ausnahmen abgesehen – die Regelungen des MEPolG über Aufgaben und Befugnisse, die Vollzugshilfe, die Zwangsanwendung, die Entschädigung und die Amtshandlungen anderer Länder und des Bundes.
Einzelregelungen
36
Das Gesetz gliedert sich in die zehn Teile:
Aufgaben und allgemeine Vorschriften
(§§ 1 bis 12),
Allgemeine und besondere Befugnisse
(§§ 13 bis 48a),
Vollzug
(§§ 49 bis 52),
Zwang
(§§ 53 bis 68),
Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche
(§§ 69 bis 75),
Organisation der Polizei und der Verwaltungsbehörden
(§§ 76 bis 87),
Zuständigkeiten
(§§ 88 bis 92),
Gefahrenabwehrverordnungen
(§§ 92 bis 102),
Kosten; Sachleistungen
(§§ 103 bis 105),
Überleitungs- und Schlussvorschriften
(§§ 107 bis 111).
37
Die Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr ist Sache der „Verwaltungsbehörden“ und der „Polizei“, wobei jedoch die Regelung des § 2 Abs. 2 zu beachten ist. Die allgemeine Befugnisklausel (§ 13) gilt nur subsidiär. In den Spezialermächtigungen ist für jeden einzelnen Eingriff festgelegt, wer – Verwaltungsbehörden oder Polizei – hierzu befugt ist. Die Spezialermächtigungen (§§ 14 bis 48) regeln typische Eingriffsbefugnisse einschließlich der Befugnisse für Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (BVerfGE 65, 1 ff.).
Der Begriff „Öffentliche Ordnung“ wird trotz Kritik (vgl. Denninger, Polizei in der freiheitlichen Demokratie, S. 25 ff.; Götz, RN 93 ff.) aufrechterhalten (dafür auch Drews/Wacke/Vogel/Martens, S. 246 f. m. w. N.). Innerhalb des Definitionenkataloges des § 3 ist die Öffentliche Ordnung (Nr. 2) ebenso wie die Öffentliche Sicherheit (Nr. 1) und weitere relevante Rechtsbegriffe legaldefiniert.
38
Die Regelungen über die Vollzugshilfe (§§ 50 bis 52) stellen klar, dass zwischen Vollzugshandlungen und Ausübung unmittelbaren Zwanges zu unterscheiden ist. Die Durchführung des Verfahrens sowie die Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung werden ausdrücklich geregelt.
39
Vorschriften über Zwangsanwendung enthalten die §§ 53 bis 68. Dabei ist in § 58 Abs. 5 – in Abweichung vom MEPolG – geregelt, dass auch die Bundespolizei bei Einsätzen zur Unterstützung der Polizei nach § 91 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in den Fällen des Art. 35 Abs. 2 Satz 1 oder Art. 91 Abs. 1 GG in Sachsen-Anhalt nur die auch für die sachsen-anhaltische Polizei zugelassenen Waffen benutzen darf. Dies bedeutet, dass der BGS insbesondere keine Handgranaten, Maschinengewehre oder Gewehrgranaten in Sachsen-Anhalt einsetzen darf. § 65 Abs. 2 Satz 2 enthält hinsichtlich des Schusswaffengebrauches die in der Polizeirechtsdiskussion der Länder kontrovers diskutierte ausdrückliche Regelung hinsichtlich der Abgabe eines Schusses, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird.
40
Regelungen über den Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche finden sich in den §§ 69 bis 75.
41
Die §§ 76 bis 92 enthalten Regelungen über Organisation und Zuständigkeiten sowohl hinsichtlich der Verwaltungsbehörden der Gefahrenabwehr als auch der Polizei.
42
Die §§ 93 bis 102 haben die Ermächtigung zum Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen zum Inhalt. Diese Ermächtigung ist auf die Ministerien sowie die Verwaltungsbehörden beschränkt.
43
Die §§ 103 bis 105 befassen sich mit den bei der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten sowie Sachleistungen.
44
Der 10. und letzte Teil des SOG LSA (§§ 107 bis 111) enthält teilweise Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussvorschriften.
Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 2014 (GVBl. LSA S. 183, ber. S. 380), geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), durch Entscheidung des LVerfG vom 11. November 2014 (GVBl. LSA S. 547), durch Gesetze vom 3. Juli 2015 (GVBl. LSA S. 314), vom 27. Oktober 2015 (GVBl. LSA S. 559), vom 18. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 666)




























