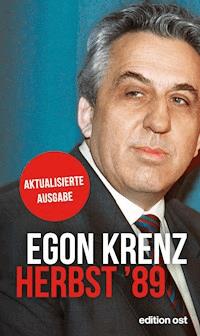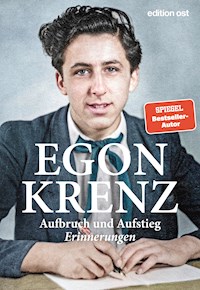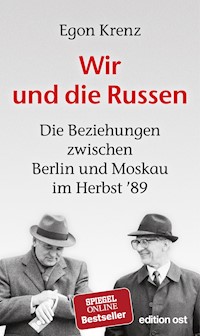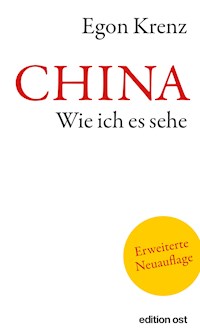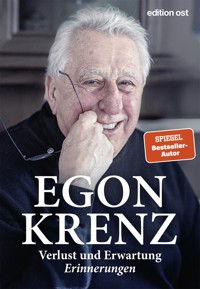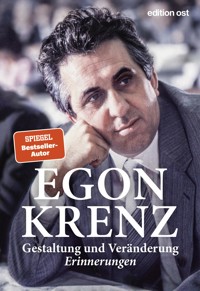
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition ost
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Jahre 1973-1989: »Wir hatten es in der Hand!« Egon Krenz — Teil II der Memoiren des ehemaligen Staatschefs der DDR — Der zweite Band der Memoiren des einstigen Staatschefs der DDR führt direkt in den Inner Circle der Staatsführung und in jene Phase, die mittels Wandel durch Annäherung die friedliche Koexistenz sichern soll. Krenz richtet sein Augenmerk auf die Zeit nach der diplomatischen Anerkennung der DDR, auf die neue Ostpolitik der SPD-Regierung und das ständigen Schwankungen unterliegende Verhältnis zu Moskau. Er berichtet über offizielle Ereignisse und gibt den Blick frei auf so manchen noch immer nicht erhellten Hintergrund. Inzwischen vom Westen als »Honeckers Kronprinz« aufmerksam beäugt, ist er involviert in politische Entscheidungsprozesse und zugleich ein sensibler Beobachter der Akteure in Ost und West, schließlich auch der ambivalenten Entwicklungen, die Gorbatschows Perestroika in der Sowjetunion und den Bruderstaaten auslöst. Was angesichts der 89er Ereignisse hinter den Kulissen zwischen Berlin, Bonn und Moskau ablief, berichtet der Staatschef, der eine Wende einzuleiten sein Amt antrat und nach 50 Tagen demissionieren musste. Krenz berichtet faktenreich und selbstkritisch und reflektiert von heutigem Erkenntnisstand aus differenziert die Ereignisse, ohne seine Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft zu relativieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Egon Krenz, geboren 1937, nach Lehrer-Studium Funktionär der Freien Deutschen Jugend, deren Chef er von 1974 bis 1983 war. Danach Mitglied der Partei- und Staatsführung der DDR. Im Herbst 1989, in der Nachfolge Erich Honeckers, Generalsekretär des ZK der SED, Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates der DDR. Im Dezember 1989 Rücktritt von allen Funktionen. Seit 1990 parteilos. Publizistisch aktiv, Autor von Büchern, die es meist in die Bestsellerlisten schaffen.
EGON KRENZ
Gestaltung und Veränderung
Erinnerungen
Für Erika
Inhalt
Wo ist denn Ihre Klingel, Herr Krenz?
An der Spitze der FDJ
Ein Gespräch mit Kossygin
Von Sosa bis zur Druschba-Trasse
Druck von allen Seiten
Ein Pfarrer, ein Sänger und ein Manifest
Sommerzeit, Autobahn und nationaler Hochmut
Von der Krim nach Gera
Keine Gangway in Warschau
Sein oder Nichtsein
Auf Umwegen zum Gipfel
Damals dachte ich so
Erst Strauß, dann Lindenberg – was macht die DDR so flexibel?
Erich Honecker wird Siebzig
Eine Ad-hoc-Entscheidung
Als Kronprinz auf der Teststrecke
Ein Blick in Honeckers Panzerschrank
Eine verlorene Hoffnung
Zu Tisch
Olympiade und Erdöl
Am Konferenztisch im Kreml
Der Marschall, der schon Stalin diente
Ein lebensgefährliches Spiel
Spaziergang mit Gromyko
Atomraketen in der DDR
Ungewohntes Taktieren
Neue Freundschaften
Vermittler in Bündnisfragen
Funkspruch aus dem Kreml
Als Kohl Honecker noch vertraute
Störenfriede
Kaffeetafel bei Honeckers
Strauß und Brandt in der DDR
Das siegreiche China …
Gegen »Brief zur deutschen Einheit«
DDR-Bild in den USA
Politisches Spiel um einen »deutschen Nobelpreis«
Kartoffeln für Leningrad
Gorbatschows Strategie
Ein Brief vom Roten Baron
Eingabe einer Frauenkommission
Ärger über die Regierung
Krankheit und Politik
Makler zwischen Staat und Kirche
Zwischen den Stühlen
Besuch im Krankenhaus
Zwischen Honecker und Gorbatschow
Kontinuität kontra Erneuerung
Ein Telefonat mit Folgen
Der letzte Parteitag
Mal schmusen, mal stänkern
Manöver der Schlapphüte
Endlich Urlaub
Gorbatschow, Kohl und Helga Hahnemann
Zehn Milliarden Mark und doch kein neues Auto
Entweder – oder
Prüfungen im Fach Perestroika
Ostgipfel und Westprovokation
Todesstrafe, Gefängnis, Amnestie
Ohne Reiseerlaubnis
Die unvollendete Souveränität
Akute Boykottgefahr
Der Druck nimmt zu
Wo ist denn Ihre Klingel, Herr Krenz?
Gerade war der erste Band meiner Erinnerungen erschienen, da überraschte mich der NDR mit der bemerkenswerten Sendung: »Klingeln bei Egon Krenz«. Der 19 Jahre alte Christoph Cyrulies aus Leipzig, so berichtet der Sender, habe »einfach beim einst mächtigsten Mann der DDR geklingelt«. Für einen Geschichtsvortrag habe der Schüler dem letzten Staatschef der DDR einen Besuch abgestattet.
Als er im Sommer 2021 mit seinem Rad nach Dierhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen unterwegs war, »kreisen seine Gedanken um die bevorstehende Begegnung: Wird Egon Krenz ihm die Tür öffnen? Wie wird er reagieren? Wird er überhaupt mit ihm sprechen?«
Cyrulies aus Leipzig weiß, der (damals) 85-Jährige war mal Staatsratsvorsitzender der DDR. »Da rutscht einem das Herz schon in die Hose«, erinnert er sich an den Moment der ersten Begegnung. Sein Resümee: »Nicht zuletzt durch das Gespräch mit Egon Krenz ist mir deutlich geworden, dass es bis heute, mehr als ein Vierteljahrhundert nach diesen denkwürdigen Ereignissen, immer noch offene Fragen gibt, deren Beantwortung für unser Geschichtsverständnis sehr wichtig ist […]. Wer, wenn nicht Egon Krenz, ist dafür kompetent!«
Was im Film berichtet wurde, kann ich als zutreffend bestätigen. Nur ein Detail war falsch: Eine Klingel gibt es bei mir nicht. Wer zu mir will und ich nicht gerade Besuch habe oder aushäusig bin, für den steht meine Tür offen. Seit dieser NDR-Sendung ist die Frage mancher Besucher nach der Klingel so etwas wie ein Passwort geworden, mich zu sprechen.
Zugegeben, dass macht mir mein Leben nicht leichter. An manchen Tagen stehen mehr Gäste vor der Tür, als ich empfangen kann. Sie wollen in der Regel mit mir über ein neues Buch reden, ein Autogramm und eine Widmung haben, oder nur ein Selfie machen. Dazu kommen einige Hundert Briefe und Mails.
Sie alle zu beantworten, übersteigt leider inzwischen meine Kraft. Nicht zu antworten, macht mir ein schlechtes Gewissen. Ich erleichtere es, indem ich allen an dieser Stelle sehr herzlich für die oft anrührende Aufmerksamkeit danke. Auch den Weggefährten danke ich, die mir ihre eigenen Autobiografien schicken, die für die Enkel bestimmt sind. »Denn«, so schrieb einer, »was die heute in der Schule über die DDR lernen, ist haarsträubend«.
Alle Altersklassen sind unter den Schreibern vertreten – von 14 bis 94 Jahre alte Leserinnen und Leser aus Deutschland Ost und Deutschland West, aber auch aus den USA, Kanada, Portugal, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Ungarn, England und Schweden schrieb man mir.
Ein über neunzig Jahre alter Leser aus Gransee ließ mich wissen: »Alles, was Sie beschreiben, habe ich so ähnlich erlebt.« Und ein 85-jähriger Professor aus Chemnitz meinte: »Stolz können wir sein, was wir geschaffen haben und auch darauf, so gewesen und geblieben zu sein.« Ein Kulturpolitiker schrieb: »Ich verfolgte Ihren chancenlosen Versuch, die DDR zu retten. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich Sie lange Zeit zu den ›Betonköpfen‹ zählte. Meinen falschen Eindruck konnte Ihr Buch korrigieren.«
Ein Pfarrer aus Düsseldorf bedankte sich für ein »sehr persönliches Gespräch, das in bleibender Erinnerung bleibt«. Er sei auf das nächste Buch »gespannt«. Ein 22-Jähriger aus einem kleinen Dorf in Norden Baden-Württembergs bekundete sein Interesse für die DDR-Geschichte, die nach seiner Wahrnehmung im Westen entstellt werde. Und ein ehemaliger Schüler der Erweiterten Oberschule (EOS) äußerte, man habe in der DDR im Fach Staatsbürgerkunde gehört, »was Kapitalismus ist«. Damals hielt er es für übertrieben und wollte es nicht glauben. Seit 1990 wisse er, dass es eher untertrieben war.
Besonders beeindruckt hat mich die Zuschrift einer fast neunzigjährigen Frau aus Magdeburg. Ihr Brief enthielt nur einen einzigen Satz: »Ihr Buch, lieber Herr Krenz, hat mir gut getan.«
DDR-Kritiker nennen so etwas Nostalgie. Nostalgie oder auch Ostalgie sind Modeworte, die benutzt werden, um unsere Erinnerung und Besinnung an Werte der DDR zu denunzieren. Diesen Leuten ist nicht bewusst: Ostdeutsche – also Bürger der DDR – haben nicht nur Trümmer des Zweiten Weltkrieges beseitigt, Städte und Dörfer wieder bewohnbar gemacht, wertvolle kulturhistorische Bauten restauriert, sondern auch zahlreiche neue Betriebe, Straßen, Stadtteile und Städte mit modernen Wohnungen, Schulen, Kinderkrippen und Kindergärten, Ambulatorien, Krankenhäusern, Sport- und Kulturstätten geschaffen. Nicht zu vergessen, dass jene historischen Gebäude, in denen die heute Regierenden sich feiern, von der DDR wiederaufgebaut worden waren, etwa das Schauspielhaus in Berlin und die Semperoper in Dresden. Nicht minder bedeutend: dass diese Ostdeutschen unendlich viel getan haben für die Aussöhnung mit den Völkern des Ostens, deren Staaten damals von Hitlerdeutschland überfallen, ausgeplündert und zerstört worden waren.
Ich erinnere mich an den Besuch von Erich Honecker 1987 in der Villa Hügel in Essen. Dort traf er führende Vertreter der westdeutschen Wirtschaft, darunter Berthold Beitz von der Krupp AG und Otto Wolff von Amerongen vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Etwa dreihundert Vertreter der Großindustrie und der mittelständischen Wirtschaft buhlten um Honeckers und damit um die Gunst der DDR. Nicht, weil unsere Wirtschaft so marode und das Land am Ende war, wie später behauptet wurde, sondern um Geschäfte mit uns zu machen. Die aber macht man gemeinhin nur mit prosperierenden Wirtschaften und zahlungsfähigen Partnern.
Professor Kurt Starke, ein auch international bekannter Soziologe, Sexualwissenschaftler und Jugendforscher, mit dem ich seit Jahrzehnten befreundet bin, schrieb mir vor einiger Zeit: »Je mehr ich über unser gewesenes Land nachdenke und je öfter ich in den vergangenen Jahren mit Ost-West-Unterschieden in meinen Untersuchungen zu tun hatte, desto mehr sehe ich mich in der Erkenntnis bestätigt, dass die DDR ein Unikat von bleibender historischer Bedeutung ist.«
Unikat ist ein treffendes Wort für das, was die DDR war. Sie war nach der Wiederbelebung kapitalistischer Verhältnisse in Westdeutschland und dem Aufstehen alter Nazis die einzig vernünftige Alternative zu einem Deutschland, das für zwei Weltkriege und die grausame faschistische Diktatur verantwortlich war, in der Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Sozialisten, Antifaschisten aller Art verfolgt, vertrieben, in Lager gesperrt und ermordet worden waren. In denen die Menschenwürde und die Menschenrechte mit SA-, SS- und Soldatenstiefeln getreten worden waren. Als in den Nachkriegsjahren im Westen alte Nazis erneut Lehrer, Juristen, Beamte, Politiker, Militärs und Geheimdienstchefs werden durften, erfolgte im Osten eine antifaschistisch-demokratische Umwälzung. 7.136 Großgrundbesitzer und 4.142 Nazi- und Kriegsverbrecher wurden entschädigungslos enteignet. 520.000 ehemalige Nazis aus öffentlichen Ämtern entfernt. Am 30. Juni 1946 stimmten mehr als 72 Prozent der Bürger Sachsens in einem Volksentscheid für die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher. (Diese wie auch andere im Buch verwandte Zahlen entnahm ich der 1984 im Dietz Verlag Berlin erschienen »Illustrierten Geschichte der DDR«.)
In Ostdeutschland kam Junkerland tatsächlich in Bauernhand; kein Nazi durfte mehr Lehrer sein. In Schnellverfahren wurden 43.000 Frauen und Männer zu Neulehrern ausgebildet, die zwar manchmal – wie es damals hieß – nicht genau wussten, ob man Blume mit oder ohne »h« schreibt, aber den Mut besaßen, dem Rat Brechts zu folgen: »Um uns selber müssen wir uns selber kümmern.« Nazis durften kein Recht mehr sprechen, Volksrichter wurden gewählt, Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten (ABF) sorgten dafür, dass das bislang existierende Bildungsprivileg beendet wurde und heute als »bildungsferne Schichten« Bezeichnete an Hochschulen studieren konnten. Und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern hielt Einzug, die Diskriminierung von Homosexuellen wurde mit der Streichung des § 175 aus dem Strafgesetzbuch beendet.
Angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt und des militärischen Engagements der Bundesrepublik sollte ebenfalls daran erinnert werden: Die DDR hat nie einen Krieg geführt und ist damit eine Ausnahme in der deutschen Geschichte. Kein NVA-Soldat setzte je seinen Fuß auf fremdes Territorium, um an Kampfeinsätzen teilzunehmen.
Allein das rechtfertigt, sich der DDR mit Achtung und Respekt zu erinnern. Ein Drittel Deutschlands war hier dem Zugriff des deutschen Kapitals entzogen, und das mehr als vierzig Jahre lang. Das ist aus dessen Sicht die eigentliche Sünde der DDR, die ihr – und damit uns, die wir sie aufbauten und verteidigten – niemals vergeben werden wird. Nach 1933 wechselten die Nazis elf Prozent der Eliten der Weimarer Republik aus. Nach 1945 wurden in Westdeutschland dreizehn Prozent der Nazikader entfernt. Nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik schickte die neue Herrschaft 85 Prozent der DDR-Eliten in die Wüste. Sie verloren ihre Arbeit, ihr Einkommen, ihre Zukunft. Nicht zu reden von den vielen Werktätigen aus den über achttausend volkseigenen Betrieben, die die Trauhandanstalt übernahm und asozial abwickelte.
Aus das sollten sollten wir nicht vergessen.
Solche Zusammenhänge von Politik, Kapital und wirtschaftlichen Interessen werden verschleiert. Man muss sie und die Geschichte aber kennen, um zu verstehen, warum heute so viele Menschen im Osten beispielsweise gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind. Für Deutschland ist von Russland noch nie eine Gefahr ausgegangen, aber zweimal hat Deutschland im 20. Jahrhundert Krieg gegen Russland bzw. die Sowjetunion geführt. Die Mauer in Berlin ist weg. Sie wurde nach Osten verschoben – sie steht nicht mehr zwischen NATO und Warschauer Vertrag, sondern zwischen der NATO und Russland. Sie ist dort, wo die Frontlinie im Prinzip an jenem 22. Juni 1941 verlief, als die Sowjetunion von Deutschland überfallen wurde. Diese »Grenzziehung« ist das Gegenteil von dem, was 1989 auf den Straßen der DDR gefordert wurde.
Ein Wort findet sich in fast allen Briefen an mich: Angst. Angst vor einem Dritten Weltkrieg, in den uns die deutsche Regierung durch ihre pro-amerikanische Politik führen könnte. Dass die Bundesregierung das Streben der USA, einzige Weltmacht zu bleiben, höher stellt als deutsche Interessen, hat ebenfalls zum sinkenden Ansehen der gegenwärtigen Ampel-Koalition beigetragen.
Die deutsche Außenministerin hat verantwortungslos und folgenlos davon gesprochen, dass der Westen einen Krieg gegen Russland führe, dessen Ziel darin bestünde, »Russland zu ruinieren«. Sprache ist bekanntlich Ausdruck des Denkens. Zwar war es bisher »nur« eine Boulevardzeitung, die mit der Schlagzeile erschien: »Deutsche Panzer stoßen gegen russische Stellungen vor«, aber allein die Tatsache, dass in Deutschland Nazijargon öffentlich verbreitet wird, macht auch mir Angst. Deutsche Panzer haben in den Schlachten vor Moskau, Leningrad, Stalingrad und bei Kursk schon einmal russische Erde umgepflügt und Tod und Verwüstung hinterlassen: Mehr als 1.700 Städte und 70.000 Dörfer wurden vernichtet und die gesamte Infrastruktur im europäischen Teil der Sowjetunion zerstört. Sollen also deutsche Panzer wieder gegen Russland rollen?
Die schreckliche Kriegsbilanz sollte deutsche Regierungen für alle Zeiten daran hindern, Waffen in Krisengebiete zu liefern. Für verantwortungsvolle Politik müsste es in dieser Situation oberstes Gebot sein, alles dafür zu tun, dass das Töten und Zerstören beendet wird, dass die Waffen schweigen und die Gefahr gebannt wird, dass ein Krieg einen Weltbrand entfacht. Statt Streit um Waffenlieferungen wäre eine Offensive der Diplomatie notwendig.
Die in unserem Land herrschende Russophobie erinnert mich an meine Kindheit, als die Nazis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges große Plakate klebten, auf denen die Russen als Untermenschen dargestellt wurden.
Seit 1951 habe ich fast an jedem 8. Mai zum Tag der Befreiung am Treptower Ehrenmal mit Gleichgesinnten Blumen niedergelegt. Immer den Rotarmisten im Blick, der das Hakenkreuz zertritt und seinen schützenden Arm um ein Kind hält. 2023 habe ich zum ersten Mal unter starker Polizeikontrolle mit ansehen müssen, wie einem jungen Russen verboten wurde, ein Duplikat des roten Siegerbanners, das 1945 auf dem Reichstag gehisst wurde, auf das Gelände des Ehrenmals zu tragen. Ich erinnerte mich an ein Lied, das ich als Zehnjähriger in der DDR-Schule gelernt hatte:
Tausende Panzer zerwühlten das Land,
hinter sich Tod und Verderben.
Weiten sowjetischer Erde verbrannt,
Städte in Trümmer und Scherben.
Doch allen Hass, alle Not überwand
Siegreich die Sowjetunion
Brüderlich reicht sie die helfende Hand
Auch unserer deutschen Nation.
Ob die Russen uns ein zweites Mal die Hand reichen, ist angesichts des Russenhasses, den führende Politiker und Medien verbreiten, nur schwer vorstellbar. Ich wundere mich, wie viel vermeintliche »Russlandexperten« es in Deutschland gibt, die, wenn man sie in den Medien hört, eher Anti-Russland-Experten sind. Sie mögen sich viel über Russland angelesen haben, ihnen fehlt aber das Einfühlungsvermögen in die russische Seele. In schwierigen Situationen haben sich die Russen immer zusammengeschlossen, Embargos und Sanktionen getrotzt und die Wirtschaft weiter entwickelt. Es ist höchste Zeit, dass die deutsche Regierung die einfache Wahrheit begreift, dass man das größte Flächenland der Erde nicht einfach beiseite schieben kann. Ohne oder gar gegen Russland wird es weder Frieden in Europa noch in der Welt geben.
Im zweiten Band meiner Autobiografie berichte ich auch darüber, dass sowjetische Politiker mit Kritik an der DDR nicht sparten. Ich schreibe über Gespräche zwischen Breschnew und Honecker, die gelegentlich kontrovers verliefen. Ich habe das immer mit einem gewissen Unverständnis wahrgenommen. Mein Verhältnis zur Sowjetunion und heute zu Russland war und ist von hohem Respekt für die historischen Leistungen des Landes und die Opfer im Großen Vaterländischen Krieges gegen den deutschen Faschismus bestimmt. Einig waren sich unsere Länder stets darüber, dass wir engste Bündnispartner waren – bis Gorbatschow dieses Bündnis einseitig beendete. Wir waren überzeugt, dass die DDR ohne die UdSSR nicht lebensfähig sei. Hätten wir diese Hilfe nicht gehabt, wären wir keine vierzig Jahre alt geworden.
Und wo auch immer die sowjetische Führung – vor dem Verrat Gorbatschows – bei uns eingriff, ging es ihr in der Regel um die politische Stabilität der DDR. Sie wusste, dass die DDR ein zuverlässiger Vorposten der sozialistischen Gemeinschaft war. Würde dieser fallen, hätte das Folgen auch für die Sowjetunion. Nur wem das bewusst war, verstand die gelegentlichen Scharmützel, die möglicherweise im Nachhinein als unfair interpretiert werden können.
Wir mussten auch lernen, dass die Beziehungen DDR-BRD letztlich nur ein Anwendungsfall der Beziehungen UdSSR-USA war. Die Sicht aus Moskau auf die Welt war immer weiter und die Entscheidung ausgewogener als die aus Berlin. Nur aus dieser Perspektive lassen sich manche Interessenunterschiede zwischen der UdSSR und der DDR erklären.
Realitäten ignorieren auch sogenannte Qualitätsmedien, die ihre Redaktionen in der alten BRD haben. Sie stellen mitunter in Abrede, dass ich erlebt hätte, was ich tatsächlich erlebt habe, tun in ihrer Arroganz so, als kennten sie beispielsweise meinen Lebenslauf besser als ich selbst. In der DDR lebten 1990 etwas mehr als sechzehn Millionen Menschen mit sechzehn Millionen Biografien, meine ist eine von diesen. Wir müssen uns wegen unseres Lebens nicht entschuldigen. Dass es in Politik und Medien noch immer Versuche gibt, DDR-Bürgern erklären zu wollen, wie sie gelebt haben oder hätten leben sollen, beweist, dass die deutsche Einheit mental noch lange nicht vollzogen ist.
Zum ersten Band meiner Erinnerungen meldete sich beispielsweise in der Süddeutschen Zeitung Norbert F. Pötzl, Jahrgang 1948, langjähriger Spiegel-Redakteur. Sein Kommentar: »Ergötzen können sich daran nur unerschütterliche DDR-Nostalgiker, die dem vermeintlichen Arbeiter- und Bauernstaat nachtrauern. Davon«, höhnte er, »gibt es jedoch offenbar in Ostdeutschland noch so viele, dass ein Machwerk wie dieses die Bestsellerliste stürmen kann«. Frei nach Heinrich Heine antworte ich darauf: Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch den Verfasser.
Vor über zwanzig Jahren besuchte er mich in meiner Berliner Wohnung. Vier Stunden lang gab ich ihm detailliert und differenziert Auskunft über Erich Honecker. Am 16. Januar und am 10. April 2002 reagierte ich aus der Haftanstalt Plötzensee kritisch auf sein Manuskript über Honecker auf die Passagen, in denen ich vorkam. Er hatte zum Beispiel meine Erzählung über meine erste Begegnung mit Erich Honecker in seine westdeutsche Sprache übersetzt: Da habe der Pimpf Egon vor seinem Führer gestanden. In diesem Moment wurde mir klar, nichts, aber auch gar nichts hatte dieser Mann von der DDR verstanden. Weder war ich jemals Hitlerjunge noch die DDR mit dem Faschismus verwandt.
Ich schrieb Pötzl: »Noch immer sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Wenn Sie beispielsweise für mich das Wort ›Pimpf‹ (Seite 27) verwenden, mag das für Sie umgangssprachlich als Synonym für ›kleiner Junge‹ stehen. Für mich sind Pimpfe ›Hitlerjungs‹. Auch in der Neuen Rechtschreibung von Bertelsmann wird dieser Begriff mit ›Angehöriger des Jungvolks‹ umschrieben.«
Ich frage mich manchmal, woran es liegt, dass intelligente Menschen nach Jahrzehnten staatlicher Einheit noch immer ein DDR-Bild aus den Hochzeiten des Kalten Krieges pflegen. Ist das vorsätzliche Boshaftigkeit oder Unwillen von der Art, wie sie dem ersten Bundeskanzler nachgesagt wurde? Konrad Adenauer soll, wenn er mit dem Zug nach Westberlin reiste, an der Grenze stets die Vorhänge zugezogen haben, um die »asiatische Steppe« nicht zu sehen. Für ihn begann hinter der Elbe Sibirien.
Als das Grundgesetz für die Bundesrepublik vorbereitet wurde, erklärte einer seiner Väter, »alles deutsche Gebiet außerhalb der Bundesrepublik ist als Irredenta anzusehen«, also als Territorium unter fremder Herrschaft, »deren Heimholung mit allen Mitteln zu betreiben« wäre. Nachzulesen im Protokoll der Sitzungen der Unterausschüsse des Verfassungskonvents vom Herrenchiemsee vom 10. bis 23. August 1948. Wer sich diesem Diktum nicht unterwerfe, hieß es weiter, sei »als Hochverräter zu behandeln und zu verfolgen«.
Eine solche Aufforderung verstehe ich als Szenario für den Umgang des – noch nicht einmal gegründeten – westdeutschen Staates mit den Ostdeutschen und deren Staat, der ebenfalls noch nicht existierte, dessen Bildung man allerdings vermutete. Die Untaten, die dieser DDR nach 1990 zugeschrieben worden sind, waren folglich noch gar nicht begangen. Und trotzdem stand schon der »Hochverrat« im Raum, der verfolgt werden sollte.
Es ist wohl der Antikommunismus, der nach Thomas Mann die Grundtorheit des 20. Jahrhunderts war, der solche Bilder und Fehlurteile noch immer hervorbringt.
Die DDR war für mich die Heimstatt des deutschen Antifaschismus. Ein Globke, ein Filbinger, ein Oberländer, ein Kissinger oder wie die ehemaligen NSDAP-Mitglieder alle hießen, die in der Bundesrepublik an exponierter Stelle tätig waren, hätten in der DDR nie eine Chance auf ein hohes Amt gehabt. (Und falls dies doch geschah und ihre Vita bekannt wurde, entfernte man sie umgehend aus ihren Funktionen.) Ich habe mir oft die Frage gestellt: Warum kamen Geistesschaffende und Künstler aus dem Exil in den Osten und mieden den Westen? Bertolt Brecht, Anna Seghers, Arnold Zweig, Johannes R. Becher, Stefan Hermlin, Friedrich Wolf, Max Lingner, Lea Grundig, Theo Balden, Wieland Herzfelde, Helene Weigel, Hanns Eisler, Bodo Uhse, Erich Weinert, Ernst Busch, Ludwig Renn, Wolfgang Langhoff, Eduard von Winterstein, Hedda Zinner, Gustav von Wangenheim ließen sich hier nieder. Haben sie sich nicht gerade deshalb für die DDR entschieden, weil sie hier die Möglichkeit sahen, Krieg und Faschismus endgültig aus dem Leben der Menschen zu verbannen? »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!« kam nicht als Weckruf aus den Westzonen, er wurde dort auch nicht zum Staatscredo. Dieser Appell wurde Maxime im Osten: »Die Vernichtung des Nazismus mit all seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens ist unser Ziel!« Dieser Schwur von Buchenwald war das Fundament, auf dem die Deutsche Demokratische Republik am 7. Oktober 1949 gegründet wurde und sich zum Ziel setzte: Niemals wieder darf von deutschem Boden Krieg ausgehen.
Pötzls »Pimpf Egon« ist gar nicht so weit entfernt von der Aussage des Herrn Döpfner, im Osten gäbe es nur »Kommunisten oder Faschisten«. Es handelt sich kaum um die Auffassung eines einzelnen Verirrten. Von derart infamem Klartext oder in subtilerer Schreibweise vorgetragen, ist die Medienlandschaft noch immer voll. Arrogante Attacken, die die Lebensleistungen der Menschen in der DDR ignorieren und der Nation einreden wollen, dass die systematische Benachteiligung der Ostdeutschen wegen ihrer vermeintlichen Demokratiefeindlichkeit und kulturellen »Verzwergung« begründet ist und bleibt. Wer so redet, hat die deutsche Einheit bis heute nicht vollzogen.
Selbst Angela Merkel, die sechzehn Jahre an der Spitze der Bundesregierung stand, monierte am Ende ihrer Kanzlerschaft den Umgang mit ihren ostdeutschen Landsleuten und damit mit ihr selbst. Am 3. Oktober 2021 fragte sie diplomatisch-höflich, wie es sich in ihrem Amte geziemte: »Müssen nicht Menschen meiner Generation und Herkunft aus der DDR die Zugehörigkeit zu unserem wiedervereinigten Land auch nach drei Jahrzehnten Deutscher Einheit gleichsam immer wieder neu beweisen, so als sei die Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung?« Und damit es auch der letzte Westdeutsche begriff, was sie meinte, erzählte sie beim Festakt in Halle vor handverlesenem Publikum: »In einem im letzten Jahr von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Buch mit vielen Beiträgen und Positionen zur Geschichte der CDU heißt es in einem der dort veröffentlichten Aufsätze über mich: ›Sie, die als Fünfunddreißigjährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biographie in den Wendetagen zur CDU kam, konnte natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung sein.‹
Die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren […] ›Ballast‹? Dem Duden nach also eine ›schwere Last, die‹ – in der Regel – ›als Fracht von geringem Wert zum Gewichtsausgleich mitgeführt wird‹ oder als ›unnütze Last, überflüssige Bürde‹ abgeworfen werden kann? – Das war der Duden.
Ich erzähle das hier nicht, um mich zu beklagen. Denn ich bin nun wirklich die Letzte, die Grund hätte, sich zu beklagen – so viel Glück, wie mir persönlich in meinem Leben beschieden ist.
Ich erzähle es auch nicht als Bundeskanzlerin. Ich möchte es vielmehr als Bürgerin aus dem Osten erzählen, als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein Leben gelebt haben, die mit dieser Lebensgeschichte in die Deutsche Einheit gegangen waren und solche Bewertungen immer wieder erleben – und zwar als zähle dieses Leben vor der Deutschen Einheit nicht wirklich. Ballast eben, bestenfalls zum Gewichtsausgleich tauglich, im Grunde aber als unnütze Last abzuwerfen. Ganz gleich, welche guten und schlechten Erfahrungen man mitbrachte: Ballast.«
Nun könnte man gern Angela Merkel fragen, warum sie erst 2021 sich getraute, dieses Thema von einer solchen Bühne anzusprechen. Oder warum sie – in Kenntnis dieser Umstände – keine andere Politik in Bezug auf Ostdeutschland in den vier Legislaturperioden betrieben habe, in der sie Regierungsverantwortung trug?
Das wären jedoch nur rhetorische Fragen. Denn wir kennen die Antwort, weil wir allein an diesem Vorgang sehen, wie viel »Macht« im Bundeskanzleramt real wohnt und wer tatsächlich »die Macht« in diesem kapitalisischen Land ausübt.
Vom Volke jedenfalls geht die Macht, wie es immer heißt, jedenfalls nicht aus …
Egon Krenz,
Dierhagen, im Sommer 2023
An der Spitze der FDJ
Bevor ich am 9. Januar 1974 zum 1. Sekretär des FDJ-Zentralrates gewählt wurde, verbrachte ich einige schlaflose Nächte. So sehr ich mich darauf freute, an der Spitze der Freien Deutschen Jugend stehen zu dürfen, war ich zugleich unglücklich darüber, meine Traumfunktion aufgeben zu müssen. Ich war gern Vorsitzender der Pionierorganisation »Ernst Thälmann«. Rückblickend meine ich, dies war meine schönste Zeit als FDJ-Funktionär. Ich hatte ständig Kontakt mit Kindern, besuchte sie in Schulen, Arbeitsgemeinschaften, Pionierhäusern und Ferienlagern, lernte die aufopferungsvolle Arbeit der Freundschaftspionierleiter und Lehrer kennen. Das hat mein Wissen über ihr Denken und Fühlen bereichert.
Es war schon etwas Besonderes für mich: Bei den Pionieren begann ich in frühen Kinderjahren mich für Politik zu interessieren und in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu denken. Dort erlebte ich die Kraft der Gemeinschaft – wir nannten das damals Kollektiv –, entwickelte im Gruppen- und Freundschaftsrat Verantwortungsgefühl, lernte im Gedankenaustausch und Meinungsstreit zu argumentieren. Das hat mir viel für meinen Weg ins Leben gegeben.
Fast 25 Jahre später, Anfang 1971, hatte ich die Pionierorganisation als Sekretär des FDJ-Zentralrats übernommen. Diese Arbeit bereitete mir viel Freude. Die Pionierorganisation war inzwischen eine gesellschaftliche Größe geworden. Hinzu kam: Die meisten Eltern waren glücklich, dass ihre Kinder an den Nachmittagen sinnvoll beschäftigt waren. Kein Kind musste auf der Straße herumlungern. Zweifellos gab es auch Eltern, die dies nicht schätzten und es ihren Kindern aus politischen Gründen nicht gestatteten, zu den Pionieren zu gehen. Das führte nicht selten zu Konflikten zwischen ihnen und ihren Kindern, die gern dabei gewesen wären. Wer das Pionierleben heute allerdings auf Fahnenappelle und Versammlungen reduziert, irrt sich. Am 4. November 1989 wünschte sich die Schauspielerin Steffi Spira für ihre Urenkel, »dass sie aufwachsen ohne Fahnenappell, ohne Staatsbürgerkunde …«
Ihr Wunsch, geäußert auf der Kundgebung auf dem Berliner Alexanderplatz, sollte sich schon bald erfüllen – allerdings vermutlich auf von ihr nicht gewünschte Weise. Mit dem Fahnenappell, der Staatsbürgerkunde und dem Wehrunterricht, die oft in der Kritik standen, verschwand nämlich auch das gesamte Bildungssystem, das nicht nur in Finnland beachtet und geschätzt wurde. Sein größter Vorteil bestand in der Einheitsschule. Die Schulpflicht von der 1. bis zur 10. Klasse für alle Kinder führte zur Erhöhung des Bildungsniveaus der Heranwachsenden. Die zweijährige Abiturstufe für leistungsstarke Schüler war eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Hochschulstudium. Weitere Möglichkeiten ergaben sich durch die Verbindung von Berufsausbildung und Abitur. Die Einheitlichkeit bezog sich auch auf die Vorschulzeit. Dem Alter entsprechend wurden die Kinder auf die Schule vorbereitet.
Die systematische Wissensvermittlung in der Schule wurde durch das polytechnische Prinzip unterstützt. Das Vordringen der polytechnischen Bildung bis in die Betriebe hat die Verbindung von Schule und Leben gefördert. Das Ziel war, auf der Grundlage eines soliden, mathematischnaturwissenschaftlichen Wissens und Könnens die Schüler in die gesellschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenhänge der Produktion einzuführen. Der polytechnische Unterricht sollte kein Ersatz einer Berufsausbildung sein, doch er schuf günstige Voraussetzungen für den Facharbeiternachwuchs.
Das einheitliche Bildungswesen schloss keineswegs die Begabten- und Talenteförderung aus. Die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS), die Spezialschulen für Mathematik und Naturwissenschaften, für Musik und Sprachen beweisen es. Darüber hinaus gab es diverse Sonderschultypen für Kinder, die aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht in der Lage waren, eine der gängigen Bildungseinrichtungen zu besuchen.
Dass heutzutage so viele Schüler in der 4. Klasse noch nicht das Einmaleins oder das Alphabet kennen, wäre in der DDR-Schule undenkbar gewesen.
Ich idealisiere unser Bildungssystem nicht. Es gab manche Kritik der Elternschaft, der Lehrer und selbst der Schüler der oberen Klassen. Ich erlebte auf der anderen Seite wiederholt, dass Spezialisten und Schulfunktionäre aus anderen Staaten in die DDR kamen, um unsere Erfahrungen im Bildungswesen zu studieren und daraus zu lernen. Ich erinnere mich stundenlang Gesprächspartner eines dieser wissensdurstigen Finnen gewesen zu sein.
Mir ist gar nicht so wichtig, ob Finnland viel von uns übernommen hat oder nicht, ob das dortige Schulwesen auf dem unseren fußte oder nicht. Wesentlich für mich war die Aufgeschlossenheit der Finnen, von uns zu lernen. Diese Lernwilligkeit war nicht nur westdeutschen Bildungspolitikern fremd, sondern generell der bundesdeutschen Politik. In den neunziger Jahren forderte die PDS eine Skandinavisierung des bundesdeutschen Schulsystems, was letztlich bedeutete, über diesen Umweg die DDR-Erfahrungen in das gegenwärtige Schulwesen einfließen zu lassen. Den Mut, diese Forderung direkt auszusprechen, hatte die Partei des Demokratischen Sozialismus nicht.
Im Vergleich mit dem gegenwärtigen dreigliedrigen Bildungssystem in der Hoheit der Bundesländer war die Einheitsschule der DDR ein epochaler gesellschaftlicher Fortschritt. Auf Veranstaltungen, bei denen ich mit Absolventen der DDR-Schule ins Gespräch komme, fragen diese hartnäckig und gelegentlich auch mit großer Empörung, warum heutzutage neu erfunden oder als neu ausgegeben werde, was es doch in der DDR bereits gegeben und sich bewährt habe, etwa die Ganztagsschulen.
Zur Schule gehörte auch die Freizeit. Dafür standen den Schülern beispielsweise 142 Pionierhäuser, 192 Stationen Junger Naturforscher und Techniker, 57 Touristenstationen und 48 Zentrale Pionierlager zur Verfügung, in denen Hunderttausende Kinder erholsame Ferien erleben konnten. Anfang der neunziger Jahre machte ich eine Radtour entlang der Ostseeküste und besuchte jene Orte, in denen es einst Zentrale Pionierlager gegeben hatte. Inzwischen waren Immobilienhaie aus dem Westen über sie hergefallen. Entweder wurden kostspielige Ferienwohnungen für Begüterte errichtet oder man tat nichts und wartete ab, dass die Grundstückspreise weiter stiegen. Unterdessen verkamen die Anlagen und Bauten ungenutzt. Eine traurige und kinderfeindliche Bilanz, die ich mir in meiner Zeit als Pioniervorsitzender nicht hatte vorstellen können.
Die Zerschlagung des DDR-Bildungssystems und seiner materiellen Basis gehört zu den unverzeihlichen Sünden auf dem Wege zur staatlichen Einheit.
Zu den politisch wichtigen Ereignissen in meiner Zeit als Pioniervorsitzender gehörte für mich 1973 die Einführung der roten Halstücher für Thälmann-Pioniere. Ich hatte dies damit begründet, dass es pädagogisch wie politisch nützlich sei, Pioniere in der 4. bis 7. Klasse auch optisch von den Jungpionieren in der 1. bis 3. Klasse zu unterscheiden. Die Thälmann-Pionire sollten rote, die Jungpioniere weiter blaue Halstücher tragen.
Die Vorgeschichte lag zwanzig Jahre zurück. Ich erfuhr sie von Margot Honecker, die zu Beginn der fünfziger Jahre als Margot Feist die Pionierorganisation geleitet hatte; sie war, wie bekannt, von 1949 bis 1954 meine Vorgängerin. 1952 hatte das Zentralkomitees der SED der Pionierorganisation den Namen »Ernst Thälmann« verliehen. Zusammen mit der Namensgebung und der Verleihung Roter Ehrenbanner auf dem Pioniertreffen in Dresden sollten auch erstmals rote Halstücher verliehen werden. Diese, so verriet mir Margot Honecker, waren bereits produziert. Doch dann kam aus der Parteiführung rotes Licht statt roter Tücher. Nein, hatte es plötzlich geheißen. Die Pionierorganisation werde von der FDJ geführt, deren Farbe sei blau: blaue Fahnen, blaue Blusen – also blaue Halstücher. Wären sie rot, könnte man irrtümlich annehmen, die Pionierorganisation unterstünde der Partei.
Beide Honeckers waren allerdings der Meinung, das sei nur ein Vorwand gewesen. Einige Politbüromitglieder waren vielmehr der Ansicht, man müsse nicht alles nachmachen, was es in der Sowjetunion gebe. Dort trugen seit 1922 die Pioniere rote Halstücher.
Meine Nachfolgerin als Pioniervorsitzende wurde Helga Labs, eine ausgebildete Lehrerin. Sie hatte im Bezirk Karl-Marx-Stadt die dortige Pionierorganisation geleitet und war seit vier Jahren 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung, ehe sie der Ruf nach Berlin ereilte.
Am 9. Januar 1974 löste ich Günther Jahn als 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ ab. Er hatte den Jugendverband seit 1967 erfolgreich geleitet. In dieser Zeit habe ich von ihm eine Menge gelernt. Was wir voneinander hielten, haben wir uns immer offen gesagt. Zum Nachtreten gab es keinen Anlass. Wir blieben bis zu seinem Tod 2015 persönlich eng verbunden, auch wenn wir oft heftig um Details miteinander stritten.
Günther war schlagfertig und wurde in der Kunst des Witzeerzählens nur noch von Werner Eberlein übertroffen. So erinnere ich mich einer Begebenheit aus dem Jahr 1969. Die Nationale Front wollte den 20. Jahrestag der Gründung der DDR begehen. Eine halbe Stunde vor Beginn der Zusammenkunft suche ich den Präsidiumsraum auf. Dort saß, mutterseelenallein, der 76-jährige Staats- und Parteichef Walter Ulbricht. »Kommen Sie ruhig rein, Genosse Jahn«, rief er mir zu – er hatte mich augenscheinlich nicht erkannt oder verwechselt. Ich korrigierte aus Höflichkeit nicht … Als ich Günther davon berichtete, scherzte er: »Ich hätte gesagt: ›Einen Augenblick, Genosse Honecker, ich komme gleich!‹«
1974 übernahm ich die FDJ von Jahn in einem sehr guten Zustand. Die Stimmung der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten vom Vorjahr (28. Juli bis 5. August 1973) wirkte nach. Hunderttausende junge DDR-Bürger hatten zusammen mit mehr als 25.000 Delegierten aus 134 Ländern ein Fest des Friedens, der antiimperialistischen Solidarität, der Freundschaft und der Lebensfreude gefeiert. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an den letzten Abend denke, als sich auf dem Marx-Engels-Platz in Berlin 750.000 Festivalteilnehmer zur größte Kundgebung, die es je in der DDR-Hauptstadt gegeben hatte, versammelten. Angela Davis, deren Mut und Standhaftigkeit erst kürzlich US-amerikanische Gefängnismauern gesprengt hatten, sprach den Appell an die Weltjugend. Als sie mit dem Bekenntnis endete: »Verstärken wir unsere Aktionen und die Einheit gegen Imperialismus, für nationale Unabhängigkeit, Demokratie, sozialen Fortschritte und für den Frieden« gab es einen Sturm der Begeisterung. Alle sangen das Lied »Wir sind überall auf der Erde«, das inzwischen zur Hymne des Festivals geworden war. Damals hatten wir noch den historischen Optimismus, dass es gelingen könne, Frieden und Fortschritt auf der ganzen Welt zu schaffen.
Reinhold Andert und Hartmut König hatten den Text geschrieben, Wolfram Heicking lieferte die Musik. Ich höre unverändert gern dieses Lied mit der ultimativen Aufforderung: »Wir bleiben dabei: Auf der Erde / auf der Erde / muss Frieden sein / wird Frieden sein.«
Angela Davis stand bis vor Kurzem noch auf der Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher in den USA. Ihr drohte die Todesstrafe. Als sie in Kalifornien im Gefängnis einsaß, gab es in der DDR eine der größten Solidaritätsaktion unserer Geschichte: Freiheit für Angela Davis. Als sie befreit war, führte ihre erste Reise in unsere Republik.
Die Schriftstellerin und Lyrikerin Gisela Steineckert erinnerte sich später: »Angela Davis kam, und Egon hat uns sein Haus, nein, seinen Sitz Unter den Linden, im obersten Stock, neben der immer laufenden Her- und Abfahrt, zur Verfügung gestellt […] Er hat nur gesagt, macht’s euch gemütlich. Leute, um einen Tisch herum, ziemlich unbequeme Stühle, aber mir gegenüber Angela. Ich gebe zu, dass sie für mich ein Vorbild war und ich eifersüchtig darauf achtete, dass dem nichts falsch Heldenhaftes, oder Kritisches hinzugefügt wurde. Ich sehe sie noch vor mir – sie sah aus wie eine hübsche Dreißigjährige.« Die farbige Bürgerrechtlerin und Kommunistin war Jahrgang 1944.
Ich war dabei, als Angela Davis anschaulich davon berichtete, dass Lastwagen Solidaritätskarten aus der DDR säckeweise ins Gefängnis brachten und wie dies die Haltung der Gefängnisaufseher zu ihr beeinflusste. Sie war davon überzeugt, dass die Solidarität der DDR und ihrer Jugend zu ihrer Freiheit beigetragen hatte.
Die Festivaltage beherrschten politische Ereignisse in Chile und Vietnam. Die Gefahr, dass in dem südamerikanischen Land ein faschistischer Putsch mit Unterstützung der USA gegen den sozialistischen Präsidenten Allende erfolgreich sein könnte, war allgegenwärtig. Als am 7. August der während des Festivals am 1. August 1973 verstorbene Walter Ulbricht bei einem Staatsakt gewürdigt wurde, war auch Gladys Marin zugegen. Ich kannte die Vorsitzende des Kommunistischen Jugendverbandes seit 1968, als ich Chile besucht hatte. Sie machte mich mit dem seinerzeitigen Senator Salvador Allende bekannt. Seither verfolgte ich besonders aufmerksam die politische Entwicklung im Andenland. Allende und die Unidad Popular gewannen 1970 die Wahlen.
Nach dem Staatsakt für Walter Ulbricht trafen wir uns zu einem Gedankenaustausch. Als wir uns verabschiedeten, standen Gladys Tränen in den Augen. Sie wisse nicht, was sie in ihrer Heimat erwarte, sagte sie, und hielt es nicht für ausgeschlossen, dass es ein Abschied für immer sein könnte. Wir umarmten uns. Ihre Ahnungen hatten nicht getrogen. Am 11. September 1973 putschte das Militär, die Strippen jedoch hatten die USA und ihr Geheimdienst CIA gezogen. General Pinochet, ein Faschist reinsten Wasser, war der Meinung, dass die Demokratie hin und wieder in Blut gebadet werden müsse. Dem Blutbad fielen schon in den ersten Wochen etwa fünfzehntausend Chilenen zum Opfer, darunter Präsident Allende, sein Freund Pablo Neruda, der Dichter und Nobelpreisträger, sowie der Sänger Víctor Jara.
Viele tauchten unter oder retteten sich ins Exil. Wochenlang hörten wir nichts von Gladys Marin, ihren beiden Kindern und dem Ehemann. Wir wussten nicht, ob sie noch lebten oder ermordet worden waren wie so viele. Schließlich übermittelte mir ein Genosse unserer Aufklärung einen Gruß von ihr. Er kam aus Chile, wo er an der Ausschleusung des Generalsekretärs der Sozialistischen Partei nach Argentinien beteiligt gewesen war.
Viele Chilenen fanden Asyl in der DDR. Nach einigen Wochen kam auch Gladys Marin nach Berlin. Sie hatte Aufnahme in den Niederlanden gefunden. Bei unserer Reise durch Städte und Dörfer der DDR schlug ihr eine Welle der Sympathie entgegen. Es lebe die internationale Solidarität, hieß es immer wieder, und dieser Ruf kam von Herzen.
Kurze Zeit später besuchte uns Joan Jara, die Witwe von Víctor Jara, dem populären Musiker und Theaterregisseur, der mit vierundvierzig Gewehrschüssen am 16. September 1973 ermordet worden war. Es war für mich ein außerordentlich bewegender Momente, als ich Joan Jara die postum an ihren Mann verliehene Artur-Becker-Medaille übergeben durfte.
Die Entwicklung im geteilten Vietnam hingegen deutete auf einen Sieg der Volksbefreiungskräfte im Süden des Landes; zu Beginn des Jahres war bereits der Aggressor USA aufgrund des internationalen Drucks und wegen des erfolgreichen Widerstandes des vietnamesischen Volkes gezwungen worden, mit Nordvietnam einen Waffenstillstand zu schließen und seine Truppen aus dem ganzen Land abzuziehen. Die USA hatten erklärt, Vietnam in die Steinzeit zurückzubomben zu wollen: Sie warfen vier Mal so viele Bomben ab wie während des Zweiten Weltkrieges in Europa – mit einer Zerstörungskraft von etwa sechshundert Hiroshima-Atombomben. Sie hinterließen einundzwanzig Millionen Bombenkrater, geschätzte dreieinhalb Millionen Landminen und etwa dreihunderttausend Tonnen nicht explodierter Kriegsmunition sowie vierundzwanzigtausend Quadratkilometer kontaminiertes Gelände. Die Streitkräfte der USA hatten fünfzig Millionen Liter des hochgiftigen Agent Orange zur Entlaubung der Wälder versprüht. Daran leiden noch heute die Menschen. Insgesamt verloren etwa vier Millionen Zivilisten, etwa dreizehn Prozent von Vietnams Bevölkerung, ihr leben, dazu kamen noch über eine Million Soldaten. Die Amerikaner verloren um die sechzigtausend Mann. Und wozu?
Am 1. Mai 1975 wurde auch Saigon befreit und nach Jahresfrist Norden und Süden zur Sozialistischen Republik Vietnam vereint. Als wir 1975 auf der Maitribüne in Berlin standen, sang der Oktoberklub ein Lied, das über Nacht entstanden war:
Alle auf die Straße
Rot ist der Mai
Alle auf die Straße
Saigon ist frei
Wenn es in der DDR ein besonders starkes Gefühl gab, das bei Kindern und Jugendlichen fest verwurzelt war, dann das der internationalen Solidarität. Solidarität mit fremden Völkern und mit einzelnen Persönlichkeiten. Dazu bedurfte es keiner »Anordnung« von Partei oder Staat. Dieses Mitmenschlichkeit habe ich als Kind und als Heranwachsender wiederholt verspürt. Ich denke dabei an Manolis Glezos (1922-2020), der während der Besetzung Griechenlands durch Nazideutschland die Hakenkreuzfahne von der Akropolis herunterholte; 1967, als faschistische Obristen putschten und Glezos inhaftierten, solidarisierten wir uns mit ihm und den anderen griechischen Patrioten.
In Erinnerung ist mir Raymonde Dien (1929-2022), eine junge Französin, die sich 1950 auf die Bahngleise legte, um einen Waffentransport der Kolonialmacht Frankreich nach Indochina zu blockieren. Sie wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Internationale Solidaritätsaktionen befreiten sie, 1951 war sie Gast bei den III. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin. Ich konnte sie damals in der Pionierrepublik in der Berliner Wuhlheide umarmen.
Unvergessen ist mir unser kollektiver Protest gegen das Todesurteil für das jüdische Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg. Ein US-Gericht befand sie Anfang der fünfziger Jahre der Spionage für die Sowjetunion für schuldig, es war die Hochzeit des Kalten Krieges. Trotz weltweiter Proteste – Papst Pius XII., der französische Philosoph Jean-Paul Sartre, Nobelpreisträger Albert Einstein, Pablo Picasso, der deutsche Filmpionier Fritz Lang (»Metropolis«), Bertolt Brecht und die mexikanische Malerin Frida Kahlo gehörten zu den Protestierern – starben beide Rosenbergs am 19. Juni 1953 auf dem elektrischen Stuhl in New York.
Unzählige Ereignisse in der Welt und in Deutschland forderten die DDR-Bürger zur Parteinahme: die nie heilenden Wunden von Hiroshima und Nagasaki, US-Invasionen von Vietnam über Kuba bis Grenada, Befreiungskriege in Angola, Mocambique und in weiteren afrikanischen und asiatischen Staaten … Immer waren wir solidarisch mit den Opfern imperialistischer Politik. So mit Patrice Lumumba (1925-1961), dem Vorkämpfer der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung, ermordet als Premierminister des unabhängigen Kongo; mit Ernesto »Che« Guevara (1928-1967) und Fidel Castro (1926-2016), die dem US-Imperialismus mehr als nur die Stirn boten; mit Nelson Mandela (1918-2013) in rassistischem Gewahrsam auf Robben Island; mit Martin Luther King (1929-1968), dem afroamerikanischen Bürgerrechtler, der durch Mörderhand starb; mit Mikis Theodorakis (1925-2021), dem weltberühmten griechischen Musiker und Antifaschisten, der sowohl von den deutschen Okkupanten wie von den griechischen Obristen eingekerkert worden war; mit Salvador Allende, mit Pablo Neruda und Luis Corvalan, die ein neues Chile wollten und Opfer der Militärdiktatur wurden …
Ende Januar 1974 beschloss die Volkskammer der DDR ein Gesetz zur Förderung der Jugend, das dritte bereits. Der Entwurf war Monate vor den Weltfestspielen veröffentlicht worden und Lesestoff für Festivalgäste besonders aus dem kapitalistischen Ausland. Durch die Diskussion wurde es wesentlich verbessert. Das Jugendforschungsinstitut Leipzig hatte etwa achthundert Vorschläge analysiert. Sein Direktor, Prof. Walter Friedrich, informierte mich, dass unter den Wortmeldungen auch viele Jugendliche waren, die sich als christlich oder konsessionell gebunden bezeichneten. Einer jener Christen war Hans Moritz. Ich hatte ihn zu Beginn der sechziger Jahre kennengelernt.
1962 lud der polnische Studentenverband zu einer internationalen Studentenkonferenz nach Warschau, um über Europäische Sicherheit zu diskutierten. Zur FDJ-Delegation, die ich leitete, gehörte auch Hans Moritz. Die Gastgeber hatten uns beide in ein Hotelzimmern gesteckt. Wir diskutierten Tag und Nacht. Moritz bestärkte mich in meiner Überzeugung, dass man als gläubiger Mensch durchaus auch ein loyaler DDR-Bürger sein konnte. Als es um die Vorschläge für das Jugendgesetz ging, traf ich mich mit ihm. Hans Moritz war inzwischen Direktor der Sektion Theologie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Man solle alles, was der DDR-Verfassung entspreche, auch im Gesetz berücksichtigen, meinte er. So haben wir es auch gehalten.
Auch später traf ich mich gelegentlich mit jungen Christen, mit Bausoldaten aus Prora und Theologiestudenten. Diese Begegnungen waren in der Regel offen und von wechselseitigem Vertrauen bestimmt, was aber nicht darüber hinwegtäuschte, dass es im Alltag durchaus Spannungen mit jungen Christen gab, die ihre Interessen nicht von der FDJ vertraten sahen. Es gab auch Auseinandersetzungen mit Personen, die ihr politisches Zuhause westlich unserer Staatsgrenze sahen. Wir waren als Jugendverband bestrebt, sie nicht auszugrenzen. Dennoch blieb unser Verhältnis zur Jungen Gemeinde schwierig. Wir verteidigten die Rolle der FDJ als einheitlichen Jugendverband und verwiesen darauf, dass 1946 alle Parteien, einschließlich die Kirchen, auf die Gründung eigener Jugendorganisationen verzichtet hatten. Die FDJ verstand sich als Interessenvertreter aller Jugendlichen. Das wurde nicht von allen so gesehen.
Das Jugendgesetz bot viele Möglichkeiten, Probleme anzupacken, die vorher nur ungenügend im Blickpunkt der Politik gestanden hatten. Mit hohem ökonomischem Aufwand entstand zum Beispiel der neue Industriezweig Jugendmode. Vorbei war die Zeit, da die politische Führung über Jeans die Nase rümpfte. Da hatte man die vom Schriftsteller Ulrich Plenzdorf in seinem Theaterstück »Die neuen Leiden des jungen W.« etwas falsch verstanden: »Jeans sind eine Einstellung und keine Hose.« Ich hatte in einer Rede vor dem Zentralrat die Auffassung des Jugendverbandes artikuliert: »Wie viel Nieten eine Hose hat, ist Sache der Mode. Uns ist wichtig, dass keine Niete in der Hose steckt.«
Was hatten wir nicht alles versucht, um dem Westeinfluss in der Jugendkultur zurückzudrängen? Auf Rock’n’Roll reagierten wir mit der DDR-Kreation »Lipsi«, Ringelsocken und Schuhe mit Kreppsohle ließen wir so wenig zu wie lange Haare, die mit den Pilzköpfen, den Beatles, aufkamen. »Gammler« nannte man allerdings abfällig auch in der Bundesrepublik jene Jugendlichen, die sich angeblich außerhalb der sozialen Norm bewegten. Wie auch immer: Gewinnen konnte die FDJ keine Kampagne gegen Mode- und Musikströmungen, die aus dem Westen kamen.
Zumindest aber konnten wir den Standpunkt durchsetzen, dass vom Habitus junger Leute nicht auf deren Persönlichkeit oder gar Haltung zur DDR geschlossen wurde. Mit ihrem Modeverhalten artikulierten die meisten Jugendlichen keine politische Protesthaltung, sie sahen die Mode in der Regel ideologiefrei. Gleichzeitig wussten wir natürlich, dass sie viel Geld für modische Kleidung ausgaben. Wir setzten uns dafür ein, in der Republik ein Netz von Verkaufsläden für Jugendmode aufzubauen. In diesen Jumo-Läden wurden eigene Erzeugnisse angeboten, deren Herstellung vom Staat subventioniert wurden. Die DDR importierte gegen Devisen Maschinen aus dem Westen, um Jeans zu produzieren. Für Denim und Indigo fehlte jedoch das Geld. Wenn wir auch die Erfahrung machen mussten, dass junge Leute lieber das Original und nicht Nachgemachtes präferierten, so haben sehr viele dennoch mangels internationaler Marken wie Levis, Wrangler oder Mustang zur DDR-Produktion gegriffen.
Die FDJ nahm sich verstärkt der Alltagsprobleme der Jugend an: Wohnungen und zinslose Kredite für junge Eheleute zum Einrichten dieser Wohnungen, Tanzmusik und Jugendclubs in Wohngebieten, Wandern und Touristik. Auch das sensible Thema Reisen gehörte dazu. Wir bauten ein von der FDJ geleitetes Jugendreisebüro auf. »Jugendtourist« wurde von Klaus Eichler geleitet, einem unserer erfahrensten Jugendfunktionäre. Das Unternehmen organisierte Reisen innerhalb der DDR und ins Ausland, ins sozialistische wie ins kapitalistische. Nicht nur handverlesen, wie der Vorwurf aus dem Westen lautete. Im großen Maßstab. Über 2,3 Millionen Menschen, ausländische Gäste eingeschlossen, reisten durchschnittlich im Jahr mit »Jugendtourist«. Der Austausch mit Polen betrug jedes Jahr über 300.000 Jugendliche. Auch der Reiseverkehr mit der Bundesrepublik nahm zu, was augenscheinlich den dortigen Verfassungsschützern ein Dorn im Auge war. Der Jugendaustausch mit der DDR tauchte regelmäßig in ihren Berichten auf, was seiner Förderung nicht eben dienlich war. Der Reiseverkehr hatte keine politische, sondern eine ökonomische Grenze. Wir konnten nur so viele Jugendliche in den Westen schicken, wie von dort zu uns kamen. Das Interesse der Ostdeutschen an Westdeutschland war schon damals größer als umgekehrt.
Im Inland entstanden neue Jugendherbergen und -hotels. Dort konnten junge Leute, auch Familien mit Kleinkindern, für kleines Entgelt großen Urlaub machen. Die Übernachtung in einer Jugendherberge beispielsweise kostete 25 Pfennig pro Person. Dennoch waren die Bedürfnisse auch hier größer als die Möglichkeiten.
Fast jeder in der DDR wusste, dass die großzügige Jugendpolitik eng mit Honeckers Namen verbunden war. Es gab Ökonomen, die kritisierten die sozialpolitischen Maßnahmen generell und speziell für junge Leute als Verschwendung. Manche meinten gar, sie seinen »Opium gegen jedes vernünftige ökonomische Denken.«
Nachträglich betrachtet stimmte das vielleicht sogar. Damals aber sah ich es nicht so. Ich freute mich über jede soziale Verbesserung für die Bürger. Was die Jugend betraf, ließ sich Honecker ohnehin nicht beirren und beeinflussen: Er setzte auf sie. Und setzte sich damit nicht nur der Kritik, sondern auch eines gewissen Spotts aus. Ich erinnere mich, dass mein Jüngster einmal aus der Schule nach Hause kam und sagte: »Erich Honecker hat sich den Arm gebrochen.«
Das überraschte mich, weil ich nichts davon mitbekommen hatte und fragte also nach: »Wie denn das?«
»Erich Honecker hat sich zu sehr auf die Jugend gestützt und ist dabei gestürzt.«
Die siebziger Jahre gehören zu den erfolgreichsten der DDR. Das ist nicht nostalgische Erinnerung, sondern wissenschaftlich belegt. Seit es existierte, seit 1966, hielt ich enge Kontakte zum Zentralinstitut für Jugendforschung (ZIJ) in Leipzig. Ich gehörte zudem dem Beirat für Jugendforschung beim Amt für Jugendfragen des DDR-Ministerrates an, seitdem dieser bestand. Für ZIJ-Chef Walter Friedrich (1929-2015) war es selbstverständlich, die FDJ-Führung über die Ergebnisse ihrer soziologischen Untersuchungen zu informieren. Er tat dies ungeschminkt und ohne Rücksicht darauf, ob die Resultate in die politische Linie passten oder nicht. Das rief die Kritiker im Politbüro auf den Plan, die Soziologie als störend empfanden. Deshalb wurde beispielsweise Ende 1978 das von Walter Ulbricht nach dem VI. Parteitag der SED 1963 ins Leben gerufene Meinungsforschungsinstitut beim ZK der SED aufgelöst und sein Archiv vernichtet. Es hieß, die Informationslinien der Partei und des Staates seien effektiver. Das war aber leider nicht der Fall. In diesen Informationslinien herrschte nicht Empirie, sondern Schönfärberei.
Angriffe gab es auch auf das Institut für Jugendforschung in Leipzig. Die Akademie für Pädagogische Wissenschaften beispielsweise sah im ZIJ einen Konkurrenten. Sie reklamierte die alleinige Hoheit über Untersuchungen an den Schulen. Wiederholt gab es auch Attacken aus Abteilungen des SED-Zentralkomitees, insbesondere dann, wenn Forschungsergebnisse aus dem ZIJ von Westmedien willkürlich zitiert wurden, um die Jugendpolitik der DDR zu diskreditieren. Besonders Siegfried Lorenz, Wolfgang Herger und später auch Eberhard Aurich setzten sich gegen solche Versuche erfolgreich zur Wehr. Der an jenem ZK-Institut tätige Heinz Niemann schrieb in seiner »Kleinen Geschichte der SED«, 2020 in der edition ost erschienen, dazu lakonisch: »Auch das in Leipzig tätige Zentralinstitut für Jugendforschung sollte geschlossen werden, was aber Egon Krenz, 1. Sekretär des FDJ-Zentralrats, in seiner Funktion als Kandidat des Politbüros zu verhindern wusste.« Bis 1990 konnte das ZIJ arbeiten.
Vom Institut für Jugendforschung erhielten wir differenzierte Einblicke in das Denken und Fühlen junger Leute. Wir bekamen zum Beispiel durch die Untersuchungen bestätigt, dass sich zwischen achtzig und neunzig Prozent der 14- bis 30-Jährigen zur DDR als ihrem Vaterland bekannten.
Manch einer mag im Rückblick an diesen Zustimmungswerten zweifeln. Es ist aber ein Fehler, das Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat nur vom Ende der DDR aus zu bewerten. Es war nun wahrlich nicht so, dass die SED über vierzig Jahre lang gegen die Mehrheit des Volkes regiert hätte. Fast zweihundert Studien des ZIJ, die im Ergebnis anonymer schriftlicher Befragungen entstanden waren, bestätigten, dass zu jener Zeit die Mehrheit der jungen Leute ein positives, loyales, durch eigene Lebenserfahrungen emotional gestütztes Verhältnis zur DDR hatten. Als Motive ihrer positiven Bewertung der DDR gaben sie über Jahrzehnte an: die Sicherheit des Arbeitsplatzes und der eigenen Entwicklung, die Friedenspolitik der DDR, die Möglichkeiten von Bildung, Qualifizierung und kultureller Betätigung, Sichwohlfühlen in der Familie, unter Freunden, im Betrieb, erlebte Solidarität und Übertragung von Verantwortung für die Gemeinschaft. Geht man davon aus, dass Jugendliche einen gewissen Querschnitt der Gesellschaft widerspiegeln, so ist der Schluss nicht abwegig: In allen Bevölkerungsschichten haben sich in den siebziger Jahren bedeutende Mehrheiten mit den Zielen und der Politik der DDR identifiziert.
Was die Wissenschaftler auf ihre Art nüchtern formulierten, drückte Reinhold Andert vom Oktoberklub mit dem »Lied vom Vaterland« sehr poetisch aus. Ich lernte ihn bei etlichen Auftritten des Oktoberklubs kennen und bin bis heute mit ihm befreundet. Andert hat eine bemerkenswerte Biografie. Von einem Bischöflichen Vorseminar und einer Lehre als Orgelbauer kam er zum Studium der Philosophie und Geschichte an die Humboldt-Universität Berlin. Danach, bis 1972, war er als Assistent für Philosophie an die Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in Berlin tätig. Er wurde von einem Gottesdiener zu einem marxistischen Wissenschaftler und später zu einem politischen Künstler und Dialektiker, wie man unschwer an seinen Liedtexten erkennen konnte.
Kennst du das Land mit seinen alten Eichen?
Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach.
Wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen.
Wo ich ein Zimmer hab’ unterm Dach.
Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen,
Wo mancher Vater eine Frage nicht versteht,
Wo ihre Kinder ihnen das nicht übelnehmen,
Weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht.
Hier schaff’ ich selber, was ich einmal werde,
Hier geb’ ich meinem Leben einen Sinn.
Hier hab’ ich meinen Teil von uns’rer Erde.
Der kann so werden, wie ich selber bin.
Kennst du das Land, wo die Fabriken uns gehören,
Wo der Prometheus schon um Fünf aufsteht,
Hier kann man manche Faust auf manchen Tischen hören
Bevor dann wieder trotzdem was nicht geht,
Wo sich auf Wohnungsämtern Hoffnungen verlieren,
Und ein Parteitag sich darüber Sorgen macht,
Wo sich die Leute alles selber reparieren,
Weil sie das Werkzeug haben, Wissen und die Macht
Hier schaff’ ich selber, was ich einmal werde,
Hier geb’ ich meinem Leben einen Sinn.
Hier hab’ ich meinen Teil von uns’rer Erde.
Der kann so werden, wie ich selber bin.
In diesem Lande lernte ich das Laufen.
Ich lernte richtig sprechen, richtig denken.
Ich lernte, nur das Brauchbare zu kaufen.
Und, dass es Freude macht, auch etwas zu verschenken.
Hier lernte meine Mutter das Regieren,
Als sie vor einem Trümmerhaufen stand.
Ich möchte dieses Land niemals verlieren
Es ist mein Mutter- und mein Vaterland
Als der Ernst-Busch-Chor fünfzig wurde und dies im April 2023 mit einem Festkonzert im Berliner Kino Babylon beging, sang Reinhold Andert dieses Lied. Vielen stand das Wasser in den Augen.
Zu meinen ersten Auslandsreisen als 1. Sekretär des FDJ-Zentralrats gehörte die Teilnahme am Kongress des Leninschen Komsomol. Ich reiste im April 1974 mit Siegfried Lorenz – seit 1966 Leiter der Abteilung Jugend im ZK der SED –, Frank Bochow (1937-2012), seit Mitte der sechziger Jahre Sekretär für internationale Verbindungen im Zentralrat der FDJ, und Heide Hinz. (Heide Hinz war ein politisches Talent. Sie hatte als junge Versicherungsangestellte die Interessen ihrer Altersgefährten vertreten, war in ehrenamtlichen Funktionen der FDJ aktiv und Finanzmitarbeiterin in der FDJ-Bezirksleitung Schwerin geworden. Schon bald wurde sie deren 2. Sekretär. Ihre Mitstreiter delegierten sie zu einem Einjahreslehrgang an die Parteihochschule nach Moskau, was der jungen Mutter durchaus Probleme bereitete. Sie meisterte diese gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen. Die Schweriner Bezirksleitung der FDJ wählte Heide nach ihrer Rückkehr zum 1. Sekretär. Nach erfolgreicher Arbeit wurde sie später Sekretär der SED-Bezirksleitung, verantwortlich für Kultur und Volksbildung. Das im Schweriner Schloss beheimatete Zentrale Poetenseminar der FDJ beispielsweise war ihr eine gute Schule gewesen. Schriftsteller hatten ihr wiederholt für ihren Einsatz für die Poetenbewegung der FDJ gedankt.)
Auf dem XVII. Komsomol-Kongress in Moskau lernte ich nicht nur die Wertschätzung des DDR-Jugendverbandes in der internationalen Arena kennen, sondern auch Leonid Breschnew. Der Generalsekretär des ZK der KPdSU war damals agil und hatte sich durch seine politischen Vorschläge und sein Handeln einen Namen als Mann des Friedens gemacht. Als Angehöriger der Roten Armee sammelte er im Großen Vaterländischen Krieg Erfahrungen, die seine Überzeugungen ausmachten. Auch auf diesem Komsolmolkongress erklärte er den Kampf um und für den Frieden zur wichtigsten Aufgabe der Sowjetunion. Breschnews Engagement für das Zustandekommen der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die er initiiert hatte, wurde 1975 mit der Unterzeichnung der Schlussakte durch dreiunddreißig Staatschefs sowie der Präsidenten der USA und Kanadas gekrönt.
Als ich zu Beginn der sechziger Jahre 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung in Rostock war, unternahm man an der Universität in Greifswald die ersten Schritte zur Erforschung der Geschichte der FDJ. Schon während seines Studiums hatte Karl-Heinz Jahnke (1934-2009) zur Geschichte der deutschen Arbeiterjugendbewegung geforscht. Als in München noch Hans und Sophie Scholl in der westdeutschen Nachkriegsöffentlichkeit wegen ihres Widerstandes gegen Hitler diskreditiert wurden, schrieb Karl-Heinz Jahnke bereits bewegende Geschichten über die Widerstandsgruppe der Weißen Rose, die in der DDR hoch geachtet war. Jahnke war seit Mitte der sechziger Jahre als Dozent für Neue und neueste Geschichte in Greifswald tätig und wechselte nicht zuletzt auf unseren Wunsch an die Universität in Rostock, wo er seit 1973 eine Professur hatte. Zusammen mit Werner Lamberz – erst als Zentralratssekretär und dann als Leiter der ZK-Abteilung für Agitation und Propagada – war ich im Zentralrat für die Einrichtung einer Forschungsstelle zur FDJ-Geschichte verantwortlich. Jahnke hatte dort den Hut auf.
Von ihm und seinen Mitarbeitern wurde eine geschlossene Geschichte der FDJ vorgelegt, für die sich deren erster Vorsitzender naturgemäß besonders interessierte.
Ich trug das Manuskript in das Büro von Erich Honecker. Nach einigen Tagen kam es mit persönlichen Anmerkungen zurück, die verrieten, dass er Seite für Seite gelesen hatte. Mit schwarzem Filzstift hatte er quer über das Deckblatt geschrieben »Geschichte muss Geschichte bleiben«.
Das bezog sich auf Stalin. Der Generalissimus hatte 1950 zum ersten Deutschlandtreffen der Jugend in Berlin ein Telegramm geschickt und dabei die Rolle der jungen deutschen Friedenskämpfer für den Aufbau eines einheitlichen, friedliebenden und demokratischen Deutschlands hervorgehoben. Stalin war seit dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 jedoch umstritten, also hatten wir seinen Namen bei der Endredaktion gestrichen.
Er kam auf Empfehlung Honeckers mit diesem Telegramm wieder in den Text hinein: »Geschichte muss Geschichte bleiben«.
Eines Tages, ich glaube es war 1974, kam Heinz Keßler, damals noch Stellvertreter des Verteidigungsministers und Chef des Hauptstabes, zu mir in den Zentralrat. Es gebe, wie er sagte, ein »Kaderproblem«. Ein Absolvent der Militärakademie in Leningrad sollte im Ministerium eine Vertrauensstellung übernehmen, was aber nur möglich sein würde, wenn für seine Frau eine ihrer Qualifikation entsprechende Arbeit gefunden werde. Sie habe ebenfalls in Leningrad studiert. Ob nicht die FDJ …?
Was für ein Glücksfall: Eine Historikerin war uns herzlich willkommen! Dr. Inge Pardon baute in der Folgezeit das Archiv im Zentralrat nach wissenschaftlichen Kriterien auf. Sie machte ihren Weg über verschiedene Funktionen der FDJ und der SED bis hin zur Leiterin des Zentralen Parteiarchivs der SED. Ihr ist maßgeblich zu danken, dass dieses nationale Kulturgut in der Wendezeit gerettet werden konnte. Es wurde in eine unselbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts im Bundesarchiv überführt, in die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (SAPMO).
Mir ist diese Episode auch deshalb berichtenswert, weil Inge Pardon nach 1990 – zusammen mit ihrem 2023 verstorbenen Mann Michael – zu einer außergewöhnlichen sowjetischen Persönlichkeit forschte. Professor Sergej Iwanowitsch Tulpanow (1901-1984), ihr Doktorvater in Leningrad, war einst eine Schlüsselfigur der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Ihm war nicht nur zu danken, dass im sowjetisch besetzen Teil Deutschlands rasch wieder Universitäten öffneten und die DEFA gegründet worden war. Der Oberst, später General der Sowjetarmee, unternahm als Leiter der Informationsabteilung der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) alles Menschenmögliche, dass aus dem Naziland zumindest im Osten ein antifaschistisches Deutschland werden konnte. Er stand mit an der Wiege der DDR und stets an der Seite des sozialistischen Deutschlands. Die Pardons setzten Tulpanow das ihm gebührende und längst überfällige Denkmal.
Dem Text der beiden Geschichtsforscher entnahm ich folgende Begebenheit: Die Mutter von Heinrich Graf von Einsiedel, der als Leutnant bei Stalingrad abgeschossen worden und in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen war, richtete am 25. Januar 1947 einen Brief an den Russen Tulpanow. »Es schreibt Ihnen die Enkelin des bedeutenden Staatsmannes Bismarck, dessen Vermächtnis immer ein ewiger und unzerstörbarer Frieden mit Russland war. Sogar auf dem Sterbebett, nachdem Wilhelm II. unter dem Einfluss finsterer Mächte meinen Großvater in den Ruhestand gezwungen hatte, hat dieser wiederholt: ›Nie gegen Russland!‹«
Menschen wie der deutschfreundliche Tulpanow stellten Weichen, sorgten für Versöhnung und Verständnis zwischen den Völkern und prägten auch Persönlichkeiten wie die beiden Autoren, die bis zu seinem Tod mit ihm in Verbindung standen – und bis heute mit der Familie in Verbindung stehen. Sie taten das ohne jegliches Kalkül und Berechnung.
Auch ich spekulierte in den siebziger Jahren, die ich inzwischen für die besten in meinem politischen Leben halte, nicht über meinen Zukunft. Ich gehörte nicht zu jenen, die die die Schritte für ihren Aufstieg planten und welche Funktion dabei am vorteilhaftesten wäre. Meine Tätigkeit in der FDJ und in der Partei waren für mich zudem weit mehr als eine Form des Broterwerbs. Vielleicht erscheint es mit dem Wissen von heute manchem als weltfremd, wenn ich sage: Es war auch mein Glaube an sozialistische Ideale, der es mir verbot, mit dem Ellenbogen jene aus der Bahn zu stoßen, die mich bei der Erreichung eines Vorhabens störten. Ich verachtete aus gleichem Grunde Emporkömmlinge, die nur nach ihrem persönlichen Vorteil trachteten. Leider gab es zu viele von ihnen – auch in unseren eigenen Reihen.
Die Vorstellung, dass ich jemals in die Parteiführung kommen würde, lag lange außerhalb meiner Fantasie. Honecker war als FDJ-Vorsitzender 1950 Kandidat des Politbüros geworden, seine Nachfolger hingegen – Karl Namokel (von 1955 bis 1959), Horst Schumann (von 1959 bis 1967) und Günther Jahn (von 1967 bis 1973) gehörten nicht dem Politbüro an. Warum sollte ausgerechnet ich mit dieser Serie brechen?
Insofern war ich überrascht, als sich Freunde am Ende des IX. Parteitages 1976 bei mir erkundigten: »Wann hat Erich dir gesagt, dass du Kandidat des Politbüro wirst?«
Gar nicht, antwortete ich wahrheitsgemäß.
Ich erfuhr es tatsächlich vom ihm erst am 22. Mai 1976, als er mich auf der 1. Tagung des neuen Zentralkomitees nominierte.
Zugegeben, es gab zuvor Gerüchte, weil Erich einige Personalentscheidungen getroffen hatte, die meine unmittelbare Umgebung betrafen. Mein Freund Siegfried Lorenz, der bis Anfang 1976 die Jugendabteilung des Zentralkomitees geleitet hatte, wurde beispielsweise 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung in Karl-Marx-Stadt, Honeckers Volkskammer-Wahlkreis. Siggis neue Funktion galt als Ausdruck hoher Anerkennung seiner bisherigen Tätigkeit. (Manchmal wird kolportiert, die Delegierung eines Abteilungsleiters des ZK in einen Bezirk sei eine Degradierung gewesen. Das ist Unsinn. Als Abteilungsleiter gehörte man dem zentralen Parteiapparat an, man war faktisch Angestellter – als 1. Sekretär einer Bezirksleitung kam man in eine andere politische Liga, es handelte sich überdies um eine Wahlfunktion. Eine solche Delegierung war keine Seltenheit. Hans Modrow – bis dahin Leiter der Abteilung Agitation – wechselte 1973 nach Dresden, Kurt Tiedke 1979 und Werner Eberlein 1983 wurden nach Magdeburg geschickt; Hans Albrecht war bereits 1968 nach Suhl gegangen und blieb dort 1. Sekretär der Bezirksleitung bis zum Herbst 1989.)
Für Siegfried Lorenz und mich stellte die Entscheidung 1976 einen Einschnitt dar. Wir unterhielten bis dato enge Arbeitsbeziehungen, trafen uns regelmäßig dienstlich und auch privat. Nunmehr würden uns einige hundert Kilometer trennen. Und wir arbeiteten auf verschiedenen Feldern. Dennoch blieben wir verbunden, berieten uns, wo wir es für notwendig hielten.
Weitere Personalien: Der 2. Sekretär des FDJ-Zentralrats, Wolfgang Herger, wurde Leiter der Jugendabteilung im Zentralkomitee. Darüber war ich sehr glücklich. Er blieb damit dem Jugendbereich erhalten und stand inhaltlich in Kontinuität zu Siegfried Lorenz. Erich Postler, mit dem ich schon seit 1961 im Zentralrat zusammengearbeitet hatte, wurde mein