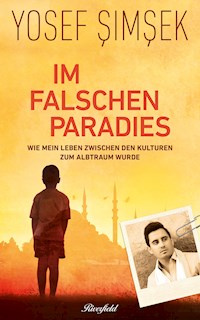Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die kleine Meryem kommt 1958 in einem abgelegenen Dorf im Südosten der Türkei auf die Welt und verbringt dort - ohne Telefon, ohne Zeitung, ohne Fernseher - die ersten Jahre ihrer Kindheit. Völlig unerwartet geschieht dann von heute auf morgen das, was ihre Welt für immer verändert wird: Trotz flehentlicher Bitten ihrer Mutter wird das Mädchen nach dem Willen ihres Vaters mit nur fünf Jahren der vetrauten Umgebung entrissen und illegal über die syrischen Berge in den Libanon geschmuggelt, um dort für die Familie Geld zu verdienen. Und von da an beginnt ihre abenteuerliche, aber zugleich auch sehr schmerzhafte Reise durchs Leben, die sie vom Südosten der Türkei in den Libanon, nach Deutschland und wieder zurück in die Türkei führt. In dieser fesselnden Geschichte erzählt ihr Sohn Yosef nicht nur die Geschichte seiner Mutter, sondern versucht auch, eine Brücke zu schlagen zwischen der östlichen und westlichen Welt, in der vor allem immer wieder Offenheit, Respekt und Toleranz gefordert wird. Gharibe ist die wahre Geschichte einer starken Frau, die sich trotz aller Herausforderungen treu bleibt und für das kämpft, was ihr am wichtigsten ist: ihre Kinder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine geliebte Mutter
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich weiß, dass viele Menschen meiner Kultur und Religion die vorliegenden Geschichten, die ich innerhalb meiner weitläufigen Familie gesammelt und niedergeschrieben habe, absurd und peinlich finden. Angeblich würde ich damit Schande über meine Kultur bringen. Doch das sehe ich anders.
Das, was ich schreibe, ist nicht ausgedacht. Diese schweren Schicksale sind das Leid echter Menschen, die leider nicht den Mut in ihren Leben hatten, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich bin kein Magier und auch kein Held aus einem Actionfilm. Ich habe keine mentale Zauberkraft, mit der ich auf wundersame Weise das Denken und Verhalten anderer Menschen ändern kann. Doch das ist auch nicht meine Absicht. Genauso wie es nicht meine Absicht ist, andere Menschen, Kulturen und Religionen zu kritisieren oder auf irgendeine Weise anzugreifen. Vielmehr verfolge ich mit meinem Schreiben eine ganz andere Absicht: Vor Jahren war auch ich einer der Menschen, die unter dieser orientalischen Kultur viel gelitten haben. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich zu meinem eigenen Lebensweg durchgekämpft hatte, und ich glaube fest daran, dass sich vieles verändern kann, wenn man lernt, über das Leid zu sprechen. So möchte ich mit meinen Geschichten ein Sprachrohr für all diejenigen sein, die nicht den Mut oder die Möglichkeit haben, für sich selbst einzustehen. In meinem letzten Buch wollte ich für die Kinder meiner Kultur sprechen und habe versucht, den Vorhang zwischen der deutschen Welt und meiner Kultur etwas zu öffnen, um meinen Lesern zu zeigen, weshalb das Verhalten der Kinder meiner Kultur anders ist als das der deutschen. Nachdem ich darauf viel positives Feedback aus Deutschland bekommen habe, möchte ich euch, liebe Leserinnen und Leser, nun noch etwas mehr in die Schatten meiner Kultur einladen.
So habe ich diese Geschichte geschrieben, die von verschiedenen Frauen meiner Kultur handelt.
Bereits als kleines Kind erzählte mir meine Mama immer wieder Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit − wie sie schon als fünf Jahre altes Mädchen zur Arbeit geschickt wurde, nicht zur Schule gehen durfte und im Krieg für das Leben ihrer Kinder kämpfte. Es kamen Themen auf wie Frauenrechte, Ehre, Mord und Blutrache. So etwas versteht man natürlich als Kind noch nicht ganz. Erst im Laufe der Zeit, das heißt heute, als erwachsener Mann, wurde mir vieles zum Thema Frauen und Frauenrechte bewusster. Und es tut mir innerlich weh, wenn ich mit Frauen meiner weitläufigen Familie, meiner Kultur zusammensitze und höre, was sie als junge Mädchen und auch noch als erwachsene Frauen erleben mussten. Heute, im Alter von 60 oder 70 Jahren, sitzen sie oft da, klagen über ihr Leben und sind verzweifelt. Oft ist ihnen nicht einmal bewusst, dass ihnen kaum noch jemand zuhört …
Ich möchte diesen Frauen Raum geben und sie sprechen lassen; sie sollen ihr ganzes Leid klagen dürfen und den Menschen zeigen, warum sie das sind, was sie heute sind.
Diese Geschichte ist nicht nur ein Geschenk für meine Mama, die die Hauptfigur dieses Buches ist, sondern auch ein Geschenk für alle anderen Frauen meiner Kultur. Ich möchte ihnen allen meinen tiefen Respekt und meine Dankbarkeit aussprechen. Ihr Frauen seid etwas Besonderes, etwas so Wertvolles, unabhängig davon, was immer wieder über euch gesagt und gedacht wird. Bleibt stark und seid glücklich, egal, was alles in der Vergangenheit geschehen ist. Wenn Gott euch die Kraft gegeben hat, bis heute an unserer Seite zu bleiben, dann hat das seine Gründe. Daran glaube ich ganz fest. Und genauso glaube ich an Gottes Gnade und Gerechtigkeit und weiß, dass auch ihr euren Frieden und euer Glück finden werdet.
Dir, Mama, möchte ich persönlich für alles Danke sagen. Nicht nur dafür, dass du mir mein ganzes Leben wie eine große Säule zur Seite standest, an der ich mich anlehnen konnte, wenn mir die Kraft zum Leben gefehlt hat. Danke für all die Stärke, die du im Außen und im Innen gezeigt hast, und danke dafür, dass du jeden deiner Wege gegangen bist, um deine Kinder zu schützen. Und aus tiefstem Herzen danke ich dir, Gott, dass du mir meine Mama als Mutter gegeben hast.
Kapitel 1
Meryem
Wie alles begann.
Mardin, 1963.
„Meryem, steh auf.“
Ich wälzte mich auf die andere Seite und spürte die harte, kalte Fläche unter mir. Mein Körper fühlte sich nicht wohl, Rücken und Nackenschmerzen quälten mich. Das lag vermutlich daran, dass ich kein Kissen hatte und nur auf einer sehr dünnen Decke lag, die im Wohnbereich auf den trockenen Sandboden gelegt war. Gerade als ich meine halb geöffneten und verschlafenen Augen wieder schließen wollte, wurde ich abermals ungeduldig wachgerüttelt.
„Aufstehen, habe ich gesagt! Du bist viel zu spät dran!“
Es war meine Mutter, die mich aus dem Tiefschlaf riss. Sie setzte mich auf und ging dann zu dem Ort im Zimmer, den wir Küche nannten. Dort wühlte sie in irgendwelchen Fässern herum. Ich sage das bewusst so, weil es eigentlich keine Küche war, sondern nur eine abgelegene Ecke in unserem kleinen Haus, wo wir aus Schlamm einige Regale geformt hatten.
Müde drehte ich mich zur gegenüberliegenden Seite des Zimmers und sah, dass meine anderen zehn Geschwister immer noch schliefen. Drei meiner älteren Schwestern starben schon als Kinder. Die anderen fünf nicht Anwesenden kenne ich noch nicht einmal oder kann mich zumindest an deren Gesichter nicht mehr erinnern. Sie lebten nicht mehr bei uns im Dorf. Insgesamt hat meine Mutter Aysche 19 Kinder zur Welt gebracht.
Langsam schaute ich auf meine dünnen, kurzen Beine hinunter. Mein kleines Herz nutzte diese kurze Gelegenheit und sprach leise zu mir: Bitte nicht… Ich mag das nicht machen. Warum ist das gerade meine Aufgabe, wo die Männer doch alle noch so schön in Ruhe schlafen können, bis die Hähne sie mit ihrem Krähen aufwecken. Ich möchte auch noch ein bisschen schlafen. Ich bin doch noch viel zu jung für so etwas.
Dann sah ich zu meiner Mutter auf, die im selben Moment wie ein gereizter Stier auf mich zukam. Grob nahm sie mich auf den Arm und trug mich zur Außentür. Mein Gesicht müde an ihre Schulter gelehnt, verschwanden meine immer noch schlafenden Brüdern langsam aus meinem Blickfeld.
Nachdem sie mich im Flur abgesetzt hatte, öffnete meine Mutter die Haustür. Draußen war es noch stockdunkel. Der Himmel war so rein und klar, dass man jeden einzelnen Stern funkeln sehen konnte. Es war nicht kalt, doch es wehte eine frische Brise an jenem Frühlingsmorgen. Gerade als ich verschlafen einen Schritt nach draußen machen wollte, begann der Muezzin in der einzigen Moschee des Dorfes mit sanfter Stimme zum Morgengebet aufzurufen. Da zwischen uns und den umliegenden Dörfern nichts anderes als karge Landschaft war, konnte man in der Stille dieses Morgens die Rufe der anderen Muezzins ziemlich gut mithören. Und trotzdem jeder einzelne von ihnen seinen eigenen Ruf in diesen Morgen schickte, klang es doch so, als ob der Gebetsruf aus einem Mund kommen würde. Es war also etwa fünf Uhr morgens. Oh nein, diese Zahl fünf … Sie erinnert mich immer an diese Zeit, denn fünf, das war auch mein damaliges Alter. Ein Alter, an das ich mich bis heute nicht gerne erinnere. Ich schaute noch einmal verzweifelt zu meiner Mutter hoch, doch sie beachtete meinen flehenden Blick nicht, sondern schubste mich in die Dunkelheit und sagte:
„Na los, mein Kind, nun mach schon. Du bist sehr spät dran.“
Wie jeden Morgen starrte ich den sandigen und steinigen Weg an, den ich gleich beschreiten würde. Obwohl dieser Weg tagsüber wie aus einem besonders schönen und fantasievollen Märchen zu kommen schien − er war von beiden Seiten mit hohen Bäumen und dichten Büschen bewachsen, zwischen denen im Frühjahr bunte Wildblumen wuchsen − machte er mir im Dunkeln doch große Angst. Da wirkte er auf mich eher wie eine finstere Höhle.
Ich hasste es, diesen Weg, der zu unseren Feldern führte, entlangzugehen. Immer wieder sah ich diese bunten Djinns, die ihre Feste feierten und mich zu sich riefen. Ein grausamer Anblick, den ich nie vergessen werde. Wenn ich ihre Einladungen nicht erwiderte, verfolgten sie mich bis zum Waldrand, bevor sie dann wieder hinter den Bäumen verschwanden, um nicht gesehen zu werden. Niemals mischten sich diese Bestien unter das menschliche Volk. Sie lebten ganz unter sich in der Wildnis. Vor einigen dieser Teufel sollten wir uns immer besonders in Acht nehmen, denn im Islam wird gesagt, dass manche dieser Kreaturen Menschen entführen, töten und auffressen.
Die schlimmsten von ihnen sollen aber die Ifrits der Meere sein. Oft wurden uns Geschichten von Menschen erzählt, die im Wasser – sei es am Seeufer oder im Meer − spurlos verschwanden und nichts von ihnen jemals wieder gefunden wurde. Dann hieß es, dass sich diese Teufel wieder ihr Opfer geholt hätten. Das Bild dieser Feiern verfolgte mich, bis ich meine Augen zum Schlafen schloss. Ich wurde von Albträumen und Schlafstörungen gequält. Manchmal, da nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und erzählte meiner Mutter, dass ich jeden Morgen davor Angst habe, diesen Weg alleine in der Dunkelheit entlangzugehen. Doch sie hatte niemals Mitleid mit mir. Das Wort Mitleid existierte bei uns noch nicht einmal. Ich hatte keine Wahl. Jeden Morgen aufs Neue musste ich mich meinen Ängsten stellen. Es war ein Befehl der Älteren, ein Befehl der Männer, also hatte ich kein Recht, dem zu widersprechen. Oft wenn ich zögerte oder von meinen Ängsten sprach, bekam ich sogar Ärger von meiner Mama. Grob schob sie mich dann hinaus in die Dunkelheit und sagte nur:
„Stell dich nicht so an! Du musst ein starkes Mädchen sein, Meryem!“
Für mich ist dies ein herzloser Vorwurf. Denn kein Mädchen der Welt kann mit fünf Jahren diese Art von Stärke zeigen. Somit nahm ich das Stück Brot und die fünf Rosinen, die mir meine Mutter wie jeden Morgen in ein kleines Tuch einwickelte und in die Hand drückte. Unauffällig starrte ich auf den Boden, bekam feuchte Augen und trottete los. Nach wenigen Schritten drehte ich mich wieder um, um nach meiner Mutter zu sehen. Manchmal keimte in mir die Hoffnung auf, dass sie doch Mitleid mit mir haben und statt mir einen meiner älteren Brüder schicken würde.
Jemand Stärkeren, der sich gegen diese Djinns wehren könnte. Außerdem glaubte ich jeden Morgen, dass dies vielleicht der letzte Moment wäre, der letzte Augenblick, wo ich meine Mutter noch sehen würde, bevor die Djinns mich dieses Mal entführen und mich töten oder zu ihrem Volk nehmen würden. Mama aber hatte schon längst die Tür hinter sich zugeknallt, um mit den Hausarbeiten zu beginnen. Das war das endgültige Zeichen, dass es auch dieses Mal kein Entrinnen gab.
Djinn, zu Deutsch Dschin oder Teufel, ist im Islam ein Geschöpf aus Feuer.
Ifrit, zu Deutsch Afreet, ist im Islam eine schlimme und gefährliche Art dieser Teufel. Dieser Dämon soll Menschen vom Guten ins Schlechte leiten. Laut Islam sind einige der Afreets Fleischfresser und ernähren sich nur von Menschen
Kapitel 2
Aysche
Meine Familie, mein ganzer Stolz
Für uns Frauen im Dorf war es die größte Aufgabe unseres Lebens, eine gute Hausfrau zu sein, unseren Mann wie einen König zu ehren und ihm zu dienen. Wir durften niemals Schande über ihn bringen – das heißt zum Beispiel, ihm in der Öffentlichkeit zu widersprechen, das Haus nicht in Ordnung zu halten, ihn hungrig zu lassen oder, auch wenn uns keine Schuld trifft, ihm kein Kind zu schenken. Bereits als ganz junge Mädchen bekamen wir diese Denkweise als die einzig mögliche eingetrichtert und wurden zur perfekten Hausfrau ausgebildet. Natürlich hatten wir nicht viel Zeit für diese Ausbildung, denn die meisten von uns heirateten bereits im Alter zwischen elf und 14 Jahren. Da kam spielen oder Kind sein für uns natürlich nicht infrage. Keines der Mädchen hatte Angst vor der Ehe oder vor der bevorstehenden Hochzeitsnacht. Es war uns eine große Ehre, die Dienerin unseres Mannes zu werden. Das war uns über Jahre wie ein einziges großes Mantra fortwährend erzählt worden. Es war unsere Daseinsberechtigung. Unser ganzes Leben war dem gewidmet. Naja, um genauer zu sein, für die Mädchen, die noch Jungfrau waren. Denn für mich änderte sich alles, als ich meine älteste Tochter Layla zur Welt brachte. Da vergaß ich nicht nur meinen Mann, sondern die ganze Welt um mich herum. Dieses Gefühl nach der Entbindung, wenn das Baby noch so verschrumpelt und voller Schleim ist, wenn es schreit und sich erst dann beruhigt, wenn es auf der Brust der Mutter liegt … Das kann man mit keinem Gefühl der Welt vergleichen. Das kann man auch nicht in Worte fassen. Das kann nur eine Mutter fühlen. Natürlich habe ich meine anderen 18 Kinder, die ich nacheinander zur Welt brachte, jedes Jahr eins, auch sehr geliebt. Und der Schmerz, ein Kind zu verlieren, gehört zu den größten Verlusten einer Mutter. Drei meiner Töchter starben schon als Babys. Schwäche zeigen oder deshalb traurig sein durfte ich jedoch nie. Für so etwas hatte ich weder Zeit, noch durfte ich vor meinen Kindern so auftreten. Ich musste ein Vorbild für sie sein und Stärke zeigen. Wer hätte denn sonst während meiner Trauer den Haushalt machen sollen? Wer hätte sonst das Essen gekocht oder sich um die Felder und Tiere gekümmert? Das waren selbstverständlich allein meine Aufgaben; erst als meine Kinder älter wurden und mir Teil für Teil abnehmen konnten, wurde es etwas leichter.
Ich glaube, dass ich stolz auf mich sein kann und dass ich all meine Kinder gut großgezogen habe. Jedes von ihnen hat sein eigenes Talent: Hamdi zum Beispiel kann gut mit Tieren umgehen und ist der geborene Hirte. Mohammed kennt sich mit Pflanzen gut aus und hat sich mit der Zeit um das Schneiden aller Weinreben im Dorf gekümmert. Yakup ist sehr ehrgeizig und wollte unbedingt lesen und schreiben lernen. Meine älteste Tochter Layla ist die perfekte Hausfrau. Und dann habe ich noch Meryem. Meine kleine Meryem … Sie ist anders als all meine anderen Kinder gewesen. Viele sagten damals, sie sei frech oder benehme sich wie ein Mann. Für mich aber strahlte sie nur Selbstbewusstsein und Stärke aus. Sie konnte einfach alles: putzen, Wäsche waschen, kochen … Ja sogar mit Tieren konnte sie gut umgehen und Feuer machen. Ich wusste schon immer, dass ich mich auf sie verlassen und ein ruhiges Gewissen haben konnte, wenn es um ihre Aufgaben ging − selbst nachdem sie unser Haus verlassen hatte und nicht mehr bei uns lebte. Sie würde nie Schande über mich oder ihren Ehemann bringen. Sie war hübsch wie eine Prinzessin, hatte ein Herz wie ein Ritter und die Stärke eines Drachens. Denn sie … sie war einfach anders als die anderen kleinen Mädchen im Dorf. Meryem beschwerte sich auch nie über ihre Aufgaben. Und selbst wenn sie es getan hätte, so hätte es doch kein Entrinnen gegeben. Ich weiß, dass sie den Mut gehabt hätte, aufzubegehren und sich zu beschweren. Doch sie tat es nie. Mir zuliebe tat sie es nicht, das weiß ich ganz genau. Sie ist ein gutes Kind gewesen. Eine gute Hausfrau.
Kapitel 3
Meryem
Meine Aufgabe
Damit ihr euch ein ganz genaues Bild machen könnt, warum wir Frauen aus der orientalischen Kultur anders sind oder anders denken als ihr Europäerinnen, möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Zeitreise − zurück in das Jahr 1963, mein fünftes Lebensjahr. Meine Geschichte beginnt im Dorf Emnaysel, das auf Türkisch Kayatepe genannt wird. Ein kleines karges Dorf, dessen wenige Bewohner arabische Türken sind und das sich im Bundesland Mardin befindet. Dort bin ich geboren und dort habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht.
Mit zitternden Beinen betrat ich den dunklen Wald, der auf die Berge zu unserem Karm führte. Meine Aufgabe war es, den ganzen Tag diesen riesigen Karm von etwa 2000 Quadratmetern zu bewachen.
Das war wohl notwendig, damit auch wirklich niemand die extrem großen und gesunden Weinblätter, mit denen wir Sarma machten, beschädigen oder unsere sauren Weintrauben pflücken würde, aus denen wir Serke und Deps herstellten. Das alles war Teil unserer Nahrung, die wir für kalte Wintertage zubereiteten und einlegten. Und es war auch Teil unserer Einkünfte, indem wir diese Lebensmittel weiterverkauften. Ich fand es merkwürdig, dass eine so große Aufgabe einem noch so jungen Mädchen wie mir zugetraut wurde. Mit meinen fünf Jahren hatte ich ja selbst Angst vor meinem eigenen Schatten. Gegen einen Dieb könnte ein Mädchen in diesem Alter nichts unternehmen. Selbst für eine erwachsene Frau wäre es schwierig, sich gegen einen oder mehrere Diebe zu wehren. Heute frage ich mich, ob die Eltern der Mädchen, die für solche Aufgaben ausgewählt worden waren, nie Angst hatten, dass ihre Töchter abends vielleicht nicht mehr zurückkommen würden.
Doch ich glaube, den Männern aus unserem Dorf war so etwas völlig egal. Ich kann mich nämlich noch gut an die hübsche Tochter unserer Nachbarn erinnern, die einmal fast vier Tage lang nicht mehr aufgetaucht ist. In unserem Dorf ging sofort das Gerücht um, sie sei von den Djinns entführt und zerfleischt worden. Die Djins sollen so hungrig und gierig nach ihrer Schönheit gewesen sein, dass sie selbst ihre Knochen verzehrt und nichts von ihr übrig gelassen hatten. Andere wiederum sagten, sie sei von Bewohnern eines umliegenden Dorfes entführt und mit einem körperbehinderten Mann zwangsverheiratet worden. Doch in unserem Dorf wurde viel Unsinn erzählt. Das waren alles nur Vermutungen und jeder gab seinen eigenen Senf dazu. Eines Morgens kam nämlich ein Hirte aus dem Nachbardorf mit ihr auf seinem Pferd angeritten und sagte, dass er sie in den Bergen gefunden hätte. Sie hatte sich in der Dunkelheit verirrt und nicht wieder nach Hause gefunden. Um nicht zu verhungern, hatte sie wilde Pflanzen und Kräuter gegessen, ohne zu wissen, ob diese giftig sind, und aus Pfützen getrunken, um nicht zu verdursten. Ja, und den Männern war es wohl egal, was mit uns Mädchen in der Wildnis geschieht, denn als wäre niemals etwas gewesen, schickte sie ihr Vater am nächsten Morgen wieder zu den Feldern... Doch kommen wir zur eigentlichen Geschichte zurück: Ich hatte also keine Wahl, ich musste meine Aufgabe erledigen und wie jeden Tag den Karm bewachen.
Draußen war es noch so dunkel, dass ich nicht mal meine Hand vor den Augen sehen konnte. Den Weg aber kannte ich mit der Zeit schon auswendig. Zwar stolperte ich ab und an über einen mittelgroßen Stein oder stieß gegen ein Gebüsch, in dem ein Tier ruhte, das dann hektisch davonlief und ich vor Schreck auf den Po fiel, aber im Großen und Ganzen kam ich immer gut voran. Ich weiß nicht, was das für Tiere oder Wesen waren, die ich aus dem Schlaf schreckte: giftige Schlangen, Füchse, Ratten − oder schon wieder einer dieser Djins, die mich einfach nicht in Ruhe lassen wollten. An ein Ereignis kann ich mich noch besonders gut erinnern: Ich stieß in der Finsternis gegen einen Stein im Wald und fiel hin. Zuerst war mir gar nicht bewusst, in welcher Gefahr ich mich befand, während ich weinend auf dem Boden saß und meine staubigen Knie abklopfte. Erst als ich aus der Finsternis des Waldes herauskam und die Sonne langsam aufging, sah ich, wie eine Horde junger Leiurus Skorpione meinen langen Rock hochkrabbelte. Diese Art von Skorpion, auch Gelber Mittelmeerskorpion genannt, ist in der Türkei stark verbreitet und zählt zu den weltweit giftigsten. Für Kinder kann ein Stich tödlich sein.
Unser Karm lag auf einen hohen Hügel in den Bergen. Die etwa zwei Kilometer lange Strecke durch den Wald legte ich immer barfuß zurück. Schuhe oder Latschen besaß damals kaum jemand bei uns im Dorf.
Auf dem Weinberg hatten die Männer aus altem Holz und trockenem Gras einen kleinen Unterstand zum Schutz vor der Sonne gebaut, und das war auch gut so. Denn bei uns in Mardin ist es im Sommer extrem heiß. Der Sand unter diesem kleinen Zelt wurde regelmäßig gut durchgesiebt, damit alle, die an diesem Ort ruhen wollten, sich ab und an auch mal dort niederlassen konnten.Es war natürlich unbeschreiblich langweilig, den ganzen Tag über dort rumzusitzen und nichts zu tun. Außerdem war es meiner Meinung nach nicht nötig, diesen Bereich tagsüber ständig zu bewachen, denn abends und nachts war auch niemand da, um darauf aufzupassen. Noch nicht einmal einen Wachhund hatten wir für die Nächte. Oft lag ich einfach nur auf dem Sand und betrachtete die vor meinem Blickfeld vorbeiziehenden Wolken, die immer wieder eine andere Form annahmen und mich so in eine Traumwelt versinken ließen. Oft ähnelten diese Wolken irgendeinem Tier oder einem wunderschönen Kleid. Bei uns trug niemals jemand geschwungene Kleider, so etwas kannten wir gar nicht. Doch in der Fantasie des kleinen Mädchens gab es einen Platz für so etwas. Ich träumte nicht nur davon, wie ich aussehen würde, wenn ich ein solches Prinzessinnen-Kleid anhätte oder wie es wäre, auf dieser einen Wolke zu reiten, die einem weißen Einhorn ähnelte. Nein, manchmal stellte ich mir auch vor, wie es wohl wäre, da oben zu sein, und wie es sich anfühlen würde, dieses flauschige Weiße zu berühren und darauf zu schlafen. Ob ich dann beim Aufwachen wohl immer noch diese starken Rücken- und Nackenschmerzen haben würde?, fragte ich mich. Wenn mir nicht nach träumen zumute war, pflückte ich mir Wildblumen auf der Wiese und machte daraus einen kleinen Kranz oder Blumensträuße. Und wenn dann noch einige Blumen übrig blieben, schmückte ich mein kleines Zelt mit den bunten Blüten, denn für meine Bedürfnisse war dieses kahle Holzgestell viel zu rau und es passte nicht zu meiner Prinzessinnen-Fantasie mit dem weißen Kleid und dem schönen Einhorn aus Wolken. Zwar hielten die Blüten in der prallen Sonne nicht sehr lange, aber während dieser kurzen Zeit schenkten sie mir trotzdem enorm viel Freude.
Wurde mir die Zeit gar zu lang, wanderte ich immer wieder um dem Karm herum, bis es etwa fünf oder sechs Uhr war. Dann durfte ich wieder nach Hause. Eine Uhr hatte ich zwar nicht, doch mit der Zeit konnte ich am Stand der Sonne ungefähr einschätzen, wie spät es war. Eine Fähigkeit, die damals jeder von uns besaß.
Das bisschen Essen, das meine Mama mir für die vielen Stunden da draußen immer einpackte, reichte mir nie. Wenn ich sehr viel Hunger hatte, so, dass ich es gar nicht mehr aushielt, habe ich auf den gesiebten Sand gepinkelt und den Matsch gegessen, der daraus entstand. Nie habe ich mich getraut, einige von den Weintrauben oder den saftigen Blättern zu essen, denn ich hatte Angst, dass meine Familie mich dafür bestrafen würde, falls mal jemand zur Kontrolle vorbeikäme und bemerken würde, dass ich mir etwas davon genommen hatte. Wasser jedoch hatte ich mehr als genug, denn meine Eltern hatten auf dem Weinberg einen kleinen Brunnen graben lassen. Obwohl Weinreben nicht sehr viel Wasser brauchen, muss man sie doch hin und wieder gießen. Besonders junge Bäume müssen gut gepflegt werden, damit sie die extreme Hitze überleben. Ein Sieb für den Brunnen gab es nicht. Somit schmeckte das Wasser nicht nur etwas sandig, sondern es waren auch immer wieder kleine Würmer drin. Mit der Zeit allerdings gewöhnte ich mich an diesen seltsamen Geschmack. Etwas anderes blieb mir auch gar nicht übrig: Ich hatte ja schließlich nur diesen einen alten verfaulten Holzeimer, mit dem ich das Wasser aus dem Brunnen ziehen konnte.
Die Blätter der Weinreben wurden immer im Frühjahr geerntet, da sie zu dieser Zeit noch sehr frisch und weich waren. So konnte man sie am besten mit Reis und Hackfleisch zusammenrollen. Für den warmen Sommer und den eiskalten Winter, der ab November anfing und unser Dorf meterhoch mit seiner Schneedecke einhüllte, haben wir die Blätter immer in Glasbehälter eingelegt, damit wir diese Delikatesse das ganze Jahr über genießen konnten. Auch bei der Weintraubenernte mussten wir auf den besten Reifegrad achten, damit die Serke und Deps auch wirklich gut wurden – schließlich verkauften meine älteren Brüder oft das, was wir davon übrig hatten, in der Hauptstadt Savur an wohlhabendere Menschen, die keine Zeit hatten, diese Köstlichkeiten selbst herzustellen.
*
Da geschah es! Wild um ihr Feuer tanzend, feierten sie Hochzeit.
„Na los, du hübsches Mädchen, nimm doch auch Teil an unsere Freude!“
„Ist das nicht die kleine Meryem?“
„Tatsächlich! Meryem ist wieder da! Komm her, mein Kind. Komm zu uns!“
Immer wieder riefen diese Djinns mit ihren unheimlichen Stimmen nach mir, wenn sie ihre Feste feierten. Sie wussten sogar, wie ich hieß.
Im Islam steht, dass die Djinns jeweils gegen Sonnenuntergang aus ihren Verstecken kommen und sich besonders gerne in Wäldern und Wassergebieten aufhalten. Deshalb wurde uns in den Islamstunden immer gelehrt, dass wir nach dem Abendgebetsruf im Haus bleiben und sämtliche Türen und Fenster schließen sollten. Nach einer Stunde etwa dürften wir wieder alles öffnen, da sich diese wilden Kreaturen bis dahin etwas beruhigt hätten. Ein besonders scharfes Auge hätten die Ifrits auf kleine Kinder. Zum Schutz vor diesen Dämonen haben die Älteren im Haus um diese Zeit immer Ayatul Kursi aus dem Koran gelesen. Denn die Rezitation des Korans, insbesondere die Rezitation dieses Verses, hören diese Kreaturen gar nicht gerne. Da ich noch sehr klein war, konnte ich noch nicht viel auswendig lernen. So stand ich diesen Kreaturen schutzlos gegenüber.
Ich hielt mir die Ohren zu und rannte durch den halb dunklen Wald nach Hause. Oft holten mich die Djinns ein, stellten sich vor mich oder stießen mich an. Dann rannte ich panisch durch einige von ihnen durch und schrie laut nach meiner Mutter. Ich schaffte es jedes Mal bis an den Waldrand. Dort brach ich dann zusammen, fiel auf die Knie und rang nach Luft.
Es fühlte sich an, als würde mein Herz stehen bleiben. Um sicher zu sein, dass sie mich wirklich in Ruhe ließen, blickte ich ihnen jeweils noch mal nach und sah, wie sie zwischen den dicken Stämmen der Bäume, zwischen Büschen und riesigen Felsen verschwanden. Ich verstand nie, weshalb sie sich nicht unter die Menschen trauten. Jeden Tag hoffte ich, das alles sei nur ein böser Traum gewesen. Doch wenn ich mich dann nachts wieder auf meine dünne Decke auf den kalten Sandboden legte, wusste ich, dass das alles Wirklichkeit gewesen war. Und ich wusste auch, dass ich am nächsten Tag das alles wieder durchleben musste.
Ayatul Kursi
Mardin ist ein Bundesland im Südosten der Türkei. Hauptsächlich leben dort arabische und kurdische Türken. Die arabischen Menschen, die in diesem Gebiet leben, sind Auswanderer aus dem Jemen.
Karm (arabisch): Weinberg.
Sarma (türkisch): Gefüllte Weinblätter.
Serke (arabisch): Essig.
Deps (arabisch): Melasse.
Ayatul Kursi, zu Deutsch Thronvers, ist der 255. Vers aus der zweiten Sure des Korans, der Al Baqara Sure. Dieser Vers wird als Schutz vor dem Teufel, vor böser Magie und dem bösen Blick rezitiert. Außerdem wird er oft auf Amulette gedruckt, die die Muslime um den Hals tragen, um sich auch so vor dem Bösen zu schützen.
Kapitel 4
Meryem
Unser Dorf Emnaysel
Unser Dorf war ein sehr kleiner Ort mitten in den Bergen. Jede Großfamilie aus diesem Dorf hatte ihren eigenen trockenen Hügel, auf dem sie ihre Siedlung errichtet hatte. Insgesamt waren das vielleicht 40 Häuser im ganzen Dorf. Einige dieser Bewohner hatten ihre Ställe und Scheunen gleich neben dem Haus. Die etwas Reicheren im Dorf, und dazu gehörte auch meine Familie, kauften sich Grundstücke, die sich etwas weiter weg vom Haus befanden, und bauten sich dort ihren kleinen Bauernhof auf. Das war auch besser so, denn so stank es um unser Haus herum niemals nach Mist, wie ich es bei den anderen Hügeln miterlebt habe. Wenn ich mich richtig erinnere, befanden sich auf unserem Hügel damals sechs Häuser. Emnayesel liegt in einer öden Landschaft. Außer den vielen steinigen Sandhügeln und etwas Büschen gab es kaum Abwechslung. Einzig an Wasserstellen und Waldgebieten, wie am Karm, gab es sehr viel Grün zu bewundern. Doch trotz dieser kahlen Landschaft kam mir dieses Dorf damals wie ein Märchenland vor. Vielleicht habe ich das als Kind aber auch nur so empfunden, weil ich nichts anderes zu sehen bekam. Noch nicht einmal in die nächste Stadt durfte ich mit. Und so etwas wie Fernsehen oder Zeitung gab es bei uns genauso wenig wie Strom, Wasserleitungen oder Kanalisation. Für viele Menschen heute scheint ein solches Leben kaum möglich oder noch nicht einmal vorstellbar zu sein, aber gerade diesen einfachen Lebensstil vermisse ich so sehr. Ich glaube, dass die Menschen in solchen Gebieten glücklicher lebten als wir heutzutage in unseren modernen Siedlungen. Sie bekamen von dem Leid dieser Welt nichts mit und waren den ganzen Tag nur damit beschäftigt, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, sich um die Tiere, die Pflanzen und die Ernte zu kümmern.
Unser Dorf gehörte zu der arabischen Provinz Mardin, deren Ursprung laut einiger Überlieferungen im Irak liegt. Im Volk selbst allerdings heißt es, und auch viele islamische Gelehrte sind dieser Meinung, dass vor vielen Hundert Jahren Menschen aus dem Jemen eingewandert sind und diese Gegend besiedelt haben. Heute sind wir als arabische Kurden anerkannt. So sprachen wir auch fast ausschließlich Arabisch, einige wenige auch Kurdisch. Türkisch wurde damals bei uns nie gesprochen. Diese Sprache beherrschten im Dorf fast nur die älteren Männer, deren Kenntnisse jedoch völlig unzureichend gewesen sind, da sie Türkisch so gut wie nie benutzten. Wenn überhaupt, dann nur, wenn jemand sehr krank war und unsere Heilkräuter keine Wirkung mehr zeigten, sodass der oder die Kranke in das nächstliegende Krankenhaus gebracht werden musste. Wir sind so sehr arabisch aufgewachsen, dass wir als Kinder noch nicht einmal wussten, dass wir auf türkischem Boden lebten.
Zwar stammt vieles von dem Arabisch, das wir in Mardin sprachen, aus der Fusha, dennoch ist unser Dialekt, im Gegensatz zu den anderen, sehr blumigen arabischen Dialekten, etwas grob und wir benutzen Ausdrücke, die es in der arabischen Literatur eigentlich gar nicht gibt.
Manchmal durfte ich mit meinen Cousinen vor der Haustür spielen. Dabei durfte uns aber auf keinen Fall einer der Jungs nahekommen – oder umgekehrt. Das hätte großen Ärger gegeben. Bei uns hätte bereits das Berühren eines fremden Jungen die Ehre und die Scham der Frau besudelt. Als Fremder zählt im Islam jede Person, mit der man in den islamischen Ehebund treten kann, und dazu gehört auch der Cousin. Damit die Ehre der jungen Mädchen auf jeden Fall gewahrt blieb, durften wir nie zu den anderen Hügeln mitgehen. Noch nicht mal mit den
Erwachsenen. Wirklich begründet wurde das nie. Es hieß immer nur, dass wir Mädchen die Ehre bewahren und Scham haben müssen. So kam es, dass ich niemals ein fremdes Haus von innen zu sehen bekam. Und gerade deshalb war unser Haus in meinen Augen ein richtiger Palast. Ich möchte es euch gerne erklären: Die Häuser in unserem Dorf waren keine stabil gebauten Häuser, wie wir sie heutzutage kennen. Für die Mauern wurden einfach nur Steine aufeinandergestapelt. Damit die Steine zusammenhielten und nicht abrutschten, wurde eine Mischung aus Wasser, Erde und Kuhmist zwischen sie gefüllt. Diese Mischung trocknete sehr schnell in der heißen südlichen Sonne und hielt das Haus für einige Zeit stabil. Die obere Hälfte der Fenster wurde immer bogenförmig aus Steinen gebaut, und die Scheiben wieder mit dieser für uns so praktischen Mischung befestigt. Ärmere Familien brachten einfach nur eine durchsichtige Plastikfolie mit Nägeln als Fenster an. Die Häuser waren immer in einem sehr schönen Rotton gehalten, der mich an den Sonnenuntergang erinnerte − das war die Naturfarbe der Steine in unserem Land. Obwohl wir zu den Reichsten im Dorf gehörten, hatte unser schönes Haus nur zwei kleine Zimmer. Man trat durch eine Holztür ein und befand sich dann gleich im Flur und im Wohnbereich. Dieser Wohnbereich war gleichzeitig die Küche und diente mir und meinen Geschwistern nachts als Schlafbereich. Das zweite Zimmer auf der rechten Seite war das Schlafzimmer meiner Eltern. Dort wurden auch tagsüber unsere Decken, auf denen wir alle schliefen und die morgens sorgfältig zusammengefaltet wurden, aufeinandergestapelt und hinter einem Vorhang aufbewahrt. Unser Wohnbereich musste nämlich immer sehr ordentlich aussehen – falls mal überraschend Besuch vorbeikommen sollte. Und das kam bei uns ziemlich oft vor, denn Telefone gab es nicht. Das einzige, das auch nur für Notfälle benutzt werden durfte, war etwa 500 Meter vom Dorf entfernt und gehörte zur Gendarmerie. Diesen Weg durfte eine Frau niemals alleine gehen, da sämtliche Eltern große Angst hatten, jemand aus einem anderen Dorf könnte das Mädchen entführen und heimlich zwangsverheiraten. Noch mehr Angst hatten sie vor der Hochzeitsnacht. Denn für eine Frau, die keine Jungfrau mehr war, hätte es kein Zurück in ihr Elternhaus mehr gegeben. Das hätte gleichzeitig die Scheidung der Ehe bedeutet. Und in den Augen der Menschen aus Mardin war und ist eine geschiedene Frau eine billige Hure. Diese Tradition wird leider auch heute noch gelebt. Der Einzige, der eine solche Frau dann noch heiraten würde, wäre ein Mann, dessen Frau verstorben ist oder ein sehr alter Mann, der sonst nie eine Frau bekommen würde. In einem solchen Fall hätte es für das Elternhaus der Frau keine Rolle gespielt, wie alt der Mann ist oder wie viele Kinder er hat. Es wäre der einzige Weg gewesen – und ist es auch heute noch oft −, die beschmutzte Ehre von Vater und Tochter wiederherzustellen.
Doch zurück zu unserer orientalischen Gastkultur, die ich nach wie vor sehr liebe. Bei uns sind Gäste zu jeder Tages- und Nachtzeit auch unangemeldet stets willkommen − sie könnten theoretisch auch um Mitternacht an die Tür klopfen. In dringenden Fällen dürften sie auch übernachten. Ob Platzmangel herrscht oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es war und ist bis heute noch ein Muss für die Menschen aus Mardin, die Gäste wie einen König oder eine Königin zu behandeln. Die Menschen im Südosten der Türkei sind bekannt für ihre Gastfreundlichkeit. Noch bis heute achten sie so sehr darauf, dass sie selbst einem fremden Reisenden Unterkunft anbieten würden. Die größte Aufregung bei uns im Dorf herrschte immer dann, wenn die Agas sich an Bayram Tagen trafen und mit den erwachsenen Familienangehörigen Dorf für Dorf besuchten. Das Treffen fand stets in den Häusern der jeweiligen Ağas statt.
Einen Tag vor Bayram gab uns ein junger Mann aus einem der anderen Dörfer Bescheid, dass sie kommen würden. Diese Ankündigung diente dazu, dass auch wirklich ein großes Festmahl für die Oberhäupter der Nebendörfer vorbereitet werden konnte. Es durfte nichts schieflaufen während dieser bedeutsamen Tage, denn das hätte die Ehre der Gastgeber sehr beschmutzt. Somit wurde das Festmahl von meiner Mutter schon einen Tag vorher bis spät in die Nacht hinein vorbereitet. Das Haus hingegen wurde erst am nächsten Tag aufgeräumt, damit es auch wirklich sauber blieb.
Während dieser Tage unterhielten sich die Männer miteinander und versuchten, große Konflikte zu lösen – es war damals üblich, Konflikte grundsätzlich untereinander zu klären. In unserer Kultur wurde es als etwas Abscheuliches angesehen, als große Erniedrigung, die bis zum Tod auf einem lastet, einen Bekannten oder Verwandten anzuzeigen oder auch Konflikte nach außen zu tragen. Die Frauen wiederum nutzten die Gelegenheit, ebenfalls zusammenzukommen, und zwar mit der Ausrede, gemeinsam für die Sauberkeit und Ordnung in Haus und Umgebung zu sorgen und das Essen vorzubereiten. Diese Tage waren für uns Kinder immer die schönsten im Jahr. Zwar bekamen wir, wie es heute der Brauch ist, zu Bayram keine Süßigkeiten, dafür hatten wir aber mit all diesen Menschen, manchmal waren bis zu 50 Personen da, immer sehr viel Spaß. Oft wurden alte Geschichten und Witze erzählt, selten auch mal über andere gelästert. Aber selbst dabei hatten die Menschen ihren Spaß. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine verstorbene Mutter bei der Sauberkeitsprobe immer ganz oben auf der Rangliste unter den Menschen stand und deshalb als eine sehr ehrenvolle Frau großes Ansehen genoss. Diese Proben galten den Menschen als Erkennungszeichen, dass hier eine richtige Set el-beyt am Werk gewesen ist – das heißt eine richtige Hausfrau, die gut auf ihre Familie und ihre Ehre achtete. Und wenn diese perfekte Hausfrau auch noch eine nicht an einen ihren Cousins verlobte oder versprochene Tochter hatte, wurde gleich in den kommenden Tagen um deren Hand angehalten. Doch lasst mich von unserem Palast weitererzählen: Bilder oder andere Dekorationen gab es natürlich nicht. Die Küche war keine richtige Küche, sie bestand vielmehr aus einigen Regalen, die aus Matsch an die Wand geformt worden waren. Dort lagerten wir die Tonfässer, in denen wir unsere Nahrungsmittel aufbewahrten – wie die selbst angebauten Linsen, die eingelegten Weinblätter und den Weizen. Wie schon erwähnt, bestand der Boden aus Sand, die Wände aus Stein. Auf dem hölzernen Flachdach war auch Sand, sodass wir uns im Frühling und im Sommer dort bequem aufhalten konnten. Das Dach erreichten wir über eine lange, stabile Holztreppe, die an der Außenwand entlangführte. Wie viele andere Menschen im Dorf auch, hatten wir Wein am Haus angebaut, den wir über ein Holzgerüst auf das Dach hochwachsen ließen. So schützte uns sein Schatten an warmen Tagen vor der Sonne und zugleich konnten die Weintrauben gut wachsen und gedeihen.
Gekocht haben wir immer vor dem Haus. Dazu legten wir drei mittelgroße, viereckige Steine kreisförmig zueinander und zündeten in der Mitte ein Feuer an. Auf die Steine legten wir dann einen riesigen Tischt zum Kochen oder ein Saj zum Brotbacken. Wenn wir Fleisch zubereiten wollten, so wie wir es heutzutage im Ofen machen, gaben wir es in einen Tonbehälter, den wir daraufhin mit einem Deckel schlossen. Dann wurde dieser Behälter so lange auf das Feuer gestellt, bis das Fleisch gar war. Wann dieser Zeitpunkt genau gekommen war, wusste nur Mama.
Dann wurde der Tontopf vom Feuer genommen, zerschlagen und das fertige Fleisch zum jeweiligen Gericht serviert. Dies war eine besondere Delikatesse für uns alle und auch ein kleines Festmahl. Denn geschlachtet haben wir nur zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel zu Hochzeiten, Bayram, Beschneidungen oder wenn ein Junge zur Welt gekommen war. Gewürze, wie wir sie heutzutage verwenden, gab es bei uns nicht. Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie wir damals alles ohne Salz essen konnten.
Um an frisches Wasser zu kommen, haben wir mithilfe unserer Tiere in der Nähe unserer Siedlung einen Brunnen gegraben. So konnten wir mit einem Eimer am Seil unsere Wasservorräte holen, die wir anschließend in Tonfässern aufbewahrten. Becher gab es nicht, wir tranken alle aus ein und derselben Tonschale. Um das Wasser von Dreck und kleinen Steinen etwas zu säubern, spannten wir ein dünnes Tuch über die Fässer, bevor wir das Wasser dort hineinschüttelten. Der Geschmack wurde dadurch zwar nicht besser, aber wenigstens hatte man keine kleinen Tiere im Mund. Wasser und Milch war das Einzige, was wir zu trinken hatten – oder, um es deutlicher zu sagen: Wir wussten überhaupt nicht, dass es andere Getränke auf der Welt gab.
Unsere Toilette befand sich im Stall, wo wir Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner und ein Pferd oder einen Esel hatten, die uns beim Bewirtschaften unserer Felder halfen. Diese Toilette war aus vier viereckigen mittelgroßen Steinen gebaut, auf die wir uns draufhockten und unser Geschäft verrichteten. Wir hatten immer einen kleinen Wasserbehälter zum Waschen dabei, denn Toilettenpapier oder Ähnliches gab es nicht. Also kippten wir Wasser auf unsere Blöße und machten uns mit der freien Hand sauber. Unsere Mutter reinigte die Toilette jeden Tag mit einer Schaufel. Der Kot wurde etwas weiter weg vom Haus hinter Büschen vergraben. Warum gerade meine Mutter diese dreckige Arbeit machen musste, verstand ich nie. Die Ställe waren genauso gebaut wie unsere Häuser, aus Steinen, die mit dieser Mischung aus Lehm, Wasser und Kuhmist zusammengehalten wurden. Nur dass hier auch die reicheren Familien die Fenster nicht aus Glas hatten, sondern alle eine durchsichtige Folie befestigten, um die Tiere im Winter vor der Kälte zu schützen. Schlachteten wir einmal eine Ziege oder ein Schaf, so wurde deren Fell nie weggeworfen. Wir fertigten daraus schöne Teppiche oder dicke Decken für den Winter, denn da gab es Tage, an denen der Schnee bis zu drei Metern hoch lag. Um das Haus zu heizen, hatten wir im Wohnbereich einen kleinen Ofen. Dort kochten wir auch während der kalten Wintertage. Damals gab es keine Kohle bei uns im Dorf, wir heizten das Haus nur mit dem Holz, das wir im Frühling und Sommer im Wald gesammelt hatten. Im Winter wäre das nicht möglich gewesen.
Kleidung und Geschirr wurde immer am Brunnen und ohne Spül- oder Waschmittel gereinigt. So etwas gab es nicht. Nur in Ausnahmefällen, wenn es zum Beispiel etwas sehr Fettes zu essen gegeben hatte, benutzten wir etwas Seife. Unser Haus wurde nur mit einer kleinen Kerze erhellt. Das war das einzige Licht, das wir hatten. Und das war wirklich nicht einfach, denn wir alle waren auf diese kleine Flamme angewiesen. Auf die Toilette gingen wir deshalb nachts nur im äußersten Notfall. Wenn es in der kleinen Bude zu eng wurde, setzten sich die Männer um ein kleines Feuer vor der Tür und klärten ihre Männerangelegenheiten − das heißt, sie diskutierten über eine hübsche Frau aus dem Nachbardorf oder über eine noch nicht vergebene Cousine.
Gegessen haben wir immer ganz traditionell auf dem Boden, an warmen Tagen auf dem Dach, ansonsten bei uns im Wohnbereich. Dazu legten wir ein großes Tuch auf den Boden, um unseren Sand dort sauber zu halten, und dann setzten wir uns alle drum herum. Das Essen wurde auf einem großen Teller herumgereicht und jeder hat mit den nur wenigen Löffeln abwechselnd davon gegessen. Waren Gäste zum Essen da, haben Frauen und Männer getrennt gegessen. Erst waren die Männer dran, dann die Frauen. Diese Tradition wird bei uns in der Kultur bis heute hochgehalten, sogar bei den arabischen Großfamilien, die in europäischen Ländern leben.
Wollten wir duschen, so wurde einer der großen Tischt mit Wasser gefüllt. Dann stellten wir Kinder uns in einer Reihe auf und wurden nacheinander von unserer Mutter sorgfältig geschrubbt. Handtücher hatten wir nicht, weshalb wir uns nach unserem Bad oder unserer Dusche an warmen Tagen einfach in die Sonne stellten und im Winter abwechselnd neben den Heizofen, um trocken zu werden. Im ganzen Dorf gab es eine einzige Schule, die nur wenige Meter von unserem Haus entfernt war. Sie war allerdings immer geschlossen. Keiner, aber auch wirklich keiner durfte diese Schule jemals betreten. Wie sehr wir Kinder uns auch noch danach sehnten − es war verboten. Noch nicht einmal zum Anschauen durften wir hin. Außerdem gab es in der ganzen Gegend nicht einmal einen Lehrer. Das war auch der Grund, weshalb niemals jemand von uns das Lesen oder Schreiben gelernt hat. Heute frage ich mich, ob der Staat überhaupt wusste, dass es unser Dorf gibt. Vielleicht hatten sie einmal von uns gehört, doch es war ihnen egal, was aus solchen Dorfmenschen wie uns wird. Oder sie kamen in unser Dorf, bauten die Schule und wurden dann von den Bewohnern verjagt. Ich habe niemals verstanden, warum die Erwachsenen so gegen unsere Bildung waren oder warum sie nicht wollten, dass wir uns das Gebäude auch nur ansahen. An manchen Tagen jedoch, da trieb mich meine Neugier dazu, ein ganz ungezogenes Kind zu sein, und ich schlich mich ganz unauffällig zur Schule, um sehnsüchtig durch die kaputten Fenster zu schauen und die völlig verstaubten Stühle und Tische zu bewundern. Es hing keine Tafel an der Wand und an einen Lehrertisch kann ich mich auch nicht erinnern. Das Gebäude roch unbeschreiblich schlimm. Vermutlich hatten einige Menschen, vielleicht Reisende oder Hirten, dort drin ihre Geschäfte verrichtet. Und trotzdem zog mich dieses alte kaputte und stinkende Gebäude immer wieder an und war für mich wie ein Traum auf einer Wolke. Ich weiß noch, wie ich mich einmal stundenlang dort aufhielt − bis meiner Familie meine Abwesenheit auffiel und sie jemand losschickte, um nach mir zu suchen. Und an jenem Tag war es nicht anders.
„Meryem!“, schrie eine sehr tiefe Stimme nach mir.
Jäh aus meinen Träumen herausgerissen, drehte ich mich um. Es war mein älterer Bruder Murat, der zornig auf mich zugerannt kam. Schnell machte ich mich vor diesem Stier in Richtung Berge aus dem Staub und verkroch mich in einer Ritze zwischen einigen großen Felsen, wo mein großer Bruder niemals durchpassen würde. Ich hörte, wie er eine Weile wie ein schnüffelnder Hund nach mir suchte, nach einiger Zeit aber erfolglos aufgab.