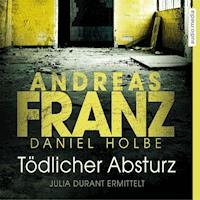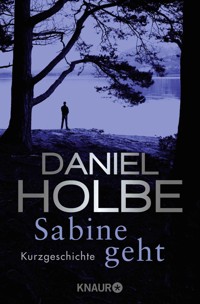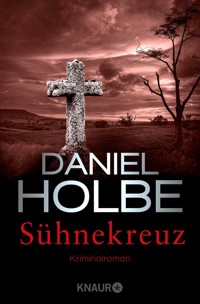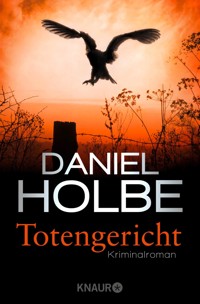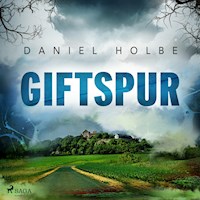
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ulf Reitmeyer, Leiter eines großen Biobetriebes in der Wetterau, bricht auf offener Straße zusammen. Zunächst deutet alles auf plötzlichen Herzstillstand hin. Doch dann taucht eine zweite Leiche auf – ausgerechnet ein Mitarbeiter Reitmeyers. Höchste Zeit, Rechtsmedizin und Kripo einzuschalten. Kommissarin Sabine Kaufmann, die sich erst vor kurzem vom Frankfurter K11 in die hessische Provinz versetzen ließ, übernimmt den mehr als merkwürdigen Fall. Und wird nicht nur mit einem perfiden Täter, sondern auch mit dem feindseligen Kollegen Angersbach konfrontiert. Sabine Kaufmann ermittelte zuvor für Julia Durant, die Kultkommissarin des verstorbenen Bestsellerautors Andreas Franz.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Holbe
Giftspur
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ulf Reitmeyer, Leiter eines großen Biobetriebes, bricht auf offener Straße zusammen. Plötzlicher Herzstillstand? Doch bei dem Opfer handelte es sich um einen kerngesunden und sportlichen Mann! Als ein zweites Todesopfer auftaucht, das ausgerechnet Mitarbeiter in Reitmeyers Betrieb war, läuten bei der Polizei alle Alarmglocken …
… und Sabine Kaufmann muss eingreifen, die das Frankfurter Kommissariat vor kurzem verlassen hat. Ihr erster Fall in der »Provinz« konfrontiert sie nicht nur mit ihrem gewöhnungsbedürftigen Kollegen Ralph Angersbach, sondern auch mit einem Täter, der auf perfide Weise mordet …
Julia Durant war die Kultkommissarin des verstorbenen Andreas Franz - und die frühere Chefin von Sabine Kaufmann.
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Montag, 18. Februar 2013
Zwei Wochen später
Sonntag, 3. März
Montag, 4. März
Dienstag, 5. März
Mittwoch, 6. März
Donnerstag, 7. März
Freitag, 8. März
Samstag, 9. März
Montag, 11. März
Epilog
Danksagung
Ich gebe auch zu, daß Gift Gift sei;
daß es aber darum verworfen werden solle,
das darf nicht sein.
Das ist allein Gift,
das dem Menschen zu Argem ersprießt,
das ihm nicht dienstlich, sondern schädlich ist.
Theophrast von Hohenheim, 1538
Prolog
Sabine Kaufmann hielt das Steuer fest umklammert.
Ihre Fingernägel pressten sich in den schwarzen Überzug. War es Leder, war es Latex? Was auch immer, es schien in diesem Augenblick die einzige Option zu sein. Kein rettender Strohhalm, denn diese Umschreibung wurde dem Szenario nicht im mindesten gerecht. Vielmehr war es für sie wie die letzte Faser eines aufgedröselten Kletterseils, von den scharfen Kanten des zerschlissenen Felsgesteins durchgescheuert, unter ihr der bodenlose Schlund, der sie bei der nächsten unbedachten Bewegung verschlingen würde.
Jede Muskelkontraktion konnte ihre letzte sein.
Sabine zwang ihren Blick nach oben. Blauer Himmel, weit über ihrem Kopf ruhten vereinzelte Kumuluswolken, jene zarten Schönwetterwolken, die es in den vergangenen Monaten viel zu selten gegeben hatte. Die Sonne strahlte warm, im Grunde war alles perfekt. Ein glückliches Zusammentreffen von angenehmer Witterung und einem freien Vormittag.
Was also zum Teufel mache ich hier?
Sie steuerte geradewegs auf Gedern zu, am nördlichen Zipfel der Wetterau gelegen und geographisch betrachtet längst dem Vogelsberg zugehörig. Kaum, dass man die flache, von Feldern und verinselten Waldstücken beherrschte Region verließ und sich von der flach gelegenen Mainmetropole entfernte, erhoben sich die unzähligen Kuppen und Höhenzüge eines beachtlichen Vulkanmassivs. Inaktiv, selbstverständlich, und das bereits seit sieben Millionen Jahren. Von lokalpatriotischen Gelehrten wurde er verbissen als Europas größter Schildvulkan verteidigt, an den umliegenden Hochschulen jedoch lehrte man das Gegenteil. Der Vogelsberg war der überwiegenden Meinung nach das größte Basaltmassiv Europas, also immer noch ein Superlativ, allerdings nicht mehr als eine Ansammlung einzelner Vulkanschlote. Wie auch immer, sein höchster Gipfel, der Hoherodskopf, lockte Sommer- wie Wintersportler gleichermaßen. Darunter auch Sabine Kaufmann. Langlauf, Rodeln, Walken – wann immer das monotone Grau des ewig dauernden Winters sie zu erdrücken drohte, flüchtete die sportbewusste Zweiunddreißigjährige sich hierhin. Der Große Feldberg im Taunus lag zwar deutlich näher, war allerdings meist überlaufen, und das auch noch von einer unerträglich selbstverliebten Schickeria der Reichen und Schönen und jener, die sich in verzerrter Selbstwahrnehmung für das eine oder andere hielten.
Muskelkontraktion.
Schweiß glänzte auf Sabines Handrücken, ihre Stirn war längst von salzigen Perlen bedeckt, und sie dankte Gott, dass niemand sie sehen konnte. Zumindest nicht von vorn.
»Alles okay?«
»Natürlich«, presste sie hervor.
Unter der Baumwolle ihres grauen Sportpullovers begann es zu jucken, und zwar unter den beiden hochgezogenen Bünden der Ärmel, die sich kurz unterhalb der Ellbogen eng über die sanft gebräunte Haut spannten.
Bloß nicht zucken.
»Gleich sind wir da, sehen Sie da vorn?«
Ich bin ja nicht blind.
Der tiefe Klang der voluminösen, von einer beneidenswerten Ruhe geprägten Stimme schien den gesamten Innenraum einzunehmen. Dabei hatte der Mann kaum eine Ähnlichkeit mit Rebroff oder Pavarotti, von einer gewissen Fülle des Bauches einmal abgesehen. Stattdessen wirkte sein Oberkörper, als habe die Natur ihn versehentlich mit zwei oder drei zusätzlichen Rippenbögen ausgestattet. Sabine schätzte, dass er über ein beachtliches Lungenvolumen verfügte, ein überdimensionaler Resonanzraum wie bei einem mannshohen Subwoofer.
Statt der üblichen Serpentinen und schmaler Nebenstraßen, die sich zwischen Viehgattern und eng stehenden Douglasien hindurchschnitten, breitete sich nun eine lange Gerade vor ihnen aus. Keine Steigung, keine Kurven, keine Abzweigung. Alles schien perfekt bereitet. Doch die Kommissarin konnte sich nicht entspannen.
Ihr Blick huschte hinab auf den Tachometer, verharrte für eine Sekunde auf dem Lüftungsregler, dann schnell wieder nach vorn.
Café au Lait, ein Croissant mit Nutella und ein bis zwei Stunden Wiederholungsprogramm im Fernsehen. Das Leben könnte so einfach sein.
»Jetzt haben wir’s gleich«, dröhnte es von hinten, und ein plötzlicher Ruck des Lenkers ließ der Kommissarin das Blut in den Adern gefrieren.
Wie von Geisterhand fuhr der grasgrüne Horizont vor ihren Augen nach oben, und in ihrem Magen wurde es flau. Bald war nur noch eine grüngolden schillernde Fläche zu sehen, immer näher kommend, und aus dem fernen Nirwana hörte Sabine noch die Frage, ob sie Hilfe brauche.
Einige Sekunden später setzte der Doppelsitzer auf der Landebahn auf.
Für den Fluglehrer, der seit Wochen auf eine schneefreie Wiese und entsprechende Thermik gehofft hatte, ging eine vielversprechende Schnupper-Flugstunde zu Ende. Er hatte die interessierte Städterin ohne allzu große Eingriffe manövrieren lassen, und sie hatte sich dabei auch nicht dumm angestellt. Für Sabine Kaufmann jedoch zählten nur die letzten Minuten. Das Thema Segelfliegen, eine fixe Idee, mit der sie seit geraumer Zeit schwanger gegangen war, war für sie an diesem Vormittag gestorben.
Vermutlich endgültig. So wie der Tod es nun einmal an sich hat.
Stunden später, als Sabine nach einem ausgiebigen Marsch durch die kalte, klare Luft mit puterroten Wangen in ihren alten Ford Focus sank, verspürte sie ein Brummen in der Magengegend. Hunger, diagnostizierte sie zunächst, doch da war noch etwas anderes. Tief im Inneren ihrer Jack-Wolfskin-Jacke meldete sich die Zivilisation.
Fünfhundert Höhenmeter weiter unten, siebzig Kilometer entfernt.
Die Kommissarin verspürte keinen Groll. Ihr Bewegungssoll hatte sie erfüllt, und jeder Weg, der sie auf sicheren Boden zurückführte, war ihr recht.
Trotzdem ist mein freier Tag.
Sabine Kaufmann blickte auf eine vergleichsweise lange Karriere im Polizeidienst zurück, denn sie hatte seit ihrer Jugendzeit nie etwas anderes werden wollen als Polizistin. Nach dem Abitur folgten die üblichen Instanzen der Ausbildung, irgendwann war sie beim berüchtigten Sittendezernat gelandet und hatte das Frankfurter Rotlichtmilieu besser kennengelernt, als sie es je wollte. Ein immerwährendes Hamsterrad, zuerst kam die Gewalt, in der Regel gegen Frauen, die sich nicht zu wehren vermochten. Dann die Angst. Vor einer Aussage, vor der Abschiebung – die Hintermänner wussten, wie sie ihre Schäfchen lammfromm hielten. Und dann neue Gewalt, um sicherzustellen, dass die Gefügigkeit blieb. Ab und an gelang es einem Mädchen, sich daraus zu befreien, auszubrechen, doch das war die große Ausnahme. Nennenswerte Verurteilungen erfolgten trotzdem nicht, denn am Ende erklärte sich doch kaum eine Frau zu einer Aussage bereit. Wenn, dann erwischte es ohnehin nur Handlanger, denn die Zuhälter verbargen sich gekonnt und blieben somit unantastbar. Gepaart mit dem nötigen Schmiergeld eine bombensichere Angelegenheit, denn es war kein Geheimnis, dass der Main nur ein Fluss sekundärer Bedeutung war. Dollar und Euro bildeten das Elixier, welches die Stadt pulsieren ließ. Sabine Kaufmann verband mit jener Zeit nicht viele positive Erinnerungen, ihre gewachsene Menschenkenntnis und Erfahrungswerte wollte sie allerdings nicht missen.
Sobald sich eine Gelegenheit bot, wechselte sie zur Mordkommission, wo sie sich die vergangenen fünf Jahre verdingt hatte. Etwas anderes als das Polizeipräsidium Frankfurt hatte sie noch nicht kennengelernt, Hessens modernstes und größtes Präsidium, und es war ihr nicht leichtgefallen, die Mainmetropole zu verlassen. Doch es gab einen Menschen, der sie zurzeit mehr brauchte: Hedwig Kaufmann, ihre Mutter. Hedi litt unter einer Persönlichkeitsstörung, deren Zyklen in den vergangenen Jahren kürzer und vor allem tiefgreifender geworden waren. Zudem war sie geschwächt von jahrelanger Trunksucht. Es bedurfte keiner intensiven, aber einer regelmäßigen Begleitung, und sonst gab es niemanden, der das hätte übernehmen können. Sabine Kaufmann hatte die Gelegenheit beim Schopf gepackt, als eine Stelle in Bad Vilbel ausgeschrieben wurde, der Stadt, in der sie aufgewachsen war und wo ihre Mutter noch immer lebte. Sie hatte eine Wohnung auf dem Heilsberg gefunden, die größer und heller war als ihre Frankfurter Bude und von deren Balkon sie hinüber auf die Skyline blicken konnte. Im Großen und Ganzen also stand nicht alles zum Schlechten, wenn man es genau betrachtete.
Das Handy.
Sabine las die SMS, welche ihr verriet, dass sich der verpasste Anrufer mit einer Sprachnachricht auf der Mailbox verewigt hatte. Sie tippte den Touchscreen kurz an, die Verbindung wurde aufgebaut und gleich wieder unterbrochen. Stirnrunzelnd musste sie feststellen, dass der Empfang gen null ging.
Laut diversen Bemerkungen, die man im geologischen Informationszentrum aufschnappen konnte, übte der Vogelsberg, dessen Basalt mit einem hohen Eisengehalt angereichert war, eine gewisse Magie auf die Dinge aus.
Verwechselte da jemand Geologie und Theologie?
Magnetischer Berg blockiert Netzempfang?
Nach Sabines Einschätzung lag es eher daran, dass sie seit Stunden keinen Funkmast mehr wahrgenommen hatte – ein weißes, rundes Funkfeuer für Verkehrsmaschinen, welches das bärbeißige Volumenwunder ihr von oben gezeigt hatte, einmal außer Acht gelassen.
Die Nachricht stammte von einem ihrer neuen Kollegen, der sie mit einer Wahrscheinlichkeit von neunzig Prozent von neuen Entwicklungen im sogenannten Ballermann-Fall in Kenntnis setzen wollte. Mit Mallorca, derzeit unvorstellbare sechzehn Grad warm und mit einer beneidenswerten Sonnenscheindauer, hatte der Fall leider nichts gemein. Vielmehr rührte der Name daher, dass vorgestern, in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Innenstadt Bad Vilbels Schüsse gefallen waren. Es gab unzählige Zeugenaussagen, doch diese waren von Vorurteilen und inhaltlichen Diskrepanzen derart zersetzt, dass sie zu keiner brauchbaren Täterbeschreibung führten.
Je tiefer man bohrte und je länger man fragte, desto mehr kristallisierte sich heraus, dass es sich um zwei bis vier Jugendliche gehandelt hatte. Im Zweifelsfall waren es immer Jugendliche, die für störenden Lärm verantwortlich waren. Dunkelhaarig, versteht sich, mit südosteuropäischem Akzent. Auch eine schwarze Pistole wollte jemand zweifelsfrei erkannt haben. Oder eine Schrotflinte. Oder eine Kalaschnikow. Man musste nur lange genug fragen.
Trotz der räumlichen Nähe zu Frankfurt wies Bad Vilbel eine eher überschaubare Kriminalitätsrate auf. Innerhalb des Wetteraukreises lag sie dennoch relativ weit oben, und die Aufklärungsquote ließ Wünsche offen, das Kreuz, wenn man so nahe an der statistisch betrachtet kriminellsten Stadt Deutschlands lag. Es gab vergleichsweise wenige Gewaltdelikte, aber wenn es zu einem besonders unschönen Szenario kam, durchflutete eine Welle der Empörung die Stadt. Der letzte Mord hatte sich nur wenige Gehminuten von Sabines Wohnung in der Heilsbergsiedlung zugetragen. Ein zurückgezogen lebender Mann, seit vielen Jahren geschieden, Frührentner mit neunundfünfzig Jahren. Seine Eltern waren 1946 aus dem Sudetenland vertrieben worden und gemeinsam mit etlichen anderen auf der südlichen Anhöhe Bad Vilbels sesshaft geworden. Diese alte Generation starb nun nach und nach aus. Enkel hatte der Mann keine, und lediglich eine Putzfrau kam dreimal die Woche, um Wäsche zu waschen und die Wohnung zu putzen. Ironie des Schicksals, denn sie stammte aus Tschechien, aber das war zwischen den beiden nie Thema gewesen. Der Mann interessierte sich weder für seine Herkunft noch für Politik, noch ging er aus.
Es war ebenjene Putzfrau, die ihn schließlich aufgefunden hatte, letzten Donnerstag, am unteren Ende seiner Kellertreppe. Sie hatte sich noch gewundert über die ausgekühlte Wohnung, was daran lag, dass die Terrassentür sperrangelweit offen stand. Vermutlich hatte sie deshalb auch nicht den verräterischen Leichengeruch wahrgenommen, denn durch die ebenfalls geöffnete Flurtür hatte die gesamte Wohnung arktische Temperaturen angenommen. Verzweifelt hielten die alten Rippenheizkörper dagegen, und der Brenner lief auf Hochtouren. Eine Klimakatastrophe im Kleinen. Die Putzfrau war mit dem Wäschekorb vor der Brust hinabgestiegen und wäre beinahe über den ausgestreckten Fuß ihres Arbeitgebers gestolpert. Ein spitzer Schrei, die herabfallende Wäsche begrub den halben Körper unter sich, dann schwanden ihr die Sinne. Für die Spurensicherung war es eine Katastrophe, denn die Frau hatte ihrem ureigenen Trieb nachgegeben und das Haus in Ordnung gebracht, bis jemand eintraf. Umso leichter war es für die Rechtsmedizin. Schlag auf den Kopf, diverse Frakturen vom Sturz treppabwärts inklusive ausgeschlagener Schneidezähne und zu guter Letzt Genickbruch. In dieser Reihenfolge.
Wegen des prämortalen Schlages auf die Schädeldecke musste man von einem Tötungsdelikt ausgehen, ausgeführt durch einen mutmaßlich hölzernen Gegenstand, vermutlich ein Baseballschläger. Die Befragten zeigten sich zunächst bestürzt angesichts dieser kaltblütigen Gewalt. Doch sie ertrugen es mit Fassung. Man lebte nun einmal in Frankfurts düsterem Schatten.
Jener bösen Stadt, deren Übel viel zu oft über den Hügel schwappte.
Montag, 18. Februar 2013
Sabine Kaufmann betrat das Büro pünktlich um acht, wie sie es gewohnt war. Das Wochenende war viel zu schnell vergangen. Nach ihrem Ausflug in den Vogelsberg, dem ursprünglich ein abendlicher Bummel mit ihrer Mutter Hedwig hatte folgen sollen, war Sabine neunmal von ihrem Handy gestört worden. Es gab zwar kaum Neuigkeiten über die suspekte Schießerei, und auch der Mord in ihrer Nachbarschaft erwies sich als eine von Sackgassen geprägte Ermittlung; doch sie war nun mal die einzige Ansprechpartnerin vor Ort beim neu ins Leben gerufenen K10, wie sich das hiesige Morddezernat nannte.
Zwei Wochen noch.
Dann sollte der neue Kollege aufschlagen, ein Ermittler aus Gießen, von dem die Kommissarin bis dato kaum etwas wusste. Doch für solche gedanklichen Ausflüge hatte sie ohnehin keine Zeit. Sabine hatte ihren Dienst am ersten Januar begonnen, und es war ihr weder bei ihrer kurzen Stippvisite zwischen den Jahren noch an ihrem ersten Dienst-Tag, einem Mittwoch, entgangen, dass man sie in der Polizeistation höchst argwöhnisch beäugte.
Die Neue, die Großstadttussi, dieser blonde Hüpfer mit den Allmachtsphantasien.
Zugegeben, niemand sagte etwas, aber Sabine Kaufmann wäre eine schlechte Kriminalbeamtin, wenn sie nicht die typischen Gesichtsausdrücke decodieren könnte. Schiefes Grinsen, plötzliches, betretenes Schweigen, Tuscheln – sie hatte dieses Machoverhalten bereits bei der Sitte kennengelernt. Immun dagegen war sie allerdings nicht.
Konrad Möbs, der Dienststellenleiter, der seinem Ruf nach so etwas wie der Fels in der Brandung sein musste, leitete die Bad Vilbeler Polizeiwache seit über zwanzig Jahren. Anstatt viele Worte zu machen, hatte er den anwesenden Kollegen Sabine kurz vorgestellt und sie im Anschluss ein wenig hilflos im Raum stehen lassen. Später hatte er sie noch einmal aufgesucht und ihr zu verstehen gegeben, dass, wenn sie etwas brauche, nicht bei ihm, sondern gleich in der Kreisstadt Friedberg anfragen müsse. Für ausufernde Ermittlungsarbeiten fehlten schlicht und ergreifend die Mittel. Das Experiment K10 sei ohnehin ein fragwürdiges Unterfangen, schloss er unmissverständlich.
Bis auf einen jungen Polizeibeamten waren alle Kollegen älter, und es gab keine weitere Ermittlerin. Sabine war ausgezogen, um die Bad Vilbeler Gewaltverbrecher das Fürchten zu lehren. Doch Punkt eins der Tagesordnung war eine unsichtbare Barriere, die zwischen ihr und einer angestaubten Männerdomäne stand. Diese galt es niederzubrechen – oder abzubauen, und das sah nicht besonders vielversprechend aus für eine Frau, die schon äußerlich weitaus zarter gebaut war als sämtliche ihrer Gegner. Von ihrem Innenleben bekam zum Glück keiner etwas mit.
Sabine schaltete den PC ein und öffnete während des Hochfahrens das Fenster ihres kleinen Büros, in dem zwei Schreibtische einander gegenüberstanden, einer davon leer. Die strahlende Wintersonne hatte sich längst wieder hinter dem seit Monaten vorherrschenden Grau verborgen, und wenn man dem Wetterbericht Glauben schenkte, würde der Frühling noch sehr lange auf sich warten lassen. Irgendwie kein Wunder, nachdem der Sommer 2012 bereits so aus dem Ruder gelaufen war.
Die Klimaveränderung?
Es gibt also doch einen Zusammenhang, dachte Sabine bissig. Seit dem spektakulären Ende der Laufbahn eines berühmten Meteorologen spielte das Wetter verrückt.
Fakt war, dass der Mangel an Sonne selbst die fröhlichsten Gemüter in Depressionen zu stürzen drohte. Und Sabine zählte sich momentan gerade nicht zur Gruppe der Frohgelaunten.
Noch bevor sie die Kaffeemaschine darauf vorbereiten konnte, ihre Produktion schwarzen Goldes aufzunehmen, meldete sich das Telefon. Es war Möbs, was sie etwas irritierte, denn er saß kaum zehn Meter entfernt von ihrem Büro, und ein wenig Bewegung hätte seiner Konstitution sicherlich nicht geschadet.
»Es gibt Arbeit im Ballermann-Fall«, eröffnete er ihr.
»Hervorragend«, erwiderte sie halbernst, »und welcher Art?«
»Es gibt augenscheinlich einen Zusammenhang zwischen den Schüssen und dem Heilsberg-Mord.«
»Oha!« Sabine wurde hellhörig, und ihre Gedanken begannen zu rasen. »Ich bin ganz Ohr«, fügte sie hinzu und griff sich Stift und Papier.
»Gestern Abend ist ein junger Mann dabei gesehen worden, wie er eine Waffe in der Nidda entsorgt hat. Ein Schrebergärtner hat ihn beobachtet und bis zu seinem Auto verfolgt.« Möbs lachte kurz auf. »Da soll mal einer sagen, es gebe keine Zivilcourage mehr unter den Menschen. Aber ich erspare Ihnen die Details. Die Halterabfrage führte zu einem Treffer, eine halbe Stunde später war der Kleine dingfest.«
»Hm. Der Kleine?«
»Er ist gerade siebzehn, ein Milchbubi«, erklärte Möbs seine Wortwahl.
»Und er hat geschossen?«
»Das zumindest hat er ohne großen Widerstand zugegeben. Eine Beteiligung an der anderen Tat streitet er vehement ab.«
»Aber er war anwesend?«, hakte Sabine nach.
»Sie wissen doch, wie das läuft, mitgegangen, mitgefangen …«, seufzte Möbs. »Er hat zweifelsohne mitbekommen, was sich abgespielt hat, und später dann kalte Füße gekriegt. Mit einem Mord will er nichts zu tun haben, das hat er immer wieder beteuert. Also ist auch schon sein Anwalt aufgekreuzt. Der Kleine kommt nämlich aus gutem Hause, da weiß man offenbar, wie der Hase läuft.«
»Ich höre da ein Aber in Ihrer Stimme?«
»Nun ja, die Familie des Jungen ist hier bei uns ziemlich angesehen. Klar, dass sie seine Weste rein halten wollen«, mutmaßte Möbs und räusperte sich. »Der Bengel lieferte daraufhin bereitwillig zwei Namen, beides Typen, die bereits vorbestraft sind. Er wird gegen sie aussagen und kommt selbst ungeschoren aus der Sache. So weit der Deal.«
Sabine überlegte kurz. Der Handel wirkte übereilt, denn in dem Fahrzeug würden sich unter Garantie Fingerabdrücke finden, die zu denselben beiden Personen führten. Andererseits konnte die Spurensicherung Tage damit verbringen, aus einem Auto Spuren zu extrahieren, und weder Haare noch Hautpartikel oder Fingerabdrücke ließen sich im Nachhinein in ein enges Zeitfenster ordnen. Womöglich war der Bengel ihre einzige Chance, den Fall aufzulösen, bevor es zu weiteren Überfällen kam. Aber es schmeckte ihr nicht. »Da steckt doch noch mehr dahinter, oder?«, erkundigte sie sich missmutig.
»Es gab noch weitere Hauseinbrüche, die in das Schema passen könnten«, rechtfertigte sich Möbs. »Allerdings kam bislang niemand zu Schaden. Irgendwo in dieser Stadt könnte es also einen recht ansehnlichen Berg Diebesgut geben.«
»Quatsch, das haben die doch längst flüssiggemacht.«
»Ihr Job, das herauszufinden«, gab Möbs zurück. Er diktierte der Kommissarin zwei Namen und die zugehörige Anschrift, eine Adresse im Nordosten der Stadt.
»Im Rosengarten«, wiederholte Sabine gedankenverloren. Sie war in Bad Vilbel aufgewachsen und kannte sich aus. Was nach einem beschaulichen Blumenviertel klang, war in Wahrheit der Standort einiger heruntergekommener Hochhäuser, in denen sich größtenteils Sozialwohnungen befanden.
Und um die Ecke eine Moschee.
»Sagten Sie nicht, dass dieser Junge aus gutem Hause stammt?«
»Er schon, die wohl eher nicht«, entgegnete Möbs scharf.
»Haben diverse Zeugen nicht zu Protokoll gegeben, dass es sich um südländische Typen gehandelt haben soll?«
»Nicht ausschließlich«, verneinte Sabines Boss. »Die Aussagen widersprechen sich, sobald sie ins Detail gehen.«
»Stimmt«, erinnerte sie sich. Es war nicht weiter verwunderlich. Man brauchte nur lange genug bei den richtigen Personen nachzuhaken, und bereitwillig wurde die nächstbeste Minderheit angeprangert. Die Nähe des Rosengartens zur Moschee in der Büdinger Straße war offensichtlich nur Zufall.
»Sie fahren aber nicht allein dorthin!« Möbs’ mahnende Stimme ließ keinen Zweifel daran, dass dies nicht nur ein gutgemeinter Ratschlag war. »Diese Typen haben ein ellenlanges Register und nichts zu verlieren.«
»Darf ich mich in unserem Personalpool also nach Belieben bedienen?«, stichelte Sabine.
»Nein. Sie treffen die Kollegen der Kripo Friedberg vor Ort. Wenn Sie jetzt losfahren, dürften Sie zeitgleich eintreffen.«
Damit war das Gespräch seitens Möbs beendet, und er hängte grußlos ein.
Die feuchtkalte Witterung schien mit eisiger Hand auf die Abgase zu drücken und diese am Aufsteigen zu hindern. Die Luft schmeckte förmlich nach Kohlenmonoxid und Feinstaubpartikeln, wenngleich das wohl größtenteils Einbildung war.
Sabine atmete schwer, als sie ihren Wagen verließ, dessen Innenraum sich auf dem kurzen Weg kaum aufgeheizt hatte. Mit Engelszungen und Stoßgebeten hatte sie die alte Karre zum Starten überredet und sich anschließend gegen den Strom aus Berufspendlern durch die Stadt gekämpft. Das Ende des in die Jahre gekommenen, metallicgrünen Ford nahte mit eiligen Schritten. Zehn Tage Minimum. So lange musste er noch durchhalten, bis ihr neuer Wagen geliefert wurde, ein Renault, Sabines erster Neuwagen. In das Modell hatte sie sich schon im letzten Herbst verliebt, sie seufzte kurz und betätigte die Zentralverriegelung. Jetzt war kein Platz für Schwärmereien. Sabine suchte mit zusammengekniffenen Augen die Umgebung ab, bis sie entdeckte, wonach sie Ausschau gehalten hatte. Ein VW-Transporter, hinter dessen Scheiben sie drei Personen ausmachte, der Fahrer stand draußen und rauchte, erwartete sie in angemessener Entfernung zur verabredeten Adresse. Zwei Kollegen kannte die Kommissarin bereits vom Sehen, eine junge Frau – endlich mal eine Frau! – sah sie zum ersten Mal. Außerdem dabei war Heiko Schultz, ein korpulenter Polizeibeamter ihres Alters, dessen Laufbahn mit Sabines begonnen hatte. Vor ein paar Wochen hatten sie sich nach Jahren wiedergesehen, Erinnerungen ausgetauscht, und nun standen sie kurz davor, ihre erste gemeinsame Aktion durchzuführen.
»Möchtest du nicht nach Bad Vilbel wechseln?«, hatte Sabine Heiko noch im Januar gefragt, als sie sich eines Abends durch das Friedberger Nachtleben bewegten. Doch er hatte nur gelacht.
»Meine Frau würde mir die Hölle heißmachen, wenn ich in ein kleineres Revier wechsle.« Im Laufe des Abends berichtete der wenig attraktive, aber sympathische Mann von seinem Häuschen auf dem Land, einer hochschwangeren Frau, die ihm gegen Ostern das zweite Kind schenken würde, und das alles mit jenem kaum zu ertragenden verklärten Blick, der sie stets berührte. Familie, Kinder, ein Haus … Sabine Kaufmann hatte sich dazu gezwungen, dieses Idyll nicht mit ihren Sorgen zu belasten, und gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Auch du, mein Sohn Brutus. Wenn selbst ein Mann wie Heiko Schultz, zwar ungemein sympathisch, aber ansonsten weder ein Krösus noch ein Adonis, es zu einer Familie brachte, warum dann nicht sie?
»Wir müssen das Überraschungsmoment nutzen.« Die etwas heisere Stimme des Beamten holte Sabine abrupt in die Gegenwart zurück. Ihr Blick wanderte die Gebäudefassade hinauf. Die Wohnung lag im vierten Stock, zu hoch, um sich über den Balkon abzusetzen, und zu tief, als dass sich die Flucht in Richtung Dach lohnen würde. Doch mit einem rationalen Handeln war nicht zwangsläufig zu rechnen. Einmal in der Falle, ohne Aussicht auf Entkommen, traten die niedrigsten Überlebensinstinkte eines Menschen hervor.
Die Gruppe näherte sich dem Eingang. Anstatt wahllos zu klingeln, kam ihnen der Zufall zu Hilfe, und eine ältere Dame presste ihren Körper durch die Metalltür, in der Hand zwei Müllbeutel, aus denen es nach altem Käse stank. Sabine legte verschwörerisch ihren Finger auf die Lippen und gab der irritierten Frau zu verstehen, dass sie sich in Sicherheit bringen solle. Ihre Waffe hatte die Kommissarin noch nicht gezogen, aber die Gürtelholster ihrer Kollegen waren nicht zu übersehen. Misstrauisch brabbelnd entfernte sich die Alte in Richtung der metallenen Müllcontainer. Zwei Beamte sicherten das Treppenhaus in der dritten Etage, die Kollegin, die sich ihr als Petra vorgestellt hatte, schlich hinauf in die fünfte. Den Fahrstuhl hatte Heiko im Erdgeschoss mit einer zwischen den Türen eingeklemmten Zeitung blockiert. Ein spontaner Einfall, so simpel in der Durchführung, so verlässlich in seiner Wirkung.
»Zeugen Jehovas?«, raunte er nun in Sabines Richtung, die ihn daraufhin verwirrt anblickte. Sie näherten sich der fraglichen Haustür, hinter der gedämpfte Stimmen zu hören waren. Vermutlich der Fernseher.
»Wie? Quatsch!« Die Kommissarin fuhr herum und schüttelte entgeistert den Kopf, bis sie Schultz grinsen sah. Für gewöhnlich tarnte man sich als Hausverwaltung, Stromableser oder ähnliche Personen, denen auch schwere Jungs unbedarft die Türe öffneten, und sei es nur, um sie abzuwimmeln.
»Dann Stadtwerke«, schlug er vor.
»Meinetwegen. Ich klingele …«
»Von wegen! Als würde eine Blondine wie du bei den Stadtwerken arbeiten.«
»Mir machen zwei spätpubertäre Jungs aber eher auf«, konterte Sabine, doch Heiko hatte längst die Tür erreicht und bohrte seinen speckigen Zeigefinger auf den Klingelknopf.
Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sich drinnen etwas rührte. Sabine vermutete, dass sie in der Wohnung auf mindestens zwei kreidebleiche, zugedröhnte Individuen stoßen würden, deren Gehirne noch viel zu träge waren, um zu verarbeiten, was sich abspielte. Doch sie täuschte sich. Nach dem zweiten Schellen näherten sich schlurfende Schritte, es schepperte, als eine Wade gegen einen Glastisch stieß, dann murrte von innen eine unverständliche Stimme. »Wnz …« Hüsteln, dann, etwas lauter: »Was?«
»Schultz, Stadtwerke Bad Vilbel. Ich soll die Thermostate prüfen.«
Sabine grinste schief. Hätte Heiko vor ihrer Tür gestanden, sie wäre prompt darauf reingefallen.
Sehr überzeugend.
»Hä?«
»Schultz von den Stadtwerken. Bitte machen Sie auf«, forderte er, diesmal mit etwas mehr Elan. Eine Türkette rasselte, dann öffnete sich ein schmaler Spalt. Dahinter zeigte sich ein unrasierter Mann in gebückter Haltung, dessen muskulöser Oberkörper aus einem Unterhemd quoll. Ungepflegte Zehennägel lugten unter der schlaff hängenden Jogginghose hervor.
Dann ging alles ganz schnell. Sabine drang mit ihrer Pistole im Anschlag in die Wohnung ein, durchforstete das im Halbdunkel liegende, nach kaltem Zigarettenrauch stinkende Innere, während im Flur Heiko Schultz den Überrumpelten über dessen Verhaftung informierte. Handschellen rasselten, doch es klang nicht nach erbitterter Gegenwehr.
»Ihr tickt ja wohl nicht richtig«, hörte Sabine, gerade als sie das Schlafzimmer betrat. Dort richtete sich erschrocken ein zweiter Mann auf, er war nur mit einer Unterhose bekleidet und wand sich aus dem zerwühlten Laken, das nicht wenige Brandlöcher aufwies und vermutlich seit Wochen nicht gewechselt worden war. Bevor er begriff, was geschah, drängte ihn Sabine auch schon in Richtung Wand. Eine Leibesvisitation konnte sie sich sparen, denn die knapp sitzende Unterhose verbarg unter Garantie keine tödliche Waffe oder sonst etwas von bedrohlicher Größe.
»Ziehen Sie sich etwas an«, stieß die Kommissarin hervor, »aber ich warne Sie! Keine Tricks, meine Mündung zielt direkt auf Ihre Hühnerbrust.«
»Einen Scheiß werd ich.« Es war mehr ein trotziges Knurren, aus dem kaum Angriffslust sprach. Sabine schaltete das Licht an, und sofort hob der Junge geblendet die Arme vors Gesicht.
»Schalten Sie die Funzel aus.«
»Werde ich nicht. Ziehen Sie sich nun an, oder sollen wir Sie halbnackt aus dem Haus schleifen?«
»Ihr könnt mir gar nichts«, wehrte er sich weiter, doch Sabine unterbrach ihn harsch.
»Sie werden beschuldigt, an einem Einbruch beteiligt gewesen zu sein, infolgedessen ein Mann starb. Heilsberg, letzten Donnerstag, klingelt da was? Ich verhafte Sie wegen des dringenden Tatverdachts, und zwar wegen Mordes.«
»Das können Sie mir nicht beweisen!«, spie der Junge aus. Er fröstelte und angelte sich eine Hose und einen Kapuzenpullover, in die er nacheinander hineinschlüpfte.
»Wir werden sehen. Rumdrehen jetzt bitte und Hände auf den Rücken.« Sabine presste sich mit voller Kraft gegen den einen Kopf größeren, schlaksigen Körper. Beißender Schweißgeruch stieg ihr in die Nase, als sie die Handschellen um seine Handgelenke schloss. »Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was Sie von nun an sagen, kann gegen Sie verwendet werden.«
Sie trat einen Schritt zurück, zuckte dann zusammen und erstarrte wie eine Salzsäule.
Ein Schuss. Verdammt. Draußen war ein Schuss gefallen!
Sabine Kaufmann packte den Mann am Schlafittchen und trieb ihn vor sich her in Richtung Ausgang. Vor ihren Augen spielte sich eine Action-Sequenz nach der anderen ab, Stirb langsam, Lethal Weapon, Departed … Bilder, wie man sie zwangsläufig kannte, wenn der Lebensgefährte auf Actionfilme und Popcornkino stand. Die meisten Szenarien endeten mit einem blutüberströmten Bösewicht, der seinen letzten Atemzug aushauchte. Doch im heutigen Drehbuch war kein Happy End vorgesehen.
Auf dem mit Flecken übersäten, zerschlissenen Teppichboden, die Schuhe noch auf dem Fußabtreter liegend, lag Heiko Schultz. Sabine schluckte. An seinem Kopf kniete Petra. Sie brauchte nichts zu erklären, Sabine zählte eins und eins zusammen. Die Wunde, die auf der Brust des massigen Körpers klaffte, stieß pulsierende Schwalle hellroten Blutes aus. Petras Hand lag darauf gepresst, vermochte aber die Kaskaden nicht zu stoppen. Nur sanft hob und senkte sich Heikos Brustkorb, die Pausen zwischen zwei Atemzügen wurden immer länger.
»Ein Messer«, wisperte Petra tonlos.
Sabine schluckte schwer, als sie sich hinabbeugte. Nur verwaschen nahm sie wahr, wie einer der Kollegen sich ihres Verhafteten annahm und Petras Stimme mit desperater Hysterie nach einem Notarzt verlangte. Aus den Augenwinkeln erkannte sie außerdem einen weiteren Körper, es handelte sich vermutlich um den Messerstecher, niedergestreckt von der Dienstwaffe eines Kollegen. Zu spät, wie eine innere Stimme grausam schrie. Aus den benachbarten Wohnungen strömten Schaulustige, das Stimmengewirr wogte auf und ebbte ab, doch all das war nur die grausame Hintergrundbegleitung des vor ihr liegenden Dramas.
Eine Routineverhaftung.
Ein toter Familienvater.
Sabine schaffte es gerade noch, den Kopf zur Seite zu werfen, bevor sie sich übergab.
Zwei Wochen später
Eisige Dunkelheit hüllte den Weidenhof ein. Nebeldunst lag über dem Kopfsteinpflaster und leckte an dem uralten Gebälk der ehemaligen Stallungen. Nahezu ungehindert durchdrang die feuchte Kälte den Bademantel des Mannes, der eilig den Innenhof überquerte. Er zog sich mit der Linken den Kragen enger, in der Rechten hielt er zwei Braunglasflaschen an deren dicken Hälsen, die bei jedem Schritt ein Scheppern verursachten. Jetzt, wo absolute Stille über dem Anwesen lag, wirkte es so laut wie der sprichwörtliche Elefant, der eine Scherbenorgie im Porzellanladen feiert. Doch niemand hörte ihn.
Nicht einmal Gunnar Volz, der auf dem Hof lebende und arbeitende Knecht, war zu sehen. Der schweigsame Hüne mit dem düsteren Blick tauchte in der Regel immer dann auf, wenn man am wenigsten mit ihm rechnete, meist sah man zuerst seine leuchtend gelben Gummistiefel, danach seinen durchdringenden, wie magisch an einem haftenden Blick. Er stand dann einfach da und glotzte, nickte allenfalls kurz und verzog keine Miene. Doch zu dieser Nachtzeit schien selbst Gunnar zu schlafen.
Ulf Reitmeyer erreichte die Stufen des Wohnhauses, in dem er auch sein Büro hatte, und kickte im Flur die Lederpantoffeln von den Füßen, an deren Sohlen nun Stroh haftete. Er drückte bedächtig die Tür ins Schloss und glitt auf Wollstrümpfen lautlos durch den Wohnbereich, hinüber in Richtung seines Zimmers, aus dem fahler Lichtschein drang. Eine Energiesparlampe tauchte den Raum in kaltes Weiß, er hatte sie längst durch eine Birne mit wärmerem Lichtspektrum ersetzen wollen. Ulf zog den kleinen Absorberkühlschrank auf, der sich unweit seines Schreibtisches in einer kubischen Schrankwand befand, und verstaute eine der beiden Flaschen dort. Die andere öffnete er, klackend schnalzte der Drehverschluss, als die einströmende Luft das Vakuum brach. Er wog das Glas in der Hand und beäugte das farbenfrohe Etikett. 500ml Bio-Kefir, eine schwarz-weiß gefleckte Kuh lachte breit, Sonnenblumen umgaben sie. Obwohl keines seiner Milchrinder auch nur jemals in die Nähe einer Sonnenblume kam, wusste Reitmeyer, dass seine Kunden mit diesem Sinnbild genau das assoziierten, was die Marketingfirma ihm versprochen hatte.
Biologisch-dynamische Glückseligkeit.
Trinkst du unseren Kefir, kommt der hundertste Geburtstag von ganz allein.
Aber abgesehen von dem ganzen Brimborium schmeckte das Zeug auch verteufelt gut. Gierig trank Reitmeyer einen großen Schluck, danach einen weiteren. Er setzte die Flasche neben seiner Tastatur ab, entsperrte den Bildschirmschoner und setzte seine Arbeit fort.
Fünf Uhr früh, dachte er zerknirscht. Die vergangenen sechs Stunden hatte er auf seiner Matratze verbracht, allein, schwitzend, und das, obwohl er bei gekipptem Fenster schlief und draußen laut Wetterbericht minus zwei Grad herrschten. Doch es gab Dinge, die hielten ihn wach, und falls die Müdigkeit ihn doch einmal übermannte, verfolgten die Dämonen ihn in seine Traumwelt. Es gab keine Möglichkeit zu fliehen, er musste sie besiegen.
Doch was konnte man schon erreichen, sonntagmorgens um fünf, wenn selbst der debile Gunnar nicht draußen herumspukte?
Reitmeyer schrieb noch zwei bitterböse E-Mails, löschte einige nicht minder freundlich klingende Aufzeichnungen auf seinem Anrufbeantworter und verschloss den ausgetrunkenen Kefir, um die Flasche anschließend in Türnähe zu deponieren. Den Rest sollte die Putzfrau erledigen, ebenso wie das Reinigen der Hauslatschen. Er legte seinen Hausmantel ab, schlüpfte in seine Laufkleidung, die er stets griffbereit hielt, und schob sich als kleine Stärkung eine Handvoll Nüsse und ein paar kandierte Ingwerwürfel in den Mund.
Die Morgendämmerung hatte noch immer nicht eingesetzt, aber das machte nichts. Leichtfüßig und mit routiniertem Bewegungsablauf begann Ulf Reitmeyer seinen Lauf. Die frostig schmeckende Luft drückte wie nadelbesetzte Kissen in seine Lungenflügel, so lange, bis das Gewebe sich an die Witterung gewöhnt hatte. Wie Eiszapfen strich der Sog durch Nasenflügel und Stirnhöhlen, doch all das war längst kein Grund, einen Mundschutz zu tragen. Reitmeyer schätzte das Puristische, er stand in bestem Training und bog grimmig lächelnd an einer Wegkreuzung in einen nicht asphaltierten Feldweg ein, der hinüber zur Nidda führte. Sofort passte sein Bewegungsapparat sich an den unebenen Untergrund an. Er kannte die Strecke in- und auswendig. Im Gegensatz zu anderen Läufern, die sich nachmittags und abends in Gruppen zusammenrotteten oder jedes Mal eine andere Route wählten, suchte Reitmeyer die Einsamkeit des angebrochenen Tages, wenn alles still und friedlich dalag.
Er trug nichts bei sich, kein Handy, kein MP3-Player, nichts, was ihn ablenken konnte. Nur er und die Natur, Zeit für Körper und Geist, in Einklang zu kommen. Und doch konnte er nicht so schnell laufen, dass er den Alltagsgedanken zu entfliehen vermochte.
Essenzielles, spirituelles und philosophisches Denken musste sich hintenanstellen und materiellen Überlegungen weichen. Die Bilanzen waren hervorragend, wie sollte es in seiner Branche auch anders sein. Personell mussten einige unschöne Entscheidungen getroffen werden, aber auch das war ihm nichts Neues. Was ihn bedrückte, war etwas anderes.
Schweiß lief ihm übers Gesicht, kullerte warm über die Wangen und tropfte, vom Hinabrinnen abgekühlt, vom bebenden Kinn in den Ausschnitt des Laufshirts. Der kurze Reiz löste ein sanftes Kribbeln an der betroffenen Stelle aus, Ulf beschleunigte weiter und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Das schweißnasse Haar wippte im Takt seiner Schritte, und er stieß einen leisen Fluch aus. Verdammt! Nicht einmal beim Laufen gelang es ihm mehr, seine Sorgen abzuschütteln.
Minuten später erreichte er den Niddaradweg, auch hier war keine Menschenseele unterwegs, und nur ein einziges Auto war in der Ferne zu hören. Es näherte sich, dann entfernte es sich wieder, ohne dass Reitmeyer es ins Blickfeld bekam.
Erneut Totenstille. Keine Vögel, keine Insekten, keine Kröten. Alles war erstarrt in dem ewig anmutenden Winterhalbjahr, dessen statistische Sonnenarmut längst Wochenthema der gelangweilten Medien geworden war. Globale Erwärmung? Die Kälte schaufelte Wasser auf die Mühlräder der Ungläubigen, für die es keinen Klimawandel gab. Äußerst kontraproduktiv. Dabei war es genau betrachtet ein völlig normaler Winter gewesen. Der fahle Schein einer Laterne warf einen kurzen Schatten unter ihn, als er den Lichtkegel unterquerte, dann verschwand er wieder. Knirschend rollten die Gelsohlen seiner Laufschuhe über den Bodenbelag, das Wasser der Nidda gluckste kaum hörbar in sanfter Bewegung, und alles in allem hätte es, trotz frostiger Kälte und trübem Morgenhimmel, ein idyllischer Märzsonntag werden können. Doch der Schatten, der sich über seinen Geist gelegt hatte, ließ sich nicht verjagen.
Etwas ist faul im Staate Dänemark.
Warum zum Teufel kam ihm dieses abgedroschene Hamlet-Zitat ständig in den Sinn?
Gab es nichts Besseres? Das Wittern der Morgenluft, zum Beispiel, auf die er sich so krampfhaft zu konzentrieren versuchte. Doch etwas war faul und schien ihm nun über den Kopf zu wachsen. Es wucherte in seinem Inneren, wie endlos verzweigte Wurzeln eines kranken Geschwürs, und konnte nur von der Person geheilt werden, die für die Fäulnis verantwortlich war.
Ihm selbst.
Kälte überlief Ulf Reitmeyer, als er seine Schritte verlangsamte, und dann durchwogte ihn in jähem Kontrast zu seinem Frösteln ein heißer, innerer Schwall. Er zuckte zusammen, tänzelte, riss seine Rechte an die feucht glänzende Kehle und glaubte dort eine geschwollene Zunge zu schmecken, die sich wie ein Pfropf in seine Luftröhre zu schieben schien. Dann sackte er in sich zusammen, spürte das taunasse Ufergras unter sich, dann schwanden ihm die Sinne.
Ein einsamer Star begann seinen schnalzenden Ruf, als würde er ein Klagelied anstimmen.
Ulf Reitmeyer war tot.
Sonntag, 3. März
Dann zieh ich eben aus, verdammt!«
Das schrille Kreischen der hysterischen Mädchenstimme schmerzte in den Ohren. Dumpfes Poltern entfernte sich, sie war eine fersenlastige Läuferin, was wohl in der Familie lag, dann krachte die schwere Holztür. Draußen wurde das Stampfen nach und nach leiser. Als es schließlich verebbt war, verkündeten unmittelbar darauf verwaschene, wie durch zugehaltene Ohren klingende Bassschläge, dass Janine ihr Zimmer erreicht hatte und sich vermutlich für die nächsten Stunden dort verschanzen würde. Oder sie packte ihre Sporttasche, um sie ihm vor die Füße zu werfen. Doch diese Möglichkeit schätzte Ralph Angersbach als eher unwahrscheinlich ein. Solche Gesten zogen nicht bei ihm, das hatte seine sechzehnjährige Halbschwester gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft schmerzlich herausfinden müssen.
Die Koexistenz der ungleichen Geschwister, deren Alter immerhin sechsundzwanzig Jahre auseinanderlag, hatte erst vor einigen Monaten begonnen. Im Herbst des vergangenen Jahres war Ralphs leibliche Mutter gestorben, eine Frau, die nie eine Rolle in seinem Leben gespielt hatte, geschweige denn die einer Mutter. Sei es aus schlechtem Gewissen oder weil er der Erstgeborene war, jedenfalls hatte sie ihm dieses alte, ziemlich heruntergekommene Haus am Ortsrand von Okarben hinterlassen, in dem sie bis zu ihrem Ableben gewohnt hatte. Und in diesem Haus, als gänzlich unerwarteten Bonus, jenen pubertierenden Teenager, aus deren Höhle die unerträgliche Musik dröhnte.
Seufzend wandte Ralph sich um und fuhr mit der Hand über die Arbeitsplatte der Einbauküche. Er machte sich keine Illusionen darüber, wer den längst überfälligen Abwasch übernehmen würde, der sich dank einer defekten Spülmaschine längst über die Grenze des Waschbeckens hinaus stapelte. In seiner anderen Hand hielt er die letzte saubere Tasse, der Kaffee darin war nur noch lauwarm, und Ralph kippte ihn kurzerhand in Richtung Ausguss. Gluckernd suchte die schwarze Flüssigkeit sich ihren Weg über Teller, Frühstücksbrettchen und Untertassen, und ein unwillkürliches Schmunzeln durchzuckte seine Mundwinkel. Fast wie ein Schokoladenbrunnen, dachte er, oder die Wasserspiele in den Hängenden Gärten der Semiramis. Er tauschte das noch lauwarme, tropfende Kaffeepad gegen ein frisches und drückte nach geduldigen Sekunden des Wartens den Knopf, der die giraffenhalsige Maschine in ein tiefes Brummen versetzte.
Apropos Garten. Ralph beugte sich ein wenig nach vorn. Die Küche befand sich im ersten Stock des Hauses, sein Blick wanderte über die drei Meter unter ihm liegende Rasenfläche, welche der Vegetation nach eher der Tundra ähnelte. Eine Amsel hüpfte frohlockend aus dem taufeuchten Gras, schüttelte sich und setzte ihren Weg auf den moosgrünen Steinplatten der Terrasse fort. Die Märzsonne stand tief, es war statistisch betrachtet viel zu kalt draußen, aber man konnte ja froh sein, wenn sie sich überhaupt einmal zeigte.
»Irgendwo musst du anfangen«, murmelte der Kommissar zu sich selbst, als er die Tasse zu seinen Lippen führte und ihm der bittere, aromatische Röstduft in die Nase stieg. Er verspürte keinen Elan, sich durch den Urwald da draußen zu quälen, denn immerhin schien sich dort seit Jahren niemand mehr engagiert zu haben.
Dann die Spülmaschine. Wenigstens ausbauen konnte er sie ja schon mal, dafür brauchte es weiß Gott keinen Kundendienstmonteur. Ein funktionstüchtiger Geschirrspüler würde wenigstens einen der Konfliktpunkte zwischen Ralph und Janine entschärfen. Bleiben noch neunundneunzig andere, schloss Ralph sarkastisch. Aber eins nach dem anderen.
Er knöpfte sein Hemd auf und hängte es über den Stuhl, kniete sich vor den Patienten und klopfte mit den Fingerknöcheln die Abschlussleiste ab. Im Grunde wusste er nichts. Nichts über Hausinstallationen, nichts von seiner Halbschwester, nicht einmal von deren Existenz hatte er ja etwas gewusst. Gab es am Ende noch ein Dutzend weiterer Kinder seiner Mutter? Eine oberflächliche Recherche im Präsidium im vergangenen Herbst hatte nichts Konkretes ergeben, aber es war dem Kommissar auch zuwider, seine abenteuerliche Familiengeschichte mit ins Büro zu tragen. Wie hieß es so schön? Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Wie aufs Stichwort meldete sich das Handy. Passanten hatten am Ufer der Nidda eine männliche Leiche entdeckt. Der Tod kennt keine freien Wochenenden, dachte Ralph, als er sich ächzend wieder aufrichtete. Er nahm einen großen Schluck aus seinem Porzellanhumpen und schob ihn neben den Geschirrberg.
»Da hast du gerade noch mal Glück gehabt«, brummte er grimmig in Richtung Spülmaschine.
Keuchend und schweißdurchnässt stand Sabine Kaufmann an einer niedrigen Betonmauer, die linke Ferse auf dem Rand aufliegend und das Bein gestreckt. Sie beugte den Oberkörper nach vorn, strebte mit den Händen in Richtung Zehenspitzen und ächzte leise, als jeder einzelne Muskel der rechten Wade ihr stechend zu verstehen gab, dass die maximale Dehnung nun erreicht war. Sie wechselte das Standbein und wiederholte die Übung. Angeblich sollte man sich weder vor noch nach dem Sport dehnen, hieß es in diversen Internetforen, aber es gab auch genügend Gegenstimmen, und sie trainierte seit Jahren nicht anders. Fünf Kilometer Laufen, drei Mal pro Woche Minimum, mit einer kurzen Pause nach der Hälfte der Strecke.
Sabines heißer Atem kondensierte zu einer dichten Wolke, verrückt, denn es war immerhin schon März, und dennoch lag an der Uferböschung der Nidda teils dichter Rauhreif. Irgendwann wollte sie das Pensum auf zehn Kilometer erhöhen, doch bis dahin galt es unter anderem, die besten Wege für ihren Frühsport zu erkunden. Sabine blickte sich um. Die heutige Laufrunde hatte am Friedhof vorbei in Richtung der Felder geführt, die ausnahmslos gelb und braun dalagen. Selbst das Grün der Wiesen wirkte kraft- und farblos, der sonnenarme Winter forderte seinen Tribut. Im Zickzack-Kurs hinab in Richtung Niddaufer, über die Brücke beim Klärwerk und Sportfeld vorbei war sie gelaufen. Zufall oder nicht, sie befand sich in diesem Augenblick nur einen Steinwurf vom Riedweg entfernt, wo ihre neue Dienststelle lag. Tatsächlich kam Sabine der spontane Gedanke, ihre Runde für eine Kaffeepause zu unterbrechen, aber sie verwarf ihn sofort wieder. Erstens wusste sie nicht, wer Dienst hatte, auch wenn die Möglichkeiten ausgesprochen überschaubar waren. Zweitens war ihr Frühsport heilig. Spute dich mal lieber, dann schmeckt das Frühstück doppelt lecker.
Ein Vibrieren an Sabines Oberarm, wo ihr Handy in einem Sportarmband steckte, unterbrach ihre Tagespläne jäh.
Knirschend rollte Ralph Angersbachs dunkelgrüner Lada Niva über den ausgestorbenen Parklatz. Im Hintergrund erkannte er das Logo des Radiosenders FFH, seitlich befanden sich die silbernen Türme der Abfüllanlage eines der Mineralbrunnen, die Bad Vilbel weit über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht hatten. Nicht, dass der Kommissar sich sonderlich gut in der Dreißigtausend-Seelen-Stadt im südlichsten Zipfel der Wetterau auskannte, aber er wusste immerhin, dass auf dem Schotter unter ihm alljährlich ein großer Jahrmarkt abgehalten wurde. Doch heute lag der Platz brach, verwaist bis auf einige Lkw-Aufleger und zwei verlassene Autos, von denen eines bereits die leuchtend rote Notiz des Ordnungsamtes trug, dass der Wagen umgehend zu entfernen sei. Schwieriges Unterfangen, dachte Angersbach, denn dem alten Audi fehlten alle vier Reifen. Er steuerte auf die dichten Bäume und Büsche zu, die den Platz säumten. Ein Rettungswagen parkte dort, außerdem einige weitere Fahrzeuge, darunter ein Streifenwagen und der protzige VW Touareg des Notarztes. Zwischen den Blättern bewegte sich etwas, und im nächsten Augenblick erkannte Angersbach seine Kollegin in unerwarteter Montur.
»Guten Morgen«, nickte er, und die leise Irritation seines Blicks blieb Sabine Kaufmann nicht verborgen.
»Ebenso«, lächelte sie zurück. »Mich hat’s beim Joggen erwischt.«
Angersbach konnte nicht umhin, die sportliche Figur seiner zehn Jahre jüngeren Kollegin wahrzunehmen. Der schlanke, aber trainierte Körper, der einen ganzen Kopf kleiner war als er, steckte in schwarzen Laufleggins, dreiviertellang, und einem entsprechenden Oberteil. Das blonde, etwas über schulterlange Haar wurde von einem Haargummi zusammengehalten, und um den Nacken lag ein weißes Handtuch, vermutlich eine Leihgabe der Rettungssanitäter.
»Zum Glück nicht so wie unseren Toten«, griff Angersbach den letzten Satz seiner Kollegin auf und zuckte mit den Augenbrauen. »Dann führen Sie mich mal hin, bitte.«
Der Arzt schien seinen schwarzen Lederkoffer entweder noch nicht ausgepackt zu haben, oder er war mit seiner Untersuchung längst fertig. Angersbach glaubte, sein Gesicht schon einmal gesehen zu haben, konnte es aber nicht zuordnen.
»Gehen Sie schon wieder?«, fragte er argwöhnisch und neigte dabei den Kopf, wie er es gern tat.
»Ich habe meinen Part bereits erledigt«, war die unmittelbare Antwort des Arztes, dessen Statur ein wenig untersetzt war. Unter seiner Schutzhaube quoll dichtes schwarzes Haar hervor und ging in einen Vollbart über. Selbst auf den Handrücken, die er soeben schnalzend freilegte, indem er die Latexhandschuhe abzog, wucherte es schwarz. »Ich habe es schon Ihrer Kollegin gesagt, das war wohl falscher Alarm. Ich kümmere mich mal um den vorläufigen Totenschein.«
»Moment, Moment«, bremste Angersbach ihn aus. »Was schreiben Sie denn hinein?«
»Todesart ungeklärt natürlich«, brummte der Arzt. »Aber ich bin mir dennoch ziemlich sicher, dass es sich um eine natürliche Todesursache handelt.«
»Weshalb?«
»Sport ist Mord, deshalb. Der Mann ist Ende fünfzig, verschwitzt von Kopf bis Fuß, als wäre er dem Leibhaftigen davongerannt, und das in einem viel zu dünnen Dress. Dünner noch als Ihre Kollegin hier.« Er deutete mit rügendem Stirnrunzeln auf Sabine Kaufmann.
»Ich will ihn selbst in Augenschein nehmen«, entgegnete Angersbach, ohne auf die Bemerkung einzugehen.
Die Nidda verlief in sanft geschwungenen Bögen und leckte an matt schimmernden Lehmbuchten. Der Wasserstand war vergleichsweise niedrig. Zwei Handbreit über der Wasseroberfläche erst begann der Bewuchs, einige Papierstreifen und vergilbte Plastikfetzen trübten das Bild. Ruhig und ohne Eile, beinahe lautlos, floss das farblose Wasser vorbei. Nicht ein einziges Tier war zu sehen oder zu hören. Auf der nahe gelegenen Straßenbrücke knatterte ein alter Porsche 911 vorbei, der Fahrer spielte offenbar genüsslich mit den unbändigen Kräften seines Boliden.
Der Tote lag bäuchlings neben dem Radweg im kniehohen, taufeuchten Gras. Er trug ein helles Funktionsshirt, in dessen Taschen man die notwendigsten Gegenstände eng am Körper tragen konnte. Dazu eine Radlerhose, die über den Knien endete. Die größtenteils ergrauten Haare waren im Nacken kurz geschnitten, lagen darüber jedoch dicht und in klebrigen Strähnen. Der Körper wirkte nicht verkrampft, doch das hatte nichts zu bedeuten, wie Angersbach wusste. Selbst tödlich verwundete Soldaten lagen nicht in unnatürlicher Haltung in ihren Schützengräben, auch wenn das Fernsehen einen das immer wieder glauben machen wollte. Es sei denn, der Tod trat von einem Moment auf den anderen ein, aber solche kurzen Sterbeprozesse gab es statistisch betrachtet höchst selten. Nein, der Mann war ins Gras gefallen und nicht wieder aufgestanden. Warum, das sollte dieser Arzt herausfinden.
»Wie lange liegt er Ihrer Meinung schon da?«, erkundigte Angersbach sich.
»Maximal zwei Stunden, würde ich meinen«, gab der Mediziner mürrisch zurück. »Am Hals sind Totenflecken ausgebildet, die Extremitäten sind aber noch nicht ausgekühlt. Die Starre hat sich bislang nur in den Augenlidern entwickelt. Auf eine Entkleidung und vollständige Leichenschau habe ich vorerst verzichtet. Ich werde einen Teufel tun, der Spurensicherung ins Handwerk zu pfuschen. Außerdem ist mir kalt, und ich habe Rufbereitschaft. Soll sich ein anderer darum kümmern. Und ich wiederhole es gerne noch mal, es ist vergebene Liebesmüh. Dieses Gerede von einem Schuss ist Blödsinn.«
»Welcher Schuss?«
Ralph Angersbach wechselte einen schnellen Blick mit Sabine Kaufmann. Wusste sie etwas, was ihm entgangen war?
Diese zuckte mit den Schultern. »Ich weiß auch nichts Konkretes, sorry, angeblich will jemand einen Schuss gehört haben. Aber Dr. Körber fand keinerlei Hinweise auf eine Eintrittswunde.«
»Sie kennen sich also?«, fragte Angersbach leicht gereizt. Er hasste nichts mehr, als an einem Tatort die zweite Geige spielen zu müssen. Oder Fundort, wie auch immer.
»Flüchtig«, bestätigte die Kommissarin. »Irgendwann kennt man eine Menge Mediziner, wenn man in einer so verbrechensstarken Stadt wie Frankfurt arbeitet.«
»Hm. Also noch einmal zu diesem Schuss. Wer hat das gemeldet?«
»Sehen Sie die Frau dort bei den Beamten?«, fragte Sabine mit gedämpfter Stimme und deutete stadtwärts in Richtung einer Baumgruppe, wo eine bieder gekleidete Frau Mitte dreißig stand, an der Leine einen schwarzweißen Border Collie, der unruhig hin und her trappelte. Sie sah in ihre Richtung und traf Angersbachs Blick. Er nickte ihr zu.
»Sie hat den Toten gefunden und gemeldet«, fuhr Sabine fort. »Übergeben wir den Fundort der Spurensicherung? Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen.«
»Übernehmen Sie das?« Ralphs Frage klang weniger wie eine Bitte als wie eine Aufforderung, das wurde er erst gewahr, als seine neue Kollegin sich wortlos abwandte und in Richtung der Uniformierten lief. Mist. Wie lange kannte er Sabine Kaufmann nun? Ganze fünf Tage. Sie hatte ihre Stelle schon zum ersten Januar angetreten, er hingegen stieß erst zum ersten März dazu. Bis dahin hatte ihn das Präsidium in Gießen gebunden, in dem Ralph Angersbach den größten Teil seines Berufslebens verbracht hatte. Dass er einmal hierherwechseln würde, hätte er noch vor einem halben Jahr mit einem müden Lächeln abgetan. Friedberg, ja, eine adäquate Mittellösung auf halbem Weg zwischen Gießen und Frankfurt. Dort gab es eine echte Mordkommission, keinen spärlichen Außenposten, aber das Leben beschritt zuweilen eben eigenartige Wege. Obgleich er keinen rechten Elan verspürte, würde er sich nach Kräften darauf konzentrieren, dass die Kommunikation zwischen ihm und seiner Großstadtkollegin funktionierte. Irgendwie.
»Chucky hat total verrückt angeschlagen, ich dachte schon, er hätte einen Biber ausgemacht.« Regina Ruppert hatte etwa Sabines Größe, eins fünfundsechzig, und war dem Ausweis nach fünfunddreißig Jahre alt. Sie sah älter aus, was daran liegen mochte, dass ihr der Schreck noch in den Knochen saß. Dunkelblonde Locken lugten unter ihrer Fleece-Mütze hervor, sie drehte nervös in den Haaren. Sabine nickte verständnisvoll und entschied, die Fragen so knapp wie möglich zu halten. Außerdem wurde ihr allmählich kalt. Sie bereute es mittlerweile, dass sie vom Riedweg direkt hierhergesprintet war.
»Sie waren also auf Gassirunde?«, fuhr Sabine fort.
»Ja, auf dem Rückweg. Ich wollte eigentlich abbiegen und über die Brücke gehen«, sie deutete in Richtung der klobigen Betonüberführung, »aber, na ja.«
»Haben Sie den Toten in irgendeiner Weise berührt? Oder Ihr Hund?«
»Um Himmels willen!« Die Frau schüttelte angewidert den Kopf. Dann überlegte sie einige Sekunden und fuhr fort: »Chucky hat ihn mit der Nase angestupst. Als er sich nicht bewegt hat, habe ich ihn angesprochen, dann zog ich sofort das Handy heraus und habe den Notruf gewählt.«
»Konnten Sie andere Lebenszeichen erkennen?«
»Sie meinen Atem oder Puls?« Regina wand sich, schien unangenehm berührt. Sabine nickte auffordernd.
»Nun, ich habe ihm die Hand vor den Mund gehalten«, begann ihr Gegenüber, und ihre Blicke wanderten ausweichend hin und her. »Aber er atmete nicht. Keine Bewegung, das hab ich doch schon gesagt.«
»Okay, in Ordnung.« Sabine lächelte matt. »Sie haben richtig gehandelt. Nicht jeder hätte die Überwindung aufgebracht, sich dem Körper zu nähern. Aber kommen wir noch einmal auf den Schuss zu sprechen, den Sie gehört haben.«
»Glauben Sie mir etwa nicht?« Regina Ruppert verschränkte die Arme und funkelte Sabine herausfordernd an.
»Wieso fragen Sie?«
»Ich lebe doch nicht hinterm Mond. Mir ist nicht entgangen, dass es keine Schussverletzungen gibt.«
»Keine sichtbaren zumindest«, korrigierte Sabine.
»Also glauben Sie mir?«
»Schildern Sie mir den zeitlichen Ablauf bitte so präzise wie möglich.«
»Gut, in Ordnung.« Regina lächelte matt. Sie zeigte wieder in Richtung der Niddabrücke, in deren Betonsockel sich ein düsterer Durchgangstunnel für den Niddaradweg befand. »Ich war mit Chucky auf dem Rückweg. Wir laufen je nach Witterung manchmal bis nach Dortelweil oder Gronau, aber heute war schon beim Römerbrunnen Schluss. In der Unterführung fiel dann dieser Schuss. Ich glaube, der Arme ist einen halben Meter hochgehüpft vor Schreck. Ein einziger Knall, nichts weiter, danach war wieder Stille. Zumindest so lange, bis Chucky zu jaulen begann und wie ein Wilder losrannte. Er reagierte nicht auf mein Rufen, und mir schlug das Herz bis hier.« Sie legte sich die Hand unters Kinn. »Aber ich musste ihm ja hinterher, obwohl ich lieber die Böschung rauf und bis nach Hause gerannt wäre. Keine Menschenseele weit und breit.« Sie fröstelte, rieb sich die Oberarme, dann wurde ihr Blick leer. »Das nächste Bild, an das ich mich erinnere, ist Chuckys Nase in Reitmeyers Gesicht.«
Die Kommissarin zuckte zusammen.
»Reitmeyer?«, wiederholte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Sie kennen den Toten?«
Doch Regina Ruppert gab ihr keine Gelegenheit zum Grübeln.
»Ulf Reitmeyer, den kennt hier doch jeder«, sagte sie schnell, wie beiläufig. »Der Bio-Mogul.«
Ralph Angersbach schaltete einen Gang zurück, als sie den Kreisel verließen und die Steigung der Frankfurter Straße in Richtung Heilsberg nahmen.
»Reitmeyer? Sagt mir nichts.«
»Ich kenne ihn auch nur vom Namen her«, erwiderte Sabine Kaufmann und blickte nachdenklich aus dem von Handabdrücken übersäten Seitenfenster. Sie hatte Angersbach gefragt, ob er sie kurz zu Hause absetzen würde, denn mittlerweile war sie vollkommen durchfroren. Eine heiße Dusche, frische Kleidung und ein hastiges Brötchen unterwegs; all das war für sie nichts Neues. Und doch war alles irgendwie anders. Angersbach schenkte ihr einen fragenden Blick, dann musste er sich wieder auf die Straße konzentrieren. Wo waren wir eben?
»Reitmeyer hat vor vielen Jahren einen Bioladen in Bergen-Enkheim aufgemacht«, nahm Sabine den Faden wieder auf. »Nach und nach wuchs daraus ein gigantisches Unternehmen, so viel weiß ich. Die Kunden schwören auf seine Produkte, denn er befriedigt die Nachfrage ökologisch und ökonomisch. So zumindest stellt er sich selbst gerne dar.«
»Stellte sich dar«, brummte Angersbach nachdenklich, und Sabine nickte mit einem schmalen, freudlosen Lächeln.
Der Kommissar musste unwillkürlich schmunzeln. »Sie kennen sich ziemlich gut aus hier in der Ecke, wie?« Diesmal klang seine Stimme weniger wie ein Oberlehrer, sondern beinahe schon anerkennend.
»Bin hier aufgewachsen«, bestätigte Sabine. Sie näherten sich einem weiteren Kreisel, und sie deutete nach rechts vorne. »Die erste Ausfahrt müssen wir raus.«
Wenige Minuten später parkte der Geländewagen, dem Sabine weder optisch noch technisch etwas abgewinnen konnte, vor dem Mehrfamilienhaus, in dem sie wohnte. Ihr Rücken schmerzte, die Federung der Sitze war ein Witz, und die stumpf verkratzte Holzperlenauflage konnte das auch nicht zum Besseren wenden.
»Soll ich warten?«
»Danke, ich komme selbst runtergefahren«, lehnte Sabine ab, angestrengt darauf bedacht, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie eine weitere Fahrt in diesem Vehikel um jeden Preis vermeiden wollte.
»Wie Sie meinen. Dann kümmere ich mich so lange um die notwendigen Telefonate. Bitte lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Die Angehörigen sollen Reitmeyers Tod nicht erst aus den Nachrichten erfahren.«
»Halbe Stunde?«
»Die Zeit läuft«, grinste Angersbach und trat aufs Gas. Der dünne Auspuff vibrierte und spie eine dunkle Abgaswolke aus, dann wendete das Unikum in einem engen Halbkreis und knatterte davon.
Komischer Kauz, dachte Sabine im Hineineilen. Sie nahm zwei Treppenstufen auf einmal und hatte, kaum dass sie die Wohnungstür aufgeschlossen hatte, auch schon ihr Laufshirt über den Kopf gezogen. Sekunden später flogen der schwarze Sport-BH und das Handtuch in den Wäschekorb, und sie drehte den Regler der Dusche auf. Gierig sog ihr unterkühlter Körper die dampfende Wärme des auf sie hinabprasselnden Wassers auf, und am liebsten wäre sie den Rest dieses winterlichen Märzsonntags genau hier verblieben. Die Pflicht ruft, mahnte sie sich jedoch. Sabine würde einen Teufel tun, ihrem doch recht gewöhnungsbedürftigen Kollegen den Triumph zu bescheren, sich zu verspäten.
Die Polizeistation von Bad Vilbel lag in einer Nebenstraße, nahezu verdeckt von dem Gebäude der lokalen Feuerwehr, dessen Schlauchturm sich martialisch in den Himmel reckte. Weiß getüncht, mit türkisen Fenstern und einem halben Dutzend Gauben, wie man sie in den neunziger Jahren nur allzu gern in Neubauten untergebracht hatte, wirkte das zweigeschossige Haus auf den ersten Blick wie eine Arztpraxis. Der Eingangsbereich lag unter einem Vorbau, den eine schlanke Rundsäule trug, zur Straße hin gab es einige wenige Parkplätze, und niedrige Bodendecker füllten die Zwischenräume des Grundstücks. Rechts führte eine Einfahrt in den Hof hinter dem Gebäude, doch hierhin war Sabine bislang nie abgebogen, da in der Regel draußen kaum Fahrzeuge parkten.
Schwungvoll lenkte Sabine ihren brandneuen Renault Twizy, den sie am vergangenen Donnerstag nach wochenlangem Warten endlich in Empfang hatte nehmen dürfen, auf den Parkplatz. Es handelte sich um ein modernes Elektroauto mit zwei hintereinander angeordneten Sitzen. Flügeltüren und Fenster gab es als Nachrüstpakete und waren bei den vorherrschenden Außentemperaturen sicher keine Fehlinvestition gewesen, wenn auch eine teure. Der Akku hielt mindestens hundert Kilometer, und glaubte man diversen Internetforen, konnte man ihn sogar fast doppelt so lang ausreizen. Für Sabines Zwecke das ideale Fahrzeug, denn weiter als in Richtung Vogelsberg führte sie ihr Radius derzeit ohnehin nicht. Und mehr als zwei Personen beförderte sie auch nie, in der Regel war es nur sie selbst. Bevor sich ein Schatten über ihre Miene legen konnte, stieg die Kommissarin hurtig aus. Sie schloss den Wagen ab, vergewisserte sich, dass ihre eilig aus dem Schrank gegriffene Kleidung korrekt saß, und ging rasch zum Eingangsportal. Dreiundzwanzig Minuten, nicht übel, dachte sie und betrat das Gebäude.
Ralph Angersbach war im Grunde genommen ein ihr gleichgestellter Kollege. Beide waren Polizeioberkommissare, wobei es Sabine ein Rätsel war, wieso Angersbach es nicht längst zum Hauptkommissar gebracht hatte. Als Außenposten der regionalen Kriminalinspektion unterstanden sie der Führung des K10 in Friedberg und damit Kriminaloberrat Horst Schulte. Trotz heiligem Sonntag, wie Sabine von einem geschäftig umhereilenden Uniformierten aufschnappte, hatte dieser seinen Weg nach Bad Vilbel gefunden.
»Es ist eine mittelprächtige Katastrophe«, eröffnete Schulte die Besprechung, nachdem alle Platz genommen hatten. Seine dunklen, buschigen Augenbrauen erinnerten an einen Habicht, und die spitze, leicht gekrümmte Nase tat ein Übriges. Der füllige, breitschultrige Körper des etwa Fünfzigjährigen verbarg sich hinter einem halbrunden Stehpult, das gewöhnlich für Pressekonferenzen herhalten musste.
»Ein zumindest regional prominenter Toter«, fuhr Schulte mit tiefem Schnarren fort, »eine Zeugin, die einen Schuss vernommen haben will, aber keine Hinweise auf eine entsprechende Verletzung beim Opfer. Die Presse wird verrücktspielen. Was wissen wir bislang über den Tathergang?«
Mirco Weitzel, einer der Uniformierten, die bei Regina Ruppert gestanden hatten, fasste die dürftigen Erkenntnisse noch einmal zusammen.
»Reitmeyer joggte stadtauswärts in Richtung Dortelweil«, begann er, wurde jedoch sofort von Angersbach unterbrochen.
»Sein Kopf lag aber doch in Richtung Bad Vilbel. Worauf begründen Sie Ihre Behauptung?«
Weitzel schmunzelte. Er war achtundzwanzig Jahre alt, athletisch gebaut und trug sein kurzes, braunes Haar stets korrekt gestylt. Unter den Kollegen munkelte man, er verwende tagtäglich große Mengen an Sekundenkleber dafür, denn auch nach dem Tragen der Dienstmütze wirkte seine Frisur in der Regel wie frisch gerichtet. Angeblich hatte man ihn sogar schon mit einem kleinen Spiegel erwischt, den er in seiner Brusttasche tragen sollte, doch für Sabine waren das die üblichen bösen Unterstellungen neidischer Kollegen, die weniger attraktiv waren. Ein Schönling allerdings, das musste sie zugeben, schien der junge Mann schon zu sein.
»Hundekot an seinen Sohlen«, sagte dieser triumphierend.
»Hundekot?« Die Aufmerksamkeit aller war ihm nun gewiss.
»Ja, an seinen Laufschuhen. Die Spusi hat ein paar Meter südlich einen zertretenen Hundehaufen gefunden, und in seinem Schuhprofil waren entsprechende Rückstände. Das bedeutet, er war stadtauswärts unterwegs.«
Sabine beobachtete aus den Augenwinkeln, wie Angersbach diese Information aufnahm. Er schien einerseits beeindruckt zu sein, der Erkenntnis an sich jedoch keine allzu große Bedeutung beizumessen.
»Ob hin oder zurück ist letztlich nebensächlich«, kommentierte er, »es sei denn, er lief diese Strecke nach einem festen Muster, und jemand hat ihm aufgelauert. Ohne Eintrittswunde scheidet ein Heckenschütze aber aus, oder sieht das jemand anders?«
»Darum geht es mir ja«, schaltete Schulte sich wieder ein. »Was wissen wir von ihm? Feinde, Gewohnheiten, Motiv, Gelegenheit«, er wedelte ungeduldig mit der Hand. »Oder sein Gesundheitszustand. War er herzkrank, nahm er Medikamente, hatte er Asthma? Zugegeben, Reitmeyer war besser in Form als ich und noch lange nicht in einem Alter, wo man einfach umkippt. Oder führen wir es einmal ad absurdum: Hat möglicherweise jemand auf ihn geschossen, und der Schuss verfehlte ihn, hat ihn aber zu Tode erschreckt?«
»Dazu brauchte es keinen Heckenschützen«, brummte Angersbach und erinnerte sich an den alten Porsche, der über die Brücke geknattert war. »Ein Knallkörper oder eine Fehlzündung täten es auch.«
»Wie auch immer. Ich stelle keine Theorien auf, die nicht auch in der Bildzeitung produziert werden könnten. Aber fahren Sie bitte fort.« Schulte nickte in Mirco Weitzels Richtung.
»Keine äußeren Verletzungen nach Inaugenscheinnahme durch den Notarzt. Die Todesursache bleibt zunächst unklar, Dr. Körber und das Opfer waren nicht miteinander bekannt. Ohne Kenntnis der Krankengeschichte …«
»Klar so weit«, unterbrach Schulte den Beamten. »Wir beantragen eine Obduktion. Wir können es uns nicht leisten, nach Reitmeyers Hausarzt zu fischen, jede Stunde ist kostbar. Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald Sie sich in der Rechtsmedizin einfinden können.«
Sabine nickte. In ihrem Kopf formten sich vertraute Bilder des rechtsmedizinischen Instituts in Sachsenhausen, außerdem Gesichter einiger alter Bekannter. Insgeheim freute sie sich darauf, wenngleich die Umstände weniger erfreulich waren, dem Team dort einen Besuch abzustatten. Doch dann fiel ihr siedend heiß ein, dass ja nun ein anderes Institut zuständig war. Mist. Sie schluckte.
»Friedberg oder Gießen?«, raunte sie, für die anderen nicht hörbar, in Richtung ihres neuen Kollegen.
»Was?«, entgegnete er, weitaus weniger diskret, und die Kommissarin bereute, überhaupt gefragt zu haben.
»Schon gut«, wehrte sie hastig ab.
»Ist es zeitlich angemessen, die Pressekonferenz zwischen zwölf und ein Uhr anzusetzen?«, fragte Schulte in die Runde. »Bis dahin sollten die Hinterbliebenen aufgesucht sein. Ich möchte das möglichst eng terminieren, um Spekulationen zu vermeiden.«
»Kommt drauf an. Wen gibt es denn da?«, erkundigte sich Sabine.