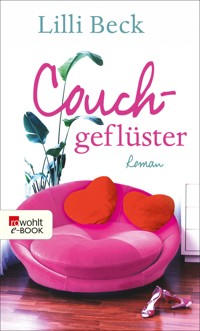11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glück und Glas, wie leicht bricht das?
Am 7. Mai 1945 werden Marion und Hannelore in der Frauenklinik in der Münchner Maistraße geboren. Obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen stammen, wachsen sie wie Schwestern auf und sind unzertrennlich. Doch als Marion sich an ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag verliebt, zerbricht ihre Freundschaft. Während der Kalte Krieg immer mehr eskaliert, die Studenten auf die Straße gehen und die ersten Kommunen entstehen, trennen sich ihre Wege endgültig. Die widerspenstige Marion wird Fotomodel, hat großen Erfolg im Beruf, aber kein Glück in der Liebe. Hannelore studiert Jura, um Anwältin zu werden, doch das Leben hat andere Pläne mit ihr. Jahrzehnte später, am 7. Mai 2015, wollen sie ihren siebzigsten Geburtstag zusammen feiern – doch kann die Zeit alle Wunden heilen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Lilli Beck
Glück
und
Glas
Roman
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch, obwohl reale Fakten und Unternehmen erwähnt werden. Die beschriebenen Personen, Begebenheiten, Gedanken und Dialoge sind fiktiv.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
1. Auflage
© der Originalausgabe 2015 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de unter Verwendung eines Motivs von Dr. Paul Wolff & Trischler; LOOK-foto/Franz Marc Frei
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17124-7www.blanvalet-verlag.de
Leben lässt sich nur rückwärts betrachtet verstehen,muss aber vorwärts gelebt werden.
Søren Kierkegaard
1969
»See me, feel me, touch me …«
Heiser klang die Stimme des Sängers durch den Flur, über dessen abgetretenes Parkett sich eine Linie achtlos verstreuter Kleidungsstücke zog. Ein buntes Blumenkleid schmiegte sich an eine konservativ geschnittene dunkle Popelinhose, metallisch glänzende Plateauschuhe paarten sich mit klassischen schwarzen Schnürschuhen, zarte hellblaue Spitzenunterwäsche zierte ein schwarzes Batisthemd, über dem sich eine gestreifte Krawatte ringelte. Die Spur ungezügelter Begierde endete im Badezimmer, wo tropfende Kerzen auf Chianti-Flaschen ein sanftes Licht auf die weißen Kacheln warfen, sich der süßliche Duft von Sandelholz-Räucherstäbchen mit dem würzigen Aroma von Marihuana und der exotischen Note eines schweren Parfüms vermischte. Wo leises Stöhnen von Leidenschaft zeugte.
»… touch me …«
Glücklich seufzend lehnte sich Moon an seine Brust, zündete sich einen Joint an und inhalierte tief. »Ich liebe diesen Song von The Who«, flüsterte sie heiser beim Ausatmen des Rauchs. »Er war das Highlight in Woodstock … Ich wollte, ich wäre dabei gewesen …«
»Ich liebe es, dich zu berühren und in meinen Armen zu halten …« Sachte schob er mit der freien Hand eine rote Haarsträhne zur Seite und fuhr mit den Fingern entlang der vollendet geschwungenen Halslinie hinunter zu ihren Brüsten. »Es will mir einfach nicht in den Kopf, wieso sich die schönste Frau der Welt mit einem Unwürdigen wie mir abgibt.«
Leise kichernd sah sie dem aufsteigenden Rauch nach. »Du bist stoned, Unwürdiger.«
»Das auch, aber viel mehr bin ich berauscht von meiner Liebe zu dir. Dem Glück, dir begegnet zu sein. Der Gewissheit, dass du mich auch liebst.« Er zog an dem Joint, den sie ihm an die Lippen hielt. »Ich würde alles dafür geben, die Zeit anhalten zu können …«, sagte er. »›Zum Augenblicke dürft’‹ ich sagen: Verweile doch, du bist so schön …«
»Wie lieb von dir, wo du Patschuli-Schaumbäder gar nicht magst.« Entrückt blickte sie den Rauchkringeln nach, die sich im Raum verflüchtigten.
»Glücklicherweise ist vorhin eine Menge von dem stinkenden Zeug über den Wannenrand geschwappt«, erwiderte er schelmisch.
Sie schmiegte sich in seine Arme, um sich einen Herzschlag später abrupt von ihm zu lösen, sich umzudrehen und ihn aus hellgrünen Augen anzufunkeln. »Was für eine schräge Idee! Würden wir für alle Ewigkeit in dieser Badewanne bleiben, wäre ich bald ein altes, schrumpeliges Weib. Ich würde keine Fotoaufträge mehr erhalten und wieder arm sein.«
»Nein, mein süßes, widerspenstiges Dummchen, du würdest auf ewig so jung und überirdisch schön bleiben wie in diesem Augenblick. Aber das war nur ein Zitat aus dem Faust von Goethe …« Er packte sie lachend, zog sie an sich und küsste sie mit schmerzhaftem Begehren.
Machtlos gegen seine Zärtlichkeiten, nach denen sie sich in jeder Sekunde ohne ihn verzehrte, ließ sie die Marihuanazigarette über den Wannenrand fallen. Lautlos verlosch sie in der Wasserlache.
Als sie sich endlich voneinander gelöst hatten, sagte sie schmollend: »Ich bin kein Dummchen, obwohl ich weder studiert habe noch Goethe-Zitate kenne. Wenn überhaupt, bin ich eine Widerspenstige, woran ich aber völlig unschuldig bin. Es liegt nämlich an meinem Namen, genauer gesagt, an seiner Bedeutung.« Sie griff über den Wannenrand zu dem Stuhl, auf dem eine Schachtel Gitanes und das Feuerzeug lagen. »Magst du auch?«
Kopfschüttelnd lehnte er die angebotene Zigarette ab. »Lass hören, meine süße esoterische Göttin, was dein Name mit deinem Charakter zu tun hat.«
»Nun bist du der Dumme«, trumpfte sie auf und küsste ihn flüchtig auf die glatt rasierte Wange.
»Von dir lass ich mich gerne aufklären, geliebte Lehrerin.«
Vergnügt blinzelte sie ihn an. »Das Dope macht dich albern. Also, pass auf: Marion besteht aus zwei Silben, Mar und Ion. Erstere geht zurück auf den Wortstamm Mare, das Meer, die zweite auf Ion, elektrisch geladene Teilchen. Also Wasser und Feuer, die …«
»… die wohl größten Gegensätze überhaupt«, unterbrach er sie. »Bis hierhin habe ich verstanden. Und weiter?«
»Ist doch logisch …« Sie zündete die Zigarette an. »Ich werde sozusagen von zwei Naturgewalten zerrissen, bin also eine Widerspenstige, in deren Natur es liegt, aufmüpfig zu sein. Eine harte Bürde, kann ich dir verraten. Während meiner Schulzeit hatte ich unter dieser Eigenschaft reichlich zu leiden. Nicht zuletzt deshalb war ich so froh über die Änderung meines Vornamens in Moon.«
»Nomen est omen.« Zärtlich blickte er ihr in die Augen. »Aber egal, ob Marion oder Moon, für mich bedeuten beide Namen unendliches Glück. Küsse aus dem siebten Himmel. Atemlose Leidenschaft. Verbunden mit dieser Wohnung, in der wir uns lieben. Wo wir Musik hören, bei illegalen Joints alle Probleme vergessen und von der Zukunft träumen, in der es nur dich und mich gibt.«
»Unsere Liebesinsel ohne Raum und Zeit«, ergänzte sie verträumt.
»Für immer und ewig.« Er schlang erneut die Arme um sie, wiegte sie wie ein Kind, während sie ihre Zigarette genoss. »Ob wir auf dieser Liebesinsel auch etwas zu essen finden?«, fragte er nach einer Weile. »Das Dope macht mich jedes Mal hungrig.«
»Mich auch …« Sie löste sich aus seinen Armen. »Außerdem ist das Wasser längst kalt …«
Eingehüllt in ein großes Handtuch saß sie wenig später in der geräumigen Wohnküche an einem kleinen Bistrotisch. Eine weitere Zigarette zwischen den grazilen Fingern, beobachtete sie, wie er Brote bestrich, Essiggurken zu Fächern aufschnitt und ihr den Imbiss auf einem Holzbrett servierte.
»Notfalls könntest du auch als Kellner arbeiten«, sagte sie. »Du würdest ein Vermögen an Trinkgeldern kassieren.«
Er lachte. »Wenn ich nackt wäre, so wie jetzt, garantiert.«
Gierig griff sie nach einem der Brote und biss mit großem Appetit hinein. »Hmm … hast du eigentlich niemals Angst?«, fragte sie kauend.
»Wovor?« Er sah sie verwundert an.
»Davor, dass wir bestraft werden für unsere Liebe.«
»Bestraft?«
»Ja. Denn jedes Glück hat seinen Preis …«
1
München, 7. Mai 2015
Moon nahm den zartrosa Karton in Empfang, bezahlte den Boten und geizte nicht mit Trinkgeld. Seit sie selbst lange Zeit für einen Hungerlohn hatte schuften müssen, war sie großzügig, wann immer es ihre Mittel erlaubten. Aber wohin jetzt mit der kostbaren Lieferung in dem vorherrschenden Chaos? Am besten in den Kühlschrank! Sollte die Temperatur tatsächlich wie vorhergesagt steigen, war er der sicherste Ort für die empfindliche Köstlichkeit.
Zu gern hätte sie sogleich ein Stück davon verspeist oder zumindest eine der Marzipanrosen genascht. Wie 1949, als sie und Lore ihren gemeinsamen vierten Geburtstag gefeiert hatten. Vieles aus ihrer entbehrungsreichen Kindheit hatte sie erfolgreich verdrängt oder völlig vergessen. Doch an diesen einen Tag erinnerte sie sich noch sehr deutlich. Aber welches Kind, das in den ersten Lebensjahren mehr gehungert als sich satt gegessen hatte, würde je den Moment vergessen, in dem es das erste Mal ein Traumgebilde aus Buttercreme erblickt hatte? Ein Konditorenwerk aus köstlicher, fetter Creme, die sich in geschwungenen Ranken um den Tortenrand wand und deren rosettenartige Kringel von kandierten Kirschen gekrönt waren. Noch heute spürte sie den unvergleichlich zarten Schmelz auf der Zunge, der nach Überleben geschmeckt hatte. Seit damals konnte sie keinem noch so mächtigen Gebäck widerstehen. Aber sie würde sich beherrschen. Sie wollte die Geburtstagstorte mit Lore anschneiden. Das war über die Jahrzehnte zu einem festen Ritual geworden. Neben der unvermeidlichen Frage, ob Lore wieder nur ein Ministück essen würde, aus Angst zuzunehmen, gehörte auch das gemeinsame Auspusten der Kerzen dazu sowie die Beschwörungsformel »Glück und Glas, wie leicht bricht das«, die sich leider viel zu häufig in ihrem Leben bewahrheitet hatte.
Die Torte war sicher verstaut, als das antike schwarze Bakelit-Telefon läutete. Das schrille Geräusch drang wie eine Stimme aus der Vergangenheit in Moons Erinnerungen. Beinahe schmerzhaft laut hallte es durch die 150 Quadratmeter große Vier-Zimmer-Altbauwohnung. Vor Kurzem erst war sie in ihre Heimatstadt München zurückgekehrt und hier eingezogen. Den antiquierten Apparat hatte sie mit einigen Möbeln übernommen, aber nicht damit gerechnet, dass er noch angeschlossen wäre. Ihr konnte der Anruf nicht gelten, denn außer Lore wusste niemand von ihrem Umzug, und die besaß nur ihre Handynummer.
Moon hetzte in den Flur, wo der Apparat auf dem Sideboard stand, und meldete sich mit »Neubauer«.
»Hallo, mein Name ist Walter Tanner, ich bin Galerist und betreute sämtliche Werke des Künstlers …« In schnellem, amerikanisch gefärbtem Deutsch erklärte er sein Anliegen. Er schien anzunehmen, sie wüsste, weshalb er anrief.
»Tut mir leid, Sie haben sich wohl verwählt«, sagte sie, als es ihr endlich gelang, seinen Redeschwall zu unterbrechen. »Ich wohne erst seit wenigen Tagen in dieser Wohnung und hatte noch keine Zeit, den Anschluss umzumelden.«
»Nein, nein, wenn Sie Frau Neubauer sind, habe ich die richtige Nummer gewählt«, entgegnete er und erklärte, nun etwas langsamer: »Es handelt sich um das Testament von Sky, und es wäre wichtig, dass wir uns baldmöglichst treffen.«
»Ich bedaure außerordentlich«, sagte sie und gab ausweichend das Umzugschaos als Grund an. »Zudem erwarte ich Handwerker, und Sie können sich vermutlich vorstellen, dass ich die Termine nicht absagen möchte. Aber nächste Woche sehr gerne.«
»Natürlich verstehe ich Ihre Situation«, entgegnete er höflich. »Doch die Angelegenheit ist wirklich dringend, auch in Ihrem Interesse. Es dauert höchstens eine halbe Stunde.«
»Nun … wenn das so ist«, antwortete Moon zögernd, »Dann würde ich Sie um eine Telefonnummer bitten, unter der ich Sie erreichen kann. Sobald die Reparaturen erledigt wurden, melde ich mich. In etwa zwei Stunden.«
Ausgerechnet für heute hatte sich der Telefontechniker angekündigt, um einen zeitgemäßen digitalen Anschluss zu installieren. Und der Installateur hatte versprochen, die maroden Wasserhähne im Bad zu reparieren, aus denen das Wasser nur tröpfelte. Momentan gab es lediglich in der Küche fließend warmes Wasser. Zwischen den beiden Terminen hatte sie weiter auspacken wollen, um die chaotischen Räume in ein vorzeigbares Zuhause zu gestalten, bevor sie sich den finalen Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier widmen wollte. Schwierig, in dem engen Zeitplan Raum für einen weiteren Termin zu finden. Auch wenn sie sich über die Neuigkeiten freute, sie waren schließlich eine tolle Geburtstagsüberraschung. Nach all den Geschehnissen und den darauffolgenden Jahrzehnten der Funkstille hatte Sky sie in seinem Testament bedacht! Immer noch fassungslos beäugte sie sich in dem halbblinden Spiegel über der Kommode. Eine alte Frau blickte ihr entgegen. Ihr Porzellanteint war für eine Siebzigjährige noch relativ makellos, dennoch nicht von Falten verschont geblieben. Ihr ehemals kupferfarbenes Haar fiel wie eh und je in wild gelockter Fülle über die Schultern, war aber längst silbergrau geworden. Sie war schlank geblieben, und die beim Umzug wiedergefundene, dreißig Jahre alte Jeans passte noch. Seit sie zu den »Silberellas« gehörte, wie ihr guter Freund Karl Grauhaarige immer genannt hatte, bevorzugte sie farbenfrohe Kleidung wie den sonnengelben Baumwollpulli, den sie heute trug. Eine Lage unterschiedlich langer Silberketten mit Anhängern diente als Ersatz für die schmerzlich vermissten Zigaretten, wenn sie mal wieder nicht wusste, wohin mit den Händen. Auf Make-up verzichtete sie, seit sie nicht mehr vor der Kamera stand. Manchmal benutzte sie einen kräftigen Lippenstift, und zu besonderen Gelegenheiten betonte sie ihre Augen mit Wimperntusche. Aber weder Schminke noch teure Cremes vermochten die Spuren eines ereignisreichen Lebens zu kaschieren. Siebzig Jahre waren eine sehr, sehr lange Zeit.
Zusammen mit ihrer besten Freundin Lore feierte sie heute den Einhundertvierzigsten. Schade, dass sie nicht ebenso viele Kerzen auf die Torte stecken konnten. Sie würden einem kleinen Fackelzug gleichen. Lore, die Realistische, würde sagen: »So viele Kerzen haben auf einem normalgroßen Kuchen gar keinen Platz. Und die erste Flamme wäre mit Sicherheit verloschen, wenn die letzte Kerze brennen würde.« Eine für jedes Jahrzehnt musste genügen, auch wenn das Moons Ansicht nach ein mickriger Ersatz war für all die erfüllten, schwierig-schönen Jahre, die sie beide seit jenen Tagen im Mai 1945 verband.
2
München, 7. Mai 1945
Elsa vergaß den ziehenden Schmerz im Rücken für einen Atemzug, als Veronika in die Großküche stürmte.
»Der Krieg ist aus!«, jubelte die Chefköchin der Frauenklinik in der Maistraße. »Hoffentlich erhalten wir jetzt wieder ausreichend Nahrungsmittel, um den Kranken stärkende Mahlzeiten zubereiten zu können.«
Elsa hingegen hoffte, endlich wieder ruhig schlafen zu können, keine Nächte mehr in Schutzkellern ausharren zu müssen und ein gesundes Kind zu gebären. Auch wenn sie diesem Tag voller Angst entgegensah.
»Die deutschen Streitkräfte haben heute bedingungslos kapituliert«, berichtete Veronika weiter. »Und auf dem Marienplatz sitzen unsere ›freundlichen Feinde‹ in ihren Jeeps und verteilen Schokolade.«
Elsa wusste aus dem Radio, dass am 30. April 1945 amerikanische Panzer durch München gerollt waren. Und dass am heutigen Tag die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Reims unterzeichnet wurde. In der ersten Woche nach dem sich abzeichnenden Kriegsende hatte sich die Bevölkerung noch zurückgehalten mit Jubelrufen. Zu lange hatte der grausame Krieg gedauert, und wie Elsa hatte kaum jemand geglaubt, dass es tatsächlich vorbei wäre mit dem Hunger, der Angst ums nackte Leben und der ungewissen Zukunft. Doch jeder Tag, der ohne Sirenengeheul verstrich, und jede Nacht, die die Menschen im eigenen Bett verbringen durften, ließ sie mehr und mehr an den Frieden glauben. Tage, an denen keine Bomben fielen, an denen die eigene Wohnung unversehrt blieb, schürten die Hoffnung auf ein normales Leben. Auf ein Leben, in dem jeder wieder seiner Arbeit nachgehen, Pläne schmieden und eine Familie gründen konnte. An solchen Tagen begann sie wie alle Menschen um sie herum von einer besseren Zukunft zu träumen.
Elsa zog die Hände aus dem Spülwasser und wischte sich eine Locke ihres dunklen Haars aus dem Gesicht, die unter dem Häubchen hervorgerutscht war. Sie wäre am liebsten sofort zum Marienplatz gerannt, um sich selbst von der unglaublichen Neuigkeit zu überzeugen. Doch es war bald so weit, das spürte sie an den stärker werdenden Wehen, und sie durfte die Klinik nicht verlassen.
»Es sind die Amis«, sagte Gerlinde, eine ledige Spülerin, die wie Elsa in der Klinikküche arbeitete. »Schwarze Männer sind auch dabei. Wenn sie lachen, sieht man ihre schneeweißen Zähne.«
Gerlinde war wie Elsa eine »Hausschwangere« und diente als Anschauungs- und Studienobjekt für Studenten und Hebammenschülerinnen. Dazu wurden sie einige Wochen vor der Entbindung in die Klinik aufgenommen, bekamen regelmäßig zu essen und hatten ein Dach über dem Kopf. Als Gegenleistung entrichteten sie bis zur Entbindung leichtere Arbeiten in der Küche, der Näherei oder der Wäscherei – und mussten ihre Kinder vor Gaffern auf die Welt bringen. Für unverheiratete oder auch ausgebombte, mittellose Frauen ohne Familie, Arbeit und ohne Krankenversicherung war dies die einzige Möglichkeit, nicht zwischen brennenden Trümmern gebären und das Neugeborene in Lumpen hüllen zu müssen.
Elsa hatte nach dem Tod ihres drei Monate alten Sohnes im Sommer 1942 so sehr auf neuen Nachwuchs gehofft. Im Oktober 1944, als ihr Mann Erich nach einer verheilten Verletzung wieder »kriegsverwendungsfähig« geschrieben wurde und zurück an die Ostfront musste, hatte sie gespürt, dass sich ihre Hoffnungen erfüllten. Anfang Dezember war dann ihre Zweizimmerwohnung nahe dem Schlachthof, wo Erich in Friedenszeiten gearbeitet hatte, vollkommen zerstört worden. Zu der Zeit verlor sie auch ihre Stelle als Schneiderin. Danach hatte sie den Haushalt der wohlhabenden Frau von Pöcking versorgt, die sich ihrer erbarmt und sie beim Eingemachten in der Speisekammer hatte schlafen lassen. Am 9. April war auch dieses Haus den Bomben zum Opfer gefallen und die Frau Gräfin dabei ums Leben gekommen. Die Gnädige hatte unter dem Jaulen des Voralarms Pelze und Schmuck zusammengerafft, es aber nicht mehr in den Schutzraum geschafft. Mit den nutzlosen Wertsachen in den Armen war sie von herabfallenden Trümmern erschlagen worden.
Verstört war Elsa nach dem Bombenangriff mit ihrem Notkoffer und dem alten Kinderwagen aus dem Luftschutzkeller gekrochen. Getrieben vom Überlebensinstinkt, hatte sie ohne nachzudenken zwischen den brennenden Ruinen nach Essen gesucht und lediglich ein unversehrtes Weckglas mit Erdbeeren gefunden. In diesem Moment hatte sie ihr Kind gespürt. Es wollte leben. Auch Elsa wollte weiterleben. Diesen grausamen Krieg überleben. Aber es war ein bitterkalter Frühling, und in ihrem Zustand mit nichts als einem Glas eingemachter Erdbeeren auf der Straße leben zu müssen, hätte es den Tod bedeuten können. Weinend war sie an unzähligen Leichen vorbei über vom Feuer aufgeweichte, streckenweise glühend heiße Teerstraßen gelaufen, nicht wissend, wohin. Irgendwann hatte sie sich an einen Litfaßsäulenanschlag in der Nähe der Frauenklinik in der Maistraße erinnert und sich mit letzter Kraft dorthin geschleppt. Doch der Krieg hatte auch das Krankenhaus nicht verschont. Sämtliche Fensterscheiben waren durch den Druck der Bombenangriffe zersplittert und notdürftig mit Pappe oder Decken verhängt, während vom Dach nur noch Fragmente zu erkennen waren. Es war ihr wie ein Wunder erschienen, dass sie nicht abgewiesen worden war. Erleichtert hatte sie die ebenso peinlichen wie schmerzhaften Untersuchungen durchgestanden, an ihr Kind gedacht und die Zähne zusammengebissen.
Jetzt spürte sie wieder ein starkes Ziehen im Rücken. Es war eine sehr heftige Kontraktion, und es fühlte sich so an, als wollte ihr Kind im nächsten Augenblick auf die Welt kommen. Auf eine Welt in Trümmern. In die Arme einer Mutter, die nicht einmal ein ordentliches Paar Schuhe besaß. An ihren Füßen steckten ein ramponierter brauner Halbschuh, der ausgetreten war, und ein etwas besserer, aber viel zu kleiner, schwarzer Schnürschuh, der bei jedem Schritt höllisch schmerzte.
»Trödel nicht, Elsa, die Teller spülen sich nicht von allein«, mahnte die Chefköchin ungeduldig und musterte sie gleichzeitig mit prüfendem Blick. »Oder bist schon so weit?« Sie war eine aufmerksame Beobachterin, der offensichtlich nicht entgangen war, dass Elsa sich den Rücken rieb. »Hast du schon Wehen? Soll ich die Hebamme rufen?«
»Nein, nein, es ist noch lang nicht so weit«, versicherte Elsa eilig und schüttelte den Kopf. »Ich muss nur dringend aufs Klo.« Das war gelogen und auch wieder nicht. Die Wehen waren in den letzten Stunden stärker geworden und kamen in immer kürzeren Abständen. Es dauerte nicht mehr lange, das wusste sie von der ersten Geburt. Nur mit allergrößter Anstrengung war es ihr gelungen, während der Arbeitszeit darüber hinwegzuatmen und nicht laut aufzustöhnen.
»Dann verschwinde«, sagte die Köchin, die ein mitfühlendes Herz für die bedauernswerten Hausschwangeren hatte.
Elsa bedankte sich und lief, so schnell die ungleichen Schuhe es zuließen, aus der Küche. Die Bewegung tat ihr gut, die Wehen wurden etwas erträglicher. Der Druck auf die Blase nicht. Sie musste eine Toilette finden. Sofort. Danach würde sie sich überlegen, was sie tun wollte. Aber auf keinen Fall würde sie sich im Zimmer der Hausschwangeren in ihr Bett legen, um sich ein wenig auszuruhen. Dort wurde kontrolliert, und die Hebammen ließen sich nicht täuschen. Sie würden nachsehen, wie weit der Muttermund geöffnet war, und wissen, dass es bald so weit sein würde. Das bedeutete die sofortige Verlegung in den Hörsaal, zu den Gaffern.
Keuchend schleppte Elsa sich die endlosen Flure entlang, ängstlich darauf bedacht, sich nicht an den zersplitterten Fensterscheiben zu verletzen. Die fensterlosen Gänge wiederum waren dicht belegt mit vor sich hin dämmernden Kranken und wimmernden Verwundeten, die sie wegen ihres weißen Kittels für eine Krankenschwester hielten und hilfesuchend die Hände nach ihr ausstreckten.
Endlich fand sie eine Toilette, in der sich niemand aufhielt. Aufatmend streichelte sie über den hart gewordenen Bauch und flüsterte: »Du bist ein Glückskind.« Nachdem sie sich erleichtert hatte, wusch sie sich überall gründlich, so gut es über dem Waschbecken möglich war. Noch während sie ihr glühend heißes Gesicht mit kaltem Wasser kühlte, beschloss sie, ihr Kind lieber allein auf die Welt zu bringen, als sich mit gespreizten Beinen vor die Hebammenschülerinnen und Studenten zu legen. Die vielen Untersuchungen in den vergangenen Wochen, die bohrenden Blicke und ungeschickten Hände der Anfänger waren demütigend genug gewesen. Es war ihre zweite Geburt, irgendwie würde sie es schon schaffen. Sie musste nur einen Ort finden, wo sie liegen konnte. Vielleicht in einer der Kammern, wo Putzmittel und Wäsche aufbewahrt wurden. Darin fände sie bestimmt auch ein sauberes Leintuch, um das Neugeborene einzuwickeln. Wenn alles vorbei war, würde sie behaupten, es sei eine Sturzgeburt gewesen. Eine solche hatte sie zu Hause auf dem Bauernhof einmal bei einer Magd miterlebt. Wenn nötig, konnte sie alle Einzelheiten dazu liefern.
Bevor sie die Toilette verließ, nahm sie das Kopftuch ab und zog die Schürze aus, um nicht von einer der Schwestern als Küchenhilfe erkannt zu werden. Sie wickelte beides zu einem Packen zusammen und hastete weiter. Aber so weit sie auch lief, sie fand keinen Wirtschaftsraum. Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie sich schon durch die endlosen Gänge und verschiedenen Stockwerke schleppte. Der inzwischen eingetretenen Dämmerung nach zu schließen war sie den ganzen Nachmittag unterwegs gewesen. Ihr Blick irrte durch den leeren Flur vor ihr. Hier standen keine Betten, sie schien sich auf die Privatstation verirrt zu haben.
Eine besonders starke Wehe ließ Elsa aufstöhnen. Mit aller Kraft stemmte sie sich gegen die Wand, doch vergebens. Der übermächtige Schmerz ließ sie leise wimmernd auf den Fußboden sinken. Wenn jetzt jemand vorbeikäme, wäre ihr Versteckspiel umsonst gewesen. Hechelnd erduldete sie den sich ausbreitenden Schmerz. Die Wehe ebbte genau in dem Moment ab, als sie Stimmen vernahm. Männerstimmen. Mühsam rappelte sie sich auf, presste das Kittelpäckchen vor den steinharten Bauch und zwang sich zu einem möglichst normalen Schritttempo. Die Stimmen kamen näher. Schemenhaft erkannte sie zwei Männer in hellen Kitteln. Es mussten Ärzte oder Pfleger sein. Auf jeden Fall bedeuteten sie Gefahr, aber weit und breit war keine Abzweigung, die sie hätte nehmen können. Der einzige Ausweg war die Flucht in eines der Krankenzimmer. Um diese Zeit schliefen die meisten Patienten bereits, vielleicht konnte sie sich irgendwo leise hineinschleichen und dort für ein paar Minuten verstecken. Das nächste rettende Zimmer war nur einen Schritt entfernt. Vorsichtig drückte sie die Klinke nach unten, öffnete die Tür und spähte hinein. Sie sah nur zwei Betten, eines am Fenster, das andere dicht an der Tür. Sie war tatsächlich auf der Privatstation. Darauf konnte sie jetzt allerdings keine Rücksicht nehmen, denn die Männer kamen näher. Auf Zehenspitzen schlüpfte sie in den Raum, schloss die Tür so sachte wie möglich und lauschte in die Stille.
»Schwester?«
Elsa fuhr herum und blinzelte in das plötzlich aufflackernde Licht. Eine junge blonde Frau lag in den weißen Kissen und starrte sie aus großen blauen Augen an.
»Entschuldigung …«, hauchte Elsa.
Die Stimmen auf dem Flur waren nun ganz deutlich. Die Männer mussten sich direkt vor der Tür unterhalten.
»Bitte, verraten Sie mich nicht«, flehte Elsa verzweifelt und legte eine Hand auf ihren Leib. »Ich muss mich verstecken …« Die nächste Wehe unterbrach ihre Erklärung. Sie biss sich in die Hand, um nicht laut aufzustöhnen.
Die Frau starrte von Elsas Bauch in ihr schmerzverzerrtes Gesicht, flüsterte: »Dort«, und wies mit der Hand auf das leere Bett am Fenster.
Es klopfte. Ihre Retterin löschte das Licht. Elsa schaffte es gerade noch, sich auf den Boden zu legen und unter das Bett zu kriechen. Unbeweglich lag sie da, wagte kaum zu atmen oder sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Da wurde die Tür auch schon geöffnet, jemand brummelte: »Und?«, eine andere Stimme entgegnete leise: »Alles ruhig«, worauf sich die Tür wieder schloss.
Bange Sekunden verstrichen, bis Elsa die Frau leise sagen hörte: »Sie sind weg.«
Elsa robbte unter dem Bettgestell hervor und hangelte sich mühsam hoch. »Danke, vielen, vielen Dank. Sie haben mir …«, sagte sie, bevor ihr schwarz vor Augen wurde.
Elsa wusste nicht, wie lange sie ohnmächtig gewesen war. Als sie wieder zu sich kam, konnte sie sich kaum bewegen, nur spüren, dass sie auf dem Rücken lag und zugedeckt war. Lag sie in einem Bett? Nein. Es fühlte sich eher an, als wäre sie verschüttet worden. Als läge sie unter Trümmern. Ihr ganzer Körper schmerzte entsetzlich. Ängstlich tastete sie nach ihrem Bauch. Er war flacher, fühlte sich hart an. Weiter unten spürte sie einen Verband. Sie stöhnte unter ihrer eigenen Berührung auf. Es tat höllisch weh. Was war geschehen? Hatte sie entbunden? Wo war das Kind? War es gesund? Am Leben? Blinzelnd versuchte sie sich zu orientieren. Sie erkannte einen hellen Raum. Leises Gemurmel drang zu ihr. Langsam drehte sie den Kopf nach beiden Seiten. Sie lag in einem Krankenzimmer mit mindestens sechs Betten, soweit sie das im Liegen erkennen konnte. Und sie hatte Durst. Schrecklichen Durst. Ihre Lippen fühlten sich ausgetrocknet an, die Zunge war pelzig und brannte, als habe sie tagelang nicht einen Schluck Wasser getrunken.
»Na, aufgewacht?«, fragte eine weibliche Stimme.
Gleich darauf tauchte ein rundliches Gesicht auf, und sie sah eine Krankenschwester in weißer Uniform mit einer Haube auf dem Kopf.
Elsa wollte fragen, was mit ihr und dem Kind geschehen war, brachte aber nur ein kratziges »Wo?« zustande.
»Es ist ein Mädchen.« Die Schwester lächelte schmallippig. »Sie ist gesund und munter. Ziemlich mager, kaum zweieinhalb Kilo schwer, aber so mickrig sind in diesen Zeiten alle Neugeborenen. Dafür hat sie sehr lange Beine und viele Haare. Leider sind sie rot!«
Elsa schwirrte der Kopf. Hatte sie richtig verstanden? Sie hatte ein Mädchen geboren. Ein bedauernswertes Geschöpf mit roten Haaren. Es war ihr unmöglich, sich zu konzentrieren. »Ich … habe … Durst«, stammelte sie.
Die Schwester nickte und entfernte sich. Wenig später kam sie mit einem Schnabelbecher zurück und flößte ihr eine Flüssigkeit ein, die nach ungesüßtem Kamillentee schmeckte.
Der quälende Durst verschwand. »Wo bin ich hier?«
»In der Frauenklinik in der Maistraße, und ich bin Schwester Gottelinde«, sagte die Weißgekleidete und erklärte, was geschehen war. Nachdem Elsa ohnmächtig geworden war, habe eine Patientin die Notklingel betätigt. Danach war sie in den Kreißsaal gebracht worden, wo die Ärzte nach kurzer Untersuchung einen Kaiserschnitt angeordnet hätten. Sie habe viel Blut verloren, eine große Narbe, daher rührten die Schmerzen, und sehr lange geschlafen.
Ängstlich blickte Elsa sie an. »Und mein Kind?«
»Vollkommen gesund, bis auf die roten Haare. Ihr Mädel ist auf der Säuglingsstation«, erklärte die Schwester. »Ruhen Sie sich erst mal aus, wenn es Ihnen besser geht, dürfen Sie es sehen.«
Elsa schloss die Augen. Sie hätte nicht sagen können, ob sie glücklich war oder traurig. Sie war nur müde, unendlich müde – und froh, es überstanden zu haben. Auch wenn sie nicht wusste, wo sie nach der Entlassung unterkommen, wie sie das Baby ernähren oder wie sie ohne Geld und eine Bleibe überleben sollte. Trotz der Sorgen und Zukunftsängste fiel sie in einen erlösenden Dämmerschlaf.
»Wie geht es Ihnen?«
Elsa hörte die besorgte Frage wie aus weiter Ferne. Als sie die Augen erneut öffnete, sah sie eine junge Frau an ihrem Bett sitzen. Sie musste wie sie Mitte zwanzig sein, trug einen dunkelblauen Morgenmantel mit weißem Blumenmuster. Das halblange dunkelblonde Haar war in hübsche Locken gelegt, als käme sie aus Friedenszeiten, in denen Frauen sich beim Friseur Wellen legen ließen. War sie auch eine Hausschwangere? Kannten sie sich aus dem Kreißsaal?
»Möchten Sie etwas trinken?« Die Besucherin erhob sich, griff nach der Schnabeltasse, die auf dem Nachtkästchen stand, gab ihr einen Schluck und fragte: »Erinnern Sie sich nicht an mich?«
Gierig sog Elsa den kalt gewordenen Tee ein. »Vielen Dank … Aber ich weiß leider nicht …«
Die Frau beugte sich über sie und flüsterte ihr ins Ohr: »Sie kamen vorgestern Nacht in mein Zimmer …«
Erschrocken blickte sich Elsa nach der Schwester um.
Die Besucherin blinzelte ihr zu. »Keine Angst, ich habe gesagt, Sie hätten sich verlaufen … Ich heiße Hilde Lemberg … einige Stunden nach Ihnen habe ich auch mit einem Mädchen entbunden«, redete sie weiter. »Wir werden es auf den Namen Hannelore taufen lassen. Und wie heißt Ihre Kleine?«
»Meinem Mann gefällt Marion …«, begann Elsa. Dann fiel ihr ein, dass sie der Dame zu großem Dank verpflichtet war. »Ich heiße Elsa Neubauer, Sie haben mir und meinem Kind das Leben gerettet. Wie kann ich das wiedergutmachen?« Dass sie auf der Flucht vor den Schülerinnen und Studenten gewesen war, verschwieg sie lieber.
»Das war doch selbstverständlich.« Hilde legte ihre Hand auf Elsas Arm. »Besuchen Sie mich doch mal, wenn Sie entlassen werden. Sicher hat es etwas zu bedeuten, dass uns die tragischen Umstände ausgerechnet am Kriegsende zusammengeführt haben. Und unsere Mädchen in den Frieden hineingeboren wurden, wie Botschafterinnen, die eine neue Zeit verkünden. Das sollten wir ein klein wenig feiern.« Sie lächelte. »Wir wohnen in der Herthastraße, in der Nähe des Nymphenburger Schlossparks. Hier, ich habe die genaue Adresse aufgeschrieben.« Sie legte einen Zettel auf den Nachttisch.
»Herthastraße, Nähe Schlosspark«, wiederholte Elsa, und vor ihrem geistigen Auge erschien ein wunderschönes Haus mit Garten, in dem lachende Kinder spielten. Was für eine heilsame Vorstellung, dachte sie lächelnd. »Vielen Dank für die Einladung, ich komme gerne.«
»Das genügt für heute«, ertönte aus dem Hintergrund die strenge Anweisung. Sekunden später rauschte die Schwester heran und wies mit unmissverständlicher Miene auf das Ende der Besuchszeit hin.
Hilde Lemberg wiederholte ihre Einladung und verabschiedete sich fröhlich winkend mit: »Bis bald, Elsa«, als befände sich das Land in paradiesischen Friedenszeiten, wo man eine liebe Freundin zu Kaffee und Kuchen einlud.
»Bis bald«, sagte auch Elsa und nahm sich fest vor, Hilde Lemberg eines Tages zu besuchen.
Die allgemeine Notsituation, die mangelnde medizinische Versorgung und das auch für Kranke rationierte Essen ließen Elsas Kaiserschnitt nur langsam heilen. Es dauerte drei Wochen, doch sie war glücklich, ihre vollständige Genesung im Wochenbett abwarten zu dürfen. Besseres und mehr Essen hatte sie sich mit dem einzigen Schmuck erkauft, den sie besaß: einem Granatherz an silberner Kette, das Erich ihr damals zur Geburt ihres Sohnes geschenkt hatte. Doch wie hätte ihr Körper sonst genügend Milch für ihr kleines Mädchen gehabt? Marion war so entsetzlich mager, dass Elsa mehr als einmal um das Leben ihres Kindes fürchtete. Hätte man ihren Schmuck nicht akzeptiert und sie nicht auf der Entbindungsstation behalten, die Kleine hätte nicht überlebt. Dem Entlassungstag sah sie mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach wie vor wusste sie nicht, wohin. Sie besaß nichts mehr, das sie gegen eine Unterkunft hätte eintauschen können. Ihre wenigen Kleider in einem Koffer, der geflochtene Korbkinderwagen und die Babywäsche von ihrem verstorbenen Sohn waren ihre gesamte Habe. Zu gerne hätte sie Hilde Lemberg besucht, doch mit leeren Händen bei ihrer Retterin aufzutauchen war beschämend.
Die Sonne schien, und es war immer noch Frieden, als Elsa schließlich die Klinik verlassen musste und auf die Straße trat. Große Zuversicht spürte sie jedoch nicht, als sie mit dem Kind im Wagen die Lindwurmstraße entlang Richtung Sendlinger Tor lief. Sie achtete nicht auf die Ruinen, umrundete die zahlreichen Bombenlöcher und versuchte, die beißenden Gerüche nach verwesenden Leichen zu ignorieren. Sie wollte möglichst schnell zum Marienplatz, wo die Amis Süßigkeiten verteilten, wie Besucher erzählt hatten. Schokolade! Das wäre das passende Geschenk, um sich bei Hilde Lemberg zu bedanken. Wie lange hatte sie solch eine Köstlichkeit nicht mehr genossen? Sie erinnerte sich an eine Tafel, die Erich ihr 1943 zu Weihnachten geschenkt hatte. Ob er überhaupt noch lebte? Den Gedanken an seinen möglichen Tod verdrängte sie. Lieber dachte sie an seinen letzten Brief vom Januar, als sie noch in der Zweizimmerwohnung gewohnt und jeden Abend für seine gesunde Rückkehr gebetet hatte. Als die Wehrmacht am 1. September 1939 in Polen einmarschiert war, war laut verkündet worden, dass die Soldaten bis Weihnachten wieder zu Hause wären. Niemand hatte ahnen können, dass Hitler mit diesem Überfall die ganze Welt ins Verderben stürzen würde.
Elsa musste nur die Augen schließen, und sie sah Erichs krakelige Schrift vor sich, die ihr verriet, wie sehr er sich mit dem Schreiben abgemüht hatte. Den Inhalt des Briefes konnte sie auswendig aufsagen:
Meine liebe Elsa,
Du hättest meinen Freudensprung sehen sollen, als ich die freudige Nachricht gelesen habe. Es wird ein Bub, da bin ich mir ganz sicher. Wir wollen ihn Moritz nennen. Das beiliegende Pferd habe ich für ihn geschnitzt, hoffentlich kommt es heil an. Aber wenn’s doch ein Mäderl wird, was Gott verhüten möge, dann nennen wir es halt Marion nach meiner Schwester.
Pass immer gut auf Dich auf und iss ordentlich, die gnädigste Frau Gräfin hat ja genug, sie wird Dir schon was abgeben.
Wie es mir im Felde ergeht, darüber könnte ich viel schreiben. Doch es sind hässliche Geschichten, und Papier ist knapp, deshalb beschränke ich mich auf das Wichtigste. Ich freue mich schon auf den Frieden, und auf Dich natürlich. Wenn es Dir möglich ist, schicke mir bitte ein Paar Wollsocken und lange Unterhosen. Es ist bitterkalt hier im Felde, da braucht Dein Mann was Warmes.
Es grüßt Dich Erich, Dein lieber Mann
Das Holzpferdchen war angekommen, und sie hatte ihm ein Paar Wollsocken gestrickt, aber ob er die erhalten hatte, wusste sie nicht. Ihre späteren Briefe waren unbeantwortet geblieben. Sie unterdrückte ihre Angst, dass er vielleicht verwundet worden war. Versagte sich, daran zu denken, warum keine Antwort kam oder wie es ihm ging. Innerlich hielt sie daran fest, dass er am Leben war und seine Briefe in den Kriegswirren verloren gegangen waren. Ob sie ihm von seiner Tochter schreiben sollte? Würde er auch ein Mädchen lieben können? Würde er sich trotzdem freuen? Mit diesen bangen Gedanken schob sie den Kinderwagen die von Fliegerangriffen aufgerissene Straße entlang, Schuttbergen und Bombenlöchern ausweichend. Überall nur Ruinen und Zerstörung, so weit das Auge reichte. Gab es überhaupt noch intakte Häuser? Wie lange würde es dauern, bis alles wieder aufgebaut war? Vermutlich Jahrzehnte, womöglich ein Menschenleben lang. »In welch eine Zukunft habe ich dich hineingeboren, mein armes, armes Kind«, flüsterte sie weinend, beugte sich über die schlafende Marion und drückte ihr einen sanften Kuss auf die Stirn. Wie sollte es nur weitergehen in diesen Notzeiten, in denen niemand genug zu essen hatte? Wie lange würde sie noch Milch haben? Wie lange würde sie ihr Kind ernähren können? Wo würden sie unterkommen?
Mehrmaliges Hupen schreckte sie auf. Die Kleine schlug die Augen auf und begann zu weinen. Abrupt blieb Elsa stehen, sah sich ängstlich nach einem Versteck um. In den Ruinen? Dort waren einige Frauen dabei, den Schutt wegzuschaufeln. Doch da hielt bereits ein offener Jeep dicht neben ihr. Zwei schwarze Männer in Uniform mit kahl geschorenen Köpfen lachten sie an.
»Hey, sweet Mama!«
Das mussten die »freundlichen Feinde« sein, von denen Veronica erzählt hatte. Sie wirkten nicht bedrohlich. Aber es kursierten auch Geschichten von Vergewaltigungen. Nervös wischte sie sich die Tränen von den Wangen, lächelte unsicher und wollte ihren Weg fortsetzten, als einer der beiden ausstieg und sich über den Korbwagen beugte.
»Cute baby«, sagte er und hielt ihr eine Dose sowie etwas Weißes, Längliches entgegen. »For you.«
Als sie es nicht sofort annahm, legte er die beiden Dinge in den Kinderwagen, stieg wieder in den Jeep und fuhr mit seinem Kumpel winkend davon. Das Baby beruhigte sich, Elsa atmete erleichtert auf und betrachtete neugierig die Geschenke. In der Dose war Fleisch! Sie konnte es kaum fassen, doch es war deutlich an dem Aufkleber zu erkennen. Ein Hochgefühl durchströmte sie, als hielte sie ein Vermögen in der Hand. Behutsam versteckte sie die Dose unter Marions Decke, als wäre es eine zerbrechliche Kostbarkeit. Das andere Geschenk passte in ihre Hand. »Gum«, las sie halblaut, konnte sich aber nichts darunter vorstellen. Verbargen sich in dem weißen Papier etwa Zigaretten? Nein, deren Verpackungen sahen anders aus. Es roch auch nicht nach Tabak. Möglicherweise überdeckte der allgegenwärtige Gestank aus den Ruinen nach Verbranntem und Verwesung feinere Düfte. Aber was auch immer sie da in Händen hielt, es ließe sich bestimmt für etwas eintauschen. Mit neu erwachtem Mut blinzelte sie in die Sonne. Es war Frieden, und es konnte nur, ach was, es würde ganz sicher besser werden. Alles war besser, als stundenlang im Luftschutzkeller auszuharren, beständig in der Angst, das Gebäude könnte über einem einstürzen oder die Wucht der Mineneinschläge einem die Lunge zerreißen.
Elsa beschloss, direkt in die Herthastraße zu laufen, um sich bei Hilde Lemberg zu bedanken. Es war ein weiter, beschwerlicher Weg; mit dem quietschenden Kinderwagen galt es, die Bombenkrater zu umrunden oder den mit Bündeln beladenen Menschen auszuweichen, die offensichtlich ebenso wenig wussten, wohin. Aber trotz der ungleichen Schuhe, die sie jeden Schritt schmerzhaft spüren ließen, wollte sie sich davon überzeugen, ob das Haus mit dem Garten tatsächlich existierte, das sie sich im Wochenbett erträumt hatte. Möglicherweise war es nichts als eine Wunschvorstellung, aber wovon sollte eine Obdachlose wie sie sonst träumen?
Erschöpft kam sie am frühen Abend in der Herthastraße an. Sie war die Nymphenburger Straße entlanggegangen, hatte einige Male pausiert, sich bettelnden, kriegsversehrten Soldaten erwehrt oder einen ruhigen Platz in den brandgeschwärzten Ruinen gesucht, um dem Kind die Brust zu geben und es notdürftig zu wickeln. Es schien fast unmöglich, sich in der Steinwüste zurechtzufinden, in den Überresten die altbekannten Häuser wiederzuerkennen, geschweige denn, die einfachen Holzkreuze zu ignorieren, die Tote unter den Trümmern anzeigten. Und es zerriss ihr das Herz, den bettelnden, abgemagerten Kindern nichts geben zu können.
Schließlich kam sie vor dem Haus Nummer 31 an. Es war ein zweistöckiges gelbes Gebäude mit großen Dachgauben, leicht vergilbten Holzläden an den Fenstern und einem Balkon auf Säulen, der den Eingang überdachte. Das Anwesen war umgeben von einem grün gestrichenen Lattenzaun, hinter dem sie blühende Obstbäume und pickende Hühner auf der Rasenfläche erblickte. Das Haus war nicht so prächtig wie in ihrer Fantasie, verfügte aber über eine breite Freitreppe zum Eingang und war, abgesehen von wenigen zerbrochenen Fensterscheiben, vollkommen unversehrt.
Sie war im Paradies angekommen.
3
München, Weihnachten 1948
Hilde Lemberg musterte den übersichtlichen Inhalt ihres Kleiderschranks und überlegte, welches von den warmen Stücken sie entbehren konnte. Obwohl sie beständig etwas verschenkte, besaß sie immer noch drei Pullover, zwei Strickjacken, fünf Wollröcke, zwei Skihosen, Handschuhe, Mützen und Schals. Einiges davon wollte sie an das Rote Kreuz weitergeben. Es war ihr unerträglich, jeden Tag aufs Neue zu hören, wie sehr die Menschen drei Jahre nach Kriegsende immer noch Not und Hunger litten. Nur wer amerikanische Zigaretten auftreiben konnte und mutig genug war, sich auf die Schwarzmärkte zu wagen, bekam, wonach ihm gelüstete, sogar das begehrte Schweineschmalz in Dosen. Die weniger Glücklichen mussten sich auf Hamsterfahrt ins Münchner Umland begeben oder mit den 950 Kalorien begnügen, die es pro Tag mithilfe der Lebensmittelkarten gab. Im Winter reichte das kaum zum Überleben. Beinahe noch katastrophaler war die Wohnungsnot. Nicht alle durch die Bomben obdachlos gewordenen Bewohner fanden Unterschlupf bei Verwandten. Die meisten wurden in Baracken einquartiert oder bei Fremden zwangseingewiesen. Weder die fast vollständig zerstörte historische Altstadt noch die unbewohnbaren Wohnhäuser waren wieder aufgebaut worden. Es würde Jahrzehnte dauern, obwohl sich Tausende Freiwillige bemühten, die Trümmer mit bloßen Händen wegzuschaffen. Nur wenige lebten im eigenen unversehrten Haus mit Garten, in dem sie Gemüse anpflanzen und sogar ein paar Hühner halten konnten, so wie ihre Familie. Friedrich, ihr Ehemann, hatte 1944 seinen Bruder mit Frau und den beiden Kindern aufgenommen. Die vier hatten ihre Wohnung durch einen Bombenangriff verloren und bis Ende 1947 im Haus gewohnt. Trotz der räumlichen Enge wegen der Verwandtschaft war Hilde Lemberg dankbar für ihr privilegiertes Leben. Geboren und aufgewachsen in einem wohlhabenden Elternhaus mit Personal und durch ihre Verheiratung mit dem Schuhfabrikanten Lemberg junior gesellschaftlich aufgestiegen, kannte sie weder Hunger noch wirtschaftliche Not. Erst in den letzten beiden Kriegsjahren, als die Materiallieferungen für die Schuhherstellung ins Stocken geraten war, hatten sie Angestellte entlassen müssen. Die Fabrikation war schließlich zum Stillstand gekommen, und es waren karge Zeiten angebrochen. Im letzten Kriegsjahr, als sie das Dienstmädchen nicht mehr hatten bezahlen können, war dieses über Nacht verschwunden, nicht ohne vorher noch die Speisekammer leer zu räumen.
Hilde bemühte sich fortan nach Kräften, das große Haus mit dem Salon, den sechs Schlafzimmern, den zwei Bädern, der Wohnküche und die für ihren Schwiegervater ausgebaute Dachwohnung allein sauber zu halten. Doch die Pflege der wertvollen antiken Einrichtung, das Ausklopfen der Perserteppiche und die mühsame Wäschepflege war eine kaum zu bewältigende Plage. Sie bereute, nie kochen gelernt zu haben, und hoffte täglich, ihr Mann möge über ihre rudimentären Kochkünste hinwegsehen. Auch über den Anbau von Gemüse wusste sie lediglich, dass es in der Erde wuchs. Als sie guter Hoffnung war, hamsterte ihr Schwiegervater Butter, Mehl und zwei Kisten Zigaretten. Dem Hamstergut und einem Paar ihrer schönsten Schuhe verdankte sie das luxuriöse Klinikbett und die Erster-Klasse-Geburt. Ihre glückliche Lage war ihr einmal mehr bewusst geworden, als die von Wehen gezeichnete Elsa Schutz in ihrem Krankenzimmer gesucht hatte.
Nie würde sie vergessen, wie Elsa drei Wochen später glücklich gelächelt hatte, als sie ihr das Gartentor geöffnet hatte. Anscheinend hatte sie damit gerechnet, doch abgewiesen zu werden, dabei war Hildes Einladung ernst gemeint. Von der Krankenschwester hatte sie von Elsas Schicksal als Hausschwangere erfahren und war zutiefst erschüttert gewesen. Sie selbst hatte drei Tage lang mit mäßigen Wehen im Klinikbett gelegen, denn Lorchen wollte einfach nicht schlüpfen, wie ihr Mann es ausdrückte. Als ahne das Ungeborene, in welchem Zustand es die Welt vorfinden würde. Friedrich hatte gescherzt, das kleine Lorchen fürchte sich vielmehr vor den abenteuerlichen Kochkünsten ihrer Mutter. Als Friedrich von Elsas Situation, ihrer Arbeits- und Wohnungssuche erfuhr und hörte, dass sie kochen konnte und bereits im Haushalt tätig gewesen war, rief er: »Sie schickt uns der Himmel«, und bot ihr spontan eine Stelle als Haushälterin in der Villa an. Es sei ein großes Haus, seine Frau käme nicht damit zurecht. Hilde wusste, dass er großes Mitleid mit der obdachlosen Elsa hatte. So war allen geholfen. Elsa nahm die Stelle nur zu gern an, und zur Feier verspeisten sie gemeinsam die Dose Corned Beef mit Bratkartoffeln und ein paar Eiern zum Abendessen.
Anfangs bestand Elsas Lohn aus dem Dienstbotenzimmer im Souterrain, neuen passenden Schuhen, einigen abgelegten Kleidern von Hilde, Babywäsche für die kleine Marion und natürlich Essen. Hilde war es peinlich, sie nur mit Naturalien bezahlen zu können, Elsa dagegen war überglücklich, ihr Kind nicht zu fremden Menschen oder in ein Heim geben zu müssen. Seit der Währungsreform am 20. Juni erhielt Elsa zusätzlich 20 Mark für ihre Dienste.
Hilde war über die Maßen erleichtert, in Elsa eine tatkräftige Hilfe und in der kleinen Marion eine Spielgefährtin für ihre Tochter gefunden zu haben. Elsas erfinderischen Kochkünsten und den Hühnern ihres Schwiegervaters war es zu verdanken, dass sie den quälend langen Hungerwinter 1946/1947 überlebt hatten. Jener Winter war der kälteste und längste des Jahrhunderts. Im vorangegangenen heißen, trockenen Sommer waren die Ernteerträge noch unter den bescheidenen Erwartungen ausgefallen. Die Versorgungslage verschlechterte sich von Woche zu Woche. Es gab einfach nichts zu essen. Alle hungerten, waren klapperdürr, und das tägliche Leben war geprägt vom stundenlangen Anstehen nach Lebensmitteln oder der Suche nach Brennmaterial. Hilde beobachtete immer wieder, wie die Leute in den Schuttbergen nach Fenster-, Türrahmen oder Parkettdielen wühlten, die wertvoller waren als Gold, denn durch die tägliche Stromabschaltung war man auf Holzfeuer angewiesen. Hilde war dem Himmel jeden Tag aufs Neue dankbar, dass er ihr Elsa geschickt hatte. Staunend beobachtete sie, wie die patente junge Frau zusammen mit ihrem Schwiegervater eine Kochkiste zimmerte, in der Kartoffeln nach kurzem Aufkochen über Stunden garten. Und den Griesbrei für die Kinder stellte sie zum Aufquellen einfach in die Babybettchen, die zugleich schön warm wurden. Mit Schaudern hörte sie beim Anstehen nach Brot die Geschichten von ungeheizten Wohnungen, in denen die Federbetten so klamm waren, dass sie nicht mehr wärmten. Man erzählte sich auch von Tellern, die im Küchenschrank mit einer Eisschicht zusammenklebten, und von eingefrorenen Wasserleitungen. Der Weiße Tod forderte in Europa Hunderttausende Opfer. Der Boden war wochenlang derartig durchgefroren, dass die bedauernswerten Toten nicht einmal beerdigt werden konnten.
In diesen entbehrungsreichen Jahren kümmerte sich Hilde um die beiden kleinen Mädchen, während Elsa den Haushalt versorgte, Hildes alte Kleider für die Kinder umarbeitete, Essen kochte oder auf dem Schwarzmarkt in der Möhlstraße das Familiensilber gegen Lebensmittel eintauschte. Und wenn sie erfolglos zurückkam, zauberte sie aus einer einzigen Kartoffel, einer halben Zwiebel und gesammelten Kräutern eine köstliche Suppe. Sonntags gab es falsches Beefsteak aus eingeweichtem, ausgedrücktem Brot, das mit klein geschnittenen Zwiebeln, Kräutern und Gewürzen vermengt, in Mehl gewälzt und im Rohr gebacken wurde. Nachmittags tranken sie Kaffee aus gerösteten Bucheckern, dazu gab es Grießplätzchen. Und letztes Weihnachten hatte Elsa falsches Marzipan aus Kartoffeln und Puderzucker hergestellt.
Dieses Jahr würden sie nun endlich wieder mit einem richtigen Tannenbaum, echten Butterplätzchen und einigen Geschenken feiern. Seit der Währungsreform war die größte Not vorbei. Friedrich hatte Leder und lang entbehrte Arbeitsmaterialien erhalten. Die Schuhproduktion war seitdem in vollem Gange, und die finanzielle Lage hatte sich merklich verbessert. Auch die Schaufenster waren über Nacht mit den herrlichsten Dingen gefüllt. Doch am glücklichsten war Hilde, weil sie ihr Haar nicht mehr mühsam selbst waschen musste, sondern sich wieder die lang vermissten Friseurbesuche und eine luxuriöse Maniküre leisten konnte. Der Coiffeur im Hotel Bayerischer Hof hatte ihr schulterlanges Haar auf Kinnlänge geschnitten, es platinblond gefärbt, aufgedreht und asymmetrisch aus dem Gesicht gekämmt, wie es jetzt bei den großen Hollywooddiven Mode war. Genau so trugen es Jean Harlow und Marlene Dietrich, und Hilde fühlte sich mindestens glamourös wie ein Filmstar seit ihrem letzten Friseurbesuch.
An Heiligabend versammelten sich alle zum Mittagessen am Küchentisch. Es gab Steckrübensuppe und Brot mit guter Butter, die Elsa gegen Babykleidung eingetauscht hatte. Am Abend würden sie Sauerkraut mit Bratkartoffeln essen, dazu für jeden ein Paar knuspriger Bratwürstchen. Und am ersten Feiertag würde endlich wieder eine Gans im Rohr brutzeln.
Nach der Suppe wechselte die Familie ins Wohnzimmer, um dem »Christkind« beim Schmücken des Tannenbaums zu helfen. Hilde zündete die letzte Kerze am Adventskranz an, und Opa Lemberg heizte den Kamin ein. Als Friedrich aus der Fabrik nach Hause kam, wechselte der Hausherr den Anzug gegen eine abgetragene Hose, um den ersten Friedensweihnachtsbaum zurechtzusägen. Zwei, drei Fehlversuche später war er zwar um einige Zentimeter kürzer, aber er passte in den gusseisernen Baumständer. »Meine handwerklichen Fähigkeiten sind ziemlich stümperhaft«, gab er freimütig zu.
»Immerhin steht er gerade«, kommentierte Hilde, die zufrieden das Werk ihres Ehemanns betrachtete.
»Und die Aktion ist ohne Blutvergießen abgelaufen«, scherzte Friedrich, während er sich die Hände rieb.
Im Radio wurden nicht nur besinnliche deutsche, sondern auch fröhlichere amerikanische Weihnachtslieder gespielt. Bing Crosby sang Jingle Bells, und Hannelore hüpfte Hand in Hand mit Marion durch den Salon. Später las Opa Lemberg den Kindern Weihnachtsgeschichten vor. Elsa sortierte schweigend die verhedderten Lamettafäden. Hilde ahnte, warum sie so still war. Elsa wartete sehnlichst auf Post von Erich, der nach den letzten Informationen in russischer Gefangenschaft war.
»Schön vorsichtig«, ermahnte Hilde die Mädchen, als sie den Baumschmuck ausgepackt hatte und die beiden je eine bunte Kugel zu ihrem Mann tragen durften, der traditionell das Schmücken übernahm. Anschließend steckte sie die wenigen noch aus Friedenszeiten übrigen Bienenwachskerzen in die Halterungen und verteilte gemeinsam mit Elsa die Lamettafäden.
»Papi, kommt jetzt endlich das Christkind?«, wollte Hannelore wissen, die seit Tagen ungeduldig war.
»Erst, wenn es dunkel geworden ist«, erklärte Friedrich Lemberg seiner Tochter zum wiederholten Male.
Hildes Schwiegervater beschäftigte die Kinder nach dem Vorlesen noch eine Weile mit dem Aufbau der Weihnachtskrippe. Danach schlug er vor, die inzwischen neu angeschafften Hühner zu füttern und jedem einen Namen zu geben, was auf große Begeisterung stieß. Ihr Mann begab sich ins Bad, um sich für die Bescherung zu rasieren. Hilde und Elsa bestückten noch die gezackten Pappteller mit den selbst gebackenen Plätzchen, je einer Apfelsine und einigen Schokokringeln. Anschließend machten sie sich gemeinsam ans Aufräumen.
»Du bist schon den ganzen Tag so nachdenklich«, sagte Hilde, als sie auf dem Dachboden den Karton für die Weihnachtskugeln in einem ausgedienten Schrank verstauten.
»Mir fehlt nichts. Es ist nur«, antwortete Elsa zögernd, bevor sie den Grund ihrer Schweigsamkeit verriet. »Ich habe einen Brief bekommen …«
Hilde begriff sofort, dass es wohl keine guten Neuigkeiten waren. »Ist dein Mann am Leben?«
»Ja, das schon … aber …« Elsa griff in die Tasche ihrer Kittelschürze und zog einen schmuddeligen Briefumschlag heraus, den sie Hilde reichte. »Du kannst ihn gerne lesen.«
Hilde nahm das Kuvert entgegen, holte den einmal gefalteten Zettel heraus und las mit klopfendem Herzen:
Meine liebe Frau!
Seit der letzten Post im Sommer bin ich ohne Nachricht von euch. Hoffentlich geht es euch besser als mir. Ich habe mich verletzt, bin aber arbeitsfähig, wie bei einer der regelmäßig stattfindenden Routineuntersuchungen festgestellt wurde. Ich arbeite im Straßenbau. Wir müssen Steine schleppen und Gräben schaufeln, das ist schwer, und wir bekommen nicht genug zu essen. Aber ich will nicht jammern, Hauptsache, ihr seid am Leben und gesund. Wohnst Du noch bei der Familie, die Dich aufgenommen hat? Behandeln sie Dich gut, und musst Du nicht zu schwer schuften? Das geröstete Brot in dem Päckchen hat mir gut geschmeckt, die Zigaretten natürlich auch. Ich darf jeden Monat ein Paket erhalten, wenn es Dir möglich ist, schicke mir bitte noch mehr Zigaretten, denn damit kann ich alles ertauschen, was ich benötige. Leider ist Papier zu knapp, um lange Briefe zuschreiben. Ich hoffe, bald wieder von Euch zu hören. Bleibt gesund und vergesst mich nicht.
Viele Grüße von Deinem Mann Erich
Hilde steckte den Brief zurück in den Umschlag und gab ihn Elsa. »Mach dir nicht so viele Gedanken, wir werden reichlich Zigaretten besorgen, selbst wenn wir dafür auf etwas verzichten müssen«, versprach sie, um Elsa zu trösten. Dass auch sie besorgt war, wollte sie nicht zugeben.
Elsa sah sie fragend an. »Glaubst du wirklich, dass es ihm gut geht? Die zensierten Stellen machen mir Angst … man hört so viel über die Schikanen, denen die Gefangenen ausgesetzt sind. In Russland soll es besonders grausam sein …« Sie stockte. Tränen liefen über ihre Wangen.
Tröstend legte Hilde den Arm um Elsas Schultern. »Nicht verzagen, Elsa. Wir schicken ihm ein großes Paket, du schreibst ihm, dass es euch gut geht und dass ihr gesund seid, das wird ihn trösten und ihm die Kraft geben, alles zu überstehen, bis er endlich aus der Gefangenschaft entlassen wird.«
4
München, 7. Mai 2015
Moon band sich das Haar mit einem dicken Gummi im Nacken zusammen und holte tief Luft, bevor sie den Geschirrkarton durch die nach Osten liegende Küche schob. Noch glich der Raum einer Rumpelkammer, doch sie wollte ihn schnellstens in eine gemütliche Wohnküche verwandeln, in der sie mit Lore die Sonne genießen konnte. Wie in den meisten Altbauwohnungen gab es vor der Küche einen kleinen Balkon für Blumen oder Kräuter, der groß genug war für einen Minitisch mit zwei Stühlen. Sollte es am Abend noch warm genug sein, würden Lore und sie dort mit einem Glas Champagner auf die Zukunft anstoßen. Wie auch immer diese aussehen mochte. Sie hatte sich abgewöhnt zu planen, kam es doch meist anders, als man es sich wünschte. Und mit siebzig stand man garantiert schon näher am Grab als an einem lebensverändernden Ereignis. Oder etwa nicht?
Irgendwo klingelte ein Telefon. Bis sie registrierte, dass es ihr Handy war, und sie es in einer der Jackentaschen aufgestöbert hatte, war der Apparat verstummt. Ein Rückruf war nicht möglich, der Anrufer hatte die Nummer unterdrückt. Hoffentlich war es nicht der Installateur, der sie ein weiteres Mal vertrösten wollte, überlegte Moon. Sie wollte Lore so gerne in einer repräsentativen Wohnung empfangen, und die Freundin hatte versprochen, möglichst zum Mittagessen, spätestens aber am Nachmittag zu Kaffee und Torte zu erscheinen. Sicherheitshalber würde sie den Klempner selbst kontaktieren und sich den Termin bestätigen lassen. Doch es blieb bei der guten Absicht. In seinem Büro war der Anrufbeantworter eingeschaltet, und seine Mobilnummer hatte er ihr nie verraten.
Sie fragte sich, ob Lore sie vielleicht hatte erreichen wollen. Immerhin war es möglich, dass sie ihre Handynummer unterdrückte, warum auch immer. Moon wählte ihre Nummer, erreichte aber nur die Mailbox. »Hi, Lore, ich bin’s … Hast du mich angerufen? Ich hab mein Handy nicht so schnell gefunden … Ich bin in der neuen Wohnung und freue mich auf unsere kleine Geburtstagsparty … Bis später!«
Moon griff nach dem alten, roten Album, das sie beim Auspacken der Handtücher gefunden und während des Telefonats im Blick gehabt hatte. Darin waren Bilder aus ihrer Kindheit gesammelt. Leider existierte kein einziges Babyfoto von ihr. Zu gerne hätte sie gewusst, wie sie als Einjährige ausgesehen hatte. Aus den spärlichen Erzählungen ihrer Mutter wusste sie nur, dass sie mit einem dichten roten Haarschopf zur Welt gekommen war. In den spießigen Nachkriegszeiten ein unverzeihlicher Schönheitsmakel, gleichbedeutend mit einer ansteckenden Krankheit, was sie vor allem in der Schulzeit leidvoll zu spüren bekommen hatte.
Bedächtig öffnete sie das Album. Brüchiges Transparentpapier mit eingeprägtem Spinnennetzmuster bedeckte die erste Seite. Vorsichtig blätterte sie um. Auf schwarzem Karton klebte ein Schwarz-Weiß-Foto mit weißem Zackenrand: Lore und sie in hübschen Sommerkleidern. Juli 1949 stand in weißer Schrift unter dem Bild. Im Hintergrund die unscharfen Umrisse ihrer beider Mütter. Sommernachmittage in Lembergs Garten mit Badespaß in einer Zinkwanne … das waren unbeschwerte Stunden gewesen, in denen sie vergessen hatte, wie sehr ihre Mutter und sie auf die Güte der Lembergs angewiesen waren.
Bewusst hatte sie diese lebensbedrohliche Zeit nicht erlebt, aber sie fürchtete Hunger und Kälte nach wie vor mehr als alles andere. Ihr Körper schien diese Gefühle wie auf einer Festplatte gespeichert zu haben. Allein der Gedanke an eisige Temperaturen ließ sie frösteln. Unwillkürlich griff sie nach der Strickjacke, die über dem Küchenstuhl hing, als fühle sie die grausame Kälte jener Hungerwinter aufs Neue. Dabei hatten sie dank der Stellung ihrer Mutter bei Lembergs gar nicht so schrecklich gehungert wie andere Menschen. Ihre Mutter hatte Gemüsebeete angelegt, Opa Lemberg hielt Hasen und auch ein paar Hühner, die im Sommer im Garten herumliefen. Am Abend wurde das Federvieh eingesammelt und für die Nacht im Keller eingesperrt, damit keiner es klaute. Lores Großvater schlief manchmal sogar bei den Tieren. Und dennoch hatte es an allem gefehlt, und sie sah sich in der Erinnerung dünne Einbrennsuppe ohne ein einziges Fettauge löffeln, bitteres Löwenzahngemüse essen oder trockene Brotrinden kauen. Erst nach der Währungsreform, so hatte ihre Mutter erzählt, war es besser geworden. Lächelnd erinnerte sie sich an die Holzroller, die Lore und sie zu Weihnachten bekommen hatten.
Mit gemischten Gefühlen blätterte sie zur nächsten Seite. Ein Foto, das sie und Lore in hübschen Karokleidern zeigte, beide mit weißen Schürzen, riesigen Haarschleifen und selbst gebastelten Schultüten aus bemaltem Packpapier.
Moons Augen füllten sich mit Tränen, als sie die Beschriftung las: Schulanfang 1951. Die Tage davor würde sie nie vergessen. Ihr Vater war ein halbes Jahr vorher aus langer russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Mit seiner Heimkehr veränderte sich ihr Leben dramatisch, und nicht nur zum Guten …
5
München, Anfang September 1951
Verwundert starrte Marion den fremden, klapperdürren Mann mit den leeren Augen an, der jetzt mit ihnen in dem winzigen Zimmer lebte. Das sollte ihr Vater sein? Der nie lachte, wenig sprach und den sie Vati nennen musste. Wochenlang waren sie und ihre Mutter zu allen Stellen gelaufen, die Auskünfte über heimkehrende Kriegsgefangene gaben. Bei jedem angekündigten Heimkehrer-Transport hatten sie hoffend am Bahnsteig gestanden. Und sie hatte sich so sehr darauf gefreut, endlich auch einen liebevollen Vater zu haben, so wie Hannelore. Einen, der sie in den Arm nahm, mit ihr spielte oder ihr vorlas wie Opa Lemberg. Doch ihr Vater war überhaupt nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt hatte. Als sie ihn endlich vom Zug abholen durften und sie ihm die Hand geben und einen Knicks machen musste, hatte sie sich sogar ein wenig gefürchtet. Er sah so abgemagert und schmutzig aus und kein bisschen wie auf dem Bild, das ihre Mutter jeden Abend betrachtet hatte. Nicht mal ein kleines Lächeln hatte er für sie übrig gehabt. Auch nicht für ihre Mutter, der er nur stumm um den Hals gefallen war.