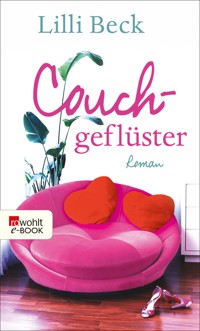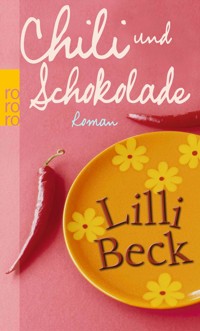9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Liebe und Hoffnung in einer Zeit, die kein morgen kennt …
Berlin, 9. November 1938: Aliza wird von durchdringenden Schreien geweckt, als ihr Großvater von der Gestapo abgeholt wird. Die politische Lage in Deutschland spitzt sich immer weiter zu, doch entgegen aller Mahnungen weigert sich ihr Vater, ein jüdischer Arzt, das Land zu verlassen. Nur seine Tochter will er im Ausland in Sicherheit bringen. Aliza ist am Boden zerstört, dass sie Fabian, ihre große Liebe, zurücklassen muss. Beim Abschied versprechen sich die beiden, nach ihrer Rückkehr zu heiraten. Doch werden sie die Wirren des Krieges überstehen? Und werden sie danach noch dieselben sein?
Ein bewegender Roman, der von einer großen Liebe erzählt, von einem Land zwischen Niedergang und Größenwahn, und vom Schicksal einer ganzen Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Ähnliche
Buch
Berlin, 9. November 1938: Aliza erwacht von durchdringenden Schreien, als ihr Großvater von der Gestapo abgeholt wird. Die politische Lage in Deutschland spitzt sich immer weiter zu, doch entgegen aller Mahnungen weigert sich ihr Vater, ein jüdischer Arzt, das Land zu verlassen. Nur seine Tochter will er im Ausland in Sicherheit bringen. Aliza ist am Boden zerstört, dass sie Fabian, ihre große Liebe, zurücklassen muss. Beim Abschied versprechen sich die beiden, nach ihrer Rückkehr zu heiraten. Doch werden sie die Wirren des Krieges überstehen?
Autorin
Lilli Beck wurde in Weiden/Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in München. Nach der Schulzeit begann sie eine Ausbildung zur Großhandelskauffrau. 1968 zog sie nach München, wo sie von einer Modelagentin in der damaligen In-Disko Blow up entdeckt wurde. Das war der Beginn eines Lebens wie aus einem Hollywood-Film. Sie arbeitete zehn Jahre lang für Zeitschriften wie »Brigitte«, »Burda-Moden« und »Twen«. »Mehr als tausend Worte« ist nach »Glück und Glas« und »Wie der Wind und das Meer« ihr dritter historischer Roman bei Blanvalet.
Weitere Informationen unter: https://lilli-beck.de/
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
LILLIBECK
MEHRALSTAUSENDWORTE
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Lilli Beck
© 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Archive Photos/Getty Images; www.buerosued.de
KW·Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-22317-5V003
www.blanvalet.de
Die Vergangenheit muss reden,
und wir müssen zuhören.
ERICHKÄSTNER
1
Berlin, 9. November 1938
ALIZAERWACHTEVONeinem durchdringenden Schrei. Einen Moment lang dachte sie, geträumt zu haben, als der nächste Aufschrei durch die Nacht gellte. Ein verzweifelter Hilferuf, der klang, als würden einem Menschen unerträgliche Qualen zugefügt. Zitternd setzte sie sich auf und starrte in die Nachtschwärze ihres Zimmers. Die vertrauten Schatten der Einrichtung und die Gewissheit, zu Hause bei ihren Eltern zu sein, beruhigten sie ein wenig. Die Wohnung befand sich in einem dreigeschossigen Gebäude in der Wormser Straße, das über je zwei Wohnungen pro Etage verfügte und in Besitz ihres Großvaters, Samuel Landau senior, war. Er hatte es 1910 errichten und jede der unterschiedlich großen Wohnungen mit Badezimmer und Toilette ausstatten lassen, ein wahrer Luxus in jenen Zeiten. Die in L-Form geschnittene Sechszimmerwohnung ihrer Eltern lag in der ersten Etage, direkt über der Praxis ihres Vaters.
Erneut hörte sie ganz in der Nähe jemanden schreien. Ihr Herz begann zu rasen. Im Zimmer war es zu dunkel, um die Uhrzeit auf dem Wecker zu erkennen, und sie wagte nicht, die tulpenförmige Lampe auf dem Nachtkästchen einzuschalten. Stattdessen tastete sie nach dem silbernen Rahmen mit Fabians Foto, drückte es an die Brust und erinnerte sich an seine Worte. »Ich bin immer bei dir, wie die Sterne am Himmel, auch wenn man sie am Tag nicht sehen kann.«
Ein Hund jaulte auf. Eine grausame Schrecksekunde lang glaubte sie, die Stimme von Emil, dem Zwergpudel ihrer Großeltern, die zwei Stockwerke über ihnen wohnten, erkannt zu haben.
Angestrengt lauschte sie in die Stille.
Nein, alles war ruhig, sie hatte sich wohl getäuscht. Vielleicht war es ein Hund aus dem Nebenhaus oder irgendwo auf der Straße gewesen.
Eine Weile konzentrierte sie sich auf das Ticktack des Weckers. Hörte auf ihren Herzschlag und versuchte, ruhig zu atmen. Eine, vielleicht auch zwei Minuten mochten vergangen sein, als sie meinte, im Treppenhaus das beängstigende Knallen eisenbeschlagener Stiefelabsätze zu vernehmen.
Gestapo?
Immer wieder hörte man von nächtlichen Verhaftungen. Und wer sonst veranstaltete solchen Lärm, während die Welt schlief? Die Bewohner des Hauses trampelten nicht die Treppen hinunter, sie benutzten den Aufzug.
Die Haustür schlug zu.
Der Motor eines Automobils wurde angelassen.
Aliza stellte den Rahmen zurück auf das Nachtkästchen. Mutig verließ sie ihr warmes Bett. Es war kalt im Zimmer, sie fröstelte trotz des knöchellangen Flanellhemds. Auf nackten Füßen eilte sie zum Fenster, von wo aus sie auf die Straße hinunterblicken konnte.
Vorsichtig lugte sie durch einen Spalt des zartgrünen Seidenvorhangs. Die Straße war menschenleer, es hatte geregnet, Blätter schwammen in den Pfützen wie kleine Boote, beleuchtet von Straßenlaternen.
Aliza mochte den Spätherbst und auch den Winter mit seinen langen Abenden, wenn es bald auf Weihnachten zuging. Im ersten Monat des neuen Jahres würde sie ihren siebzehnten Geburtstag feiern. Auch jetzt wäre es ein friedliches Bild draußen, stünde nicht direkt vor dem Haus eine schwarze Limousine, an deren Beifahrerseite gerade ein Mann einstieg. Soweit sie es erkennen konnte, saß jemand im Fond. Keiner musste ihr erklären, dass es sich um Hitlers Schergen handelte, deutlich zu erkennen am dunkelgrauen Kleppermantel, der als »Gestapomantel« beschimpft wurde.
Die rückwärtige Wagentür wurde zugeschlagen.
Der Motor heulte ungeduldig auf.
Das Fahrzeug raste davon.
Die Reifen hinterließen Spuren in der Regenpfütze, die, kaum gezogen, wieder ineinanderflossen. Das Wasser schloss sich zu einer glatten Fläche, als wäre nichts geschehen, als wäre nur ihre Fantasie mit ihr durchgegangen, wie so oft nach einem spannenden Buch.
Das Schrillen des Telefons jagte Aliza den nächsten Schreck ein. Es holte sie zurück in die Realität, in der die verhassten Nationalsozialisten an der Macht waren, die bereits 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen und jüdischen Ärzten wie ihrem Vater die Behandlung von Ariern verboten hatten.
Das Klingeln hielt an. Vermutlich ein Notfall. Ihr Vater war auch mitten in der Nacht bereit, seinen noch verbliebenen Patienten zu helfen. Aber wieso hörte er das Läuten nicht?
Mit klopfendem Herzen lief sie den kurzen Flur entlang und gelangte durch die Zwischentür in die geräumige Diele. Als kleines Mädchen war sie dort mit ihrem Dreirad stundenlang im Kreis gefahren oder hatte sich vor ihrem zwei Jahre älteren Bruder Harald in der Garderobennische versteckt.
Über dem zierlichen Telefontisch brannte wie jede Nacht die Wandlampe, damit man sich auch im Halbschlaf zurechtfand. Der Apparat schepperte weiter. Sie nahm den Hörer ab: »Aliza Landau …«
»Hallo, Aliza, hier ist Walter Rosenberg …«
»Hallo, Onkel Walter.« Er war nicht ihr richtiger Onkel, sondern ein alter Studienfreund ihres Vaters und von Beruf Richter, dem die Nazis wie allen anderen jüdischen Richtern, Anwälten und Staatsanwälten im April 1933 Berufsverbot erteilt hatten.
Aliza sparte sich die Höflichkeitsfloskeln und fragte direkt: »Bist du krank?«
»Nein, mit mir ist alles in Ordnung, aber …«
Walters Stimme klang zu leise für einen Mann, der es gewohnt war, auf seinem Richterstuhl laut und deutlich zu sprechen, auch wenn ihm das seit Jahren verboten war.
Alizas Blick fiel auf eine Notiz, die halb unter den Apparat geklemmt war. »Moment, hier liegt ein Zettel mit Papas Handschrift«, sagte sie und las vor: »Mama und ich sind bei einem Notfall.«
Walter zögerte. »Und dein Bruder?«
»Harald hat Nachtschicht, er arbeitet doch im Jüdischen Krankenhaus. Seit er mit anderen jüdischen Studenten von der Universität verwiesen wurde, verdingt er sich als Leichenschieber.«
»Noch so eine Sauerei«, schnaufte Walter.
»Ja«, entgegnete Aliza knapp und schluckte, als ihr mit einem Mal bewusst wurde, dass sie völlig allein in der Wohnung war. Und Onkel Walter rief mitten in der Nacht sicher auch nicht aus reiner Höflichkeit an. Irgendetwas stimmte nicht. Ein Angstschauer kroch über ihren Rücken. »Bitte, sag mir, was los ist.«
»Das muss ich wohl«, begann Walter und erklärte, in den nächsten Tagen seien Gewaltaktionen gegen Juden geplant.
»Gewaltaktionen?«, wiederholte Aliza beklommen. Allein das Wort laut auszusprechen schürte ihre Furcht.
»Einzelheiten wusste mein Kontaktmann leider nicht, aber es ist eine Information aus sicherer Quelle, und ich nehme seine Mahnung überaus ernst. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir das Haus verlassen.«
Intuitiv wanderte Alizas Blick zur Wohnungstür. Stand sie nicht einen Spalt offen? Genau konnte sie es nicht erkennen, aber wehte da nicht eiskalte Zugluft in die Diele? Im nächsten Augenblick meinte sie, Schritte zu hören. Sie geriet in Panik. Ihr Mund wurde trocken, ihre Hände zitterten. Aber Onkel Walter würde ihr nicht helfen können.
»Ich richte es aus«, versprach sie und verabschiedete sich eilig, um die Tür zu verschließen und dann Fabian anzurufen. Er wohnte am Kurfürstendamm über der Parfümerie seiner Eltern und wäre mit dem Wagen in wenigen Minuten bei ihr.
Aliza nahm all ihren Mut zusammen und durchquerte die Diele. Nein, die Tür war ins Schloss gezogen. Durch die schmale Ritze schimmerte ein Lichtstreifen, das Treppenhaus war also erleuchtet. Sie presste das Ohr an die Tür und vernahm ein leises Weinen. Dann war es also nicht die Gestapo, der leise Töne fremd waren, die brüllte und lärmte und sich barbarisch benahm.
Aliza knipste den Lüster in der Diele an, öffnete vorsichtig die Wohnungstür und erschrak, als sie in den Hausflur blickte. Ziva, ihre Großmutter und die Mutter ihres Vaters, schleppte sich schwer atmend die Treppe herunter.
Die zierliche Frau, die Aliza nur in untadeliger Garderobe, mit gepflegter Frisur, gepudertem Gesicht und rötlichem Lippenstift kannte, sah erschreckend derangiert aus. Die bloßen Füße steckten in schwarzen Absatzschuhen, und die hellbraune Nerzjacke über dem fliederfarbenen Nachthemd wirkte grotesk. Ihre Augen waren rot gerändert, die bleichen Wangen tränenüberströmt, und sie blutete an der Stirn. Ihre linke Hand umklammerte eines der hellblauen Taschentücher, wie Großvater Samuel sie benutzte. Wieso war er nicht bei ihr? Seit Aliza denken konnte, waren die Großeltern unzertrennlich. Und wo war der betagte Pudel, der ihnen auf Schritt und Tritt folgte?
Aliza schob die Fußmatte über die Schwelle, damit die Tür nicht zufiel, und war mit drei Schritten bei ihr. »Was ist mit dir, Bobe?«, fragte sie.
Schluchzend sank Ziva in die Arme ihrer Enkeltochter. »Se haben … ihn jeholt … de braunen Bastarde … se haben meen Mann jeholt …«, stammelte sie. »Jeschlagen und abjeführt, wie een Verbrecher.«
Aliza fühlte einen schmerzhaften Stich in der Brust. Es war also ihr Großvater gewesen, den sie auf der Rückbank des schwarzen Wagens gesehen hatte. Den die Gestapo verschleppt hatte. Kein Wunder, dass ihre Großmutter, die sie seit jeher auf Jiddisch »Bobe« nannte, vor lauter Aufregung in den Berliner Jargon verfiel. Wo sie doch sonst so großen Wert auf geschliffenes Deutsch legte.
Nervös blickte Ziva sich um. »Samuel … wo ist mein Sohn?« Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie Aliza an.
Aliza begriff sofort, was Ziva meinte. »Nein, nein, er wurde zu einem Notfall gerufen. Mama ist auch bei ihm. Aber ich bin ja da, nun komm erst mal herein«, sagte sie so ruhig wie möglich, um ihre Großmutter nicht noch mehr aufzuregen. In Wahrheit war sie selbst den Tränen nahe. Sie reichte der zitternden Ziva den Arm und führte sie in die zum Hinterhof liegende geräumige Küche.
Aliza schaltete auch hier die Deckenlampe an, sowie die beiden Tischlampen auf dem niedrigen Büfett, die den Raum in warmes Licht tauchten. »Soll ich uns Kaffee kochen?«, fragte sie, um die beängstigende Stille zu durchbrechen.
Ziva antwortete nicht. Unbeweglich verharrte sie neben dem länglichen Küchentisch, der die Mitte des Raumes beanspruchte. Sie setzte sich erst, als Aliza ihr einen der gepolsterten Stühle zurechtrückte. Das Taschentuch knetend, starrte Ziva ins Leere.
»Lieber Baldriantee?« Aliza fühlte sich vollkommen hilflos. Was sollte sie tun? Was vermochte ihre Großmutter zu trösten? Das Radio einschalten? Nein, das war wohl keine gute Idee. Wenn nur Papa und Mama endlich kämen, seufzte sie lautlos, während sie die schwache Glut des Vorabends mit dem Feuerhaken auflockerte und Holzscheite nachlegte. Ein wärmendes Feuer schadete nicht, sie fror, ihre Füße waren wie Eiszapfen, sie war immer noch barfuß, wagte aber nicht, Ziva allein zu lassen, um sich etwas überzuziehen.
»Es ist jemand an der Tür«, flüsterte Ziva plötzlich, sprang auf und hetzte zu Aliza am Herd. »Wir müssen uns verstecken.«
»Ich habe nichts gehört«, entgegnete Aliza wahrheitsgemäß, aber auch, um sich selbst zu beruhigen. Die Küche lag hinter der Diele und dem Badezimmer am Ende des Flurs, also viel zu weit weg vom Eingang. Zudem hatte sie die Küchen- und die Verbindungstür geschlossen, es müsste schon jemand die Wohnungstür eintreten, dass sie es hier in dieser hintersten Ecke hören konnten.
Doch sie erahnte Zivas Angst, als diese aufgeschreckt zu der schmalen Schranktür eilte, hinter der sich die Speisekammer verbarg.
»Aliza … Kind«, wisperte sie aufgebracht. Im Flur hallten jetzt deutlich vernehmbare Schritte. Sekunden später knarrte die Küchentür, und eine tadelnde Stimme erklang.
»Aliza! Warum springst du mitten in der Nacht durch die Gegend? Und was soll die Festbeleuchtung in der ganzen Wohnung?«
Es war Rachel, ihre Mutter, in Hut und Mantel und sichtlich übernächtigt. Sie hatte dunkle Schatten unter den Augen, die blonden Haare waren zerzaust und die Wangen gerötet. Ziva kam aufschluchzend aus ihrem Versteck. »De Gestapo hat ihn jeholt … abjeführt wie een Verbrecher.«
»Gott der Gerechte stehe uns bei«, stöhnte ihre Mutter entsetzt, als Bobe weinend auf sie zukam.
Sekunden später betrat auch Alizas Vater die Küche. Der große dunkelhaarige Arzt war ebenfalls noch im Mantel, unter dem er einen grauen Glencheck-Anzug mit Hemd und Krawatte trug. »Mame, was ist geschehen?«, rief er hörbar besorgt. »Bist du gestürzt? Du blutest an der Stirn. Aliza, hol bitte den Medikamentenkoffer, er steht in der Diele.«
Gehorsam eilte Aliza nach draußen und nutzte auf dem Rückweg die Gelegenheit, in eine Strickjacke und Hausschuhe zu schlüpfen. Als sie in die Küche zurückkehrte, untersuchte ihr Vater gerade Bobes Stirnverletzung.
»Sorge dich nicht, Mamele, wir holen Dade wieder raus«, versprach er und streckte, ohne aufzublicken, die Hand nach der Ledertasche aus.
Aliza stellte den braunen Lederkoffer auf den Küchentisch.
Ihr Vater zog zuerst den Mantel aus und legte ihn auf einen der Stühle. »Beruhige dich, Mame, und erzähl uns, was geschehen ist. Wohin haben sie Dade gebracht?«, redete er mit gedämpfter Stimme auf seine zitternde Mutter ein, während er den Metallbügel des Koffers öffnete.
»Ach, mein Junge …« Schluchzend wischte Bobe sich mit dem Taschentuch über die Augen. »Ich kann es einfach nicht fassen, diese Unmenschen haben Emil … mit ihren Stiefeln getreten und mit einem Knüppel …« Unterbrochen von Weinkrämpfen versuchte sie, das Grauen zu beschreiben, das sich zuvor abgespielt hatte. Verzweifelt knetete sie das Taschentuch und berichtete von einem Trommeln an der Wohnungstür, das sie aus dem Schlaf gerissen hatte.
Rachel hatte den Mantel inzwischen ebenfalls ausgezogen, über eine Stuhllehne geworfen, den Hut obendrauf gelegt und machte sich am Herd zu schaffen. Aliza wusste, dass ihre Mutter sich in schwierigen Situationen gern in Geschäftigkeit flüchtete.
»Oh Ziva, was für eine Tragödie. Warum hast du denn überhaupt aufgemacht?«, fragte Rachel.
»Ich dachte doch, es sei unser Schauspieler«, erklärte Bobe kleinlaut. »Der trinkt nach den Vorstellungen oft einen über den Durst, poltert dann gegen alle Türen und brüllt nach seiner Frau oder nur so aus Daffke irgendwelche Parolen. Fremde kommen nachts nicht ins Haus, schließlich wird die Haustür abends um acht abgesperrt.«
Die Küchentür flog auf, und Harald platzte in den Raum. »Was ist denn hier los? Überall brennen die Lampen, als wäre schon Weihnachten.«
»Die Gestapo hat Großvater verhaftet«, flüsterte Aliza ihrem schlaksigen Bruder zu, der nicht weniger übernächtigt als seine Eltern wirkte. Sein kantiges Gesicht war beinahe so leichenblass wie das von den Toten, die er Tag für Tag von den Stationen in den Keller schaffte. Sein blondes Haar bedurfte dringend einer Wäsche, und Mamas prüfendem Blick nach zu schließen, war ein Vollbad vonnöten. »Wir fragen uns gerade, wer sie ins Haus gelassen hat, wo doch abends abgesperrt wird.«
Harald ging zum Spülbecken, um sich die Hände zu waschen. »Ich wette, das war Karoschke«, schimpfte er über das Wasserplätschern hinweg. »Hinterhältiger Treppenterrier. Ihr hättet ihm die Wohnung kündigen sollen, als er Blockwart wurde.«
»Nein, das wäre unklug gewesen«, entgegnete Samuel, der Bobes Stirnwunde vorsichtig mit Jod betupfte. »Außerdem, welchen Grund hätten wir angeben sollen? Ich glaube nicht, dass Karoschke etwas damit zu tun hat. Er ist uns nach wie vor dankbar für die erlassene Miete, als er damals in finanziellen Nöten war. Ich bin sicher, dass er uns auch weiterhin beschützt, jedenfalls sind wir bisher nicht behelligt worden.«
»Nicht behelligt, was redest du da?«, fuhr Ziva ihren Sohn zornig an. »Dein Vater wurde grundlos verhaftet und wer weiß wohin verschleppt. Sie haben ihn geschlagen, weil er gewagt hat zu erwähnen, dass er im Krieg als Frontarzt für sein Vaterland tätig war und man ihm für seine Verdienste sogar einen Orden verliehen hat. Einen dreckigen Juden haben sie ihn genannt, unsere Wohnung durchsucht, Möbel zertrümmert, Schubladen rausgerissen und einfach alles verwüstet. Einer hat ganz ungeniert in meine Schmuckschatulle gegriffen, die Kette mit den Solitärdiamanten, ein Geburtstagsgeschenk von Samuel, in seine Tasche wandern lassen und mich dabei hämisch angegrinst. Und mein armer Emil …« Ihre Stimme versagte.
»Verzeih mir, Mame. So habe ich es nicht gemeint.«
Ziva putzte sich umständlich die Nase. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was sie von ihm wollen, er ist doch ein alter Mann von fünfundsiebzig Jahren und nicht mehr ganz gesund …« Leise begann sie wieder zu weinen.
Aliza fühlte auch ihre Augen feucht werden. Doch sie wollte nicht weinen, als wäre ihr geliebter Großvater bereits tot, und konzentrierte sich auf den würzigen Duft von echtem Bohnenkaffee. Dann dachte sie an das gemeinsame Abendessen, das sie gestern mit den Großeltern im angrenzenden Esszimmer eingenommen hatten. Alle Mahlzeiten wurden dort am stets mit einem weißen Damasttuch bedeckten runden Tisch verspeist. Nur das Frühstück fand immer in der Küche statt. In den Sommermonaten war der Raum von der Morgensonne durchflutet, und in der kalten Jahreszeit war er wärmer, da die drei Kachelöfen über Nacht auskühlten. Im gusseisernen Küchenherd wurde vor dem Schlafengehen nachgelegt, und die noch vorhandene Glut flackerte im Handumdrehen wieder zu einem wohltuenden Feuer auf. Zum Kochen war längst ein moderner Gasherd mit vier Flammen und einem Backrohr installiert worden, doch den alten Herd hatten sie behalten, da die Küche ausschließlich damit zu beheizen war.
»Aliza, die Milch«, mahnte ihre Mutter.
Konzentriert, als ginge es darum, eine gute Note für eine gestellte Aufgabe zu bekommen, nahm Aliza die Milchkanne aus dem wuchtigen Kühlschrank, der vor knapp drei Jahren eingezogen war. Diese praktische Errungenschaft der Technik ersparte das tägliche Milchholen, und im Sommer schwamm die Butter nun nicht mehr in einer Schüssel mit Wasser, sondern lag in einem dafür vorgesehenen Fach. Es gab sogar ein Gefrierfach, in dem man Wasser zu Eiswürfeln frieren konnte, um damit Getränke zu kühlen. Großvater hatte den Eisschrank angeschafft, damit er an heißen Sommertagen seine geliebte Zitronenlimonade eisgekühlt trinken konnte. Beim Gedanken, wie er auf dem Balkon saß und kalte Limonade genoss, liefen ihr nun doch die Tränen über die Wangen.
Harald hatte sich die Hände abgetrocknet, das Handtuch ordentlich zurückgehängt und sich auf den Stuhl neben Babe gesetzt. »Wohin wurde Großvater gebracht?«
»Ich weiß es nicht …« Ziva atmete schwer. »Sie haben mich zur Seite gestoßen, weil ich gewagt habe, danach zu fragen. Einer hat mich Schlampe genannt und mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen.«
»Wir werden Dade rausholen, wohin auch immer sie ihn verschleppt haben«, versprach ihr Vater.
Ziva blickte ihn traurig an. »Das ist viel zu gefährlich, am Ende verhaften sie dich auch noch. Ich werde gehen.«
»Nein, Mame, lass mich das machen, ich rede mit Karoschke. Wenn ich ihn freundlich bitte, wird er uns helfen.«
»Bitten?« Ihre Mutter musterte Papa ungläubig, als sie die Kaffeekanne auf den Tisch stellte. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Blockwart auf Bitten reagiert.«
»Warten wir’s ab.«
»Onkel Walter hat vorhin angerufen«, berichtete Aliza, während sie Kaffeetassen verteilte.
Samuel klebte vorsichtig ein Pflaster auf die Verletzung seiner Mutter und verstaute den Rest wieder in seinem Arztkoffer. »Was wollte er denn?«
»Uns warnen, dass in den nächsten Tagen Gewaltaktionen geplant seien. Eine Information aus sicherer Quelle, hat er gesagt. Wir sollen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir das Haus verlassen.«
»Was denn für Gewaltaktionen?«, fragte ihre Mutter.
»Das wusste er nicht«, antwortete Aliza. »Aber er klang sehr besorgt. Vielleicht war die Verhaftung von Großvater bereits der Anfang.«
»Verbrecherpack«, knurrte Harald erbost und rührte so heftig in seiner Kaffeetasse, dass er ein Fußbad anrichtete. »Was werden die sich noch alles einfallen lassen? Reicht es nicht, dass sie den Ärzten vor fünf Jahren die kassenärztliche Zulassung entzogen haben, die Wohlhabenden verhaften, um sich ihre Vermögen anzueignen, und alle jüdischen Geschäftsinhaber zwingen, ihre Schaufenster mit weißen Buchstaben zu kennzeichnen? Nicht zu vergessen, dass sie uns Kennkarten mit einem roten J aufzwingen. Oder dass alle Frauen mit Zweitnahmen Sara und die Männer Israel heißen müssen.«
Bobe streichelte mit einer Hand resigniert über Großvaters Taschentuch. »Sie wollen unser Volk vernichten.«
Nachdem Ziva sich etwas beruhigt hatte, kümmerte Samuel sich um den bedauernswerten Hund. Behutsam wickelte er den leblosen Tierkörper in ein Bettlaken, das er im Wäschekorb fand, und trug das Bündel in den Keller. Später würde er das treue Haustier mit Haralds Hilfe irgendwo begraben.
Um Viertel nach sechs läutete er bei Hermann Karoschke, der als Finanzbeamter von Montag bis Samstag das Haus um halb sieben verließ. Er würde ihn also höchstens beim letzten Schluck Kaffee stören. Samuels Vater hatte dem Ehepaar Karoschke die Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad, die gegenüber seiner Praxis lag, vor langer Zeit vermietet. Dass Karoschke inzwischen die Position eines Blockwarts innehatte, war bislang kein Nachteil gewesen.
Karoschke öffnete die Tür. Der fünfundvierzigjährige hagere Mann war, wie von Samuel erwartet, bereits korrekt in Anzug und Krawatte gekleidet. Am Revers des Jacketts steckte das runde Parteiabzeichen mit dem Hakenkreuz. Auch seine Schuhe glänzten, und das seitlich rasierte, oben extrem kurz geschnittene hellbraune Haar klebte am Schädel.
»Doktor!« Er musterte ihn verwundert. »Was verschafft mir die Ehre?«
»Guten Morgen, Herr Karoschke«, grüßte Samuel. »Ich komme wegen meines Vaters …«
Karoschke hob die Augenbrauen. »Ich verstehe nicht …«
»Nun, er wurde heute Nacht von der Gestapo abgeholt. Haben Sie nichts gehört? Meine Frau und ich, wir waren bei einer Hausgeburt, aber meine Mutter sagt, es sei ein ziemlicher Radau gewesen.«
Karoschke rülpste vernehmlich. »Verzeihung … Äh nein, nicht das Geringste, ich erfreue mich eines gesunden Schlafs, sozusagen des Schlafs des Gerechten.« Erheitert über seinen eigenen Scherz, verzog er den schmalen Mund zu einem Grinsen.
»Nun, wie auch immer«, wiegelte Samuel ab, denn er glaubte dem Mann kein Wort. Aussprechen durfte er das natürlich nicht. Aber es war kein Geheimnis, dass die nächtlichen Überfälle der Gestapo Tote aufweckten. »Ich dachte, Sie als Blockwart wüssten vielleicht, wo ich mich nach meinem Vater erkundigen kann. Meiner Mutter wurde nämlich weder erklärt, was ihm vorgeworfen wird, noch, wohin sie ihn bringen wollten.«
Karoschke brummelte ein undefinierbares »Hmm«, strich sich über das glatt rasierte Kinn und erklärte: »Versuchen Sie es bei der Leitstelle der Gestapo in der Burgstraße, Doktor, dorthin werden Verhaftete zur Befragung gebracht.«
Samuel griff in die Innentasche seines Jacketts, nahm eine Zehnerpackung Schmerztabletten heraus und überreichte sie Karoschke. »Vielen Dank.«
Karoschke war zwar ein überzeugter Nationalsozialist und oft ziemlich arrogant, hatte ihm aber geholfen, die neueste Schikane zu umgehen, die Göring sich im April ausgedacht hatte. Die Anordnung des Reichsmarschalls besagte, dass Juden, deren gesamtes Vermögen fünftausend Reichsmark überstieg, dieses beim Finanzamt anzeigen mussten. Wie Karoschke es gedeichselt hatte, dass sie sich nicht beim Amt hatten melden müssen, wollte er lieber nicht wissen.
Karoschke steckte die graue Pappschachtel mit einem zufriedenen Lächeln ein. »Viel Glück, Doktor«, sagte er, ohne sich zu bedanken, und schloss die Wohnungstür.
In Karoschkes wesentlich kleinerer Wohnküche saßen seine Frau Ingrid und die sechzehnjährige Birgit auf der hölzernen Eckbank beim Frühstück mit Muckefuck, Magermilch und Margarinebrot. Eine schwache Glühbirne in der Deckenlampe über dem blanken Holztisch verbreitete schummriges Licht, das eher schläfrig als wach machte.
Ingrid Karoschke, eine südländisch aussehende Vierzigjährige mit dunkelbraunen Augen und zurückgesteckten schwarzen Locken, wickelte das Vesperbrot für ihren Mann in Pergamentpapier. Nur für ihn hatte sie es mit Mettwurst bestrichen, ihrer Tochter konnte sie lediglich einen Apfel zum Margarinebrot für die Schulpause mitgeben. Hermann hatte vor einigen Monaten äußerste Sparsamkeit angeordnet, aber gleichzeitig versichert, das Tausendjährige Reich hielte eine glorreiche Zukunft für die Familie parat. Genaueres könne er noch nicht verraten, und sie hatte aufgegeben, danach zu fragen. »Hier.« Sie reichte Hermann das Brotpäckchen. »Wer war denn das in aller Herrgottsfrüh?«
Karoschke verstaute das Pergamentpäckchen in der schäbigen ledernen Aktentasche, die auf dem einzigen Stuhl lag. »Landau, wegen heute Nacht, er wollte wissen, wohin der Alte gebracht wurde.«
Ingrid warf ihrem Mann einen strengen Blick zu. »Musstest du die Gestapo wirklich ins Haus lassen?«
»Kümmere dich lieber um meine Uniform, da fehlt ein Knopf. Du weißt, dass ich sie jederzeit benötigen könnte«, sagte er, ihre Frage ignorierend, beugte sich zu ihr und küsste sie liebevoll auf den Mund. »Es hat alles seine Richtigkeit.«
»Jawohl, mein Führer«, scherzte Ingrid. »Bis heute Abend. Du darfst dich auf deine Leibspeise freuen, Pellkartoffeln mit Stippe.«
»Famos.« Karoschke strich seiner Tochter über das ordentlich zu Zöpfen geflochtene dunkle Haar. Er war sehr stolz auf sein einziges Kind. Birgit war schlau wie ein Junge und ließ ihn vergessen, dass zwei Söhne nach der Geburt gestorben waren. »Sei schön fleißig, mein Schatz, damit du mich auch weiter mit so herausragenden Belobigungen erfreust wie zuletzt für die Mathearbeit.«
Birgit nickte brav. »Ja, Vati.«
Im Flur nahm Karoschke den abgetragenen Wollmantel von der Garderobe, angelte den speckig gewordenen Hut von der Ablage darüber und verließ die Wohnung. Ein wenig ärgerte er sich über Ingrids Vorwurf. Er hatte nichts weiter als seine Pflicht getan. Der Gestapo die Haustür nicht zu öffnen hätte nicht nur immensen Sachschaden bedeutet, denn versperrte Türen stellten keine Hindernisse für diese kulturlosen Horden dar, sondern auch seinen eigenen Untergang zur Folge gehabt. Wenn sie ihn nicht gleich zusammen mit dem alten Landau abgeführt hätten. Auf jeden Fall wäre ihm seine Arbeitsstelle gekündigt und infolgedessen auch der ehrenamtliche Posten des Blockwarts aberkannt worden. Doch nur in dieser Funktion war es ihm möglich, wenigstens den Doktor zu schützen. Ingrid hatte ja keine Ahnung von den weitreichenden Vorgängen, auch nicht von seinen eigenen Zukunftsplänen. Die Zusammenhänge, beziehungsweise die anstehenden Aktionen, waren ohnedies streng vertrauliche Dienstgeheimnisse, die er niemandem verraten durfte. Nicht einmal seiner wunderschönen, wohlgeformten Ehefrau, die er auch nach zwanzig Jahren noch genauso liebte und begehrte wie am ersten Tag und um die ihn alle Männer beneideten. Mit Stolz erinnerte er sich an einen Sommersonntag am Wannsee, wo sie einem Kollegen mit dessen Familie begegnet waren. »Ein echtes Rasseweib, verehrter Kollege, und die Figur …«, hatte der mit lüsternem Blinzeln bemerkt. Weniger erfreulich waren die beleidigenden Andeutungen eines anderen Mitarbeiters, der es einfach nicht hatte lassen können, Ingrid und auch seiner Tochter, die traurigerweise seine große Nase geerbt hatte, jüdisches Aussehen zu unterstellen. Als wären dunkles Haar und eine größere Nase untrügliche Indizien jüdischer Abstammung. Blanker Unsinn, fand Karoschke. Wenn ausschließlich blonde Menschen arisch waren, müsste auch in den Adern des Führers nichtarisches Blut fließen. Hitler war schließlich dunkelhaarig und seine Nase keineswegs zierlich. Auf manchen Bildern blickte er direkt verschlagen drein, so, wie man es den Juden nachsagte. Karoschke hatte andere Erfahrungen, was Aussehen oder Verschlagenheit anging. Die Haare des Doktors waren zwar dunkel, aber er selbst ein höchst respektabler Mann, immer freundlich und großzügig, wenn jemand in Not war. Das hatte er am eigenen Leib erfahren. Als 1931 alle Gehälter im öffentlichen Dienst um fünfundzwanzig Prozent gekürzt worden waren, hatten Landaus ihm die Miete um denselben Prozentsatz gesenkt. Zum Dank hatte er zumindest den Doktor aus den Listen entfernt, als es um die Offenlegung der Vermögen ging. Natürlich hielt er seine Sympathie für die jüdische Familie streng geheim, sogar vor Ingrid und Birgit. Als Finanzbeamter und erst recht als Blockwart würde er für jede noch so kleine Sympathiebekundung als »Judenknecht« verdächtigt werden.
2
Berlin, 9. November 1938
ALIZASASSMIThängendem Kopf am Tisch und starrte den Teller an. Gewöhnlich war sie mittags derart hungrig, dass sie leicht ein halbes Schwein verdrücken konnte, wie ihr Vater gerne scherzte. Aber wegen des nächtlichen Geschehens und der Warnung von Onkel Walter hatte ihre Mutter sie nicht zur Schule gehen lassen. Versäumen würde sie gewiss nichts, der Unterricht war ohnehin eine Qual. Seit man sie und zwei anderen Jüdinnen in die hinteren Bänke versetzt hatte, mussten sie noch mehr Hänseleien ertragen. Aber den ganzen Tag untätig in der Wohnung zu hocken war auch schrecklich, noch dazu, wo sie sich so auf den Abend mit Fabian gefreut hatte. Er wurde heute achtzehn und hatte sie zu einem Klavierkonzert eingeladen.
Ach, Fabian, seufzte sie lautlos in sich hinein und sah sich mit ihm am Sonntagnachmittag durch Berlin spazieren. An seiner Seite war das Leben voller Lachen und Sonne. Mit ihm vergaß sie, dass sie Jüdin und seit Hitlers Machtergreifung einfach alles Schöne verboten war. Nur neben Fabian kümmerten sie die hetzerischen Plakate an den Litfaßsäulen nicht, die das deutsche Volk seit 1933 in fetten schwarzen Lettern aufforderten, sich zu wehren und nicht bei Juden zu kaufen. Zum Glück war es Juden nicht verboten, bei Ariern einzukaufen, sonst hätte sie Fabian niemals kennengelernt.
Vergangenen Januar hatte sie von Bobe zum sechzehnten Geburtstag ein Geldgeschenk erhalten und ihr erstes Parfüm bei Pagels’ erstanden. Fabian hatte sie beraten. Dass er der Sohn des Inhabers war, hatte sie damals noch nicht gewusst.
Nie würde sie den Moment vergessen, als er ihr etwas Je Reviens auf die Innenseite des Unterarms gesprüht hatte.
»Jeder Duft entwickelt seinen Wohlgeruch erst auf der Haut«, hatte er gesagt und ihr so tief in die Augen geblickt, dass ihr abwechselnd heiß und kalt geworden war.
Ob es unanständig ist, mit Fabian Geburtstag zu feiern, wo Großvater verhaftet worden ist?, überlegte Aliza. Sie konnte es immer noch nicht recht fassen. Gestern erst hatte er ihr ein Küsschen auf die Wange gegeben, und sie hatte gelacht, weil sein grauer Bart kitzelte. Traurig dachte sie an den toten Emil, den sie jeden Nachmittag für eine »große Runde« um die Häuser geführt hatte. In die Parkanlagen wagte sie sich wegen des Verbots für Juden trotz ihrer rotblonden Haare und der hellen Augen nur noch selten. Der Hund hatte das natürlich nicht verstanden und mit aller Kraft an der Leine gezerrt, sobald sie in die Nähe eines Parks gekommen waren.
Nur sonntags, wenn Fabian sie begleitete, kümmerte Aliza sich nicht um Verbotsschilder. Fabian war kein Jude, hatte welliges blondes Haar und blaue Augen. Und keiner, dem sie begegneten, vermutete eine verbotene Liebe zwischen einem Arier und einer Jüdin. Sie ernteten sogar freundliche Blicke von diesen grässlichen SA-Männern in ihren braunen Uniformen, die Aliza wie eine leibhaftige Drohung empfand.
In diesem Moment wurde ihr bewusst, dass der gestrige Spaziergang mit Emil der letzte gewesen war. Ein dicker Kloß im Hals verdarb ihr endgültig den Appetit auf das panierte Schnitzel, ihr Lieblingsessen. Aber auch Harald und ihr Vater, die den ganzen Vormittag in der Burgstraße gewesen und ohne Nachricht über Großvaters Verbleib zurückgekehrt waren, stocherten lustlos auf den Tellern rum. Obwohl sie sonst niemals Fleisch, nicht mal Schweinefleisch verschmähten. Ihre Familie kümmerte sich nicht um die strengen Glaubensregeln, und Mama kochte nicht koscher. Trotz des tragischen Vorfalls hatte sie auf einem gesitteten Mittagessen am Tisch bestanden. »Großvater würde es nicht gutheißen, wenn wir uns gehen ließen oder unser gewohntes Familienleben aufgäben und trauerten, als wäre er gestorben. Denn das ist er nicht!«, hatte sie mit Nachdruck erklärt, dann aber doch das Radio abgeschaltet, als Heinz Rühmann einen fröhlichen Schlager trällerte.
»Was bedrückt dich, mein Augensternchen?«, erkundigte ihr Vater sich, der noch den dunklen Anzug trug, den er für den Bettelgang in die Burgstraße angezogen hatte.
Aliza zuckte nur schwach mit den Schultern und lächelte. Sie mochte es, wenn ihr Vater sie mit dem Kosenamen anredete, nur heute änderte auch das nichts an ihrer betrübten Stimmung.
»Wie geht es Mame?«, wechselte ihre Mutter das Thema. »Aliza hat mir am Vormittag oben beim Aufräumen geholfen, zumindest die Glasscherben konnten wir wegschaffen. Ziva saß wie versteinert dabei.«
»Sie schläft jetzt in unserem Gästezimmer, ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel gegeben«, antwortete der Vater und wandte sich an Harald. »Würdest du mir später mit dem Hund helfen? Zu zweit schaufelt es sich schneller, und wir müssen jede Aufmerksamkeit vermeiden.«
Aliza unterbrach das akribische Kleinschneiden des panierten Fleisches. »Ich komme auch mit.«
Ihr Bruder taxierte sie mit krauser Stirn. »Das ist nichts für kleine Mädchen.«
»Ach nee!« Herausfordernd erwiderte Aliza den Blick. »Du glaubst wohl, weil du nicht mehr studieren darfst und als Leichenschieber schuftest, bist du Spezialist für Tote? Emil war auch mein Hund. Ich kannte ihn vom ersten Tag an, als die Großeltern ihn gekauft haben, durfte den Namen aussuchen und habe ihn viel öfter ausgeführt als du.«
»Schon gut«, beschwichtigte ihr Vater. »Wir erledigen das gemeinsam. Sobald es dunkel wird, fahren wir los, etwa gegen fünf. Es sei denn, die Praxis ist voller Patienten.«
Aliza hörte deutlich den zweifelnden Unterton in seiner Stimme. Sie wusste, wie sehr es ihn schmerzte, dass seit September 1938 die Approbationen aller jüdischen Ärzte per Verordnung erloschen waren. Nun musste er sich »Krankenbehandler« nennen und durfte nur noch Juden versorgen. Einige seiner langjährigen arischen Patienten kamen dennoch heimlich am Abend oder baten um einen Hausbesuch, doch wann zuletzt alle Stühle im Wartezimmer besetzt waren, daran vermochte Aliza sich nicht zu erinnern.
»Hat denn heute niemand Hunger?«, fragte ihre Mutter, deren trauriger Blick über das beinahe unangetastete Essen wanderte.
»Wir verspeisen es am Abend kalt«, entgegnete ihr Vater. »Du hast nicht umsonst in der Küche gestanden.«
Ihre Mutter lächelte. »Schon gut.« Sie erhob sich von ihrem Stuhl und begann abzuräumen.
»Ich helfe dir«, bot Aliza unaufgefordert an. Ihr war alles recht, was sie ein wenig ablenkte von der Angst um ihren Großvater. Selbst Scherben zu beseitigen oder den Hund zu beerdigen war besser, als untätig darauf zu warten, dass Großvater wieder nach Hause kam.
Die Türklingel schrillte laut wie eine Alarmglocke.
»Wir sind nicht da«, flüsterte Aliza, deren Herz zu rasen begann.
Nur Harald schien keine Angst zu haben. Zornig sprang er auf und schob entschlossen seinen Stuhl zurück. »Wenn das die Gestapo ist, denen blase ich den Marsch, aber ganz gewaltig.«
»Du bleibst hier«, herrschte ihr Vater Harald an. »Oder willst du uns alle ins Unglück stürzen?«
Wieder schrillte die Glocke. Eine dunkle Stimme rief: »Herr Doktor, sind Sie da? Bitte, wir brauchen Hilfe«, begleitet von einem jammervollen Schluchzen.
»Das klingt nicht nach Gestapo«, stellte ihre Mutter erleichtert fest.
»Ich werde nachsehen«, sagte Samuel.
Aliza hielt es nicht an ihrem Platz. Sie ignorierte den mahnenden Blick ihrer Mutter und folgte ihrem Vater.
Im Hausflur stand ein junges Paar neben zwei weinenden kleinen Mädchen mit rotzverschmierten Nasen. Der Mann stützte sich auf den Arm seiner Frau, sein Gesicht war schmerzverzerrt, und aus einer offenen Wunde über der Augenbraue tropfte Blut. Auch die Jacke seines dunklen Anzugs aus dickem Wollstoff war blutbespritzt und teilweise zerrissen. Aliza erschrak beim Anblick des Mannes, der ihr gut bekannt war. Es handelte sich um Jacob Tauber, Inhaber eines Juwelierladens am Olivaer Platz, ein Familienunternehmen in dritter Generation.
»Verzeihen Sie, Herr Doktor, wenn wir Sie in der Mittagszeit stören«, entschuldigte sich die Frau, die einen dunkelblauen Mantel mit Pelzkragen und eine Pelzkappe trug.
»Großer Gott, Herr Tauber, was ist denn passiert?«, fragte ihr Vater.
Aliza wusste, dass er in den letzten Wochen schon mehrmals Patienten mit ähnlichen Verletzungen behandelt hatte. Und jedes Mal hatte er berichtet, dass die Gestapo dahintersteckte.
»Unser Laden ist von einer Horde Nazis überfallen worden«, erklärte Frau Tauber.
Ihr Vater lud die Familie mit einer Handbewegung zum Eintreten ein. »Möchten Sie sich erst einmal setzen? Es ist ein weiter Weg von Ihrem Geschäft bis hierher.«
Herr Tauber nickte tapfer. »Es geht schon.«
»Gut, dann würde ich Sie in die Praxis bitten, dort kann ich Sie besser versorgen. Aliza, sag deiner Mutter Bescheid.«
Aliza tat, wie ihr geheißen, rannte dann aber hinunter, um zu helfen. Papas Sprechstundenhilfe war nämlich vor zwei Tagen ganz überraschend nach Frankreich emigriert, und Aliza hatte schon als kleines Mädchen gern »Sprechstundenhilfe« gespielt. Ihrem Vater Mullbinden, Salben oder Pflaster anzureichen oder wie vor einigen Wochen bei einer Geburt dabei zu sein, war aufregend. Noch vor einem Jahr hatte sie auch Medizin studieren wollen, doch das schien ein Ding der Unmöglichkeit, seit die Nazis sämtliche Studienfächer und auch zahlreiche Berufe für Juden verboten hatten. Und solange die sich immer neue Schikanen ausdachten, würde gleich welches Studium ein Wunschtraum bleiben. Aber sie würde sich von dieser Mörderbande nicht unterkriegen lassen. Wenn die Nazis weiter an der Macht blieben, würde sie eben Schriftstellerin werden. Ihre Mutter glaubte, sie habe großes Talent, trotz der schlechten Noten, die sie für ihre Schulaufsätze nach Hause brachte. Aber das lag nur an dem Deutschlehrer, einem Judenhasser wie aus dem Lehrbuch; er war einer jener selbst ernannten »Herrenmenschen«, die im Mai 1933 mit riesigem Tamtam eine öffentliche Bücherverbrennung am Opernplatz veranstaltet hatten. Auf einem Scheiterhaufen waren die Werke jüdischer Schriftsteller verbrannt worden und mit ihnen auch Bücher »wider den deutschen Geist«. Das Schreiben war zum Glück noch nicht verboten, und als Schriftstellerin würde sie die Machthaber eben mit einem arisch klingenden Künstlernamen täuschen. Vielleicht Anna Müller, das klang nach Müllerstochter, noch deutscher ging es kaum.
Auf den Stühlen im Wartezimmer, dessen blassgelbe Wände dringend einen neuen Anstrich benötigten, saß Frau Tauber zwischen ihren Kindern. Die etwa vier und sechs Jahre alten Mädchen mit den dunklen Pagenköpfen hatten inzwischen aufgehört zu weinen, umklammerten jedoch ängstlich die Arme ihrer Mutter.
Die Tür zur Ordination war geschlossen, Aliza klopfte kurz an und trat ein. Der Behandlungsraum mit den cremeweißen Stahlschränken, in denen hinter Glastüren Fachliteratur, Medikamente und Verbandsmaterial aufbewahrt wurden, war ihr ebenso vertraut wie ihr eigenes Zimmer. Hier hatte ihr Vater ihre aufgeschlagenen Knie verarztet, sie gegen Diphtherie geimpft und mit vierzehn, nach ihrer ersten Monatsblutung, aufgeklärt.
»Erst die Hände«, sagte ihr Vater, als er sie bemerkte, und wies dann mit einer Kopfbewegung zu dem schmalen Schubladenkasten auf Rollen, auf dessen milchweißer Glasplatte ein Fläschchen reiner Alkohol bereitstand.
Aliza wusch ihre Hände am Waschbecken und desinfizierte sie wie eine gelernte Krankenschwester. Auch ohne Anweisung wusste sie, wann ihr Vater eine Tinktur oder eines der Instrumente benötigte, während er Herrn Taubers Wunde über der Augenbraue säuberte.
Der Patient hielt still, obwohl ihm anzusehen war, dass ihn jede Berührung schmerzte. »Haben Sie … es nicht gelesen … oder im Radio gehört?«, fragte Herr Tauber, von Stöhnen unterbrochen.
»Das Brennen wird gleich nachlassen«, versicherte ihr Vater. »Nein, ich bin heute noch nicht dazu gekommen, die Zeitung aufzuschlagen.«
Herr Tauber sog die Luft durch die Zähne ein, als müsste er große Schmerzen ertragen. Aliza litt mit ihm, sie erinnerte sich nur allzu gut, welches Feuer die Jodtinktur auslöste.
»Erzählen Sie«, forderte ihr Vater ihn auf.
»In der Deutschen Botschaft in Paris ist ein gewisser Ernst vom Rath von einem siebzehnjährigen polnischen Juden erschossen worden. Nun zerstören die Nazis unsere Geschäfte und behaupten, das deutsche Volk wolle Rache für den feigen Mord. Aber ich sage Ihnen, es ist wieder mal nur ein Vorwand, um uns zu terrorisieren, auszuplündern und sich gewaltsam unsere Vermögen anzueignen. Ich wurde mit Stöcken …« Herr Tauber stöhnte erneut auf, als Samuel ein Stück Mulltuch über die Wunde legte und es mit dem von Aliza angereichten Pflaster festklebte.
»Leider sind wir noch nicht fertig«, bedauerte ihr Vater, während er Herrn Tauber half, Jackett und Hemd auszuziehen.
Aliza nahm die Kleider entgegen und hängte sie an einen Garderobenhaken an der Wand.
Vorsichtig tastete ihr Vater den Oberkörper des Patienten ab. »Sie haben drei gebrochene Rippen, deshalb die starken Schmerzen beim Luftholen …«, erklärte er.
Aliza hörte aufmerksam zu, was ihr Vater über die Atmung sagte: dass Tauber keinesfalls zu flach atmen dürfe, da es sonst zu einem gefährlichen Sauerstoffverlust im Blut käme.
»Und Sie müssen sich unbedingt im Jüdischen Krankenhaus an der Iranischen Straße röntgen lassen, um abzuklären, ob innere Organe verletzt worden sind. Abtasten reicht da leider nicht.«
Herr Tauber hielt trotz der ärztlichen Warnung den Atem an. Offensichtlich war Luftholen sehr schmerzhaft.
Aliza hätte ihm gerne die Hand gehalten, wie sie es bei Kindern tat. Aber das war wohl unangebracht. Und Cognac, den schwer verletzte Erwachsene zur »Betäubung« bekamen, stand schon lange nicht mehr im Arzneischrank. Der Patientenschwund hinterließ überall seine Spuren.
An diesem Nachmittag jedoch gaben sich die Patienten die Klinke in die Hand. Verprügelte Geschäftsinhaber mit blutenden Wunden, Frauen mit Blutergüssen und zerrissenen Kleidern und sogar Kinder, die misshandelt worden waren.
Aliza und ihr Vater hörten bald auf, die Patienten zu zählen, deren Verletzungen sie behandelten oder die sie ins Jüdische Krankenhaus verwiesen. Und jeder der Hilfesuchenden berichtete von ähnlichen Gräueltaten.
»Es war einfach grauenvoll, Herr Doktor, wild gewordene Horden mit Knüppeln bewaffnet, die zuerst auf die Schaufenster und danach auf mich und die Kunden losprügelten.«
Der nächste Verletzte war kaum noch in der Lage zu sprechen, so grausam war er zugerichtet worden. Sein Sohn begleitete ihn in die Praxis und erzählte von dem Überfall.
»Sie schlugen mit Eisenketten auf uns ein, bedienten sich an allen Waren und forderten sogar Passanten auf, die Auslagen zu plündern.« Ganze Straßenzüge seien mit Glasscherben übersät, und kein Polizist weit und breit, der für Ordnung gesorgt, oder sonst jemand, der dem Wahnsinn Einhalt geboten hätte.
Am späten Nachmittag betrat ein Uniformierter das Sprechzimmer und nahm seine Schildmütze vom Kopf.
»Verzeihn Se, Doktor, det ick so einfach rinnplatze«, entschuldigte der Mann sich. »Tachchen auch, Aliza.«
»Tach, Herr Feiler«, begrüßte ihr Vater den Polizeibeamten aus dem Revier am Kaiserdamm.
Der freundliche Polizist war auch Aliza seit Jahren gut bekannt. Herr Feiler war vor 1933 noch Patient gewesen; dass er als Beamter nicht mehr in seine Sprechstunde kommen durfte, nahm ihr Vater ihm nicht übel.
Verlegen drehte Feiler seine Mütze in den Händen. »Ick müsste Se janz dringend sprechen …«
»Sofort, nur einen Moment«, bat ihr Vater, während er dem halbwüchsigen Jungen auf der Behandlungsliege ein Stück Heftpflaster über die genähte Wunde am Kinn klebte. »Du warst sehr tapfer«, lobte er den schmächtigen Kerl, der, außer die Stirn kraus zu ziehen, keine Miene verzogen hatte. »Sei in den nächsten Tagen sehr vorsichtig beim Waschen, und komm in einer Woche wieder. Dann ziehen wir die Fäden, und du bist wieder so gut wie neu.«
Der Junge zog die Nase hoch. Erst jetzt schien er sich eine kleine Gefühlsregung zu erlauben.
Aliza begleitete den Patienten zur Tür und vertröstete das noch wartende Paar.
»Sie verjeben noch langfristije Termine?«, bemerkte Feiler erstaunt.
»Was meinen Sie?«, entgegnete ihr Vater irritiert, der sich am Waschbecken die Hände säuberte.
»Nun, in diesen unsicheren Zeiten planen die meisten … ähm … Menschen nur noch von eem Tach uuf den andern.«
Aliza sah Feilers verlegener Miene an, dass er eigentlich die Juden hatte sagen wollen. Seit die Nazis an der Macht waren, redeten mehr und mehr Freunde und Verwandte nur noch über Emigration und verließen irgendwann das Land. Anfang August war Tante Helene, eine Cousine von Mama, mit Mann und drei Kindern nach Schanghai ausgewandert. Um dort einzureisen, brauchte man keine Bürgen und auch kein »Vorzeigegeld« als Sicherheit, nicht mal ein Visum, nur eine Ausreisegenehmigung für Deutschland. Tante Helene hatte ihre Apotheke in der Oranienburger Straße weit unter Wert verkauft und davon dann ein Viertel ihres Vermögens als »Reichsfluchtsteuer« an die Nazis abgeben müssen. Was ihr noch geblieben war, hatte für die Schiffspassagen ihrer Familie gereicht. Am Ende war der Familie nur ein kläglicher Rest Bargeld geblieben, um sich ein neues Leben in einem fremden Land aufzubauen. Ob sie gut angekommen waren, hatten sie noch nicht gehört. Es war jedoch eine unvorstellbar weite Reise ans andere Ende der Welt. Zuerst ging es mit dem Zug nach Genua, von wo aus ein Schiff durchs Mittelmeer, das Rote Meer und den Indischen Ozean bis nach China fuhr. Womöglich waren sie noch immer unterwegs.
»Ich weiß, was Sie meinen«, erwiderte ihr Vater, wobei er den Polizisten ratlos anblickte. »Aber ich kann meine Patienten nicht im Stich lassen. Sie wissen doch bestimmt, dass von den über dreitausend jüdischen Ärzten in ganz Deutschland nur noch gut siebenhundert praktizieren. Und selbst unsere Genehmigung, als Krankenbehandler zu arbeiten, ist von der polizeilichen Registrierung abhängig, die jederzeit widerrufen werden …« Ihr Vater stockte, alles Blut wich aus seinem Gesicht. »Sind Sie etwa hier, um mir ein endgültiges Berufsverbot zu verkünden?«
»Nee, nee, Herr Doktor«, beruhigte der Beamte ihn. »Ick komme, um Sie zu warnen, weil ick über drei Ecken erfahren habe, wat Ihrem Vater zujestoßen is.« Feiler brach ab und blickte Aliza an, als wollte er in ihrer Anwesenheit nicht weiterreden.
»Wie geht es meinem Großvater?«, platzte sie aufgeregt heraus.
»Wenn Sie etwas wissen, reden Sie, bitte«, drängte nun auch ihr Vater. »Mein Sohn und ich waren heute Vormittag in der Burgstraße, wurden aber nicht vorgelassen.«
»Leider hab ick keene Ahnung, wohin Ihr Vater jebracht wurde«, antwortete Feiler. »Aber ick weeß, dat er wie unzählige andere Mitglieder der verbotenen SPD verhaftet worden is. Vermutlich is det nur een Vorwand, um Betriebe zu arisieren oder sich de Immobilien untern Nagel zu reißen. In letzter Zeit jeschieht det doch täglich. Ich wollte Se nur warnen, Doktor, womöglich will man Ihnen ooch det Haus wegnehmen. Det Vorgehen ist doch immer det gleiche: Zuerst werden alle Männer der Familie verhaftet, denn folgt de Enteignung und danach … Man will et sich jar nicht so jenau vorstellen. Aber wir wissen nur zu jut, dat diese Bande vor nichts zurückschreckt.«
3
Kurfürstendamm, 9. November
BEHUTSAMNAHMFABIANPagels die Parfümflakons aus der Glasvitrine und rieb sie sorgfältig mit einem weichen Staubtuch ab. War jedes von jeglichem Schmutz befreit und glänzte verführerisch, stellte er die Kristallgefäße zurück auf den ebenfalls gesäuberten Glasboden. Zufrieden war er erst dann, wenn der Eindruck von Perfektion erreicht war, und was die meisten Verkäuferinnen tödlich langweilte, gehörte zu seinen liebsten Beschäftigungen. Nicht nur, weil er als Sohn des Hauses die Parfümerie einmal übernehmen würde, sondern weil er sich dabei an den wichtigsten Tag in seinem Leben erinnerte, als wäre es gestern gewesen.
Es war vor zehn Monaten, an einem Samstag im Januar, der völlig unspektakulär begonnen hatte – abgesehen von den Schneeflocken, die sachte vom Himmel fielen.
Kurz vor Ladenschluss betrat ein junges Mädchen die Parfümerie. Gekleidet in einen grün-schwarz karierten Mantel, steuerte es auf den Ladentisch zu, an dem er soeben eine Kundin verabschiedet hatte. Sie warf die rotblonde Lockenmähne mit so viel Schwung über die Schulter, dass die geschmolzenen Schneeflocken auf ihren Haaren als Tropfen davonflogen. Als sie ihn mit ihren großen hellgrünen Augen anblickte und lächelnd »Guten Tag« sagte, war es um ihn geschehen. Sekundenlang starrte er sie wie eine Erscheinung an, und sein Herz schlug im doppelten Tempo, als wäre er durch die halbe Stadt gerannt. Schließlich hatte er sich wieder im Griff.
»Was darf ich Ihnen zeigen?«, erkundigte er sich mit professioneller Routine.
»Ein Parfüm«, antwortete sie.
Er vermochte seine Freude kaum zu verbergen, denn nichts war zeitaufwändiger als die Auswahl eines Duftes. Und nichts eignete sich so sehr, Genaueres über eine Kundin zu erfahren. Sollte es ein Eau de Toilette für alle Tage oder ein intensiver Duft für besondere Gelegenheiten sein? Nur ein kleines Fläschchen für die Handtasche oder ein repräsentativer Flakon für den Toilettentisch? Die Antworten verrieten eine Menge über die Gewohnheiten, ob die Dame ledig oder verheiratet war und natürlich auch etwas über den sozialen Stand, denn reines Parfüm war erheblich kostspieliger als ein preiswertes Eau de Cologne. Um die Adresse des jungen Mädchens zu erfahren, bot er kostenlose Lieferung frei Haus an. Es verstand sich von selbst, dass er sie selbst übernommen hätte.
»Die Ausgabe können Sie sich sparen«, lachte sie und kräuselte ihre niedliche Nase mit den Sommersprossen.
Doch so schnell gab ein Pagels nicht auf. »Dann werde ich Sie nach Hause begleiten, sonst bleiben Sie noch in einer Schneeverwehung stecken«, sagte er mit ernster Miene, als läge Berlin im hintersten Sibirien.
Selbstbewusst blickte sie ihn an. »Wenn Sie nichts Besseres vorhaben, meinetwegen.«
Diese erste aufregende Begegnung lebte jedes Mal wieder auf, sobald er den von Lalique entworfenen bauchigen Flakon in die Hand nahm und an dem blumigen Duft von Je Reviens schnupperte.
Das momentane graue Novemberwetter glich ein wenig dem im vergangenen Januar, genau wie seine Hochstimmung. Heute Abend würde er seinen achtzehnten Geburtstag mit Aliza feiern. Den Musterungsbescheid, der vormittags in der Post gewesen war, verdrängte er. Er würde auch Aliza nicht davon erzählen. Wozu? Es war nur ein Bescheid. Ob er für den Wehrdienst tauglich war, würde sich erst bei der Untersuchung herausstellen. Heute wollte er nicht über derlei Unerfreulichkeiten nachdenken. Heute wollte er glücklich sein. Mit der großen Liebe seines Lebens.
Der Vormittag verlief trotz des regen Betriebs schleppend. Fabian war ungeduldig wie selten und empfand sogar jene Kundin als lästig, die sich das gesamte Pflege- und Make-up-Sortiment einer französischen Firma einpacken und damit die Kasse kräftig klingeln ließ. Ihm blieb nicht einmal Zeit für eine Zigarettenpause, und dennoch schienen die Zeiger seiner Armbanduhr vorwärtszukriechen. Wann immer er einen Blick darauf warf, waren kaum fünf Minuten verstrichen. Er sehnte sich nach dem Ladenschluss um halb sieben – nach Aliza. Nach ihrem Lachen, ihrer Umarmung und vor allem nach ihren süßen Küssen.
Am späten Nachmittag gegen fünf, während vor dem aufziehenden grauen Nebel in den Straßen all die Cremetiegel, Fläschchen und Flakons im Licht der Neonbeleuchtung noch kostbarer als sonst glitzerten, drang frenetisches Gebrüll in die leisen Beratungsgespräche. Beinahe im selben Moment hörte Fabian das Zersplittern von Glas. Dem sekundenlangen Klirren nach zu schließen war ganz in der Nähe ein Schaufenster zu Bruch gegangen.
Vor Schreck rutschte ihm der Pinsel ab, mit dem er einer blonden Kundin gerade den neuesten Nagellack namens Rouge noir auf dem Nagel seines kleinen Fingers vorführen wollte. Die aufreizende Blondine mit der Nutriastola um den Hals achtete gar nicht darauf, sondern hastete, wie auch die anderen Damen im Laden, neugierig zum Schaufenster.
Fabian verschloss das Nagellackfläschchen und entfernte in aller Ruhe den Patzer mit einem Papiertuch. Als die nächste Schaufensterscheibe zu Bruch ging, war ihm, als vibrierten die Kristallflakons in der Vitrine. Nun gesellte er sich doch zu den Schaulustigen am Fenster. Was er über die Köpfe der Damen und Herren hinweg beobachten konnte, war schlichtweg unfassbar. Entsetzt sah er vier oder fünf breitschultrige Männer in Zivil mit Eisenstangen auf die Auslagen des gegenüberliegenden Bekleidungshauses Bamberger eindreschen. Dazu brüllten sie weithin hörbar »Juda verrecke« und tobten wie von Sinnen. Was war da los? In einem ersten Impuls wollte er hinausrennen, dem brutalen Treiben Einhalt gebieten oder zumindest laut aufschreien. Nur der Kundschaft wegen hielt er sich zurück und presste die Lippen zusammen.
Die Ladentür öffnete sich, und eine Gruppe von fünf oder sechs Passanten trat ein, die offensichtlich Schutz suchten.
»Wat jeht denn da draußen vor?«, erkundigte sich eine der Verkäuferinnen.
Erneut öffnete sich die Ladentür. Herein trat eine prominente Filmschauspielerin in einem prächtigen Silberfuchsmantel, der ihr das Aussehen einer russischen Prinzessin verlieh. Ihr folgte ein blonder Hüne in einer ordenverzierten schwarzen Wehrmachtsuniform. Das Pärchen zog sofort alle Blicke auf sich.
»Der Volkszorn erwacht«, verkündete der Hüne, als hätte er die Frage der Verkäuferin gehört. »Jetzt geht es dem Judenpack an den Kragen.«
Spitze Schreckensschreie wurden ausgestoßen. Aufgeregte Kommentare wurden laut.
»Wat is los?«
»Das deutsche Volk wehrt sich gegen die Vorherrschaft der Juden«, antwortete er mit abfälliger Miene.
»Versteh ick nicht, was soll det denn heißen?«
Der Uniformierte grinste hämisch. »Das Judenpack dominiert doch die gesamte deutsche Wirtschaft, dem muss endlich Einhalt geboten werden.«
»Genau! Der Stürmer hat och darüber berichtet, det de Juden ganze Ladenstraßen beherrschen, Mietshäuser besitzen und de Vergnügungsstätten bevölkern. Det is een unmöglicher Zustand.«
»Dabei sind se doch nur verlauste Ausländer, die uns deutsche Mieter abkassieren. Ick finde det unerträglich. Det muss uffhörn.«
»Da ham Se recht. Man muss nur mal durch de Berliner Viertel laufen, egal, wo de hinkiekst, een Judenladen nach dem anderen. Überall ham se de Finger drin.«
»Was ein Glück, dass se ihre Schaufenster nun mit einem weißen J kennzeichnen müssen, so sind se schneller zu erkennen.«
Der hochdekorierte Wehrmachtshüne erklärte schadenfroh: »Das erleichtert doch vieles!«
Zustimmendes Gelächter wurde laut.
Fabian hätte den Nazi samt seiner Holden zu gerne des Ladens verwiesen. Doch er war auch Geschäftsmann, und als solcher war es ihm unmöglich, die Kundschaft zu maßregeln. Der Kunde war König, aber sich das Gehetze weiter anzuhören, das ging dann doch zu weit. Er eilte in den rückwärtigen Teil des Geschäfts, wo er durch eine verspiegelte Tür in einen schmalen Arbeitsraum gelangte, in dem der Telefonapparat installiert war. Er würde die Polizei anrufen, damit sie etwas gegen die Zerstörer unternahm. Es konnte doch nicht angehen, dass jeder X-Beliebige seine warum auch immer aufgestaute Wut am nächsten Schaufenster auslassen durfte. Dass er so empfand, hatte nicht nur mit Aliza oder ihrer Familie zu tun. Seit der Machtübernahme der NSDAP häuften sich die Ausschreitungen und Schikanen gegen die Juden, und das war ihm einfach unerträglich. Gegen diese Horde da draußen würde er allein wenig ausrichten können. Die Polizei musste einschreiten.
»Wat globen Se denn, wat ick tun soll?«, antwortete der Beamte am anderen Ende der Leitung, nachdem Fabian ihm die Situation geschildert hatte.
»Das ist Sachbeschädigung, und Sie sind verpflichtet, dagegen vorzugehen«, protestierte Fabian energisch.
»Ick weeß, ick weeß, aber so einfach is det nich«, seufzte der Mann und legte ohne weitere Erklärungen auf.
Fabian war derart überrascht, dass er noch einige Male »Hallo« in den Hörer brüllte, bis er einsah, dass am anderen Ende tatsächlich aufgehängt worden war. Was war das denn?, murmelte er halblaut vor sich hin und überlegte, was der Polizist mit seiner letzten Bemerkung hatte ausdrücken wollen. Eine logische Erklärung fiel ihm aber nicht ein.
Trotz der geschlossenen Bürotür hörte er nun erneut das Splittern von Glas. Und dass nicht nur ein schlichtes Wasserglas zu Bruch gegangen war, sondern eine größere Fläche, verriet das darauf folgende Gejohle.
Im Verkaufsraum harrten einige Kundinnen unverändert vor der Auslage aus, offensichtlich fasziniert vom Geschehen.
Fabian überlegte verzweifelt, wie er die schaulustigen Damen auf elegante Weise aufscheuchen könnte, als die Ladentür sich ein weiteres Mal öffnete.
»Jemand verletzt?«
Es war sein Vater und Chef des Hauses, Bruno Pagels, ein großer brünetter Mann Anfang vierzig, dessen sonore Stimme die Schaulustigen am Fenster aufschreckte. Die Damen fühlten sich ertappt, die Angestellten erinnerten sich, was sie hier eigentlich zu tun hatten, und huschten auseinander, während sie aufgeregt das Geschehen kommentierten.
Bruno Pagels sah sich nach Fabian um, entdeckte ihn am Kassentresen und ging auf ihn zu. Normalerweise war er wie sein Sohn den ganzen Tag im Geschäft anwesend, doch heute waren er und seine Frau in der Privatwohnung über der Parfümerie mit den Vorbereitungen für ein besonderes Abendessen beschäftigt gewesen. Eine Radiomeldung und der Lärm auf der Straße hatten ihn aufgescheucht.
»Was sich da draußen abspielt, gefällt mir gar nicht«, sagte er zu Fabian und berichtete von den Nachrichten und den allerorts stattfindenden Aktionen gegen jüdische Geschäfte und Hausbesitzer. »Sogar Synagogen brennen.«
»Ich habe gerade bei der Polizei angerufen«, entgegnete Fabian. »Der Beamte am Telefon hat sich zwar höchst seltsam benommen, aber ich hoffe, sie schicken jemanden.«
»Dann sollten sie sich beeilen, bevor die Randalierer alles kurz und klein schlagen«, sagte Bruno leise, als Fabians Kundin auf sie zukam. Sie hatte sich an den Nagellack erinnert. Pagels senior riet noch zu einem farblich passenden Lippenstift. Gnädig nickte die Kundin die Empfehlungen ab.
Fabian versicherte: »Vorzügliche Wahl«, als er den Kassenbon ausstellte und anschließend den Einkauf abkassierte.
Bruno hatte inzwischen die Waren verpackt, überreichte das Päckchen mit einem »Beehren Sie uns bald wieder« und wandte sich abermals an Fabian. »Hast du was von Aliza gehört?«
Sein Sohn hatte ihnen Aliza im Frühjahr vorgestellt, und sie waren genauso in dieses bezaubernde Mädchen verliebt wie Fabian selbst. Bruno und seine Frau störte es nicht, dass Aliza Jüdin und noch sehr jung war. Jung gefreit, nie bereut, hatte schon seine Mutter gesagt, als er selbst mit zwanzig seine damals achtzehnjährige Frau geheiratet hatte. Doch er hatte Fabian zur Seite genommen, ihm ein Päckchen der von Reichsführer SS Heinrich Himmler verbotenen Fromms Präservative zugesteckt, über Verantwortung gesprochen und gesagt: »Solange Aliza noch zur Schule geht, möchte ich keine ›böse Überraschung‹ erleben.«
»Eigenartig«, wunderte sich Bruno. »Normalerweise meldet sie sich doch nach der Schule …«
»Nicht jeden Tag«, wandte Fabian ein. »Vielleicht möchte sie mir lieber persönlich gratulieren und hat deshalb noch nicht angerufen. Wir haben uns für sieben Uhr verabredet, ich werde sie abholen.«
»Hoffen wir, dass alles in Ordnung ist«, sagte Bruno, wobei eine tiefe Unmutsfalte zwischen seinen Brauen entstand.
»Was meinst du?«, fragte Fabian.
»Ich überlege nur, wie es den Landaus geht. Die Meldungen über brennende Synagogen und was sich da draußen abspielt sind vielleicht erst der Anfang. Wer weiß, was den braunen Brüdern noch alles einfällt.«
»Vater! Du machst mir Angst.« Fabian war laut geworden, ein Ehepaar drehte sich irritiert um und begann zu flüstern.
»Das lag nicht in meiner Absicht, tut mir leid. Ich wollte dich nicht beunruhigen«, beschwichtigte Bruno seinen Sohn.
»Aber jetzt bin ich es. Wenn du einverstanden bist, fahre ich sofort zu Aliza.«
Bruno nickte. »Natürlich, bis Ladenschluss kümmere ich mich um die Kundschaft. Aber sei vorsichtig, geh diesen Schlägern aus dem Weg, und misch dich nicht in Streitereien ein. Damit hilfst du nämlich niemandem.«
Fabian kümmerte sich weder um die Mahnung seines Vaters noch um das feuchtkühle Novemberwetter, das einen warmen Mantel verlangt hätte, sondern hetzte im Anzug auf die Straße und hielt ein vorbeifahrendes Taxi an. Atemlos nannte er dem Fahrer die Straße und bat ihn, »auf die Tube« zu drücken.
Der Fahrer nickte mürrisch. Ob er schlecht gelaunt oder ihm die kurze Strecke von der Parfümerie in die Wormser Straße nicht genehm war, interessierte Fabian aber nicht.
Es dauerte immerhin zwanzig Minuten, bis der Wagen sich dem Ziel näherte. Der Chauffeur hatte mehrmals großen Glasscherben und Schaulustigen ausweichen müssen, die die Straße blockierten. Auch Lastwagen, in die Menschen verladen wurden, behinderten die Fahrt. Fabian sah dieses unmenschliche Vorgehen gegen jüdische Mitbürger nicht zum ersten Mal, angeblich wurden sie nach Osten, in eine neue, rein jüdische Heimat ausgebürgert, aber nach dem Terror gegen die jüdischen Geschäfte hegte er Zweifel an diesen Behauptungen. Eine jüdische Familie aus der Nachbarschaft war letzte Woche abgeholt worden, nur mit Handgepäck. Wie sollten sie sich damit denn ein neues Leben aufbauen? Im nächsten Moment befiel ihn ein grausamer Gedanke: Hatte Aliza deshalb nicht angerufen, weil sie und ihre Familie ebenfalls verhaftet worden waren? »Schneller, schneller!«, schrie er voller Panik. »Es ist ein Notfall.«
Entnervt kurvte der Fahrer über Umwege zur angegebenen Adresse, während er bei jeder Störung »Wat für ’ne Sauerei« fluchte.
Fabian ahnte, dass der Mann sich nicht anmerken lassen wollte, ob er mit seinen Äußerungen die Schlägertrupps, die Verwüstungen oder das Vorgehen gegen die Juden meinte. In Zeiten, wo Hakenkreuzfahnen das Stadtbild prägten, war es gefährlich, offenkundig sein Missfallen auszudrücken. Ein falsches Wort konnte den Gewerbeschein kosten, Berufsverbot oder die Verhaftung bedeuten. Es war ratsam, lediglich dann eindeutig Partei zu ergreifen, wenn man für die Partei war. Seine wahren Gefühle äußerte man nur noch innerhalb der Familie, denn die Angst vor Repressalien war meist größer als die Zivilcourage.
Am Ziel angekommen, atmete Fabian erleichtert auf, als er sah, dass die hohen Sprossenfenster der Praxis jetzt um sechs noch erleuchtet waren. Trotz der eingeschränkten Sprechstunden, wie auf dem neuen Emailleschild stand.
Fabian wusste, dass Alizas Vater seit über zwanzig Jahren praktizierte, einen ausgezeichneten Ruf und vor dem Berufsverbot das Wartezimmer täglich voller Patienten gehabt hatte. Wie grausam musste es für den leidenschaftlichen Mediziner gewesen sein, als man ihm die Kassenzulassung entzogen hatte und er sich nicht mehr Arzt nennen durfte.
Erleichtert bemerkte Fabian, dass die graublau lackierte Haustür unbeschädigt und auch noch nicht verschlossen war. Obwohl er das imposante Jugendstilanwesen nicht zum ersten Mal betrat, war er abermals beeindruckt von der Eleganz in dem edel gestalteten Treppenhaus: Die Stufen wie auch die schulterhohe Wandtäfelung waren aus rötlichem Marmor, die runden Spiegel an den Seitenwänden umrandet von floralen Stuckgirlanden, kristallene Lüster hingen von der Decke. Ein Aufzug in einem kunstvoll geschmiedeten Gerüst vervollständigte die geschmackvolle Ausstattung.
Fabian überlegte, ob er Dr. Landau von den Krawallen berichten sollte. Vielleicht hatte er nichts davon mitbekommen, überall in den Nebenstraßen wie auch in der ruhigen Wormser Straße war es so friedlich wie an einem ganz normalen Mittwochabend.
Als er im Hochparterre angelangt war, wurde die Praxistür geöffnet, und Aliza trat heraus. Ihre hellgrünen Augen glänzten, ihre Wangen schimmerten rosig, und ihr rotblondes Haar war locker im Nacken zusammengebunden. Alles, was er unter Schönheit verstand, war in Aliza vereint.
4
Berlin, 9. November 1938
ALIZAWARVON