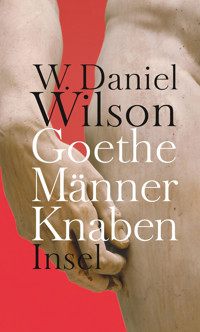
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nackte Ganymede und ihr göttlicher Entführer; der fast weibliche Apoll von Belvedere; zwei schöne nackte Jünglinge, von denen einer dem anderen den Arm über die Schulter legt: Die Kunstwerke im Treppenhaus von Goethes Wohnhaus in Weimar sind nicht nur antike Klassiker, sondern auch ein homoerotisches Bildprogramm par excellence. Und in seinem dichterischen Werk, von der frühen Vorliebe für androgyne Gestalten über die obszönen Witze im Umfeld der »Römischen Elegien« bis zur Geschlechterverwirrung der »Grablegung« in »Faust II« beschäftigt sich Goethe ebenfalls intensiv mit dem Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe. In dieser Werkbiographie mit Blick aufs andere Ufer enthüllt W. Daniel Wilson einen überraschenden ‚homosexuellen‘ Impuls in Goethes Werk, der von sublimer romantischer Liebe bis zu fast pornographischer Derbheit reicht. In bestechenden Einzelanalysen zeigt Wilson, wie Goethe in seinen Werken die Grenze zwischen gleichgeschlechtlicher und gegengeschlechtlicher Liebe schrittweise verwischt. Und Goethe bereichert die mann-männliche Liebe durch ein entscheidendes Moment: das der Partnerschaftlichkeit. Damit stößt er der gleichgeschlechtlichen Liebe das Tor zur Moderne auf. - mit zahlreichen Abbildungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 768
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
W. Daniel Wilson
Goethe MännerKnaben
Ansichten zur ›Homosexualität‹
Mit zahlreichen Abbildungen Aus dem Englischen von Angela Steidele
Insel Verlag
Die Arbeit an diesem Buch wurde gefördert vom
eBook Insel Verlag Berlin 2012
Erste Auflage 2012
© Insel Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-458-79320-5
www.insel-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1 Liebesgrüße aus Griechenland
2 Ganymed und seine Freunde: Die voritalienische Zeit
Götter Helden und Wieland
Eine Nacht mit Sokrates
Übersinnliche Knabenliebe: »Ganymed«
Übersinnliche Pädophilie: »Erlkönig«
In Weimar: Lukians Küsse und Kinäde
Mignon und sein Eiertanz
3 Das Land der Sodomie: Italien und die Folgen
Kleidertausch: Karneval und Theater
Der strafende Phallus: Priapische Übungen und die Römischen Elegien
Bettina und die »Buben aus dem Alterthum«: Venezianische Epigramme
4 Liberale Gesinnungen: Das Winckelmann-Buch und Verwandtes
Winckelmanns Briefe und Sex
Antikes
Freundschaft
Schönheit I: Utopie
Schönheit II: Natur und Ursprünge
Schönheit III: Lebendige Kunst
Echte Kerle
Falsche Weiber
Gegen das Verbergen
5 Schenke spricht, Schenke liebt: West-oestlicher Divan
In den Kot fallen
Persischer Ganymed
Die Staubverliebten
Knabenbordell
Schenke spricht
Silberleib
6 Buben im Treppenhaus
»Hercules und Hylas« und Wilhelm Meisters Wanderjahre
Apoll und Hyazinth
Hadrian und Antinous
Salve, Schwule!
7 Die wahren Hexenmeister: Faust II
8 Goethe und die griechische Liebe
Anhang
Anmerkungen
Siglen
Bibliographie
Bildnachweis
Register der Werke Goethes
Register der Personen, Werke und mythologischen Figuren
Sachregister
Meiner Großfamilie: Lucy, Marguerite, Adrian, Martin und Christina
Vorwort
Wer heute Goethe liest, staunt, wie vielschichtig und modern er in seinem gesamten Werk die Themen Geschlecht und Begehren behandelt. Es verwundert daher, dass sich die wenigen Bücher über Goethe und die ›Homosexualität‹ vorwiegend auf seine eigenen angeblichen Neigungen beschränkt haben. Wie sehr die ›griechische Liebe‹ ihn fesselte, wie anhaltend er über sie nachdachte, wie überraschend er sie ›modernisieren‹ wollte – all das ist von der Literaturwissenschaft bislang nur unzureichend aufgearbeitet worden. Das vorliegende Buch ist die erste umfassende Studie zu Goethes Haltung gegenüber einem Phänomen, dem die Mehrheit auch in den westlichen Gesellschaften weiterhin zurückhaltend begegnet und das weltweit immer noch angefeindet wird. Zu Grunde liegt dieser Untersuchung ein reiches Korpus von Texten aus allen Phasen von Goethes Schaffen einschließlich bislang unveröffentlichter Quellen.
Befragt nach seiner Haltung zur gleichgeschlechtlichen Liebe, erscheint der mehr verehrte als gelesene Dichterfürst lebendiger als je, geradezu verjüngt. Er erschüttert das antike Muster von Herrschaft und Unterwerfung in der griechischen Liebe und verleiht dem traditionell passiven und stummen ›Geliebten‹ erstmalig eine Stimme. Schrittweise verwischt er in seinen Werken die Grenzen zwischen gleichgeschlechtlicher und gegengeschlechtlicher Liebe. Letzten Endes betrachtet Goethe die Liebe zwischen Männern als eine Art höherer Existenz, den banalen, auf Fortpflanzung angelegten ›heterosexuellen‹ Beziehungen überlegen. Mit Wärme und Achtung begegnete er Männerliebhabern und verlangte Gleiches von der Gesellschaft.
Ein solches Thema darf auf Interesse auch jenseits streng akademischer Kreise hoffen. Diese selektive Werkbiographie mit Blick aufs andere Ufer ist nach wissenschaftlichen Standards erarbeitet, doch für die breitere Öffentlichkeit geschrieben. Um den Lesefluss nicht zu stören, findet die Auseinandersetzung mit der Forschung zumeist nur in den Anmerkungen statt, wo Fragen und Probleme für die Literatur- und Kulturwissenschaften vertieft aufbereitet werden.
Die Arbeit an diesem Vorhaben wurde durch mehrere Freisemester ermöglicht, die mir das Royal Holloway, University of London großzügig gewährte, sowie durch ein Stipendium des Arts and Humanities Research Council. Mit großer Freude danke ich zahlreichen Kollegen für ihre selbstlose Unterstützung. Zu den Germanisten, die Teile des Manuskripts gelesen und mit wertvollen Hinweisen bereichert haben, zählen Matthew Bell (King’s College, London), Susanne Kord (University College, London), Horst Lange (Nevada), Angus Nicholls (Queen Mary, University of London), Jim Reed (Oxford) und Hans Rudolf Vaget (Smith College, Massachusetts). Vorträge in Berkeley, Birmingham, Edinburgh, Halberstadt, London, Manchester, Oakland, Pittsburgh, Oxford, Swansea, Toronto und Weimar beschenkten mich mit fruchtbaren Diskussionen. Kollegen aus anderen Disziplinen halfen mir durch unvertrautes Gelände: Jane Everson, John O’Brien und Ahuvia Kahane (Italienische, Französische bzw. Klassische Philologie am Royal Holloway, University of London), Nima Mina (Iranistik, School of Oriental and African Studies, University of London) und Caroline Vout (Kunstgeschichte, Cambridge). Susanne Schäfer (Freie Universität Berlin) machte deutsche Übersetzungen antiker Autoren ausfindig. In Weimar unterstützten mich von der Klassik Stiftung Weimar: Wolfgang Albrecht, Georg Kurscheidt, Elke Richter (Abteilung Editionen), Katharina Krügel (Kustodin Plastik), Bettina Werche (Kustodin Gemälde), Jochen Klauß (Goethes Bibliothek im Goethe-Nationalmuseum), Bernhard Fischer (Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs) und besonders sein Vorgänger Gerhard Schmid. Der Direktor des Stadtarchivs Weimar, Jens Riederer, stand mir über viele Jahre hilfreich bei. Die Archivarinnen und Bibliothekare in Weimar (einschließlich des Thüringischen Hauptstaatsarchivs), in der British Library sowie in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz waren mir stets eine große Stütze. Meine Frau, die Historikerin Christina von Hodenberg, war mir eine geduldige und unschätzbare Gesprächspartnerin.
Eine wahre Mitstreiterin gewann ich in der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Angela Steidele. Nach dem Erfolg ihrer Geschichte einer Liebe: Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens (Insel, 2010) machte sie Thomas Sparr (Suhrkamp/Insel) auf mein Projekt aufmerksam, der sich sofort für das Vorhaben engagierte. Angela Steidele schärfte als Lektorin und Übersetzerin meine Argumentation mit Leidenschaft und Umsicht; liest sich das Buch flüssig, ist es ganz besonders ihr zu verdanken. Für ihre Mitarbeit bin ich ihr zutiefst verbunden.
London, im Januar 2012
KAPITEL 1 Liebesgrüße aus Griechenland
Gegen Mittag des 28. August 1829 betreten Antoni Edward Odyniec und Adam Mickiewicz Goethes Haus am Frauenplan. Der 80. Geburtstag des Hausherrn gleicht in der kleinen Residenzstadt Weimar einer Staatsangelegenheit, zu der sich Gäste aus ganz Europa, Abgeordnete von Universitäten, Theatern und gelehrten Gesellschaften eingefunden haben. Zur Überraschung der beiden polnischen Dichter und Reisegefährten steht die Tür sperrangelweit auf, und der Diener verlangt keine Karte: Heute stehe das Haus jedermann offen. Während sie im Vestibül warten, bis eine Schar Gratulanten gegangen ist, betrachtet Odyniec die beiden Statuen in den Nischen, die ihm schon bei früherer Gelegenheit aufgefallen sind: zwei Mal der nackte Ganymed, gleich groß. Der eine breitet die Arme weit aus in glühender Erwartung, von Zeus’ Adler entführt zu werden; es ist ein Abguss einer antiken Statue. Die andere, ein modernes Werk, zeigt den Knaben auf dem Olymp, wo er seinem göttlichen Liebhaber Wein einschenkt. Vor den beiden steht die antike Statue eines Hundes, der Odyniec an die Entführung Ganymeds erinnert, wie Vergil sie beschreibt; dort bellen Hunde dem Adler hinterher, der den Jungen verschleppt. Der Adler selber, so weiß Odyniec noch vom letzten Besuch, hängt oben im Treppenhaus über der Tür – der erste Ganymed scheint zu ihm aufzusehen.
Auf dem ersten Absatz von Goethes großartiger ›italienischer‹ Treppe erkennt der Pole dann eine Büste des Apoll von Belvedere, des Gottes der Dichtkunst und der Sonne. Er erinnert sich, dass Apoll die schönen Jünglinge Hyazinth und Cyparissus liebte, die beide jung starben. Auch Winckelmanns Begeisterung für diese fast weibliche Statue fällt ihm ein. Neben Apoll steht Achill, und Odyniec meint sich zu entsinnen, dass dieser Held des Trojanischen Kriegs ebenfalls einen früh dahingeschiedenen Jüngling liebte, seinen schmucken Waffenkameraden Patroklus. Während er langsam hinter einigen Engländern die Treppe hochsteigt, studiert Odyniec an der Wand Zeichnungen der Elgin Marbles aus dem Britischen Museum, die Goethe ihm stolz beschrieben hat und die eigens für den Großherzog angefertigt wurden. Eine zeigt Herkules, der ebenfalls geliebte Jünglinge verlor, Hylas und Abderus. Auf der zweiten Zeichnung schmiegt sich eine Frau in den Schoß einer anderen. Sie erinnern den Polen an zwei griechische Liebhaberinnen, die Goethe in einem seiner Werke erwähnt. Oben, direkt neben der Tür ins erste Zimmer, steht ein beeindruckendes Doppelstandbild zweier schöner nackter Jünglinge. Einer legt dem anderen den Arm um die Schulter. Sie stellen den römischen Knaben Antinous dar – der ebenfalls tragisch umkam – und den Geist seines Liebhabers, des Kaisers Hadrian; so sagt man jedenfalls, erinnert sich Odyniec, als er mit seinem Freund die Schwelle mit der Intarsie ›Salve‹ überschreitet.
Der Gelbe Saal ist voller Gratulanten. Schnell finden sie Goethe und stammeln auf Französisch ihre Glückwünsche. »Je vous remercie, Messieurs, je vous remercie sincèrement.« Stolz zeigt ihnen das Geburtstagskind einen huldvollen Brief des bayerischen Königs, den jede Menge Bewunderer umringen. Er begleitet ein grandioses Geschenk, das im nächsten Raum steht, in den Goethe sie nun führt. Dieses Büstenzimmer gleicht einem Museum und wird von Bildern des Weingottes Bacchus beherrscht, der fast so aussieht wie eine Frau. Nicht anders der kolossale Antinous; Odyniec erkennt in ihm die berühmte Büste aus Mondragone in Italien. Mitten im Raum steht die Gabe Ludwigs I., auf einem Podest und mit Blumenranken geschmückt: der Abguss eines antiken Torsos. Es ist Niobes jüngster Sohn, den Apoll erschlug, auch wenn ihn seine Schönheit tief berührte. Später bemerkt Odyniec, wie Goethe allein zu der Statue zurückkehrt; er bewegt die Hände, als ob er mit ihr spräche – keiner seiner Gäste scheint ihm so lebendig wie dieser Torso zu sein.
Antoni Edward Odyniec’ Gedanken an Goethes 80. Geburtstag habe ich zwar frei geschildert, doch treu nach historischen Berichten. Dabei habe ich die Kunstwerke in Goethes Treppenhaus sowie in seinem Büstenzimmer so wiedergegeben, wie das frühe 19. Jahrhundert sie verstand; heute interpretiert man sie häufig anders.1 Odyniec’ Gang durch Goethes Haus wirft grundsätzliche Fragen auf – einmal davon abgesehen, warum noch niemandem, zumindest nicht im Druck, das homoerotische Bildprogramm aufgefallen ist, dem mit einer einzigen Ausnahme die elf Kunstwerke in Goethes legendärem Treppenhaus angehören. Teilten Goethes gebildete Gäste zumindest einige der Gedanken, die ich Odyniec zugeschrieben habe? Helfen diese Kunstwerke, Goethes Haltung zur gleichgeschlechtlichen Liebe zu verstehen? War er vielleicht selber schwul? Können die Begriffe ›schwul‹ oder gar ›homosexuell‹ überhaupt eine Person beschreiben, die 1829 oder 1770 gelebt hat? Warum erzählen so viele Kunstwerke in Goethes Treppenhaus vom frühen Tod geliebter Jünglinge? Was war überhaupt ein ›Jüngling‹ oder ein ›Knabe‹, was ein ›Geliebter‹ und was ein ›Liebhaber‹, und zwar sowohl in den deutschen Ländern des 18. Jahrhunderts als auch in der Antike? Das Treppenhaus mit seinen homoerotischen Anspielungen ist nur eines – wenn auch ein besonders markantes – von vielen Beispielen, das mich zu meiner These führt: Goethes Sicht auf die gleichgeschlechtliche Liebe kann nur im Rückgriff auf die Antike verstanden werden – eine Antike, die für das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert lebendig war. Noch stärker als viele seiner Zeitgenossen empfand Goethe, den die vorurteilslose Erforschung der menschlichen Natur antrieb, die Antike und insbesondere die griechische Liebe als brennend aktuell und dichterisch anregend.
Die ›griechische Liebe‹ der Antike wird vielfach missverstanden. Zunächst einmal war sie nicht auf Griechenland beschränkt. Auch im alten Rom kam sie, etwas später, häufig vor. Das antike Persien – für meine Interpretation des West-oestlichen Divans von Bedeutung– kannte ein ähnliches Phänomen. Die »asiatische Homosexualität«,2 wie sie mittlerweile genannt wird, war im Mittelmeerraum, in der Türkei, in großen Teilen des Nahen Ostens und Südostasiens, in China, Japan und den Südpazifischen Inseln weit verbreitet. Für die Europäer war freilich die griechische Variante von größter Bedeutung, lag sie doch, zusammen mit der römischen, der eigenen Zivilisation zu Grunde – oder beschmutzte sie, je nach Standpunkt. Als Teil der Gründungskultur des Abendlands fasziniert die griechische Liebe Europa seit je.
Dabei darf die griechische Liebe nicht mit der Homosexualität verwechselt werden. Dieser letztere Begriff wurde zuerst 1869 öffentlich gebraucht und bezeichnete zu Beginn eine psychische Verirrung, einen pathologischen Befund – ist also mit dem antiken Verständnis sexueller Vorlieben völlig unvereinbar. Darüber hinaus steht er für eine bestimmte Identität, für die Vorstellung, Männer, die Sex mit Männern haben, unterschieden sich grundsätzlich von anderen Männern. Zwar könnte es in der Antike eine ähnliche Identität gegeben haben, nämlich den Kinäden (griech. kinaidos, lat. cinaedus), einen erwachsenen Mann, der sich weiblich gab und kleidete und sich gern von anderen Männern penetrieren ließ. Doch ist der wissenschaftliche Streit über die Identitätsfrage nebensächlich, da Goethe sich nicht eingehend mit der Figur des Kinäden befasste, obwohl er sie kannte (mehr dazu im nächsten Kapitel). Eines scheint jedoch gewiss: In der Antike betrachteten sich Männer, die den aktiven Part beim Sex mit Jünglingen übernahmen, nicht als anomal oder gar krank; und ganz sicher galten sie nicht als weniger männlich als Männer, die nur mit Frauen ins Bett gingen.
Ein weiterer Unterschied zwischen modernen Homosexualitäten und der griechischen Liebe ist für diese Untersuchung bedeutender: das Alter. Partnerschaften zwischen ungefähr gleichaltrigen Männern sind heute gang und gäbe. Im Gegensatz hierzu waren bei den alten Griechen Beziehungen zwischen einem älteren Liebhaber (griech. erastēs) und einem jugendlichen Geliebten (erōmenos) üblich. Das führte zum größten aller modernen Missverständnisse, jüngst bezeichnet als »Mythos der Knabenliebe«3. Da Goethes Verständnis, Würdigung und Kritik der griechischen Liebe ganz auf diesem schwer zu verstehenden antiken Phänomen beruht, müssen hier dessen sozial- und kulturhistorischen Bedingungen skizziert werden.
Was war ein ›Knabe‹ im alten Griechenland – und in den deutschsprachigen Ländern des 18. Jahrhunderts? Die Antwort wird nicht leichter dadurch, dass das griechische Wort paides (Knaben) zwei Bedeutungen hatte: Im engeren Sinn bezeichnete es Jungen bis ungefähr zum 18. Lebensjahr, doch wurde es im weiteren Sinne auch für 18- bis 19-jährige junge Männer gebraucht.4 Der ›Liebhaber‹ war fast immer älter als 18, doch nicht viel; üblicherweise hörte er um die 30, wenn er heiratete, mit dem Sex mit Knaben auf. Der jüngere Partner oder ›Geliebte‹ musste älter als 18 sein; Sex mit einem Minderjährigen galt als Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden konnte. Wohlhabende Familien stellten Sklaven als Aufseher oder Leibwächter (paidagōgoi) für ihre unter 18-jährigen Söhne ab, um sie vor älteren Verehrern zu schützen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass Beziehungen mit ihnen nachgefragt waren und vorkamen. Da Mädchen mit 14 heiraten konnten, wurden im antiken Griechenland minderjährige Knaben strenger geschützt als Mädchen – die übliche Verwechslung der ›Knabenliebe‹ mit der Pädophilie hätte das nicht erwarten lassen.
Verkompliziert wird das alles noch dadurch, dass Pubertät und Körperbehaarung, die in diesem Buch eine große Rolle spielen werden, von der Antike bis mindestens zum Ende des 18. Jahrhunderts später einsetzten als heute. Erst im 19. Jahrhundert verschob sich die Pubertät in der westlichen Welt um mehrere Jahre nach vorne. Die Gründe für diese große Veränderung sind umstritten, doch gilt die bessere Ernährung als eine wahrscheinliche Ursache. In der Antike erschien die Gesichts- und Körperbehaarung zuallererst mit etwa 18, und einen richtigen Bart hatte man frühestens mit 20. Während die Haare erst spät in der Pubertät wachsen, setzt der Samenerguss dagegen einige Jahre früher ein. Da sich griechische Männer nicht rasierten, zeigen Bilder männlicher Paare einen deutlichen Altersunterschied: Der Liebhaber ist fast immer bärtig, der Geliebte bartlos. Dem sagenumwobenen Helden des Trojanischen Krieges, Achill, spross noch kein Bart, wie Goethe selbst einmal hervorhob.5 Statuen, die ausgewachsene junge Männer ohne Bart- und Schamhaar abbilden, idealisieren nicht. In Rom, wo sich die Männer rasierten, ließ Kaiser Augustus mit 23 zum ersten Mal den Barbier kommen.6 An dieser spät einsetzenden Pubertät änderte sich bis in die Goethe-Zeit nur wenig. Der Theologe und Autor Carl Friedrich Bahrdt etwa hatte auch mit 19 noch keinen Bart, Carl Philipp Moritz im selben Alter nicht viel mehr. Laut Friedrich Christian Laukhard übernahmen an der Universität Gießen »milchbärtige Studenten« die Frauenrollen in Theateraufführungen – junge Männer also, die mit 18, 20 Jahren nur einen Pfirsichflaum auf der Oberlippe trugen.7
Goethe und seine Zeitgenossen dürften sich also kaum über solche bartlosen, ansonsten aber sexuell entwickelten Jünglinge gewundert haben, die man in Griechenland epheboi (›Epheben‹) nannte. Sie konnten zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, im Allgemeinen waren sie 18 oder 19. Sie waren in Athen die begehrtesten Sexobjekte: schon ›legal‹ (wenn sie mindestens 18 waren), aber noch glatt. Sobald der Bart spross, versiegte das Verlangen des älteren Liebhabers oder Verehrers. Strato hält 17 für das wünschenswerteste Alter eines Knaben – und beschreibt in zwei Gedichten, wie seine Leidenschaft mit der Körperbehaarung des Knaben abkühlt.8 Aus einem anderen Kulturkreis, der Goethe interessierte, rät der persische Satiriker Obeid-e Zâkâni: »Türkische Sklavenknaben, solange sie bartlos sind, kauft um jeden Preis, den man für sie verlangt, und sobald sie anfangen, einen Bart zu bekommen, verkauft sie um jeden Preis, den man bietet.«9 Goethe griff dieses Thema auf und schildert etwa im West-oestlichen Divan diesen entscheidenden Moment in der Adoleszenz: »Es schwillt die Brust, es bräunt der Pflaum [Flaum] | Er ist ein Jüngling worden.«10 Offensichtlich hat das Begehren nach jungen Männern viel mit Androgynie zu tun, der Verbindung männlicher und weiblicher Züge »in der Jugend«, wie Goethes Sozius Wilhelm von Humboldt 1795 schrieb, »auf der schmalen Gränze zwischen beyden Geschlechtern«.11 Nicht nur junge Frauen, sondern auch junge Männer zogen mit ihren glatten Körpern Römer und Griechen erotisch an; gnadenlos verhöhnt als Liebesobjekte wurden dagegen bärtige Männer genauso wie behaarte runzlige Frauen.12
Der Altersunterschied zwischen Liebhaber und Geliebtem hatte in der griechischen Liebe demnach zwar größte Bedeutung, war jedoch wesentlich geringer als allgemein angenommen. Meist betrug er nicht mehr als ein paar Jahre (oft waren beide Partner bartlose Epheben), und in jedem Fall war er bei weitem geringer als zwischen Frischvermählten im antiken Griechenland. In Platons Dialog über die Liebe, dem Symposium, behauptet etwa Pausanias von denen, die nicht vom irdischen, sondern vom »himmlischen Eros« beherrscht werden:
Sie lieben nicht kleine Knaben [paidon], sondern solche, die schon verständig zu werden beginnen, das ist gegen die Zeit, da der erste Flaum den Wangen zu entsprossen anfängt.13
Der Pfirsichflaum, der im Gegensatz zum richtigen Bartwuchs als attraktiv galt, erschien also zusammen mit der geistigen Reife der »Knaben«, wie Pausanias solche Liebesobjekte dezidiert nennt. Er hält Beziehungen mit ihnen für einvernehmlich: Ein rücksichtsvoller Liebhaber wartet, bis der Angebetete selbstständig denken und fühlen kann – und macht ihm erst dann den Hof. Pausanias selbst führte eine lebenslange Partnerschaft mit Agathon, was ziemlich ungewöhnlich war.14 Kurzum: Der Begriff ›Knabe‹ hatte wenig mit seiner heutigen Bedeutung gemein.
Pausanias mag die gesellschaftliche Wirklichkeit stark geschönt haben. Die begehrenswertesten Epheben wurden in Athen oft von einem ganzen Schwarm von Verehrern verfolgt, die zuweilen ihr Lager auf der Schwelle des Geliebten aufschlugen und sich an den ausgeklügeltsten Verführungsmethoden versuchten. Idealiter galt die Beziehung als pädagogische Einrichtung zur Sozialisation des Knaben. Im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten stattete der ältere Partner den jüngeren mit dem Rüstzeug für sein Leben als erwachsener Bürger aus. Zum Drehbuch der Verführung gehörten jedoch auch Geschenke, üblicherweise ein Kampfhahn oder ein anderes wertvolles Tier. Um seinen Ruf zu schützen, musste der Geliebte dabei delikat vorgehen. Obwohl er Geschenke annahm, durfte er nicht den Eindruck erwecken, er werde für Sex bezahlt, denn sonst konnte er der Prostitution angeklagt werden und fast alle Bürgerrechte verlieren. Aus demselben Grund durfte er seine sexuelle Gunst nicht allzu bereitwillig verschenken. In der Theorie zumindest blieb die Beziehung asymmetrisch. Darüber ist sich auch die sonst zerstrittene historische Zunft einig: »erōs sollte nur der erastēs empfinden«15.
In diesen Beziehungen war demnach Macht im Spiel: Nicht gegenseitige Liebe zwischen Gleichen begründete sie, sondern die Eroberung eines Niederrangigen durch einen Höherrangigen, also einen erwachsenen Bürger.16 Dabei sollte dem Geliebten die Unterordnung allerdings erleichtert werden. In Ovids berühmten Worten bereitete die Knabenliebe nur dem Eindringenden Lust.17 Um dem Geliebten mögliches Unbehagen beim Analverkehr oder das Gefühl der Demütigung zu ersparen, bevorzugten die Griechen daher den sogenannten Schenkelverkehr, bei dem der Liebhaber seinen Penis von vorne zwischen die geschlossenen Beine des Geliebten schob.18 Ein Grieche, der sich oral oder anal penetrieren ließ, sonderte sich selbst aus den Reihen der männlichen Bürgerschaft ab und ordnete sich bei den Frauen und Fremden ein.19 Griechische Vasen zeigen regelmäßig, wie Frauen anal penetriert werden; bei Männerpaaren findet sich das Motiv dagegen selten und wenn, gehören stets beide Partner derselben Altersgruppe an.20 Dennoch bleibt festzustellen: Die Liebe zwischen einem Mann und einem Jüngling war im antiken Griechenland nach allgemeinem Willen und allgemeiner Vorstellung eine Einbahnstraße.
In Rom war die Angelegenheit (noch) weniger romantisch und ausgeglichen. Viele Feinheiten im mann-männlichen Liebeswerben der Griechen fielen bei den Römern weg, die die gleichgeschlechtliche Liebe für ein griechisches Phänomen hielten. Hier entstand eine ›Ideologie der Männlichkeit‹,21 nach der jeder Mann seine Würde und Männlichkeit verlor, der sich penetrieren ließ. Sexuelle Beziehungen zwischen freien Männern wie in Griechenland waren in Rom verboten. Mann-männlichen Sex hatte fast nur noch ein freier, oft verheirateter, penetrierender Mann mit einem jungen Sklaven (oder mit Männern, die auf die Regeln pfiffen: Kinäden oder Strichern). Zwang wurde die Regel, Sex Unterdrückung.22
Natürlich gab es Ausnahmen. Einigen ›Geliebten‹ in Rom und Griechenland dürfte die passive Rolle Lust bereitet haben; andere übten selbst Macht über den Liebhaber aus, indem sie die sexuelle Befriedigung verweigerten.23 Die (aktive) Koketterie der erōmenoi wurde vielfach missbilligt – was zeigt, wie häufig sie war. Die griechische und römische Literatur birgt etliche Beispiele, die das herkömmliche Modell anzweifeln oder für nichtig erklären.24 Solche Umkehrungen mögen einen modernen Interpreten wie Goethe inspiriert haben. Denn trotz solcher Rollenverstöße blieb der Geliebte zumeist stumm – und sein Gefühl ein Rätsel. Genau an diesem Punkt aber wird Goethes grundsätzliche Modernität augenfällig: Er gibt dem ›Knaben‹ eine Stimme – auch wenn sie nicht authentisch ist, sondern seiner Phantasie entstammt.
Das ist umso beachtlicher, weil sich die antike Ideologie trotz solcher Ausnahmen und Umkehrungen zäh hielt. Noch im Italien der Renaissance, wo die gleichgeschlechtliche Liebe weit verbreitet war, wurden Männer verachtet, die es sich von hinten besorgen ließen.25 Die entscheidende Frage ist, ob auch der vor allem römische Männlichkeitswahn in der Goethezeit fortdauerte. Begehrten damalige Deutsche mit mann-männlichen Neigungen vor allem ›Knaben‹? Wie verstanden sie ihre Neigungen überhaupt?
Leider gleicht die ›griechische Liebe‹ im deutschsprachigen Raum des 18. Jahrhunderts immer noch einer terra incognita, trotz vielversprechender Anfänge in der Forschung. Um weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen, sind zu wenige Quellen und zu wenige Zeitgenossen bekannt, die andere Männer sexuell begehrten: der Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann, der Schweizer Historiker Johannes von Müller, der Dichter August von Platen, Herzog August von Sachsen-Gotha, vielleicht Friedrich II. (»der Große«) von Preußen. Jenseits dieser üblichen Verdächtigen schießen die Spekulationen ins Kraut – wobei die sexuelle Praxis auch der Genannten unsicher ist. Natürlich ist die Gesetzeslage bekannt, verankert in der Peinlichen Gerichtsordnung des Heiligen Römischen Reichs (Constitutio Criminalis Carolina, 1532), die das Partikularrecht der deutschen Länder mit einigen Abweichungen bestimmte. Nach Zedlers Universal-Lexicon (1743) umfasste die »Sodomie« fast alle sexuellen Spielarten, die nicht der Zeugung dienten: mit Tieren, anal mit Mann oder Frau, Selbstbefriedigung, sogar Sex mit dem Teufel (und zuweilen Nekrophilie).26 Sodomie war mit dem Tod zu bestrafen – in Sachsen-Weimar spätestens seit 153927 –, doch ist nach 1729 kein Fall mehr bekannt, in dem ein Mann oder eine Frau deswegen hingerichtet worden wäre.28 In Preußen wurde die Todesstrafe für Sodomie 1746 abgeschafft, in Österreich 1787.29 Unter dem Einfluss des Philosophen Anselm Feuerbach legalisierte das neue bayerische Strafgesetzbuch von 1813 einvernehmlichen Sex zwischen Erwachsenen (der jetzt allerdings in den Geltungsbereich der Polizei fiel); im Königreich Westfalen und anderen Gebieten unter französischer Besatzung war dies schon drei Jahre früher der Fall gewesen.30
Zweifelsohne ging der Trend hin zu Toleranz. Was früher als Sünde verurteilt worden war, wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zumeist als ›unnatürliches‹ Verhalten geächtet. Warum die Sodomie unnatürlich sei, wurde allerdings selten erklärt; man verwies entweder auf die Tierwelt, wo man gleichgeschlechtliches Sexualverhalten für nichtexistent hielt (ein Einwand, den schon antike Gegner der griechischen Liebe erhoben), oder argumentierte kameralistisch, beeinflusst vom Bevölkerungswachstumswahn des Jahrhunderts: »Ein sehr verkehrter Geschmack«, urteilte ein Arzt über die gleichgeschlechtliche Liebe 1796, »der für die künftigen Generationen lauter Nullen erzeugt!«31 Natürlich gab es auch das uralte Argument, Menschen seien körperlich für die heterosexuelle Liebe und Fortpflanzung ›gemacht‹, nicht jedoch für die Sodomie. Wie auch immer, alles zusammen säkularisierte die Vorurteile über die griechische Liebe. Doch bewegte sich die zunehmende Toleranz innerhalb gewisser Grenzen. Sodomie galt immer noch als Verirrung und, außerhalb intellektueller Kreise, als Sünde gegen die Gebote der Bibel. Als um 1800 die Geschlechterrollen auf Grundlage der vermeintlichen ›Natur‹ neu definiert und strenger geschieden wurden, meldeten sich intolerante Stimmen wieder lauter zu Wort, vom aufkommenden Nationalismus ermutigt und mit ihm verbündet.32 Trotzdem – jemanden wegen Sodomie strafrechtlich zu verfolgen scheint im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert abwegig geworden zu sein.
Die Gesetzeslage sagt natürlich wenig darüber aus, wie Männer, die mit Männern oder ›Knaben‹ Sex hatten, wirklich gelebt, geliebt und sich gefühlt haben. Der Forschung zufolge sollen Männer von der Antike bis zum frühen 18. Jahrhundert grundsätzlich sowohl Männer als auch Frauen begehrt haben; man spricht von der ›nach Alter gegliederten Ordnung des Mittelmeerraums‹. Sie wurde durch die moderne, nach Geschlechteridentitäten gegliederte Ordnung ersetzt, die die Welt in eine homosexuelle Minderheit und eine heterosexuelle Mehrheit einteilt.33 Diese Veränderung wird an der sogenannten ›molly‹ (›Tunte‹) festgemacht, die im frühen 18. Jahrhundert in London nachgewiesen ist, einem sich weiblich gebenden erwachsenen Mann, der Sex ausschließlich mit Männern oder Knaben wollte.34 Die meisten Männer verstanden sich mittlerweile als ›heterosexuell‹; ließen sie sich mit ›mollies‹ ein, konnten sie schnell selbst als eine gelten. Mit anderen Worten, spätestens seit der ›molly‹ im London des frühen 18. Jahrhunderts unterscheidet man im modernen Sinn zwischen ›heterosexuell‹ und ›homosexuell‹ – und nicht erst seit dem späten 19. Jahrhundert, wie Michel Foucault und andere glaubten.
Viel könnte gesagt werden – und wurde bereits gesagt –, um diese These zu modifizieren. In der deutschsprachigen Welt wurden solche Muster bislang schlicht nicht entdeckt.35 Weder die nach Alter noch die nach Geschlechterrollen gegliederte Ordnung kann unproblematisch auf die deutschen Lande übertragen werden. Hier erlebte man wenig oder nichts von dem, was sich im Florenz der Renaissance abspielte – tatsächlich setzte man häufig die deutsche Unschuld der sexuellen Verdorbenheit Italiens in Sachen Sodomie entgegen.36 Auch wurde man hier nicht im frühen 18. Jahrhundert Zeuge einer beginnenden Tunten-Subkultur. Da der deutsche Flickenteppich ökonomisch ein Entwicklungsland blieb, gab es keine Metropole, die sich mit London, Paris, Rom oder Amsterdam hätte messen können. Der einzige Hinweis auf ein ›molly house‹ in den deutschsprachigen Ländern stammt aus dem aufstrebenden Berlin, das ein Stricherbordell beherbergt haben könnte. Der Wahrheitsgehalt von Friedels Briefen über die Galanterien von Berlin (1782) wurde jedoch in Frage gestellt, da sie von einem österreichischen Offizier stammen, der ein Interesse daran gehabt haben könnte, die preußische Hauptstadt samt ihrem angeblich sodomitischen König zu verunglimpfen.37 Da Friedels Briefe durch keine weitere Quelle je bestätigt wurden, bleiben sie zweifelhaft. Das einzige andere bekannt gewordene Dokument dieser Art ist ein erstaunlicher Brief von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der behauptet, deutsche Jünglinge hielten sich Lustknaben, nachdem Christoph Martin Wielands Geschichte »Juno und Ganymed« (1765) sie auf den Geschmack gebracht habe (Kap. 2). Auch dieser Behauptung hängt der Ruch der Verleumdung an, da kein weiterer glaubwürdiger Hinweis auf eine sodomitische Subkultur je zum Vorschein gekommen ist. Deutschland war, so scheint es, auch ein sexuelles Entwicklungsland.
Erschwert wird die Frage nach der griechischen Liebe in den deutschsprachigen Gebieten des 18. Jahrhunderts zudem durch die herzensergießende Rhetorik des empfindsamen Freundschaftskults. Winckelmann, Müller und ihresgleichen sublimieren in ihren zahlreichen Briefen ihr Begehren gewöhnlich in ein hochtrabendes, heroisches Freundschaftsideal. Männer drückten ihre Liebe und Zuneigung füreinander höchst verstiegen aus, ohne dabei sexuelles Begehren zu offenbaren. Männerküsse veranschaulichen das Problem.38 Im 18. Jahrhundert konnten sich Männer ohne jedes Anzeichen von Erotik küssen. Gegen Ende des Jahrhunderts schimpfte ein Autor sogar über die unscharfe Trennung zwischen dem Kuss der wahren Freundschaft und dem oberflächlichen Kuss aus Höflichkeit, der nicht im Einklang mit »dem männlich teutschen Charakter«39 stehe, sondern eher Ausdruck »der vollherzigen Modemenschen« sei. Der »teutsche Mann verachte den faselnden Modekuß«, solle aber nicht ganz aufs Küssen und Umarmen verzichten, sondern sie eben nur für »die stärkste symbolische Freundschaftsversicherung« benutzen. Kurz, Männer küssten sich, verrieten damit jedoch keine Neigung zur ›Homosexualität‹ – zumindest nicht notwendigerweise. Dasselbe gilt für die überschwänglichen Freundschaftsbeteuerungen zwischen Männern und Frauen. Die empfindsame Sprache des Freundschaftskults allein genügt daher nicht, sexuelles Begehren anzunehmen.40 Während Winckelmann und Müller außer empfindsamen Ergüssen noch weitere Signale aussandten, die ihre Neigung zur griechischen Liebe bekundeten, gilt dies für die meisten anderen Beispiele des Brief- und Freundschaftskults der Empfindsamkeit nicht.
Die Beispiele von Winckelmann und Müller, deren Neigung den Zeitgenossen bekannt war, legen auf den ersten Blick nahe, dass Deutschland den Weg Englands gegangen war und sich Männer, die andere Männer oder Knaben liebten, ›anders‹ fühlten. Die ›nach Alter gegliederte Ordnung‹ scheint von der ›nach Geschlechterrollen gegliederten Ordnung‹ allmählich abgelöst worden zu sein. Doch wie schon erwähnt gibt es keinen Beweis dafür, dass in Deutschland jemals das ›altersgegliederte‹ Muster vorherrschte, nach dem alle Männer Frauen und Knaben begehrten. Sodomieprozesse und -anklagen im frühneuzeitlichen Deutschland und in der Schweiz (1400-1600) zeigen, dass mann-männliches Begehren nicht weit verbreitet und ganz sicher nicht akzeptiert war.41 Zudem bleibt die in England belegte ›molly‹ in Deutschland (noch) unsichtbar. Das bedeutet: Männer, die sich wegen ihres sexuellen Begehrens von anderen Männern verschieden fühlten, wurden noch nicht als besonders verweiblicht empfunden – weder von anderen noch von sich selbst. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hieß es dann jedoch auch hierzulande, Winckelmann etwa sei kein rechter Mann gewesen; Goethe trat dieser Ansicht entgegen (Kap. 4).
Um 1790 wurden im deutschsprachigen Raum immerhin einige Texte veröffentlicht, die von dem Bewusstsein männer- oder knabenliebender Männer zeugen, anders zu sein. Karl Philipp Moritz’ bahnbrechende psychologische Zeitschrift Magazin zur Erfahrungsseelenkunde druckte einen Brief, der von gleichgeschlechtlichem Begehren spricht, das immer wieder enttäuscht wird und daher Depressionen auslöst. Auch die Antwort auf diesen Brief bekundet sowohl ein ausschließliches mann-männliches Begehren als auch die Weigerung, den erotischen Anteil zu akzeptieren.42 Das beeindruckendste Dokument dieser Art stammt jedoch aus einer Art Selbsthilfe-Zeitschrift, die der sächsische Pastor Johann Samuel Fest herausgab. Es ist das Zeugnis eines jungen Mannes, den sein ausschließliches Verlangen nach Männern peinigt, da er es weder ausleben noch loswerden kann.43 Von daher ist der anonyme junge Mann viel weniger ein »Sodomit« alten Schlages, ist also kein »Gestrauchelter« im Sinne Foucaults, sondern gehört einer »Spezies« an, die Foucault erst ab 1870 veranschlagt.44 In einer berühmten, vielfach kritisierten Passage behauptet der französische Theoretiker:
Der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts ist zu einer Persönlichkeit geworden, die über eine Vergangenheit und eine Kindheit verfügt, einen Charakter, eine Lebensform, und die schließlich eine Morphologie mit indiskreter Anatomie und möglicherweise rätselhafter Physiologie besitzt.
Fast alle aufgezählten Merkmale passen auch zu dem jungen Mann von 1789 – achtzig Jahre früher. So beschreibt er sein frühes Verlangen nach anderen Jungen als eindeutig sexuelle Vorliebe:
Die ersten Bilder, die ihm seine Phantasie mit einer Art von wollüstiger Empfindung vormahlte, waren nicht Mädchen, sondern Knaben. Sein seltsamer Trieb scheint also angebohren zu seyn […].45
Auf vergleichbare Weise erkennt einer der Jünglinge aus Moritz’ Zeitschrift den Ursprung seiner ›Verirrung‹ im ausschließlichen Kontakt zu anderen Jungen, die ihn oft umarmten; er schreibt: »ich erinnere mich, schon in meinem Knabenalter einige Mannspersonen recht zärtlich geliebt zu haben«.46 Ähnlich wie in der modernen Psychologie wird der Drang als angeboren verstanden, oder in der frühen Kindheit erworben, und mit einer entschiedenen Vorliebe für Männer und sexuellem Desinteresse an Frauen verknüpft:
Dieser unnatürliche Trieb scheint mit seinem Ich genau verbunden zu sein, und ist ihm eben so fest eingepflanzt, wie uns andern die Liebe zum Weibe […].47
Vor allem dieser Satz scheint auf eine eindeutige ›homosexuelle‹ Identitätzu verweisen.48Zwar versichert der Erzähler in Fests Zeitschrift, sein Freund sei »an Körper und Seele ganz andern Männern ähnlich«, wirke also äußerlich keinesfalls weiblich (was Foucault die »Morphologie« nennt). Indem er jedoch immer wieder auf den angeblich anomalen und unnatürlichen Trieb seines Freundes zu sprechen kommt, widerspricht er sich selbst. Denn wenn er fragt: »Was suchte die Vorsehung, als sie in einen männlichen Körper eine weibliche Empfindung legte?«, führt er seine frühere Behauptung, die »Seele« des Jünglings gleiche der anderer Männer, ad absurdum. Er nimmt sogar Karl Heinrich Ulrichs’ Definition der »Urninge«, des »dritten Geschlechts« vorweg, deren »weibliche Seele im männlichen Körper gefangen«49 sei – im selben Jahr, 1868, prägte Karoly Maria Benkert in einem Brief an Ulrichs die Begriffe »homosexual« und »heterosexual«. Auch wenn der Körper des jungen Mannes in Fests Zeitschrift keine Foucault’sche ›Morphologie‹ oder ›rätselhafte Physiologie‹ besitzt, begehrt er doch besondere männliche Körper:
Sein Geschmack in der Liebe ist dabei äußerst zart. Jünglinge und Knaben nur reizen ihn, und selbst von diesen nur äußerst wenige. Keine Schönheit bestimmt seine Neigung, sondern ein gewisser Wuchs, ein gewisser Zug im Gesicht, und ein gewisses Betragen, worüber er sich selbst nicht erklären kann. Der geringste Fehler des Körpers, ein schielendes Auge, ein nicht völlig proportionirter Wuchs, ein blasses Gesicht u. s. w. stößt ihn zurück. […] Unter allen Mannspersonen, die er ie gekannt hat, erinnert er sich nur eine äußerst kleine Anzahl gefunden zu haben, zu denen er Zuneigung gehabt hat. Der schönste weibliche Körper ist todt für ihn mit allen seinen Reizen […].50
So dürftig solche Zeugnisse auch sind, hängt das heutige Verständnis des gleichgeschlechtlichen Begehrens im 18. Jahrhundert doch wesentlich von ihnen ab. Sie belegen, dass sich entscheidende Charakteristika von Foucaults modernem ›Homosexuellen‹ schon um 1790 finden. Eines davon ist das ausschließlicheBegehren eines Mannes nach anderen Männern; ein anderes die bestimmte Körperlichkeit von Männern, zu denen sich der Jüngling in Fests Zeitschrift hingezogen fühlt. Am ›modernsten‹ ist vielleicht die Frage nach der Herkunft des gleichgeschlechtlichen Begehrens: ob angeboren (in dem Aufsatz bei Fest) oder durch (sexuelle) Kindheitserlebnisse erworben (wie im ersten Brief in Moritz’ Zeitschrift). Dieses Begehren für angeboren zu halten war ein wichtiger Schritt hin zur Medikalisierung, d. h. Pathologisierung der Homosexualität. Der deutsche Gerichtsmediziner Johann Ludwig Casper tat sich dabei besonders hervor – nur zwanzig Jahre nach Goethes Tod.51 Auch der Wunsch, vom gleichgeschlechtlichen Begehren ›geheilt‹ zu werden, bezeugt die allmählich einsetzende Medikalisierung – und eine frühe Form des sogenannten ›schwulen Selbsthasses‹. Und lange bevor der Begriff erfunden wurde, gab es die Ahnung einer ›homosexuellen‹ Identität: entscheidend dafür war das subjektive Gefühl, sich sexuell und vielleicht auch psychisch von anderen Männern zu unterscheiden.
Auf der anderen Seite fehlen in diesen Bekenntnissen wichtige Eigenschaften, die den ›Homosexuellen‹ des späteren 19. Jahrhunderts ausmachen – etwa eine ihm zugeschriebene, äußerlich sichtbare Morphologie, wie sie in England zuvor schon die ›molly‹ und in der Antike den Kinädenauszeichnete. Auch ist die Pathologisierung noch nicht mit dem ausgewachsenen System vergleichbar, das sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte. Darüber hinaus kann man das egalitäre Beziehungsmodell moderner Homosexueller noch nicht erkennen. Zuletzt gibt es keinen Hinweis auf eine gleichgeschlechtliche Subkultur: Tiefe Vereinsamung lässt diese jungen Männer verzweifeln.
All das spricht gegen eine einheitliche Entwicklung in Europa. Die frühneuzeitliche ›altersgegliederte Ordnung‹ mag fast überall im Mittelmeerraum und sogar in England verbreitet gewesen sein, nicht aber in Deutschland. Hier gab es im späten 18. Jahrhundert auch keine ausschließlich ›nach Geschlechterrollen gegliederte Ordnung‹, die zu der Zeit in England das alte System ersetzt hatte. Stattdessen bestanden im deutschsprachigen Raum äußerst unterschiedliche Modelle gleichgeschlechtlichen Begehrens nebeneinander. Die namenlosen Jünglinge der veröffentlichten Zeugnisse begehrten keine Frauen, und dasselbe galt für die bekannteren Fälle im 18. Jahrhundert, Winckelmann oder Friedrich den Großen – aber keiner von ihnen war eine effeminierte ›molly‹. Andere Männer begehrten möglicherweise sowohl Knaben oder Jünglinge als auch Frauen, aber viele von ihnen werden sich als anders als die meisten Männer empfunden haben. Zur gleichen Zeit war jedoch die Annahme, die gleichgeschlechtliche Neigung sei angeboren, noch lange weder wissenschaftlich begründet noch allgemein anerkannt, und auch mit der elaborierten physiologischen und psychologischen Morphologie von Männern, die andere Männer begehren (und nicht nur Knaben), haperte es noch – genauso wie mit einer vollständigen ›homosexuellen‹ Identität und einem Gruppengefühl. All das spricht immer noch dagegen, Männer vor Mitte des 19. Jahrhunderts ›homosexuell‹ zu nennen. Dennoch kannte jemand wie Goethe höchstwahrscheinlich einige der Wesenszüge, die die moderne ›Homosexualität‹ ausmachen.
Sicher wusste Goethe auch um die Feindseligkeit, die solchen Männern begegnete. Die Quellen, die Helmut Puff und andere ausgewertet haben, zeigen deutlich, dass die ›Sodomie‹ in der frühen Neuzeit allgemein geächtet war. Im 18. Jahrhundert entspannte sich die Lage etwas, aber die Grundhaltung war immer noch Ablehnung. Ganz zu Beginn des 19. Jahrhunderts steigerten sich die Anfeindungen abermals, und auch die relativ liberale Gesetzeslage unter französischer Herrschaft verschlechterte sich nach 1815 wieder.52 Schon die erwähnten Bekenntnisse um 1790 sprechen deutlich von Schande. In dem Beitrag in Fests Zeitschrift, dem ausführlichsten von allen, reden die Leute von solchen Männern »mit einer Art von Abscheu […] als Lasterhafte, Unzüchtige, oder gar als Verbrecher«.53 Auch die Haltung des Autors selbst ist zutiefst ambivalent. Der Aufklärung verpflichtet, schreibt er einerseits einfühlsam vom Begehren seines Freundes; andererseits missbilligt er bereits die Vorstellung, diese Wünsche könnten sexuell ausgelebt werden, als »groben Mißbrauch des männlichen Körpers« – den sein Freund nicht begangen habe. So gründet seine Toleranz auf der Annahme, nicht alle Männer würden diese Bedürfnisse ausleben. Einige von ihnen seien an ihrer Krankheit auch selbst schuld, »durch große Ausschweifungen und geheime Sünden im Knabenalter«, womit er die Selbstbefriedigung meinen dürfte, die gerade mit einer so hysterischen wie kurzlebigen Kampagne ausgerottet werden sollte.54 Der Briefschreiber fährt fort:
Doch, sei ihr Trieb angebohren oder verschuldet, so würde doch derienige, dessen Neigung ihn zum Mißbrauch eines männlichen Körpers antriebe, wenn er sich ihr überließe, gewiß sehr unmoralisch handeln, und selbst öffentliche Ahndung verdienen, wenn sich auch manches zu seiner Entschuldigung sagen ließe.
Der Widerspruch ist offensichtlich. Im Anschluss schildert der Autor dann die klassische griechische Liebe bei Sokrates, Vergil und Horaz und endet mit einem damals bekannten Zitat über den jüngst verstorbenen Friedrich den Großen, der Frauen gescheut und die Gesellschaft von »schönen Mannspersonen« gesucht habe.55 Er folgert daraus:
Wenn Männer, wie Socrates und Friedrich II, von denen man wohl sehr wahr sagen könnte: quales non candidiores terra tulit [die reinsten Seelen, welche je die Erde trug],56 diese Neigung empfanden: so kann sie wohl unmöglich ohne Ausnahme ein moralisches Verbrechen sein, und ist gewiß zuweilen ein angebohrner unwillkürlicher Trieb, der sehr dazu geschickt ist, den unglücklich zu machen, der ihn fühlt.
Zum Ende seines Essays wünscht er sich trotzdem, man könne diese Krankheit ausrotten, zumal sie auch das schöne Geschlecht angehe: Breite sich dieser »Trieb« weiter aus, müssten sie ihre Tage »in einer traurigen Ehelosigkeit« verbringen. Dass sich diese angeblich elenden Frauen miteinander trösten könnten, kommt ihm nicht in den Sinn.
Die Ambivalenz des Autors ist symptomatisch für seine Zeit. Auf nur wenigen Seiten schwankt er mehr als ein halbdutzendmal zwischen Toleranz und Ablehnung.57 Diese Widersprüchlichkeit kehrt bei anderen Autoren wieder, die zu der Zeit über die griechische Liebe schreiben, insbesondere, wenn sie zwischen mann-männlicher ›platonischer‹ Liebe und Freundschaft einerseits und sexueller Erfüllung andererseits unterscheiden. Auch Goethe teilte diese Ambivalenz zuweilen. Seine erwachsene Lebenszeit umfasste allerdings sechs Jahrzehnte, in denen sich die Rollen der Geschlechter stark veränderten. Wie schon erwähnt verhärteten sich die Ansichten über die griechische Liebe um die Jahrhundertwende und waren zum Teil geradezu feindselig zur Zeit von Goethes Tod 1832. Seine aufgeschlossene Haltung zur griechischen Liebe und ihre Darstellung in seinem Werk müssen vor diesem Hintergrund gewürdigt werden.
Und wie stand es um Goethe selbst? War er, oder war er nicht? Die griechische Liebe in Goethes Werken hat reißerische Autoren wie seriöse Wissenschaftler gleichermaßen in die biographische Falle gelockt. Fast alle nehmen an, Goethes literarisches Werk – besonders seine Dichtung – zeuge unmittelbar von mann-männlichem Begehren. Diese Behauptung widerspricht allem, was die Literaturwissenschaft (zumindest seit den 1950er Jahren) über den Unterschied zwischen empirischem Autor einerseits und lyrischem Ich in einem Gedicht oder Erzähler in einem Prosatext andererseits erarbeitet hat. Auch wenn Gefühle und Erfahrungen zweifelsohne bei der Formulierung von Texten eine Rolle spielen, können die fiktionalen Stimmen nicht umstandslos als unmittelbarer Ausdruck des Autors genommen werden. Im Fall der gleichgeschlechtlichen Liebe wird dieser Grundsatz von fast jedem Goethe-Interpreten übersehen.58
Solche Interpretationen lenken von den literarischen Texten und ihrem eigentlichen Aussagewert ab. Eines der Venezianischen Epigramme etwa, das Goethe nicht veröffentlichte, beginnt mit den Worten »Knaben liebt ich wohl auch«. Hans Dietrich (ein Pseudonym für Hans-Dietrich Hellbach) nannte es schon 1931 »berüchtigt«. Obwohl er in seinem Buch das Thema ›Homosexualität‹ in der deutschsprachigen Literatur zum ersten Mal ernsthaft untersucht, bestreitet Hellbach panisch, Goethe könne ein ›Homosexueller‹ gewesen sein. Zum Beweis führt er einen anderen Interpreten an, der dieses Epigramm für »Phantasieauswüchse« hält, nicht persönliche Erfahrung. Drei der von Goethe veröffentlichten Epigramme sortiert er als »nur […] Beobachtungen eines Durchreisenden«59 aus. Trotz seiner Verdienste lenkt Hellbach damit das Hauptaugenmerk auf die Biographie und besonders auf Goethes Sexualität. Vor allem kann eine solche Herangehensweise nichts über das Epigramm selber und seine Bedeutung aussagen; biographische Spekulation ersetzt literarische Analyse. Noch jüngst, in den 1990er Jahren, meinte ein Interpret, ein weiteres, ebenfalls ›homosexuelles‹ Epigramm könne nichts mit Goethe zu tun haben, weil darin auch von mehreren »Mädchen« die Rede ist, mit denen der Sprecher ebenfalls geschlafen habe, während ein anderes, (scheinbar) glaubwürdigeres Epigramm von Goethe als treuem Ehegatten erzähle – auf das eine Epigramm kann man sich also verlassen, auf das andere aber nicht. Der Widerspruch wird noch krasser dadurch, dass der Interpret jedes Epigramm, das von Goethes sexuellen Abenteuern berichten könnte, als »erkennbar literarisches Spiel« einstuft.60 In beiden Fällen endet die kaum begonnene Analyse der Venezianischen Epigramme abrupt nach der Feststellung, Goethe sei nicht ›homosexuell‹ gewesen – wahrscheinlich richtig, aber fadenscheinig begründet.
Ein ernsthafter Beitrag zu Goethe und der gleichgeschlechtlichen Liebe muss einerseits nüchterner vorgehen, andererseits auf werkübergreifende Zusammenhänge achten.61 Ich werde mich vieler Versuchungen enthalten. So werde ich keine Mutmaßungen über Goethes angeblich »latente Homosexualität« anstellen, über mögliche »homoerotische Obsessionen«, sein »gleichgeschlechtliches Begehren«,62 kurz, seine ›sexuelle Orientierung‹ – außer einer kurzen Betrachtung im Schlusskapitel, die mögliche Erträge aus der vorliegenden Untersuchung erörtert. Ich enthalte mich, weil es schlicht zu wenige Belege gibt.63 Zudem ist noch gar nicht geklärt, was ›sexuelle Orientierung‹ im 18. Jahrhundert überhaupt bedeutete. Vor allem aber glaube ich, dass reißerische Spekulationen über Goethes Geschlechtsleben – von denen es in den letzten zweihundert Jahren mehr als genug gab – von den eigentlichen Fragen ablenken: Was hielt Goethe von der gleichgeschlechtlichen Liebe, wie betrachtete er sie und wie stellte er sie dar? Da sich bisher der Großteil der Aufmerksamkeit auf Goethes angebliche sexuelle Neigungen richtete, blieben die viel wirkmächtigeren Aspekte seiner – ja, unserer – Haltung zur gleichgeschlechtlichen Sexualität verborgen: Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen antiken Vorbilder für spätere Zeitalter? Praktizierten nur ›verweiblichte‹ Männer die griechische Liebe? Ist die Liebe zum gleichen Geschlecht angeboren oder erworben? Welches Machtgefüge herrscht in der Liebe zweier Männer? Zwischen einem Mann und einem Knaben oder Jüngling? Und schließlich: Kann sie in die Gesellschaft integriert werden – wie gehen wir mit Vorurteilen um?
In jeder Arbeit über die gleichgeschlechtliche Liebe ist die Terminologie ein berüchtigtes Problem. Wegen der Komplexität des Themas werde ich den Begriff ›Homosexualität‹ nur als Stichwort in Anführungszeichen benutzen. Auch wenn einige ihrer Aspekte, wie bereits dargestellt, schon früher entwickelt werden, ist die Homosexualität doch ein Kind des späten 19. Jahrhunderts und bezeichnet die ausgeprägte Identität von Individuen, die sich als Gemeinschaft verstehen und die von außen, d. h. von der Medizin, zu pathologischen Fällen erklärt werden. Begriffe wie ›schwul‹ gehören späteren Zeiten an, und ich werde sie daher nur selten und ironisch gebrauchen. ›Homoerotisch‹ hat sich hingegen in wissenschaftlichen Beiträgen von der Antike bis zur Frühen Neuzeit als handlicher Begriff durchgesetzt; er bezeichnet sexuelle Anziehung oder Begehren zwischen Männern bzw. zwischen Frauen, lässt den Vollzug aber offen. Der ältere Begriff ›Sodomit‹ (den Foucault vom modernen ›Homosexuellen‹ unterschied) umfasst sowohl spezifischere als auch weitere Bedeutungen, die ihn weniger geeignet machen; vor allem aber wurde er abwertend gebraucht, weshalb ich ihn nur gelegentlich benutzen werde. Die ›Knabenliebe‹ dagegen meint ausdrücklich die Liebe zu (meist älteren) ›Knaben‹ und taugt daher gut zur Beschreibung dieses Begehrens. Der Begriff wurde sehr häufig für das gleichgeschlechtliche Begehren überhaupt gebraucht – und Sprache beeinflusst Wahrnehmung; Goethes Luther-Bibel etwa verbot die ›Sodomie‹ mit »Knaben« – heutige Übersetzungen dagegen die mit »Männern«.64 Dem historischen Gebrauch im 18. Jahrhundert gemäß soll der Begriff ›Knabe‹ in diesem Buch junge Männer bis ungefähr 18 Jahren beschreiben. Etwas ältere, also 19- bis 20-Jährige, werde ich dagegen mit den damaligen Begriffen ›Jüngling‹ bzw. ›Ephebe‹ bezeichnen. Meine Terminologie wird freilich je nach Umständen wechseln, zumal es ohnehin Abweichungen gab. So konnte ›Knabe‹ auch ›Jüngling‹, ja sogar ›junger Mann in der späten Adoleszenz‹ bedeuten, wie etwa – zumindest poetisch – in den Werken von Goethe und Schiller.65
Aus Mangel an Alternativen und um die historische Besonderheit von ›homosexuell‹ zu vermeiden, werde ich häufig den Begriff ›gleichgeschlechtlich‹ gebrauchen; er ist potentiell frei von modernen Identitätsvorstellungen, da man nicht sagen kann, »Ich bin gleichgeschlechtlich« (im Gegensatz zu »Ich bin homosexuell«).66 Mein wichtigster, da auch konzeptioneller Ersatz für das Substantiv ›Homosexualität‹ ist jedoch die ›griechische Liebe‹. Der bilderstürmende Leipziger Germanist Hans Mayer verspottete den Begriff in seinem bahnbrechenden Buch Außenseiter (1975), das den Ton in der modernen Debatte über die gleichgeschlechtliche Liebe in Deutschland vorgab, als »vornehm euphemistisch«.67 Goethe jedoch benutzte den Ausdruck, wenn auch nur zweimal und vielleicht in beschönigender Absicht. Dennoch ist er durch diese historische Authentizität geadelt. Vor allem aber streicht er implizit die entscheidende Bedeutung heraus, die die klassische Antike für das Verständnis des gleichgeschlechtlichen Begehrens im 18. Jahrhundert hatte. Darüber hinaus reflektiert die ›Liebe‹ die »Rückkehr des Affekts«, der in Studien zur Sexualität bis vor kurzem oft vernachlässigt wurde.68 Gerade weil der Begriff ›griechische Liebe‹ vage bleibt, eignet er sich dafür, sexuelles Begehren zu beschreiben, ganz egal, ob vollzogen oder nicht; will sagen, er umfasst sowohl das Erotische wie das Sexuelle. Denn eines möchte ich klarstellen: Weder ›Liebe‹ noch ›griechische Liebe‹ sind ›platonisch‹ bzw. unerotisch gemeint. Der kleine, aber nur scheinbar arglose Gott Amor (Eros) beherrschte nicht nur Goethe – sondern auch dieses Buch. So gehört zu meinen Absichten, etwa gerade da, wo Goethe »in aller Reinheit« von nicht-sexuellen Beziehungen zwischen Männern zu sprechen behauptet, seine unterschwelligen Anspielungen und damit die Ironie offenzulegen, die spielerisch die eigene Behauptung unterläuft.
Der zweite Verzicht, den ich übe, betrifft das Textkorpus: Nur die wichtigsten Werke Goethes, in denen er deutlich oder explizit über die gleichgeschlechtliche Liebe schreibt (auch wenn die sexuelle Erfüllung in der Regel ausbleibt), werde ich behandeln – ausgenommen solche Texte, bei denen unklar bleibt, ob ein männliches oder weibliches Liebesobjekt gemeint ist. Schöpft man den Gehalt dieser Werke in Gänze aus, gibt es selbst mit dieser Beschränkung mehr als genug Material. Vieles davon steht im Kontext von Goethes Hauptwerken (wie FaustII und dem West-oestlichen Divan). Reiche Ernte fährt man ein, untersucht man nur Goethes Lektüre über die gleichgeschlechtliche Liebe im Zusammenhang mit diesen Werken. Vielleicht werden manche Leser einige Werke hier vermissen, etwa Werthers fiktive Briefe aus der Schweiz (1796 entstanden). Nachdem Werther dort sein Verlangen befriedigt hat, erst einen Mann und dann eine Frau nackt zu sehen, denkt er über seine Erfahrung nach; die kurze Passage, in der er von seinem nackten Freund Ferdinand schwärmt, wird oft ›homoerotisch‹ verstanden.69 Mir leuchtet das nicht ein, gehört das alles doch zu Werthers ›Experiment‹, ist ein logisches und kurzes Vorspiel zu dem aufwändigeren – und verstörenden – Vorhaben, eine Frau zu mieten, um ihren Körper zu betrachten. Untersuchte man die vielen Werke Goethes, in denen die griechische Liebe dem modernen Empfinden nach augenfällig scheint, kämen die bedeutenderen Werke zu kurz, in denen Goethe den Leser mit der gleichgeschlechtlichen Liebe konfrontiert, wie sie in seiner Zeit verstanden wurde.
Trotz dieser Vorsicht muss man sich nicht auf eine ›positivistische‹ Beschreibung von Goethes Texten beschränken. Im Gegenteil: Viele Leser dürften manche der folgenden Interpretationen für gewagt halten. Tatsächlich müssen verborgene Pfade entdeckt werden, denn Goethe spielte gern mit seinen Lesern. In seinem allerletzten Brief benannte er selbst »diese sehr ernsten Scherze« im damals unveröffentlichten zweiten Teil des Faust, der unter anderem eine Szene enthält, in der Mephisto scheinbar ›schwul‹ wird (Kap. 7). Die paradoxen ernsten Scherze gelten seit langem als überaus bezeichnend für Goethes Spätwerk.70 Meine Behauptung ist nun, dass Goethes Spiel mit dem Leser zahllose Verweise auf eigene wie auch antike Werke in Kunst und Literatur birgt, die die gleichgeschlechtliche Liebe heraufbeschwören. In einem weiteren Brief bemerkte Goethe (ausgehend von den Widmungsversen im Faust, »Zueignung«),
daß das Publicum nicht immer weiß wie es mit den Gedichten, sehr selten aber, wie es mit dem Dichter dran ist. Ja ich läugne nicht, daß, weil ich dieses sehr früh gewahr wurde, es mir von jeher Spaß gemacht hat, Versteckens zu spielen.71
»Versteckens« spielt er auch in dem dicht geknüpften Netz von Assoziationen, die in seinem Werk auf die gleichgeschlechtliche Liebe verweisen. Viele dieser Anspielungen können nur im Rückgriff auf die griechische und römische Literatur verstanden werden. Je älter er wurde, desto ausschließlicher schrieb Goethe für eine kenntnisreiche, höchst gebildete Öffentlichkeit, ja für ein ausgewähltes, elitäres Publikum.72 Tatsächlich enthält jedoch schon das erste veröffentlichte Werk, in dem Goethe die griechische Liebe anklingen lässt – die Farce Götter Helden und Wieland –, so einen »Scherz«, den nur versteht, wer seinen Vergil gelesen hat. Sein letzter Text zu diesem Thema, die vorletzte Szene von Faust II, gipfelt in der Menschwerdung des Teufels durch die griechische Liebe, die Goethe via Winckelmann, den Apoll von Belvedere und vielfache Anspielungen auf die klassische Antike, Kastratentum und auf die biblische Sodom-Geschichte grandios aufleuchten lässt.
Die Auflösung all dieser Verknüpfungen soll letzten Endes Goethes anhaltendes, unbeirrbares Interesse an der griechischen Liebe während seines gesamten Erwachsenenlebens aufzeigen. Es wäre verführerisch, die gleichgeschlechtliche Liebe als das Lebensthema Goethes darzustellen. Nach der Lektüre dieser Studie wird mancher Leser vielleicht zu diesem Schluss kommen. Doch muss die Perspektive gewahrt bleiben: Goethes Œuvre besteht aus mehr als nur gleichgeschlechtlicher Liebe – die heterosexuelle Variante herrscht viel stärker vor. Auch wenn man also nicht übertreiben darf, so hoffe ich doch, den Beweis anzutreten, dass das Thema Goethe wichtiger war, ihn dezidierter und beständiger beschäftigte als bislang angenommen. Erst hierdurch erschließt sich, wie aktuell seine Sicht auf die gleichgeschlechtliche Liebe für die moderne Gesellschaft ist.
KAPITEL 2 Ganymed und seine Freunde: Die voritalienische Zeit
Götter Helden und Wieland
Die erste Anspielung auf die griechische Liebe, die Goethe der Öffentlichkeit präsentierte, wirkt auf den ersten Blick leicht ›homophob‹. Sie findet sich in der gehässigen Satire (1773), die der junge Dichter auf Christoph Martin Wieland münzte, den berühmten, 16 Jahre älteren Autor und Erzieher des Weimarer Prinzen Carl August. Goethe war erst 24 Jahre alt und stand kurz vor dem landes-, ja europaweiten Durchbruch: Noch im selben Jahr veröffentlichte er , ein Jahr später . Wieland war Beleidigungen gewohnt. Die kecken Dichter des Sturm und Drang griffen ihn mit Vorliebe als Vertreter der Empfindsamkeit und besonders des literarischen Rokoko an, das ihnen gekünstelt, französisierend und seicht erschien. Zwei Jahre nach seiner derben Attacke, 1775, sollte Goethe selbst als Favorit des sechs Jahre jüngeren, gerade mündig gewordenen Herzogs Carl August nach Weimar gehen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























