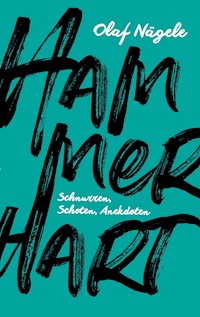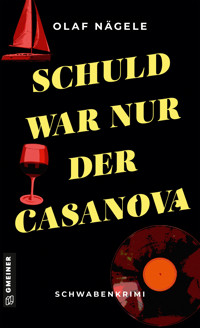Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pfarrer Goettle
- Sprache: Deutsch
Im Ummendorfer Badesee wird ein Toter in einem Plastiksack gefunden. Hinweise auf seine Identität gibt es nicht. Erst die Veröffentlichung seines Fotos bringt Bewegung in den Fall: Biberachs Pfarrer Andreas Goettle erkennt in dem Toten Karlheinz Kaiser, einen der Initiatoren, die den 1. FC Oberschwaben in den Profifußball bringen wollten. Allerdings wurde Kaiser vor Jahren für tot erklärt. Hauptkommissarin Greta Gerber und Pfarrer Goettle forschen nach und geraten in einen Sumpf aus Intrigen, Lügen und Korruption.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olaf Nägele
Goettle und der Kaiser von Biberach
Kriminalroman
Zum Buch
Der Kaiser ist zurück!Zwei Schwimmer machen im Badesee bei Ummendorf einen grausigen Fund: In einem Plastiksack verpackt, treibt ein toter Mann an der Oberfläche des Gewässers. Hinweise auf seine Identität gibt es nicht. Hauptkommissarin Greta Gerber hofft, durch die Veröffentlichung eines Fotos des Toten Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Der Plan geht auf. Biberachs Gemeindepfarrer Andreas Goettle erkennt in dem Toten Karlheinz Kaiser, einen der führenden Köpfe beim 1. FC Oberschwaben, der kurz vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Bundesliga steht. Nur: Kaiser ist vor Jahren bei einem Segeltörn in der Ägäis ertrunken. Als wenig später der Mittelfeldspieler Maik Riemenschneider schwer verletzt aufgefunden wird, scheint die Spur unweigerlich zu dem Fußballclub zu führen. Doch nicht nur beim 1. FC Oberschwaben geht es um viel, das es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. Je näher Greta Gerber und Andreas Goettle der Wahrheit kommen, desto gefährlicher wird ihre Situation.
Olaf Nägele, 1963 in Esslingen geboren, hat nach langen Aufenthalten in München, Stuttgart und Hamburg den Weg in seine Heimatstadt zurückgefunden. Dort feilt der Kommunikationswirt (KAH) an PR- und Werbetexten, verfasst als Journalist Artikel für diverse Zeitungen und arbeitet als Redakteur bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Spaß, Geschichten zu erzählen, hat ihm Beiträge in Anthologien eingebracht, Hörspiele für den SWR, Kurzgeschichtenbände, Romane und Radio-Kolumnen für Neckaralb Live Reutlingen folgten. Für die Kurzgeschichte „Die Sache mit Gege“ erhielt er einen Ehrenpreis der Akademie Ländlicher Raum in Baden-Württemberg und seine Radiokolumne »Ingo lernt schwäbisch« wurde 2020 für den Medienpreis der Landesakademie für Kommunikation nominiert.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
»Goettle und der Kaiser von Biberach« erschien erstmals 2015 beim Silberburg-Verlag.
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © bajo57 / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6828-5
1
Das Telefon klingelt. Schrill.
Eine Hand ergreift den Hörer, führt ihn langsam zum Ohr.
»Ja?«
»Er ist wieder da!«
Die Stimme am anderen Ende klingt rau, gebrochen.
Knisterndes Schweigen.
»Wer?«
»Na, er. Frag doch nicht so bescheuert. Er ist wieder da! Er!«
Was folgt, ist Stille. Eine Ruhe, die schmerzt.
»Das gibt es doch nicht. Dieser Idiot. Was soll das?«
Heiseres Keuchen, wie der grollende Atem eines wilden Tieres.
»Was will er?«
»Was wird er wohl wollen? Er ist nicht dumm. Er bietet uns ein reines Gewissen, hat er gesagt. Und dafür will er zwei Millionen.«
Empörungsstöhnen.
»Wo ist er?«
»Ich weiß es nicht. Er will uns auf dem Stadionparkplatz treffen. Morgen um Mitternacht. Mit dem Geld.«
»Das geht jetzt nicht. Unmöglich.«
»Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er klang sehr entschlossen.«
Wieder Stille, endlos.
»Vielleicht gäbe es da noch eine andere Lösung …«
»Aber wir können ihn doch nicht …?«
»Fällt dir etwas Besseres ein? Er muss wieder weg!«
Ein Knacken unterbricht die Verbindung.
Ruppig, es klingt fast wie ein Schuss.
2
»Und jetzt konzentriert euch. Der Atem fließt direkt in eure Muskeln, der Körper ist angespannt. Bündelt eure Energie und nehmt sie mit in den Schlag. Eure Hände werden zu geschärften Äxten, die sich butterweich durch das Holz arbeiten.«
»Jetzt leg scho des Brettle na. I han a g’scheite Wuat, da muss i koi Energie mehr bündla, um Kleinholz draus zum macha.«
Karatetrainer Daniel Bischoffsberger öffnete die Augen und sah den Eleven strafend an, der es gewagt hatte, seine Konzentrationsphase auf das Empfindlichste zu stören.
Andreas Goettle erwiderte seinen Blick in seiner ureigenen Weise, die man fast als rebellisch bezeichnen konnte. Es hatte keinen Zweck, den etwas untersetzten Mittfünfziger mit hohem Haaransatz, dessen dunkle Augen unter buschigen Brauen angriffslustig funkelten, zurechtzuweisen. Goettle, der in seinem weißen Kampfanzug wie eine unkolorierte Version seines sonstigen Erscheinungsbilds wirkte – schließlich trug er als katholischer Gemeindepfarrer von Biberach ausschließlich schwarze Kleidung –, ließ sich von nichts und niemandem in die Schranken weisen, und schon gar nicht, wenn er im Harnisch stand.
Bischoffsberger seufzte, legte ein Holzbrett auf die dafür vorgesehene Vorrichtung, machte eine einladende Geste und überließ dem Geistlichen mit dem blauen Gürtel den Vortritt. Mit stoischer Miene und ausgeprägter Zornesfalte auf der Stirn brachte sich Goettle in Position, presste die schmalen Lippen aufeinander, holte mit dem rechten Arm weit aus und zerschmetterte unter dem Ausstoß eines wilden Schreis – der sich rein lautmalerisch an der Kante eines beliebten schwäbischen Fluchs entlanghangelte – das Brett. Die anderen Karateschüler applaudierten.
»Reschpekt, Herr Pfarrer. Des Brettle hot koi Schahs ghet«, befand Renate Münzenmaier, mit 65 Jahren die älteste Teilnehmerin des Kurses. Eigentlich hatte die rüstige Dame gar keine Karateausbildung nötig. Sie hatte eine Zunge, die schärfer war als eine geschliffene Axt. Wenn sie sich in eine ihrer gefürchteten Litaneien hineinsteigerte, dann ermüdete jegliches Material. So sah es zumindest Andreas Goettle, der sich tagtäglich mit seiner Haushälterin konfrontiert sah und sich nicht selten ihrer bissigen Angriffe erwehren musste.
»I kann mir des scho denka, wem der Schlag g’olta hot«, krächzte die agile Seniorin und kicherte. Wenn sie lachte, dann schien es, als rollte eine Welle durch ihren massiven Leib, die sich langsam von unten ausdehnte, Bauch und Busen ergriff und schließlich den Kopf zum Wackeln brachte. 94 Kilogramm, ohne Schuhe.
Die anderen Karateschüler grinsten. Es war ein offenes Geheimnis, dass es vor allem einer war, der das Blut des Gemeindeseelsorgers in Wallung bringen konnte. Landrat Helmut Mössinger. Durch seine unbestreitbare Nähe zur Industrie – schließlich hatte er lange die Geschicke der IHK geleitet – förderte er so ziemlich jede Idee, die das Zeug hatte, das oberschwäbische Idyll aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Auf sein Geheiß wurden Wellness-Tempel inmitten von Naturschutzgebieten errichtet und für den Stadion-Neubau des 1. FC Oberschwaben vor den Toren Ummendorfs waren mehrere Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche vernichtet worden. Mobilfunkmasten und Windräder wurden in die Landschaft gesetzt, als gälte es, sein Revier zu markieren. Die Steuergelder wurden mit offenen Händen ausgegeben, als kämen sie aus einer nie versiegenden Quelle, und selbst Umweltschützer und Naturfreund Goettle hatte wenig Verständnis für die sündhaft teure Errichtung der beiden Fledermausbrücken, die über die Nordwestumfahrung führten. Offenbar wollten auch die kleinen Vampire nicht mit dem Bauwerk in Verbindung gebracht werden, denn bislang nutzten sie es so gut wie nicht.
Für Andreas Goettle war jeder Eingriff in die Schöpfung eine unverzeihliche Sünde. »Niemand vergeht sich ungestraft am Werk Gottes«, lautete seine Devise, und wann immer Landrat Mössinger mit einer neuen Idee aufwartete, scharte der rührige Geistliche Oppositionelle um sich, um einen Sturm der Revolte anzuzetteln. Mal mit Erfolg, mal ohne.
»Welche Idee ist es denn dieses Mal, die dich so aufbringt, Andreas?«, erkundigte sich Daniel Bischoffsberger. Ihm war klar, dass er das Training so nicht fortführen konnte. Der aufgebrachte Pfarrer würde jede Gelegenheit nützen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Goettle strich sich mit der linken über die schmerzende Schlaghand und verzog das Gesicht. »I sag bloß oins: Fracking. Der Siach verhandelt mit a paar Engländer, die hier in der Region nach Erdgas sucha wellet. Dabei presset se an Haufa Gift in de Boda, damit Risse em Stoi entstandet ond des Gas entweicha kann. Des Gift hemmer dann au em Trinkwasser, ond irgendwann laufet mir älle mit zwoi Köpf rum.«
»Bloß net. Bei meiner Migräne halt i des net aus«, warf Renate Münzenmaier ein.
Der Karatelehrer legte seinem Schüler die Hand auf die Schulter und hoffte, ihn durch diese versöhnliche Geste beruhigen zu können.
»Ja, wir haben alle gesehen, wie sehr dich das aufregt. Aber du solltest dich da mehr aus der Energie nehmen.«
Goettle betrachtete einen Moment lang die zwei Hälften des Brettes, das er eben zerschlagen hatte, und senkte mit schuldbeladener Miene den Kopf, als wollte er das Holz um Verzeihung bitten.
»’s isch doch wohr. Die machet älles he, als dät denne älles g’höra. Und des bloß, weil der Schofsegg… des verirrte Schaf seinen Hals net voll g’nuag kriaga kann. Ond sei Kumpel, der Erlbacher von der Sparkass, isch sofort mit a paar Milliona dabei.«
»Das stimmt. Aber wenn unsereins einen Privatkredit will, dann wird erst ein umfangreiches Rating durchgeführt, bei dem immer nur ein Ergebnis herauskommt: Nix gibt’s«, meldete sich Eleni Theadopoulo zu Wort.
Die Deutschlehrerin mit griechischen Wurzeln am Pestalozzi-Gymnasium gehörte einer Vereinigung von Naturschützerinnen an, die sich den exotischen Namen »Grüne Minnen Oberschwaben« gegeben hatten. Zehn Damen hatten sich zu einer schlagkräftigen Truppe zusammengerottet, die, wann immer sich die Gelegenheit bot, durch Störaktionen von sich reden machte. Besonders unter dem Engagement der Frauen zu leiden hatte der Erlebnistierpark Jägerhof in Pfullendorf. Bereits drei Mal war es ihnen gelungen, nächtens einzudringen und die Tiere aus ihren Stallungen zu befreien. Sehr zur Freude von Pfullendorfs Bevölkerung, die sich kräftig amüsierte, als ein Lama in die Bäckerei Schockenrieder hineinspazierte und eine ordentliche Pfütze auf den Streuselkuchen aus eigener Herstellung spie. »Des Tierle hot halt G’schmack«, hieß es da, und: »Des war’s erschde Mol, dass der Kucha net furztrocka war.«
Die Ordnungshüter wiederum hatten für die Aktionen der Widerständlerinnen kein Verständnis. Einen ganzen Tag lang pirschten sie Hasen, Meerschweinchen, einem Esel und drei Ponys hinterher, die den Verkehr in der Stadt lahmlegten.
Eigentlich wäre ein Diener des Herrn, wie es Pfarrer Goettle nun mal war, zu mehr Neutralität verpflichtet gewesen, aber er unterstützte die »Minnen«, so gut er konnte. Und wenn er nur während seiner leidenschaftlichen Sonntagspredigten in St. Frieder zum Sympathisantentum aufrief.
»Oifach mol a bissle mitdenka«, brüllte er die Kirchgänger zuweilen an, wenn sie ihm zu viel Lethargie an den Tag legten. »Au mol nolanga. Wenn der liebe Gott g’wollt hätt, dass ihr bloß bled guckat, no dätet ihr als große Glotzbebbel durch die Landschaft kugla. Er hot euch aber au a Hirn geba, ond des darf mr au mol benutza.«
Gleichgültigkeit, Diplomatie oder Zurückhaltung gehörten nicht zum Portfolio der Eigenschaften, die Goettle in sich vereinte. Er war einer, der sich einmischte, der den Menschen Hoffnung gab, der in seinem Leben viel bewirkt hatte. Schon als Schüler hatte er sich in der Katholischen Kirchenjugend engagiert. Er hatte sich für die Belange von älteren oder sozial schwachen Menschen eingesetzt und damit den Grundstein für sein Engagement in praktizierter Nächstenliebe gelegt. Als Referendar hatte er die Friedensaktivitäten der katholischen Kirche in der ehemaligen DDR begleitet, und später zog es ihn in die Favelas von Rio de Janeiro, in denen er Schulen aufgebaut hatte.
Andreas Goettle war einer, der seinen Worten Taten folgen ließ. Wenn er verkündete, dass es an der Zeit sei, die Kindertageseinrichtung im Ort auf Vordermann zu bringen, dann stand er am nächsten Morgen mit seinem Werkzeugkasten vor der Tür und legte Hand an. Wenn er den Senioren im Altenstift versprach, einen Ausflug zu organisieren, den sie so schnell nicht vergessen sollten, dann konnten die Damen und Herren schon die Rucksäcke packen. Die Bierverkostung in der Schussenrieder Brauerei vor einigen Jahren war noch allen Beteiligten in bester Erinnerung geblieben, zumal sich der Geistliche einen Zweiliterkrug aus dem Bierkrugmuseum mit Gerstensaft füllen ließ und diesen tatsächlich in einem Zug leerte. Ja, Andreas Goettle wusste, wie man sich Respekt bei den Gemeindemitgliedern verschaffte. Und demzufolge war er auch sehr beliebt. Anders konnte man es wohl nicht erklären, dass er seit Jahren den Beinamen »Liebs Herr Goettle von Biberach« hatte.
3
»Sieh mal einer an. Welche Ehre. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch hier treffe.«
»Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mich freue, dich zu sehen. Was willst du? Warum bist du hier?«
»Oh, ich dachte, das hätte ich schon am Telefon erwähnt. Zwei Millionen Euro. Zurzeit sind ein paar Zahlungen fällig. Einige Leute werden sehr ungeduldig und haben mir schon ihren Besuch angedroht. Das ist gar nicht gut.«
»Du hast Geld bekommen. Genug, um unterzutauchen. Alles andere geht uns nichts an. Das ist dein Ding. Es ist eben eine schwierige Zeit.«
»Schwierige Zeiten gibt es immer. Ich will davon nichts hören. Ich bin an Lösungen interessiert. Genau wie meine Kunden. Und dafür brauche ich Geld. Schnell. Ist das klar?«
»Du hättest nicht hierherkommen dürfen. Es hat sich viel verändert, seit du weg bist. Du machst alles kaputt.«
»Aber nein. Ihr gebt mir mein Geld, und schon tauche ich wieder unter. Ich löse mich praktisch in Luft auf.«
»Wir haben das Geld nicht. Wir haben investiert. Außerdem lief es in letzter Zeit nicht so, wie wir es geplant haben. Wir brauchen Zeit.«
»Das interessiert mich nicht. Ich will meinen Anteil, und zwar sofort.«
»Bist du verrückt? Steck die Waffe weg!«
»Zwingt mich nicht, sie zu gebrauchen. Und sag dem Bürschchen, er soll stehen bleiben, sonst puste ich ihm das bisschen Hirn weg, das er mit sich spazieren trägt.«
»Lass den Scheiß. Los, nimm ihm die Knarre ab … Sei vernünftig … Das ist doch Wahnsinn … Wir können doch noch mal reden … Hört auf … Nein … Nicht … Aufhören! Sofort!!!«
…
»Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. So viel Blut. Ist er … tot?«
4
»Du bist also auch nicht aus Biberach. Genau wie ich. Ursprünglich stamme ich aus Hannover, aber die letzten Jahre habe ich in New York zugebracht. Eine geniale Stadt, am liebsten würde ich da sofort hinziehen. Die Leute dort sind so offen und frei, so ganz anders als hier. Allein dieser Dialekt, den sie hier reden. Furchtbar.«
Greta rührte mit dem Strohhalm in ihrem Hugo und betrachtete das Pfefferminzblatt, das auf der Oberfläche schwamm, als wäre darauf eine geheime Botschaft zu entdecken. Zum Beispiel, wie sie diesen Kerl gegenüber wieder loswerden konnte, der seit einer geschlagenen halben Stunde ohne Punkt und Komma aus seinem ereignislosen Leben erzählte. Natürlich hatte sie sich mit Joachim getroffen, um ihn kennenzulernen, aber war davon ausgegangen, dass auch sie einmal zu Wort kommen würde. Das war bislang noch nicht der Fall gewesen.
Der sportliche, schlanke Mittdreißiger ohne Altlasten, der »mit beiden Beinen im Leben stand, der in Anzug und in Jeans eine gute Figur machte, mit dem man lachen und auch mal weinen konnte, der sich für Kunst, Theater und Musik interessierte, gerne reiste und auch kulinarischen Freuden nicht abgeneigt war«, hatte sich in einen Rausch geredet. Davon hatte nichts in seinem Profil gestanden, das er im Flirtportal »www.ausgesinglet.de« eingestellt hatte, um ein weibliches Pendant zu finden.
Greta fragte sich, warum sie immer wieder auf diesem Wege versuchte, jemanden kennenzulernen. Konnte sie nicht einfach in eine Kneipe gehen, ein bisschen flirten, sich auf einen Drink einladen lassen?
Nein, konnte sie nicht. Wenn sie von einem Mann angelächelt wurde, sah sie sofort an sich herunter, um einen Fehler an sich zu suchen. Einen Fleck auf der Bluse zum Beispiel oder einen offenen Reißverschluss der Jeans.
Das Selbstbewusstsein, das Greta im Job an den Tag legte, schien sie jeden Abend an der Pforte des Kriminalkommissariats abzugeben. Dann verwandelte sich die toughe Hauptkommissarin in ein unscheinbares Mäuschen, das so gar nichts mit sich anzufangen wusste und so wirkte, als existierte es gar nicht.
Dabei hatte sie sich fest vorgenommen, in der neuen Stadt alles besser zu machen als in ihrer Heimatstadt Freiburg. Der Job in Biberach hatte der erste Schritt in diese Richtung sein sollen. Es war nicht der berufliche Aufstieg, den sie sich gewünscht hatte, aber die Stelle hatte Vorteile: Neue Kollegen, ein interessantes Aufgabengebiet und vor allem war sie schnell verfügbar gewesen. Hier konnte Greta einen Neuanfang wagen, ohne die Last der Erinnerung, die sie in den ruhigen Momenten niederdrückte.
Wenn der Boden zu rutschen beginnt, muss man die Zelte abbrechen, um sie auf festem Grund wieder zu errichten, hatte ein Freund geraten.
Das hatte sie getan und bereute diesen Schritt keinen Moment. Von Anfang an hatte sie sich in das malerische Städtchen verliebt. Die bunten Fassaden in der Innenstadt, die Fachwerkbauten, die Türme und Erker der Häuser am Marktplatz. Dieser ruhige, unaufgeregte Strom, in dem sich die Menschen durch die Stadt treiben ließen, oder dieses Laisser-faire, mit dem sie in den zahlreichen Cafés saßen, um sich dem Müßiggang hinzugeben. Allerdings, und das war wohl das berühmte Haar in der Wohlfühl-Suppe, verwandelte sich das Zentrum nach Ladenschluss in ein Postkartenmotiv. Schön anzusehen, aber viel zu ruhig für Gretas Geschmack, die etwas mehr Umtriebigkeit von der einstigen badischen Heimat gewohnt war.
Eine Wohnung hatte sie sofort gefunden: zwei Zimmer, Küche, Bad in einem lindgrün gestrichenen Haus mit roten Fensterläden in der »Neuen Gasse«, ganz nah am Zentrum. Das Beste daran, fand Greta, war jedoch die räumliche Nähe zur Chocolaterie Maya, gleich um die Ecke. Dort genehmigte sich die Hauptkommissarin hin und wieder eine der »süßen Versuchungen«. Das half ihr beim Nachdenken.
Und doch war sie auch nach vier Monaten im Oberschwäbischen noch nicht so richtig heimisch geworden, geschweige denn, dass sie in ihrer neuen Stelle gefordert gewesen wäre. In Biberach und Umgebung dachte anscheinend niemand daran, ein Verbrechen zu begehen, das über einen Einbruchdiebstahl, eine Körperverletzung oder einen Raub hinausging.
Auch den Kollegen oder den Nachbarn war sie nicht nähergekommen, was mitunter an deren Sprache lag. Greta mochte den warmen Klang des Schwäbischen, was aber nicht hieß, dass sie alles verstand. Ständig musste sie sich das Gesagte wiederholen lassen, und dieses stetige Nachfragen nervte wohl auch die Mitarbeiter, die sie deutlich spüren ließen, dass sie eine »Reig’schmeckte« war. Eine Badenerin obendrein.
In dem Bemühen, Anschluss zu finden, war sie in den katholischen Kirchenchor eingetreten. Nicht, dass sie besonders gläubig gewesen wäre, aber der Ruf, der dem Sangeskollektiv vorauseilte, hatte sie neugierig gemacht. Denn der Leiter, Pfarrer Andreas Goettle, war ein eingefleischter Rockfan, und entsprechend war die Auswahl der Songs eher modern ausgerichtet.
Für das nächste Sommerfest hatte er die Aufführung der Rockoper »Jesus Christ Superstar« geplant. Greta war als Besetzung der Prostituierten Maria Magdalena vorgesehen. Pfarrer Goettle hatte das als »Pfondsidee« eingestuft, dass ausgerechnet eine Hauptkommissarin diese verruchte Rolle bekleiden sollte. »Da könnet Se au mol die donkle Seite ausleba«, hatte er ihr augenzwinkernd zugeflüstert. Ungewöhnliche Worte aus dem Mund eines Geistlichen.
»Weißt du, die Leute denken immer, Versicherungsmakler sei so ein langweiliger Beruf. Aber das stimmt gar nicht. Wenn man erfolgreich sein will, muss man sehr individuell auf die Wünsche der Kunden eingehen. Das erfordert ein hohes Maß an Kreativität. Ich hatte da mal eine Unternehmerin, die den Betrieb des Vaters übernommen hatte …«
Von Versicherungsmakler hatte in dem Inserat ebenfalls nichts gestanden, und auch in der sonstigen Beschreibung hatte Joachim selbstgefällig beide Äuglein zugedrückt. Eine gute Figur würde er weder in Jeans noch im Anzug machen, über dem Gürtel seiner Hose spannte ein prächtiger Bauch den Stoff seines Hemds. Die Brille, den Schnauzbart und die Halbglatze hatte er auch nicht erwähnt, und für welche Art von Literatur und Musik er sich interessierte, das wollte Greta eigentlich schon nicht mehr wissen. Dem bisherigen Gespräch nach zu urteilen, kam Joachim über die Lektüre der Micky Maus nicht hinaus und zählte bestimmt Andrea Berg zu seinen Lieblingsinterpretinnen.
»Ich muss mal kurz für kleine Mädchen«, unterbrach Greta das Geschwurbel des Gegenübers und erhob sich. Sie zog den engen Rock, der hochgerutscht war, nach unten und stakste auf den für ihre Verhältnisse hochhackigen Schuhen in Richtung Toilette. Sie spürte Joachims Blicke auf ihrem Hintern und schwor sich, zum nächsten Blind Date, sollte es je wieder zu einem kommen, in Jeans und Sneakers zu erscheinen. Das fehlte noch, dass sich dieser personifizierte K.-o.-Tropfen an ihrem Outfit aufgeilte, während sie Mühe hatte, nicht ins Wachkoma zu fallen.
Im Vorraum des WCs baute sie sich vor einem Spiegel auf, strich mit einem Finger eine Verwischung ihres Kajalstrichs weg und sah sich kritisch an. Gut, die Nase war ein bisschen zu spitz, was die schmalen Wangen noch mehr betonte. Und ja, ein Friseurbesuch konnte auch nicht schaden, und sei es nur, um die ersten grauen Strähnchen wieder in den dunklen Fluss der schulterlangen Haare zu integrieren. Aber sonst sah sie doch gut aus. Nicht zu dick, nicht zu dünn, die wenig ausgeprägten Rundungen saßen zumindest an den richtigen Stellen, und schließlich gab es ja textile Mittel und Wege, diese zu betonen. Hatte sie es wirklich nötig, noch mehr Abende wie diesen mit den männlichen Vertretern der Resterampe zu verbringen?
Greta schüttelte den Kopf.
Sie zog ihr Handy aus der Tasche und wählte die Nummer des Kollegen Schneider. Nach einigen Sekunden nahm er ab und versuchte, das Gebrüll im Hintergrund zu übertönen. Offenbar hatte er mehr Spaß als sie.
»Hallo, Herr Schneider, hier ist Greta Gerber. Hören Sie. Sie müssen mir einen Gefallen tun.«
Schneider war wenig begeistert von dem Vorschlag, aber die Hauptkommissarin wusste, dass sie sich auf ihn verlassen konnte. Als sie wieder an den Tisch trat und sich setzte, wurde sie von Joachim aufmerksam gemustert.
»Was machst du eigentlich so? Ich meine … beruflich.«
Diese Pause, dieser süffisante Ton gab seiner Frage eine anzügliche Note, und einmal mehr bedauerte Greta, ein Outfit gewählt zu haben, das ihre Weiblichkeit so eindeutig betonte. Am Ende dachte dieser Hinterhof-Casanova noch, dass sie es nur für ihn angelegt hatte.
Sie zog am Strohhalm, verschluckte sich, hustete, um den fehlgeleiteten Tropfen aus der Luftröhre hinauszubefördern, und überlegte, ob sie Joachim die Wahrheit sagen oder ihm eine Notlüge servieren sollte. Sie würde ihn ohnehin nicht wiedersehen, das stand fest. Und irgendwie hatte sie keine Lust, über ihren Beruf zu reden. Schon gar nicht mit ihm, dem Versicherungsmakler mit seinem so aufregenden Leben.
»Ich bin Sekretärin bei einer Gebäudereinigungsfirma«, sagte sie und sah dabei zu, wie Joachims Mimik den Fahrstuhl nach unten nahm. Offenbar hatte er sich ein spannenderes Date gewünscht.
»Hm, ja, das ist bestimmt auch ganz nett«, hakte er ein. »Ich sage ja immer: Ein Beruf ist so interessant, wie man ihn sich macht. Ich zum Beispiel stelle mir jede Woche eine neue Herausforderung …«
Er zog ein Smartphone aus der Tasche, wischte wie wild auf dem Display herum und präsentierte eine Liste. »Hier. Nächste Woche will ich zwei Neukunden besuchen und insgesamt mindestens 1.500 Euro Umsatz machen. Das ist hart, oder? Ich meine, ich kenne die Kunden noch gar nicht und ich habe keine Idee, wie und wo ich sie finden soll. Aber man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist einer meiner Grundsätze. Nur so kommt man weiter …«
Die Melodie der TV-Serie »The Munsters« erklang. Der Klingelton ihres Telefons unterbrach Joachims einsetzende Wortkaskade. Mit geweiteten Augen starrte er Greta an, als sie ihr Handy aus der Tasche zog und ihn entschuldigend anblickte.
Sie nahm ab. »Gerber? Ja … Ach so … Jetzt gleich? … Gut, ich komme.«
Sie legte Joachim eine Hand auf die Schulter.
»Es tut mir leid, aber ich muss dringend weg. Einer unserer Fensterputzer ist vom Gerüst gefallen. Nicht schlimm, nur aus dem ersten Stock. Das macht er oft. Wahrscheinlich will er sich eine Krankmeldung erschleichen. Ich muss die Unfallversicherungsunterlagen für ihn raussuchen. War wirklich nett mit dir.«
»Aber wir wollten doch noch einen Nachtisch …«, stammelte Joachim und sah ihr dabei zu, wie sie sich die schwarze Jeansjacke über die Schulter warf.
»Vielleicht ein anderes Mal. Ich ruf dich an«, sagte Greta und rauschte davon, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Sie biss sich auf die Unterlippe, um nicht loszuprusten. Eine dümmere Ausrede hätte sie wohl kaum finden können, aber offenbar zog Joachim die Geschichte keine Sekunde in Zweifel. Blieb zu hoffen, dass dieser Langweiler ihre Aussage richtig interpretierte und seine Balz anderweitig fortsetzte.
»Was soll denn der Blödsinn, Frau Gerber?«, quäkte Denis Schneiders Stimme aus dem Handy. »Haben Sie getrunken?«
»Ich bin derartig stocknüchtern, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und ernüchtert. Danke, Schneider, Sie haben etwas gut bei mir«, sagte Greta und legte auf.
Vor der Tür der Cocktailbar atmete sie tief ein und ließ die frische Frühlingsluft in die Lungen strömen. Sie fröstelte. Obwohl die Temperaturen tagsüber schon ab und an die 20-Grad-Marke überstiegen, waren die Nächte noch kühl.
Aus der Grünanlage neben der Stadthalle war jugendliches Johlen zu hören. Flaschen rollten über den Boden, Gelächter. Die jungen Biberacher schienen sich schon auf den nahenden Sommer einzustimmen, der, wie in anderen Städten auch, mit Alkoholgenuss in Freianlagen einherging.
Greta wurde ein wenig wehmütig, als sie daran dachte, dass sie die warmen Abende wohl allein verbringen musste. Einen Moment schoben sich die Gesichter ihrer Mutter und ihrer Schwester ins Gedächtnis und legten sich wie ein Band aus Stahl um den Brustkorb. Sie ließ sich von einer Heimwehwelle überrollen und kämpfte gegen die Selbstmitleidstränen an. Sie sah zum Weißen Turm, der sich stolz und mächtig über die Innenstadt erhob. Wie oft war sie in den letzten Wochen den Weg hinauf zu ihm gestiegen, hatte seine Nähe genossen und sich von ihm behütet gefühlt.
Geduld, das war es, was ihr fehlte. Und Gelassenheit. Es war alles eine Frage der Zeit, bis sie sich zurechtfand und nette Menschen kennenlernte. So viel besser war es ihr in Freiburg schließlich auch nicht gegangen. Der Beruf und die vermeintliche Karriere standen dem privaten Glück im Weg, und sie konnte in diesem Punkt auch nicht aus ihrer Haut. Vielleicht war sie keine gute Freundin, womöglich hatte sie als Liebhaberin Schwächen, aber eines war sie ganz gewiss: eine gute Polizistin. Das würde sie den Menschen hier in Biberach schon noch beweisen.
»Wenn nur mal etwas Interessantes passieren würde«, murmelte sie. Langsam schlenderte Greta die Theaterstraße in Richtung Marktplatz hinunter und nahm sich vor, sich in ihrer Wohnung noch ein Glas Rotwein zu genehmigen.
5
»Ist er tot?«
»Keine Ahnung … Warte … Nein, er atmet noch …«
»Lass uns abhauen.«
»Das können wir nicht riskieren.«
»Was schlägst du vor?«
»Heb die Knarre auf!«
»Wieso …?«
»Mach schon!«
»Aber das geht doch nicht.«
»Gib sie ihm in die Hand.«
»Was soll das denn?«
»Leg seinen Finger an den Abzug und drück ihm das Ding an die Schläfe …«
»Soll das wie ein Selbstmord aussehen, oder wie? Das glaubt doch kein Mensch.«
»Ich … Nein … Ich kann das nicht. Oh Gott, er kommt zu sich …«
»Drück ab!«
»Er macht die Augen auf.«
»Drück ab!«
»Ich kann das nicht!«
»Mach schon. Er wird keine Ruhe geben, bis er hat, was er will. Er liefert uns ans Messer. Wenn er auspackt, dann ist alles aus. Ist es das, was du willst?«
»Er will etwas sagen. Ich glaube, er hat mich erkannt.«
»Dann drück endlich ab.«
»Nein … Ich …«
»Drück ab!«
…
»Hör auf zu zittern. Wir müssen ihn wegbringen. Schnell.«
»Ich … Ich hab ihn umgebracht.«
»Unsinn. Du hast ihn wieder dahin befördert, wo er schon lange war. Wir müssen ihn wegschaffen. Ich kann ihn nicht mehr sehen.«
»Fass mit an, ich kann ihn nicht alleine tragen.«
»Mir ist schlecht. Ich muss kotzen.«
»Reiß dich zusammen und nimm seine Beine.«
»Wo bringen wir ihn hin?«
»Wir helfen ihm unterzutauchen. Endgültig.«
6
1. FC Oberschwaben schon bald drittklassig?
Andreas Goettle überflog den Bericht über den Club, der drauf und dran war, eine Institution im Profi-Fußball zu werden. Nach einem miserablen Start in die neue Saison stand das Team nun, kurz vor dem Ende der Rückrunde, an der Spitze der Regionalliga Südwest und konnte den Aufstieg in die dritte Bundesliga schaffen. Es war kein gewachsener Erfolg, sondern einer, der vom Kapital bestimmt wurde. Vor einigen Jahren hatte der Spielervermittler Siegfried Röder einige Großsponsoren um sich geschart und die Idee entwickelt, die nur bedingt erfolgreichen Fußballabteilungen von Olympia Laupheim und des FV Biberach zusammenzuführen. Unter dem neuen Clubnamen 1. FC Oberschwaben wurde eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die, verstärkt durch einige ehemalige Bundesligaprofis, den Platz von Olympia Laupheim in der Verbandsliga übernahm und sofort um den Aufstieg mitspielte, den sie letztlich knapp verpasst hatte, in den folgenden beiden Spielzeiten jedoch erreichte.
Andreas Goettle hatte diese Entwicklung zähneknirschend verfolgt. Zum einen war er glühender Fan des FV Biberach gewesen und hatte kein Heimspiel versäumt. Zum anderen ärgerte es ihn, dass aus den beiden Traditionsclubs eine Söldnertruppe entstanden war, die seiner Ansicht nach wenig mit der Region gemein hatte. Dementsprechend konnte er es auch nicht gutheißen, dass auf dem Gelände von Olympia Laupheim ein Fußballleistungszentrum zur Förderung junger Talente und ein Fußballinternat errichtet worden waren. Die Liebherr-Arena, den Stadionneubau vor den Toren Biberachs, der 20.000 Zuschauer fasste, hatte er aus Protest nie betreten. Daran würde sich auch nichts ändern, wenn der 1. FC Oberschwaben in der obersten Spielklasse ankommen würde.
»Saubande, elendige«, resümierte Andreas Goettle und legte die Zeitung zusammen. Er nahm einen Schluck von seinem bereits erkalteten Milchkaffee und sah Renate Münzenmaier zu, wie sie die Post sortierte.
»Isch was G’scheids dabei?«, fragte er angesichts des mürrischen Ausdrucks seiner Haushälterin.
»Awa, bloß Rechnunga ond Werbung«, grummelte sie und rückte einem weiteren Umschlag mit dem Brieföffner zu Leibe. Einen Moment sah sie hoch, dann brannte sich ihr Blick fest auf Goettles Hemd. »Och noi, Herr Pfarrer, Sie hen ja immer no des Hemd an, des Sie geschdern mit dem Oi versaut hen. Sie sen doch ein Allmachtsschlamper.«
Goettle erhob mahnend einen Finger und setzte eine finstere Miene auf. »Versündiget Se sich net, Frau Münzenmaier. So schwätzt man nicht mit sei’m Vorgesetzten. Außerdem isch des mei Lieblingshemmad.«
»Was isch denn an dem so b’sonders? Die sen doch älle schwarz.«
»Aber des isch halt a besonders Schwarz. So leuchtend.«
»A leuchtendes Schwarz. Jetzt sen Se no so guad. Se gebet jetzt des Hemmad her, des kommt in d’ Wäsch. So könnet Se doch koi Beicht abnehma.«
Die Haushälterin hatte sich neben ihm aufgebaut und die Hände in die Hüfte gestemmt. Goettle war klar, dass sie keine Ruhe geben würde.
Widerwillig und umständlich widmete er sich der Knopfleiste. Er streifte das Textilstück ab und überreichte es der streng blickenden Ordnungskraft.
»Ihr Wille geschehe, alter Plog’goischd.«
Renate Münzenmaier nahm ihm das Hemd ab und blickte zum Fenster hinaus. »Sie solltet sich was azieha. Do kommt scho Ihre beschde Sünderin.« Goettle sah, wie sich Joanna auf hochhackigen, grell rosafarbenen Pumps, in sehr kurzen Shorts und einem schulterfreien Top der Kirche näherte.
»I möcht mol wissa, was des Menschle älleweil zum beichta hot. Die isch jo jede Woch do.«
Goettle errötete ein wenig und winkte ab. Joanna war eine junge Frau, die bereit war, alles dafür zu tun, um ihren Traum zu verwirklichen. Sie wollte ins Showgeschäft, egal wie. Da kam so einiges an Verstößen gegen die Zehn Gebote zusammen. Aber die junge Brasilianerin war auch eine gottesfürchtige Person und erleichterte das Gewissen regelmäßig durch ihre Beichte. Kann sein, dass sie auch zu Goettle eine besondere Beziehung hatte, da er sie auch verstand, wenn sie portugiesisch mit ihm sprach.
»Des was die beichtet, des kennet Sie alles net, Frau Münzenmaier. Ond i glaub, des isch au ganz guad so.«
Er verließ die Küche, um sich aus dem Schrank im Schlafzimmer ein neues Hemd zu holen, zog es an, streifte sich sein Priestergewand über und verließ das Haus in Richtung Kirche.
7
»Wie geht es dir?«, schnarrte es aus dem Telefonhörer.
Greta Gerber erstarrte. Seine Stimme genügte, um sie unverzüglich in den Gefühlssumpf zu stoßen, dem sie so mühsam entkommen war.
»Was willst du?«, erwiderte sie scharf. Sie war wütend. Wie konnte er es wagen, im Büro anzurufen? Was erdreistete er sich, sich noch einmal in ihr Leben zu drängen, nachdem er den knallharten Schnitt vollzogen hatte?
»Ich vermisse dich. Ich muss dich sehen.«
Er sagte es so zärtlich, dass ihr ein wohliger Schauer über den Rücken lief. Sie vermisste ihn auch, aber wusste, dass sie besser beraten war, ihm das nicht zu zeigen. Richards Problem war, dass er Entscheidungen traf und sie kurz danach widerrief. Daran würde sich nie etwas ändern, das war ihr im letzten Jahr immer wieder schmerzhaft in Erinnerung gerufen worden.
»Was ist? Lässt dich deine Frau wieder mal nicht ran? Hat sie endlich erkannt, was für ein Drecksack du bist?«, fauchte sie ihn an.
Greta senkte die Stimme und legte eine Hand um die Muschel des Telefons. Kollege Schneider sah herüber und grinste frech. Für einen Moment hatte sie vergessen, dass sie nicht allein im Raum war, zudem mit einem Menschen, den sie nicht besonders gut kannte. Sie senkte die Stimme und wandte sich wieder ihrem Gesprächspartner zu.
»Lass mich in Ruhe, hörst du?«
»Wir können doch noch mal über alles reden.«
»Sag nicht reden, wenn du vögeln meinst. Ich will weder das eine noch das andere. Um genau zu sein: Ich will dich nie, nie, nie mehr wiedersehen.«
Sie knallte den Hörer auf die Gabel und schlug mit der Faust auf den Tisch. Was bildete sich dieser Typ eigentlich ein? Dass sie bereitstand wie eine läufige Hündin, wenn er nur mit dem Schwanz wedelte? Wie viel räumliche Distanz musste denn noch zwischen ihm und ihr liegen, damit er sie endlich in Frieden ließ? Noch einmal ließ sie die Faust auf den Schreibtisch krachen.
»Guten Morgen, Frau Gerber. Wenn Sie mit der rabiaten Behandlung des Arbeitsplatzes fertig sind, würde ich gern mal mit Ihnen über die Sache Seitz sprechen. Sind Sie schon ein Stück weitergekommen?«
Kriminalrat Seidel, Leiter des Kriminalkommissariats Biberach, war hinter sie getreten und sah seine neue Mitarbeiterin über die Ränder seiner Brille an. Seine Stirn hatte er in Falten gelegt, was bei ihm ein untrügliches Zeichen des Missfallens war. Greta bemerkte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Zu peinlich, dass ihr neuer Chef die emotionale Entgleisung am Telefon mitbekommen hatte.
Sie sortierte die Unterlagen aus der Akte Seitz und schüttelte den Kopf. Die bisherige Ermittlung hatte noch keine neuen Anhaltspunkte ergeben.
In die Villa von Kurt Seitz im Panoramaweg war eingebrochen worden. Außer ein bisschen Kleingeld war nichts entwendet worden, der Schaden belief sich auf wenige Hundert Euro. Wesentlich brisanter war jedoch die Entdeckung, dass auch eine Pistole, die Seitz als Mitglied des Schützenvereins besitzen dufte, aus dem Waffenschrank fehlte. Und das wiederum konnte bedeuten, dass der nun bewaffnete Täter vorhatte, weitere Schandtaten zu begehen. Die unausgesprochene Mahnung ihres Vorgesetzten zur Eile war also durchaus berechtigt, fand Greta.