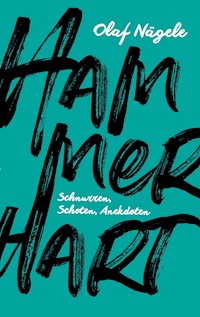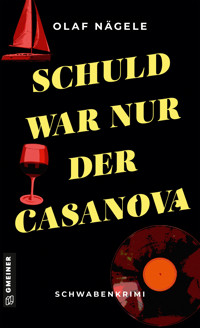
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissarin Yoselin Blaich
- Sprache: Deutsch
Bei einem Brandanschlag auf eine Villa am Bodensee stirbt die Escort-Dame Lady Kira. Ein Herr namens Boris Drescher hatte sie für ein gemeinsames Wochenende in der Ferienunterkunft gebucht. Hauptkommissarin Yoselin Blaich stellt dieser Fall vor mehrere Rätsel: Wem galt der Anschlag? Dem Besitzer des Gebäudes, einem Stuttgarter Immobilienmogul, der für seine Gentrifizierungsmaßnahmen gehasst wird? Der Sexarbeiterin? Oder Drescher, der eigentlich Morten Nadler heißt und nicht nur aus seinem Namen ein Geheimnis zu machen scheint …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Olaf Nägele
Schuld war nur der Casanova
Schwabenkrimi
Zum Buch
Heiße Liebeund lodernde Rache Yoselin Blaich, Hauptkommissarin bei der Kripo Ravensburg, steht bei ihrem neuen Fall vor einem Rätsel: Auf eine Villa in Nußdorf am Bodensee wurde ein Brandanschlag verübt, bei dem eine Frau ums Leben kam. Die Tote, Escort-Dame Lady Kira, wollte mit ihrem Kunden, Boris Drescher, ein erotisches Wochenende verbringen. Galt der Anschlag Kira oder Drescher? Oder sollte am Ende der Besitzer des Feriendomizils, der Immobilienmogul Georg von Rechberg, geschädigt werden? Letzterer hatte offenbar viele Feinde. Bald stoßen die Ermittler auf Ungereimtheiten: Boris Drescher heißt eigentlich Morten Nadler und scheint nicht nur bei seinem Namen gelogen zu haben. Zusammen mit ihrem Kollegen Norman Säger sucht Yoselin nach dem Täter und findet sich bald in einem dichten Netzwerk aus Betrug, Liebe, Eifersucht, Verzweiflung und Rache wieder. Schnell wird klar: Der Brandanschlag ist noch nicht das Ende der Bedrohung.
Olaf Nägele, 1963 in Esslingen geboren, hat nach langen Aufenthalten in München, Stuttgart und Hamburg den Weg in seine Heimatstadt zurückgefunden. Dort feilt der Kommunikationswirt (KAH) an PR- und Werbetexten, verfasst als Journalist Artikel für diverse Zeitungen und arbeitet als Redakteur bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Der Spaß, Geschichten zu erzählen, hat ihm Beiträge in Anthologien eingebracht, Hörspiele für den SWR, Kurzgeschichten-Bände, Romane und Radio-Kolumnen für Neckaralb Live Reutlingen folgten. Für die Kurzgeschichte »Die Sache mit Gege« erhielt er einen Ehrenpreis der Akademie Ländlicher Raum in Baden-Württemberg und seine Radiokolumne »Ingo lernt schwäbisch« wurde 2020 für den Medienpreis der Landesakademie für Kommunikation nominiert.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Clker-Free-Vector-Images / Pixabay; moritz320 / Pixabay; paulbr75 / Pixabay
ISBN 978-3-8392-7474-3
Vorbereitungen
Das leise Glucksen der Flüssigkeit im Einfülltrichter klang nach Bestätigung, der scharfe Geruch des Benzins beruhigte ihn. Ein prüfender Blick, dann stellte er die Flasche zu den anderen in den Karton. Sechs stolze Kamikaze-Krieger, bereit, im Kampf für Gerechtigkeit zu fallen. Mit zerstörender Wirkung. Jeder Tropfen seiner kleinen Molotow-Armee war dazu auserkoren, seinen Durst nach Vergeltung zu stillen.
Bislang war alles nur ein Spiel gewesen, bei dem es nicht darum ging zu gewinnen. Kräfte messen, mit Säbeln rasseln, einschüchtern, abschrecken. Eine Demonstration der Macht, der die Ohnmacht gefolgt war, weil er das Unvermeidliche nicht früh genug erkannt und verhindert hatte. Blind war er gewesen oder einfach nur durch seine Naivität verblendet, vielleicht hätte er sich früher einmischen sollen. Er spürte, wie sich die schmerzende Erinnerung wie ein dunkler Umhang um ihn legte, ihn einhüllte. Alles war ihm genommen worden, wirklich alles: die Zuversicht, dass sich alles zum Guten wenden konnte. Das Vertrauen in die Menschen, der Glaube an die Liebe, die Hoffnung auf Anerkennung. Aufgefressen von purer Gier.
In dieser Nacht würde er alles nehmen und seine Trauer in Genugtuung verwandeln. Tanzen auf den Trümmern einer Existenz. Vorsichtig bettete er das Feuerzeug neben seine Armee, atmete tief durch, roch das Aroma der Vernichtung, das seine Krieger verströmten. Sie waren bereit, er war es auch.
Sein Puls ging immer ein wenig schneller, wenn er den wöchentlichen Kontencheck begann. Seine Hände schwitzten, wenn er die PIN eingab und durch die Enter-Taste bestätigte. Ein kurzer Moment der Unsicherheit, er schloss die Augen, atmete tief ein, Augen auf, dann die Erleichterung. Sie hatte bezahlt. Den gesamten fünfstelligen Betrag, mit dem Vermerk »Für eine Zukunft in Freiheit«. Sein Herz machte einen Sprung. Der Anblick der neuen Zahl bedeutete für ihn pures Glück. Und die Aussicht darauf, dass er es am Wochenende so richtig krachen lassen konnte. No limits.
Auch auf dem Konto in Liechtenstein hatte sich einiges getan, ebenso in Tschechien und Luxemburg. Er wischte sich die Hände an der Hose trocken und bemerkte, dass er eine Erektion hatte.
»Na, Herr Kollege, was Schönes vor am Wochenende?«
Morten Nadler klappte seinen Laptop hektisch zu und blickte auf. Werner Richter, Schadenregulierer der Abagarion Oberschwaben AG, hatte sich vor seinem Tisch aufgebaut und grinste ihn an, als hätte er Morten bei einer Untat ertappt.
»Nichts Besonderes«, sagte er leise und hoffte inständig, dass sein Gegenüber sich mit dieser Antwort zufriedengab. »Relaxen. Vielleicht mit Freunden etwas essen gehen. Möglicherweise fahre ich am Wochenende an den See. Aber das entscheide ich kurzfristig.«
»Im Fernsehen läuft am Samstagabend ›Die Lange Comedy-Nacht‹. Das dürfte doch nach Ihrem Geschmack sein, in so einem Angestellten-Leben gibt es doch wirklich nicht viel zu lachen, oder?«
Richter ließ der sinnfreien Bemerkung ein kehliges Lachen folgen. Nadler hasste seinen Kollegen für die Überheblichkeit, mit der er ihm gegenüber auftrat. Offensichtlich hielt er sich für etwas Besseres, weil er im Außendienst durch seine Expertisen Einfluss nahm, ob ein Schadenfall bezahlt oder abgelehnt wurde. Kleine und große Schicksale hingen von seiner Meinung ab. Das befeuerte offenbar sein Ego und an Selbstbewusstsein hatte es Richter wahrlich noch nie gefehlt. Daher störte es ihn auch nicht sonderlich, dass er im Team nicht sehr beliebt war. Und er arbeitete auch kontinuierlich daran, sein Stinkstiefel-Image zu wahren. Mit großem Erfolg.
»Was ist eigentlich aus der Vandalismus-Sache an Ihrem Auto geworden? Wurde der Täter gefasst?«, erkundigte sich Richter mit gespieltem Interesse.
Morten schüttelte den Kopf. »Die Polizei ermittelt noch, aber die Chancen, die Täterin oder den Täter zu erwischen, sind gering.«
»Na ja, soll ja schlechtes Wetter geben. Da können Sie eh nicht offen fahren. Und ganz ehrlich: Cabriolet fahren ist für Männer in Ihrem Alter nicht gesund. Da holt man sich gern ein steifes Genick. Wenigstens etwas, was steif wird, was?« Richter krakeelte vor Vergnügen, machte kehrt und verließ den Raum.
Morten Nadler lächelte bittersüß und sandte ihm eine obszöne Geste hinterher. Was wusste er schon, dieser Einfaltspinsel. Der Fensterheber seines Mercedes 190 SL hatte mehr Stil als die gesamte langweilige Angeber-Karosse dieses Großmauls, die er sich von der Firma bezahlen ließ. Was wusste er denn davon, was es für ein Hochgefühl war, mit dem offenen Verdeck durch die Landschaft zu fahren, die Sonne, den Wind zu spüren, den Duft der Jahreszeiten einzusaugen? Richter hatte keine Ahnung davon, wie gut es Morten tat, wenn sich die Köpfe nach ihm umdrehten, wenn er durch die Innenstadt brauste. Und er hatte nicht den blassesten Schimmer, wie sehr seine Anziehungskraft auf Frauen gewonnen hatte, seit er dieses Auto besaß. Leider gab es auch Neider, die es offenbar nicht ertragen konnten, dass andere sich den Luxus eines mobilen Schmuckstücks gönnten. Die ihrer Zerstörungswut Raum gaben, die sie am Eigentum anderer ausließen. Erst vor wenigen Wochen waren alle vier Reifen an seinem Wagen zerstochen und die Seiten zerkratzt worden. Allein die Lackierung hatte mehrere Tausend Euro gekostet. Summen, die zum Glück von der Versicherung übernommen worden waren.
»Von wegen ›Lange Comedy-Nacht‹. Die kannst du selbst anschauen, du selbstgefälliger Trottel. Ich hab was viel Besseres vor«, murmelte Nadler. Er zog sein Smartphone hervor und prüfte die eingegangenen Nachrichten. Kira hatte ihm ein Foto geschickt, das sie in verführerischen Dessous zeigte. »Ich freue mich auf unser Wochenende«, lautete der Text darunter, der mit einem Kuss-Smiley schloss.
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, du kleine Hexe«, raunte Nadler. Er beeilte sich, seine Sachen zusammenzupacken, und verließ grußlos das Büro. Eine Frau wie Kira ließ man nicht warten.
»Jetzt sieh dir das an. Sie hat es schon wieder getan.«
Yoselin hielt kurz in ihrer Bewegung inne, um den bislang gelungenen Kayalstrich nicht zu gefährden. Sie zog ihrem Spiegelbild eine Grimasse.
»Was ist denn los?«, erkundigte sie sich lautstark. Die Tür zum Badezimmer flog auf und ihre aufgebrachte Mutter schoss herein, in den Händen einen Blumentopf, aus dem kahle Stiele ragten. »Deine Großmutter hat schon wieder die gesamte Kapuzinerkresse abgeerntet.«
Judith Blaichs Lippen bebten, als sie ihr den Trog mit den Pflanzenresten entgegenhielt. »Die blüht doch immer so schön und jetzt ist sie hin.«
Yoselin legte ihrer Mutter tröstend eine Hand auf die Schulter. »Ich kaufe dir eine neue Pflanze. Schöner, größer, bunter. Und am besten eine, die sich gegen das unbefugte Abernten wehrt. Indem sie Oma in den Finger beißt, sollte sie sich ihr nähern.« Yoselin lächelte, konnte jedoch die Stimmung ihrer Mutter nicht heben. Im Gegenteil.
»Immer wieder vergreift sie sich an meinen Dingen«, schluchzte Judith Blaich. »Ich bin wirklich froh, wenn sie wieder nach Jamaika fliegt. Dann haben wir unsere Ruhe.«
Yoselin umarmte die Unglückliche und drückte sie an sich. Zugegeben, ihre Großmutter Lourdes nervte zuweilen, wenn sie ihre schamanischen Rituale zelebrierte und dazu Dinge aus ihrem häuslichen Umfeld zur Zutat erklärte. Oft genügte es nicht, eine Zimmerpflanze zu entlauben. Je nachdem, welches Unheil oder welche Krankheit es abzuwenden oder zu vertreiben galt, waren auch Tiere des Gartens in Gefahr. Die Katze der alten Frau Schneider hatte bereits drei Schnurrhaare verloren, weil Lourdes’ Zaubertrank ohne diese Ingredienz keine Wirkung entfalten konnte. Vögel trauten sich schon lange nicht mehr in die Nähe der Greisin, und so wie es schien, hatten auch Insekten einen lebenserhaltenden Instinkt. Dennoch: Wenn ihre Großmutter bei ihnen wohnte, war die Stimmung in der Drei-Generationen-WG eine andere. Unterhaltsam, voller Energie und Überraschungen und auch viel witziger, wenn man das Tun der Großmutter mit heiterer Gelassenheit nahm. Was im Grunde nur Yoselin gelang.
Alle sechs Monate musste die alte Dame nach Jamaika zurück, weil sie nur ein Touristen-Visum besaß. Und in dieser Zeit war Yoselin den Launen ihrer Mutter ausgesetzt. Oft lag zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt nur der Bruchteil einer Sekunde, an manchen Tagen war das Gejammer über die Verdorbenheit der Welt und die Beschränktheit der Männer, die sich für alles interessierten, nur nicht für Judith Blaich, nicht zu ertragen. Oft hatte Yoselin sich gefragt, ob es nicht besser wäre, eine eigene Wohnung zu suchen, aber irgendwie schöpfte sie auch Kraft aus der ungewohnten Konstellation. Großmutter Lourdes, die Schamanin, Judith, ihre stetig nach der großen Liebe suchende Mutter und sie, Yoselin, die einzige schwarze – sie hätte ihre Hautfarbe eher mit »hellem Nougat« angegeben – Hauptkommissarin Oberschwabens. Größere Unterschiede in Lebensführung und Philosophie konnte es kaum geben, und doch funktionierte das Zusammenleben, bis auf wenige Ausnahmen, ganz gut.
Judith befreite sich aus der Umarmung und musterte ihre Tochter. »Du bist geschminkt. Gehst du aus?«
»Ja. Ins ›Slainte‹. Da ist heute Pub-Quiz und im Anschluss Schlager-Karaoke. ›Ein Bett im Kornfeld …‹«
Judith gab ihrer Tochter einen Klaps auf die Schultern, um ihren Gesang des bekannten Schlagers zu unterbinden. Yoselin mochte einige Talente besitzen, das Singen gehörte nicht dazu. Was sie jedoch nicht davon abhielt, es oft und lautstark zu tun.
Aber einen Abend im Pub konnte sich Judith offenbar vorstellen. »Oh, im ›Slainte‹ war ich ja auch länger nicht mehr. Die haben da so einen hübschen Burschen am Ausschank. Vielleicht komme ich mit?«
Yoselin dachte nicht daran, mit ihrer Mutter einen Abend im Pub zu verbringen, daher zögerte sie nicht, ihren Trumpf auszuspielen. »Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das willst. Ich treffe mich nämlich mit Konstantin und Betty.«
Ihre Mutter verzog das Gesicht. »Mit dem Spinner und der roten Socke? Oh mein Gott. Nee, da bleib ich lieber zu Hause.«
»Konstantin ist kein Spinner. Er hat halt ein eher wissenschaftliches Interesse am Leben. Und weiß demnach viel. Ich mag ihn. Und Betty auch. Ihre Ansichten mögen manchmal ein wenig schräg sein, aber sie hat immer etwas zu erzählen«, fauchte Yoselin und drehte sich dem Spiegel zu. Sie mochte es nicht, wenn ihre Mutter despektierlich über ihre Freunde sprach. Konstantin war ein Tüftler, ein Nerd, ein Wissenshungriger in Sachen Künstliche Intelligenz. Derzeit arbeitete er an einer Lösung, medizinische Pflegedienste zu entlasten: durch den Einsatz von Robotern. Er hatte einen Algorithmus entwickelt, der effiziente Dienstpläne für Krankenhäuser erstellte. Und so wie es aussah, war die Geschäftsführung des St. Elisabethen-Klinikums in Ravensburg sehr interessiert an seinen Ideen. Klar gab es auch die andere Seite, wenn er Dinge in Angriff nahm, die für Außenstehende abstrus anmuteten. Seine Nachbarn hatten zum Beispiel kein Verständnis für seinen Rasenmäher-Roboter aufgebracht, der wie eine Schildkröte aussah, sich allerdings in rasender Geschwindigkeit über Stock und Stein hinwegbewegte und sich alles einverleibte, was der gefräßige Schnabel erreichen konnte. Zwischen Gras, Blumen und Menschenbein unterschied das Gerät nicht, wie Konstantin bereits mehrfach schmerzhaft hatte erfahren müssen.
Betty war aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Sie war lebendig, friedensbewegt, im Auftrag von Umwelt- und Klimaschutz unterwegs, ging keinem Streit aus dem Weg. Mit ihr konnte man Pferde stehlen, sie war für jeden Unfug zu haben, was ihr als Realschullehrerin so manchen Ärger eingebracht hatte. Das machte sie vor allem bei den Schülerinnen und Schülern beliebt, die im Unterricht verhaltensauffällig waren, denn die versuchten die eigenen Untaten durch den Hinweis auf die schrille Paukerin zu rechtfertigen. Yoselin kannte die beiden seit der Schulzeit. Damals war Konstantin noch ein unförmiger Junge mit Brille und Zahnspange gewesen, der von den anderen Kindern ebenso gemieden wurde wie sie selbst. Betty wiederum war die schlecht gelaunte Punkerin gewesen, der sich Mitmenschen nur behutsam näherten. Hätte Yoselin nicht den ersten Schritt getan und die beiden angesprochen, wäre die Freundschaft sicher nicht entstanden. Betty und Konstantin hatten ihre Art gefunden, mit ihren Sonderlingsstellungen umzugehen. Konstantin schien es überhaupt nicht zu interessieren, was die anderen von ihm dachten. Es war, als würde er es noch nicht einmal bemerken, dass über ihn gelacht und gespottet wurde. Er saß in den Pausen in der hintersten Ecke des Schulhofs und war immer mit etwas beschäftigt. Mal schrieb er etwas in ein Notizbuch, mal zeichnete er eine Art Plan auf den Asphalt, dann wieder bastelte er Modelle aus Papier. Flugzeuge, Schiffe, Maschinen, Weltraumfahrzeuge, Autos, Motoren, Roboter und vieles mehr. Er war der erste Schüler in seiner Jahrgangsstufe, der Spiele am Computer programmieren konnte, und das in einer Zeit, in der behauptet wurde, Computer würden sich nicht durchsetzen. Den alten Kassettenrekorder seines Vaters hatte er zu seinem ureigenen Walkman umgebaut, der zwar sehr viel klobiger war als die Modelle, die es zu kaufen gab, aber funktionsfähig. Selbst vor der Elektronik, mit der die Schulglocke gesteuert wurde, machte er nicht halt. Er arrangierte, dass die Unterrichtseinheiten bereits nach 30 Minuten durch das Pausensignal beendet wurden. Sehr zur Freude der Schülerschaft, sehr zum Leid des Hausmeisters, dem dafür die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Von diesen Fähigkeiten war selbst Betty beeindruckt gewesen. Und so war ein unschlagbares Trio entstanden: der Freak, die Punquette und die Schwarze, die nicht selten das böse N-Wort zu hören bekam – die Parias des Albert-Einstein-Gymnasiums waren geboren.
»Als Frau in deiner Position könntest du wirklich etwas anspruchsvoller in der Auswahl deiner Freunde sein«, sagte ihre Mutter und entfernte sich.
»Mal sehen, vielleicht reiße ich heute einen auf, der dir gefällt. Es sei denn, Betty ist schneller!«, rief ihr Yoselin hinterher.
Sie wusste, wie sehr ihre Mutter unter der Tatsache litt, keinen Partner an ihrer Seite zu haben. Sie hatte kein glückliches Händchen in der Männerwahl. Bereits die erste große Liebe hatte im Desaster geendet: Am Hotelstrand in Ocho Rios lernte die damals frischgebackene Abiturientin Judith den jamaikanischen Surflehrer Buster Lee kennen und verliebte sich in den zehn Jahre älteren Mann. Und er erwiderte diese Liebe. Er entführte sie auf eine rosarote Wolke, überschüttete sie mit Zärtlichkeit und Zuneigung und schwor, dass diese Liebe für die Ewigkeit geschaffen war. Das hätte funktionieren können, wenn die junge Judith bereit gewesen wäre, den Preis für diese Liebe zu bezahlen. Buster liebte sie, aber er liebte sein Leben noch viel mehr. Pferdewetten, sich mit Freunden betrinken, Ganja rauchen und Musik machen waren für ihn mindestens ebenso wichtig wie das »deutsche Fraulein«. Und er blieb auch keinem weiteren Flirt abgeneigt, schließlich lebte er von den Trinkgeldern der überwiegend weiblichen Kundschaft.
In ihrer Verzweiflung wandte sich Judith an Busters Mutter Lourdes, die sofort sah, was mit dem bleichen Mädchen mit den rot geweinten Augen los war. Ihr Sohn, den sie für einen furchtbar faulen Tunichtgut hielt, der nicht einmal ein Huhn schlachten, geschweige denn eine Hütte bauen konnte, hatte der jungen Frau komplett den Kopf verdreht. Sie musste ihr die Wahrheit sagen: Judith erfuhr, dass Buster bereits zwei Kinder von zwei Frauen hatte und sich nicht im Geringsten darum scherte. Die Mütter bekamen ein wenig Geld von ihm, als könnte er sich damit von der Verantwortung freikaufen. Als Vater war er ein Komplettausfall, als Ehemann sowieso.
Geläutert und frustriert kehrte Judith nach Ravensburg zurück, allerdings nicht allein. Als die morgendliche Übelkeit nicht verschwinden wollte und die Monatsblutung ausblieb, ging sie zum Arzt und bekam die Bestätigung für ihren Verdacht: Sie war im dritten Monat schwanger. Sie schrieb Briefe an Buster, wollte sich ihm mitteilen, ihn zu sich locken, doch Antwort bekam sie von Lourdes, die im Gegensatz zu ihrem Sohn ein großes Interesse hatte, nach Deutschland zu kommen und ihre Enkeltochter kennenzulernen.
Yoselin war der Überzeugung, dass ihre Mutter die Partnersuche zu verkrampft anging. Judith war eine attraktive Frau, die sich etwas zu grell schminkte und zu jugendlich kleidete. Sie war am Zeitgeschehen interessiert, noch mehr allerdings an der Glitzerwelt der Stars und Sternchen, konnte grandios kochen und machte den besten Kartoffelsalat der Welt. Gut, sie redete womöglich etwas zu viel, vor allem wenn sie aufgeregt war, und hatte zuweilen sehr konservative Ansichten. Aber das waren sicherlich keine Gründe dafür, dass sie bei den ganzen Flirtportalen und Singlebörsen, bei denen sie sich angemeldet hatte, nur die seltsamsten Vögel an Land zog. Es lag an Judith selbst und ihrem immer stärker werdenden Bedürfnis, geliebt zu werden. Offenbar war ihr da jeder recht, der es verstand, ein Kompliment zu machen. Es war sehr einfach, Judiths Herz zu entflammen, und ebenso einfach, sie zu enttäuschen.
Yoselin überprüfte ihr Make-up, fuhr mit einer Hand durch die blond gefärbten krausen Haare, drehte sich noch einmal in alle Richtungen und befand, dass sie gut aussah. Der Abend konnte kommen.
Begegnung
Warten. Er hasste dieses zähe Dahinschleichen der Zeit, dieses untätige Verharren. Aber die Dunkelheit war seine Verbündete, bot ihm Schutz, ohne sie ging es nicht. Und sie meinte es gut mit ihm und seinem Vorhaben, indem sie ihm eine sternlose Nacht schenkte. Er verließ das Fahrzeug, das er am Ende des Grundstücks geparkt hatte, machte seine Armee bereit, verstaute sie in seinem Rucksack und sah sich um. Die Straße war menschenleer, in einigen Fenstern der angrenzenden Häuser brannte Licht, hin und wieder mischte sich das bläuliche Flackern von Fernsehbildschirmen hinzu. Nahezu kein Geräusch war zu hören. Nur das sanfte Schmatzen, wenn eine Welle das Ufer des Sees küsste.
Er hatte Geschmack, das musste man ihm lassen. Er wusste zu leben. Ließ es sich etwas kosten. Eine Villa am Ufer des Bodensees, nicht weit vom Zentrum Überlingens entfernt und doch abgeschieden genug, um das Wochenende ungestört genießen zu können. Ein schönes Auto. Bestimmt nicht billig. Womöglich nicht das einzige. Und mit Sicherheit besaß er auch andere kostspielige Dinge. Um damit zu prahlen. Um andere von sich einzunehmen. Um Frauen kennenzulernen. Um sie zu benutzen, sie auszunutzen. Um sie nach kurzer Zeit wegzuwerfen wie einen unnütz gewordenen Gegenstand.
Sein Atem ging schnell, er hörte seinen Magen rumoren. Das Grundstück war durch eine hohe Hecke und einen Maschendrahtzaun geschützt, aber seine Vorbereitungen hatten ergeben, dass es eine Stelle im ansonsten dichten Buschwerk gab, die es ermöglichte, den Draht zu durchtrennen. Er schob die Äste geräuschlos auseinander und schlüpfte durch die Lücke. Im Schatten der großen Bäume schlich er zum Haus. Ein fahler Lichtschein beleuchtete die Terrasse, leise Musik drang an sein Ohr. Es war die Art von Musik, die in Filmen erotische Szenen einleitete. Seicht, zu viele Streicher, eine sonore Männerstimme. Die Schiebetür zur Wohnung stand offen. Leichtes Spiel für ihn und seine Armee.
In der Nähe wurde eine Tür zugeschlagen, ein Motor angelassen, ein Fahrzeug entfernte sich. Er zögerte einen Moment, duckte sich, hielt den Atem an und lauschte. Minutenlang blieb er in dieser kauernden Stellung, bis er das Ausbleiben weiterer Geräusche zum Anlass nahm fortzufahren.
Er stellte seinen Rucksack ab, reihte die Soldaten vor sich auf und entnahm das Feuerzeug. Er drehte am Zündrad, betrachtete die Flamme und hielt sie dann an die Lunte seines ersten Geschosses. Es war, als würde ein Staffelstab übergeben, ein feierlicher Augenblick.
Dem ersten Krieger sah er noch nach, beobachtete, wie sich seine zerstörerische Kraft in den Raum hineinfraß. Das Feuer hatte etwas Magisches an sich, setzte Erinnerungen frei. An Situationen, die weit zurücklagen, emotionsgeladene Momente, in denen er so etwas wie Glück verspürt hatte. Er lächelte, dann schickte er seine gesamte Armee los, um das Gebäude zu erobern und es in Schutt und Asche zu verwandeln.
Das »Slainte« in der Eichelstraße war gut besucht. Überwiegend junge Menschen saßen an den Tischen, tranken und lachten oder genossen die herzhaften Speisen. Yoselin, Betty und Konstantin hatten es zu ihrer Tradition gemacht, in dem Irish Pub Burger zu bestellen. Betty, die sich auch als Tierschützerin verstand, wurde nicht müde, den beiden das Mahl wortreich zu vermiesen, konzentrierte sich jedoch irgendwann auf ihre Soja-Bowl und beließ es dabei, mürrisch dreinzublicken. Während Yoselin und Betty sich ein Guinness dazu genehmigten, trank Konstantin stets eine Holunder-Schorle. Er lehnte alle Substanzen ab, die seinen Verstand auch nur eine Sekunde beeinträchtigen könnten. Womöglich war der Eintritt in seine Gedankenwelt aphrodisierend genug. Wenn er über das referierte, was ihn beschäftigte, dann verwandelte er sich in einen Menschen, der von innen leuchtete. Eben sprach er von den Vor- und Nachteilen von »autonomen Fahrzeugen«, Autos, die imstande waren, ohne Fahrzeuglenker auszukommen, und unterbrach seinen Redeschwall durch ein hingeworfenes Wort, das in keinem Zusammenhang zum bisher Gesagten stand.
»Anatidaephobie!«
»Was?«
Yoselin blickte Betty an, die mit den Schultern zuckte.
»Die Angst davor, von Enten beobachtet zu werden, heißt Anatidaephobie.«
»Und die bekommt man in selbstfahrenden Fahrzeugen?«, fragte Yoselin.
»Quatsch, der Quizmaster hat danach gefragt.«
»Oh Mann!«, murrte Betty und schüttelte den Kopf.
Yoselin lachte. »Wer immer noch behauptet, dass Männer nicht multitaskingfähig sind, der hat dich noch nicht kennengelernt. Ich habe die Frage gar nicht gehört.«
»Das beweist, dass du mir zugehört hast. Das mag ich so an dir. Es gibt nicht viele Menschen, die das freiwillig tun.«
Konstantin ergriff sein leeres Glas und prostete seinen Begleiterinnen zu.
»Und es gibt nur einen, der über diffizile Sachverhalte sprechen und gleichzeitig an einem Quiz teilnehmen kann. Du bist ein Phänomen. Ich hole uns etwas zu trinken. Betty, noch ein Guinness?«
»Unbedingt, der Kerl hier ist nur besoffen zu ertragen.« Sie gab Konstantin einen Stoß und lachte dröhnend.
Yoselin stand auf und ging hinüber an den Tresen, hinter dem Steven stand und Bier zapfte. Ihre Mutter hatte recht. Der Mittdreißiger mit der drahtigen Figur, die sich unter seinem Motörhead-T-Shirt abzeichnete, fiel durchaus in die Kategorie »sexy«. Sein Bart war eine Nuance zu lang und das kleine Büschel, das von einem Haargummi umschlungen vom Hinterkopf abstand, hätte es nach Yoselins Geschmack auch nicht gebraucht, aber dies ließ sich mittels einer Schere leicht korrigieren. Sie gab Steven ein Zeichen, wies auf ihre Gläser, der Barkeeper nickte und bereitete die Getränke zu.
Ein junger Mann war neben Yoselin getreten und fixierte sie. Die Hauptkommissarin wusste, dass er auf ein Zeichen von ihr wartete, einen Blick oder ein Lächeln, um ein Gespräch zu beginnen. Darauf hatte sie aber im Moment keine Lust, sie beobachtete lieber Steven, der mit eleganten Bewegungen seinem Job nachkam. Der Typ neben ihr räusperte sich, reflexartig wandte ihm Yoselin das Gesicht zu. Sie erntete ein selbstgefälliges Lächeln.
»Hi, bisch du neu hier? Wo kommsch her?«
Yoselin sah den jungen Mann, der sich neben sie an die Theke gesetzt hatte, fragend an.
»Nee, bin nicht neu. Ich komme aus Ravensburg. Wieso?«
Der Typ strich sich mit einer Hand eine Strähne aus der Stirn und lachte.
»Noi, so ursprünglich. Von wo stammsch du ab?«
Yoselin verschränkte die Arme vor der Brust. Diese Art von Gespräch hatte sie Tausende von Malen geführt. Klar, sie fiel durch ihre Hautfarbe auf, vielleicht machte dies auch neugierig, und manche hielten diese Frage nach ihrer Herkunft für einen geistreichen Gesprächsauftakt, aber inzwischen war sie es leid, dass sie in einer Multikulti-Gesellschaft immer noch gestellt wurde. Auch wenn sie nicht diskriminierend gemeint war. In ihrem 35-jährigen Leben hatte sie jede Form von Alltagsrassismus erlebt, sodass sie nichts mehr schocken konnte. Sie hatte sich an Begriffe wie »dunkelhäutig«, »farbig« gewöhnt, hatte die seltsame Diskussion mit Leuten ausgehalten, die ihr vorschreiben wollten, sich selbst als »schwarz« zu bezeichnen oder als Angehörige der »People of Color«. Wer legte solche Prinzipien fest und war diese Aneignung der Rolle als Kümmerer nicht auch eine Art der Missachtung von Menschen und Kulturen? Konnte sie nicht einfach nur als Mensch gesehen werden, der genauso individuell mit Stärken und Schwächen ausgestattet war wie alle anderen auch? Sie sah ihrem Gegenüber in die Augen. Der Typ schielte leicht, war eindeutig zu besoffen für Grundsatzdiskussionen, zudem wollte sich Yoselin nicht den Abend verderben.
»Ich stamme von meinen Eltern ab. Und zumindest meine Mutter kommt aus Ravensburg.«
»Ah, aber dein Vadder kommt von wo andersch her.« Der Typ nickte, als hätte er das größte Rätsel des Universums gelöst. Yoselin schnaubte, bezahlte ihre Getränke und wollte zu ihrem Platz zurückgehen, doch der junge Mann rückte nahe an sie heran.
»Jetzt sag halt. Wo kommt dein Alter her? I mog’s exotisch.«
Die Hauptkommissarin hätte ihm gern ihr Guinness ins Gesicht geschüttet, doch sie war Schwäbin genug, es nicht zu tun. Schließlich war das Getränk schon bezahlt.
»Mein Vater kommt aus dem Schwarzwald«, raunte sie ihrem Nebenmann in verschwörerischem Tonfall zu. »Und er gehört zu der Generation, auf die das Umfeld enorm abfärbt. Wenn sich so einer fortpflanzt …«
Sie wies auf sich und nickte.
Der Typ sah sie unsicher an, dann fiel der Groschen. Seinem Mienenspiel nach zu urteilen, wusste er nicht, ob er lachen oder sich ärgern sollte. »Ah so, des war an Witz. Okay, aber mr wird ja mol froga dirfa«, knurrte er und wandte sich ab.
»Fragen darf man«, erwiderte Yoselin. »Aber man muss dann auch mit einer Antwort rechnen.«
Wenig später, sie hatte gerade Platz genommen und einen Schluck ihres Bieres genommen, klingelte ihr Smartphone. Sie betrachtete das Display, das den Namen ihres Kollegen Norman Säger anzeigte. Sie stöhnte und nahm ab. »Herr Säger, Sie stören. Gleich geht die Karaoke-Sause los.«
Ihr Lächeln gefror. Sie lauschte den Ausführungen des Hauptkommissars, nickte stumm und schloss das Gespräch mit »Okay, ich mache mich auf den Weg«.
Konstantin und Betty sahen sie fragend an.
»Tut mir leid. Meinen großen Auftritt als Schlagerqueen werde ich heute versäumen. Ich muss los. In Überlingen-Nußdorf ist eine Villa abgebrannt. Und so wie es aussieht, hat es eine Bewohnerin nicht überlebt. Mein Kollege ist schon vor Ort.«
»Soll ich dich hinbringen?«, fragte Konstantin. »Ich habe sonst nichts weiter vor. Karaoke ist ja eh nicht so mein Ding und Betty scheint schon eine andere Gesprächspartnerin im Visier zu haben.« Er deutete auf die gemeinsame Freundin, die eine große blonde Frau in einem schwarzen Overall antänzelte.
Yoselin strahlte ihn an. »Das wäre natürlich super. Aber nur, wenn du selbst am Steuer sitzt und nicht eine Künstliche Intelligenz. Obwohl ich gar nicht sicher bin, was die bessere Alternative ist …«
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr standen kurz davor abzurücken, als Yoselin am Tatort ankam. Die Schläuche wurden zusammengerollt, Ausrüstung wurde in die Löschfahrzeuge verstaut. Die Enttäuschung, weder das Gebäude noch die Bewohnerin gerettet zu haben, war den erschöpften Gesichtern der Männer anzusehen. Yoselin kannte das Gefühl, das einen beschlich, wenn man alles gegeben hatte und die große Katastrophe doch nicht verhindern konnte. So etwas wirkte nach, kostete Schlaf, bescherte schlechte Träume.
Sie verabschiedete Konstantin, stieg aus dem Wagen, ließ die Absperrung hinter sich und schritt auf das Gemäuer zu, das einst zu den beeindruckendsten Gebäuden am Bodensee gehört hatte. Nun atmete es den aschig-muffigen Hauch der Zerstörung aus. Sie entdeckte ihren Kollegen Norman Säger, der von vielen »Nerven-Säger« genannt wurde, wohl wegen seiner unnachgiebigen Art, sich in Fälle zu vertiefen und unbequeme Fragen zu stellen. Im Moment stakste er in seiner individuellen Gangart, die an einen Fischreiher erinnerte, durch das, was mal das Wohnzimmer gewesen sein musste, und wurde vom Chef der Spurensicherer dafür ruppig zurechtgewiesen. Säger ließ sich dadurch nicht beirren, sah sich gründlich um und fertigte Notizen an. Yoselin drückte sich an den Kollegen von der Spurensicherung vorbei, bahnte sich einen Weg durch die verkohlten Reste der Inneneinrichtung. Auch wenn sie keine Expertin war, erkannte sie, dass hier Millionenwerte durch das Feuer und das Löschwasser vernichtet worden waren.
»Das sieht gar nicht gut aus, was?«, sagte sie, als sie ihren Kollegen erreicht hatte.
»Falls Ihre Bemerkung einen Hauch von Ironie enthielt, darf ich Ihnen vergewissern, dass ich sie bemerkt habe. Von ›gar nicht gut‹ kann im Zusammenhang mit dem Zustand des Gebäudes nicht gesprochen werden. Es wäre durchaus angemessen, es als eine Katastrophe zu bezeichnen.«
Säger sah sie streng an. Yoselin fühlte sich, als wäre sie beim verbotenen Griff in die Zuckerdose erwischt worden. Die schulmeisterliche Art ihres Kollegen flößte ihr zuweilen Respekt ein.
»Entschuldigung. Natürlich ist es eine Katastrophe. Was haben wir?«
Er blätterte in seinem Notizbuch und las vor. »Es liegt eindeutig Brandstiftung vor. Wir haben die Reste von mehreren Brandkörpern gefunden, die unter der landläufigen Bezeichnung ›Molotowcocktail‹ bekannt sind. Sie wurden durch die Terrassentür geworfen, die offen stand. Als die ersten Fenster aufgrund der hohen Temperaturentwicklung geplatzt sind, hat das eine sogenannte Kaminwirkung ausgelöst. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Keine Chance zu entkommen.«
»Wem gehört das Haus?«
»Die Villa gehört einem gewissen Georg von Rechberg, der in Stuttgart ein Immobilienunternehmen führt. Mit großem Erfolg, allerdings hat die Firma ein Imageproblem. Ich sage nur Gentrifizierung. Das kommt bei vielen Menschen nicht gut an. Vor allem nicht, wenn sie betroffen sind.«
Säger schnaubte, was bei ihm als Höchstmaß der Empörung einzuordnen war.
»Das heißt, er kauft Gebäude auf, saniert sie und vermietet die Wohnungen dann zu einem horrenden Preis. Vielleicht will sich hier ein Mieter rächen? Oder jemand, der durch seine Sanierungen sein Obdach verloren hat.«
Säger zuckte mit den Schultern. »Da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Wenn man den einschlägigen Zeitungsberichten glauben darf, ist von Rechberg ein ziemlich abgebrühter Zeitgenosse. Und er hängt offensichtlich nicht allzu sehr an dieser Villa. Er hat eine ansässige Agentur damit beauftragt, sie an Urlauber zu vermieten. Um sich zu rächen, hätte die Täterin oder der Täter ein anderes Objekt ins Visier nehmen müssen. Eines, das ihm am Herzen liegt.«
»Unglaublich, was Sie alles in der Kürze der Zeit herausgefunden haben. Wie machen Sie das nur?«, fragte Yoselin.
Säger zuckte die Schultern. »Ich habe eben Kontakte und stelle die richtigen Fragen. Das nennt man auch Effizienz.«
Yoselin rollte mit den Augen. Den letzten Satz hätte sich ihr Kollege getrost schenken können, Selbstgefälligkeit stand ihm so gar nicht.
Sie sah sich um. Der Raum, in dem sie sich befand, war großzügig geschnitten, und auch wenn die Inneneinrichtung kaum mehr zu erkennen war, konnte sie ihren Wert erahnen. Das Wohnzimmer grenzte direkt an die Terrasse. Der See war nur wenige Meter entfernt, sein silberner Glanz hatte fast etwas Versöhnliches. »Die Urlaubsgäste, die hierherkommen, müssen sehr wohlhabend sein. So ein Domizil kostet doch sicher ein Vermögen. Wer kann sich so etwas leisten?«
Hauptkommissar Säger nickte in die Richtung, in der ein Rettungssanitäter neben einem in Decken gehüllten Mann stand. Dieser war ungewöhnlich blass und zitterte.
»Wer ist das?«, erkundigte sich Yoselin.