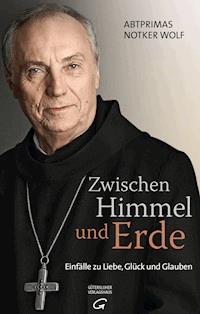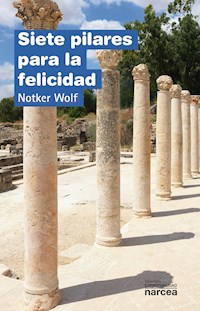Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Wir haben alles. Nur keine Zeit. Kann man das Leben entschleunigen? Kann man. Dafür sollte man jeden Tag nach einer einfachen Maxime leben: Zeit ist kostbar. Wie das geht und wie viel Spaß es macht, wie sehr das Leben an Qualität und Tiefe gewinnt, das zeigt Notker Wolf. Wer ihn traf, war überrascht: von seiner Präsenz, von seiner Leidenschaft, den Moment zu leben. Er war – von Korea bis Afrika, von New York bis Jakarta – das ganze Jahr weltweit unterwegs als Oberhaupt eines globalen Ordens. Sein Rat war gesucht bei Wirtschaftsbossen und Politikern. Was gab ihm Kraft? In diesem faszinierend persönlichen Buch spricht er über den Zusammenhang von Zeit und Sinn: Zeit ist Leben. Leben braucht Zeit. Ein Buch der Lebenskunst, der Lebensfreude und der Spiritualität. »Wer in der Gegenwart lebt und die Zeit aushält, der muss nicht mehr hetzen. Der ist einfach schon da.« (Notker Wolf)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Notker Wolf
Gönn dir Zeit. Es ist dein Leben
Herausgegeben von Rudolf Walter
Neuausgabe 2024
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2009
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Bundes.
Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal, Rosenheim
Umschlagmotiv: © Notker Wolf
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN E-Book 978-3-451-83570-4
ISBN Print 978-3-451-03497-8
Inhalt
Vorwort
1 Zur Freude geboren
2 Die große Frage
3 Sinn und Grenzen der Arbeit
4 Aussteigen geht nicht
5 Geschwindigkeit und Tempo des Lebens
6 Den Druck herausnehmen
7 Aus der Pause kommt die Kraft
8 Jeder Augenblick ist heilig
9 Das Zeitmaß der Mönche
10 Herzschlag des Lebens
11 Der Schatz des Sonntags
12 Hetzen, Schreiten, Zeit vertreiben
13 Ganz da sein – Kern der Meditation
14 Präsenz: Glück ist, wenn die Zeit still steht
15 Der rechte Augenblick
16 Vom Warten, von der Ungeduld und der Geduld
17 Wenn die Zeit zur Hölle wird
18 Eulen und Lerchen
19 Vertane und vertrödelte Zeit
20 Rituale – so viel Zeit muss sein
21 Zeit zum Träumen, Zeit zu wachsen
22 Werte – Haltungen auf Dauer
23 Dankbar – jeden Tag
24 Das Zeitliche segnen
Vorwort
Kürzlich, am Flughafen in Rom, schob mir bei der Abfertigung nach Santo Domingo und Guatemala eine junge Frau die Reiseunterlagen zu und schaute mich an. Dann sagte sie ungläubig: „Sie sind ja mehr in der Luft als ein Pilot!“ Und in der Tat: Ich lege im Jahr unglaublich viele Meilen zurück.
In den zehn Tagen meiner Reise nach Santo Domingo und Guatemala saß ich sicher allein drei volle Tage im Flieger. Fast jeden Tag kamen im Auto zwei bis vier Stunden dazu, in denen ich unterwegs war.
Meine mobile Existenz mag extrem wirken. Sie liegt aber im Trend. Das hängt mit der größeren Mobilität und Vernetzung unserer Welt zusammen. Und natürlich mit meiner Aufgabe: Als Abtprimas bin ich Ansprechpartner für 800 Klöster, weltweit, auf allen Kontinenten. Um meinen Aufgaben nachzukommen, muss ich zeitweise das Leben eines Managers leben mit unwahrscheinlich vielen Terminen. Und auf der anderen Seite lebe ich als Mönch in einem Zeitmaß, das von einer ganz anderen Ordnung her bestimmt ist.
Die Frage, die viele Menschen heute umtreibt, bewegt auch mich: Kann man in dem ganzen Stress, inmitten all der modernen Hektik noch Ruhe finden? Wie kann man in all dem Druck, der von außen auf einen einstürmt, noch Souverän seiner eigenen Zeit sein?
Ein internationaler Manager, der kürzlich im Flieger neben mir saß, sagte mir: „Sie strahlen eine solche Ruhe aus und dabei geht’s Ihnen doch im Grunde genommen genauso wie uns. Wie machen Sie das?“
Diese Frage stand auch am Anfang dieses Buches. Und dahinter war die Idee: Es könnte interessant sein, Erfahrungen und Gedanken gerade von jemandem zu lesen, der ebenfalls großem Zeitdruck ausgesetzt zu sein scheint.
Manche, die gehört haben, dass ich darüber schreibe, haben mit einer leichten Ironie nachgefragt, ob ich mir dieses Buch selber erst einmal zur Brust nehmen werde. Ich habe ihnen geantwortet: Ich glaube, dass mich nicht nur eine gemeinsame Not mit den anderen Menschen verbindet – sondern auch eine Suche danach, wie wir mit dieser Not leben können. Nicht zuletzt glaube ich aber, dass die Tradition, aus der ich lebe, gute Hinweise dafür gibt.
Viele Menschen, nicht nur Manager, leiden heute darunter, dass sie immer weniger Zeit haben für das, was wirklich wesentlich ist. Zeit für sich selbst – das scheint zum knappen Luxusgut zu werden.
„Meine Zeit“ ist es, mit anderen zu sein oder frei zu sein für das Gebet. Ich kann Arbeit einfach stehen lassen. Das scheint mir sehr wichtig: Dinge auch einfach einmal stehen zu lassen und zu sagen, jetzt ist anderes wichtig. Beim Gebet ist es Gott, beim Gespräch ist es der andere Mensch.
Die Weisheit des biblischen Kohelet ist uralt und doch immer noch sprichwörtlich wahr: „Alles im Leben hat seine Zeit.“ Es gibt eine Zeit der Freude, und es gibt eine Zeit der Trauer. Wer so unter Zeitdruck steht, dass sich das Herz nicht mehr lösen kann, um zu weinen, der ist schlimm dran. Und auch wer nicht mehr von Herzen lachen kann, ist verloren.
Diese Weisheit des alttestamentlichen Predigers ist für mich immer wieder ein Orientierungspunkt. Natürlich kann ich die Phasen nicht so voneinander trennen wie ich es gerne hätte. Sie werden sich überlappen. Aber es geht dabei auch nicht um die Maßeinheit der objektiven Zeit, die gesplittet werden müsste. Es geht darum, dass die Zeit vermenschlicht werden muss.
Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin oder in einem Gespräch, dann ist das eine ganz andere Zeit, als wenn ich ausrechne, wie viele E-Mails ich in einer Stunde erledigen soll. Und wenn ein anderer zu mir zum Gespräch kommt, dann schaue ich nicht auf die Uhr und es gibt keine Hetze. Dann ist er da. Es ist seine Zeit. Dasselbe gilt noch mehr beim Gebet. Da bekommt die Zeit nicht nur eine menschliche, sondern geradezu eine göttliche Dimension.
Auch Jesus ist mir ein Vorbild in der Kunst, mit der Zeit gut umzugehen. Er hat immer wieder die Einsamkeit gesucht für das Gebet. Und wenn er mit seinen Jüngern am See Genezareth entlang gewandert ist, dann hatte er Zeit nur für sie. Die Erzählung vom Gang nach Emmaus schildert einen solchen Moment seiner Präsenz für Menschen, die ihm nahe waren und ihm ihre Sorgen mitteilten. Aber auch die Jünger mussten gelegentlich zurückstehen, wenn andere Menschen ihn brauchten. Ich liebe diese Geschichten, auch die, die erzählen, dass Jesus sich erschöpft zu seinen Freunden nach Bethanien zurückgezogen hat, wo er einfach selber auch wieder „Mensch“ geworden ist, in einem ganz schlichten Wortsinn. Jesus setzt anderen – etwa den Pharisäern – auch Grenzen, wenn sie ihn unter Druck setzen wollen oder zu sehr bedrängen. Oder er weist – so im Lukasevangelium – den zurück, der ohne Maß verkennt, dass unser Leben endlich ist. Er lässt in einem Gleichnis Gott zum reichen Mann sprechen: „Du Tor, diese Nacht noch wird man dein Leben von dir fordern! Wem aber wird gehören, was du angesammelt hast?“ (Lk 12,20)
Auch unser Ordensvater Benedikt ist mir Orientierung.Es gibt kaum jemanden, der aus dem Nachdenken über das Seelenmaß der Zeit so kluge Ordnungen geschaffen hat für eine Zeitkultur wie der Schöpfer des abendländischen Mönchtums. Auch im weltlichen Leben heute kann man viel Inspirierendes und Heilsames vom Zeitmaß der Mönche lernen, das von Ausgleich und einem inneren Rhythmus bestimmt ist, der sich an der Liturgie und an der Natur orientiert und dem Tag und dem Ablauf des Jahres dadurch eine besondere Qualität gibt. All das sind Hinweise, die ganz aktuell sind.
Die Zeit, von der im Folgenden die Rede ist, ist also nichts, was man „haben“ oder „sich nehmen“ oder mit dem man handeln und reich werden könnte. Manche sagen „Zeit ist Geld“. Richtig daran ist: Zeit ist kostbar. Denn sie ist begrenzt. Lebenszeit ist, wie unser Leben, nicht zu kaufen, sondern Geschenk. Wenn wir sagen, dass wir uns gegenseitig Zeit schenken oder wenn wir sagen, dass etwas „Zeit kostet“, dann merken wir schon an der Sprache, wie kostbar die Zeit ist.
Es gibt natürlich die Zeit, die mit der Uhr gemessen und nach Minuten und Sekunden gezählt wird. Auch sie ist wichtig, weil sie unser Zusammenleben ordnet. Aber diese Ordnung ist nur das halbe Leben. Wir leben nun einmal in einer endlichen Zeit. Und wenn wir über Zeit reden, reden wir auch über die Kunst, unser Leben gut und sinnvoll zu gestalten in der begrenzten Zeitspanne, die wir auf dieser Welt sind. Wer Zeit sparen will und immer hektischer aktiv wird, der verliert sie möglicherweise.
Eine generelle Rückkehr zur Langsamkeit ist kein Heilmittel. Wir können nicht aussteigen aus dem Tempo unserer Welt. Und müssen doch suchen, wie wir mitten in diesem Zeitdruck noch „unsere“ Zeit finden. Leben braucht Zeit. Wenn ich mir keine Zeit mehr nehme, dann ist das Leben auch nichts wert.
Angeblich gibt es ein Tal in Tirol, in dem sich die Menschen nicht „Grüß Gott“ zurufen, wenn sie sich begegnen, sondern: „Zeit lassen!“. Auch wenn das nur gut erfunden ist – dieser Gruß hat etwas. Er ist fast ein Segen.
Sich Zeit lassen, sich Zeit gönnen, die eigene Zeit bewusster leben – darum geht es in diesem Buch: Gönn dir Zeit. Es ist dein Leben!
Damit man am Ende auch die Zeit – und alles Zeitliche – segnen kann.
1 Zur Freude geboren
1979 besuchte eine Gruppe von japanischen Buddhisten und Shintoisten unser Kloster in St. Ottilien. Die Mönche haben einige Zeit mit uns gelebt und den Alltag mit uns geteilt. Vor ihrer Abreise kamen Journalisten: „Was ist Ihnen am meisten im Kloster aufgefallen?“ Das war die erste Frage. Ich selber hielt in Erwartung der Antwort ein wenig die Luft an. Und dann sagten die Gäste aus Asien: „Die Freude.“
Meine spontane Reaktion: Wenn das Nietzsche gehört hätte!
Ich bin überzeugt, das Christentum braucht mehr Moral und weniger Moralin. Und Nietzsches Forderung, „Sie müssten fröhlicher aussehen die Christen“, gilt auch heute noch.
Wir sind zum Glück und zur Freude bestimmt, nicht zum Leiden und zum Unglück. Keiner wird auf die Frage, wozu er geboren sei, sagen: zum Trauern. Zum Leben, wenn es da ist, gehört Fülle, auch die Freude in Fülle. Jesus hat gesagt: Ich möchte, dass sie das Leben in Fülle haben – und damit auch die Freude in Fülle. Gemeint ist echte Freude, nicht die Scheinfreude, die die Werbung aufoktroyiert. Jesu Grundgefühl ist die Freude am Leben. Diese Freude, die aus Gott kommt, ist eine Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Das ist der Kern seiner Botschaft: „damit meine Freude in euch ist und euere Freude vollkommen wird.“ ( Joh 15,11)
Wir sind also sicher auch nicht auf die Welt gekommen, damit wir Angst haben. Die ständige Tendenz, zu kontrollieren, bestimmte in der Vergangenheit nicht selten die Wirklichkeit in den Klöstern und die christliche Alltagsmoral. Das hat Angst erzeugt. Es war, von heute aus gesehen, aber eher ein Infantilismus, wo Gehorsam als Unterwürfigkeit verstanden wurde oder beides miteinander verwechselt wurde.
Die monastische Tradition hat ganz andere Orientierungspunkte, auf die wir uns beziehen können. „Wie lange noch schenkst Du allen andern Deine Aufmerksamkeit, nur nicht Dir selber? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran: Gönne Dich Dir selbst.“ Das ist die Empfehlung des Bernhard von Clairvaux. Er hat es im 12. Jahrhundert an seinen Schüler Bernhard von Pisa geschrieben, den Mönch, der Papst wurde und den Namen Eugen III. annahm. So wichtig das Amt des Papstes ist, so gewaltig und vielfältig die Aufgaben, so bedeutend die Bürde – er rät Gregor, seine Zeit nicht nur anderen zu widmen, sondern sein eigenes Leben, sich selber nicht zu vernachlässigen. Bernhard kannte die Schwächen und die Stärken des Menschen. Tief verwurzelt in der benediktinischen Spiritualität kannte er auch die Notwendigkeit und den Sinn asketischer Lebensführung. Aber Gottgefälligkeit und Menschenfreundlichkeit gehören für diesen Heiligen zusammen.
Sich etwas gönnen ist ein Zeichen des weiten Herzens, der Großzügigkeit und der mitteilenden und wohlwollenden Lebensfreude, die andere nicht ausschließt.
Wir haben nur diese Lebenszeit. Und sie ist kostbar. Wir haben teil am Reichtum des Daseins.
Wer weiß, wie lange wir auf der Welt sind ...
Für uns alle gilt: Leben ist endlich.
Deshalb ist es durchaus richtig zu sagen: „Lebe endlich“.
„Pflücke den Tag!“ – sagt Horaz. Packe den Tag am Schopf, bevor er entschwindet. Nütze die Gelegenheit, solange Zeit ist. „Verweile doch, du bist so schön“, so spricht Goethe zum Augenblick – und wird in dieser Endlichkeit Ewigkeit erhaschen. Zeit ist flüchtig, diese Einsicht findet sich quer durch die menschheitliche Geschichte der Weisheit. Aber das muss nicht Weltflucht bedeuten, im Gegenteil.
Die Hinwendung zur Endlichkeit – und das heißt auch: zum Tod – kann ins Leben zurückführen. „Freut euch im Herrn allezeit“, heißt es in Philipper 4,4. Und der Sonntag Laetare, an dem dieser Text auf eine herrliche Choralmelodie gesungen wird, verweist mitten in der Fastenzeit auf die Osterfreude. Der Name dieses Sonntags ist ein Motto für das ganze Der Name dieses Sonntags ist einMotto für das anze Leben: „Freut euch im Herrn immer“.
Wer sich der Freude öffnet, wer sie sich gönnt, ihr Raum und Zeit in seinem Leben einräumt, dessen Herz wird weit. Das steht hinter dem Rat Bernhards und es steht auch in der Tradition des Mönchtums. Benedikt spricht in seiner Regel sehr kritisch über den Müßiggang. Aber die Lebensfreude spielt in der Regel eine wichtige Rolle. Am Ende des Vorworts zu dieser Regel schreibt er: Der Mönch solle sich nicht entmutigen lassen, der Anfang mag zwar schwer sein und der Weg eng, aber wer auf dem Pfad der Tugend weitergelaufen ist, dem weitet sich die Seele und er geht den Weg nicht mehr, weil er sein muss, sondern in der Freude des Herzens.
Wenn Benedikt den Mönch auf den Pfad der Tugend schickt, sagt er nicht, er solle perfekt werden. Das ist ein großer Unterschied. Wer sich unter Vollkommenheitsdruck stellt, wird nie zufrieden sein. Perfektionsdruck ist der Feind jeder Freude. Leute, die unter Perfektionismusdruck stehen, sind tragische Figuren. Sie werden nie zufrieden sein, sie jagen immer hinter etwas her, das sie nicht erreichen können. Sie kommen ewig zu kurz. Männer, die hinter dem perfekten Bodybuilderkörper herhecheln, oder die jungen Frauen, die wie das Supermodel Heidi Klum aussehen möchten und sich deswegen zu Tode hungern, sind tragische Figuren.
Benedikt sieht bei der Perfektion auch die Gefahr des Stolzes. Ihm geht es bei der Formulierung seiner Regel um das rechte Maß: darum, dass „die Starken finden, wonach sie verlangen und die Schwachen nicht davonlaufen“. Das ist benediktinisch.
Freude aus der Weite des Herzens strahlt aus auch auf andere. Ich finde sie immer bei Menschen, bei denen das Leben einfach gelungen ist. Wahre Lebensfreude ist nicht erst am Ende des Weges oder des Lebens möglich. Es gibt Menschen, die schon sehr früh so weit sind und andere, die sich diese Haltung im Lauf eines Lebens erwerben. Ich erzähle immer wieder gern von einem inzwischen verstorbenen Mitbruder, der ein solcher Mensch war. Mit seiner Geradlinigkeit und mit seinem Humor konnte er alles in Frage stellen. Der konnte durch eine kleine Bemerkung die Wirklichkeit zurechtrücken und den konnte selber nichts aus der Bahn werfen. Er konnte dasitzen und sich alle Argumente anhören und am Schluss mit einer Frage das ganze Kartenhaus zusammenfallen lassen. Das nenne ich Souveränität und heitere Gelassenheit.
Dieser Mitbruder hatte seinen Platz im Chor unserer Klosterkirche direkt mir gegenüber. Hin und wieder sah ich ihn in sich hineinschmunzeln und wenn ich ihn hinterher gefragt habe, sag mal, was hast du heute wieder gedacht, dann sagte er nur: „Es ist halt so schön.“ Meistens war es eine Boshaftigkeit, die ihm durch den Sinn gegangen war und die er dann so kommentierte: „Lieber andere ärgern als sich selbst. Das ist gesünder.“
Wir dürfen uns selber gut sein und sollen es auch anderen gegenüber sein. Wenn ich glaube, angenommen und geliebt zu sein, ganz so wie ich bin, brauche ich nicht krampfhaft nach Selbstfindung suchen, um mich selber annehmen zu können. Viele, die von ihren Eltern nicht genügend Zuwendung bekommen haben, suchen lebenslang sich selbst. Ein normal aufgewachsenes Kind braucht sich nicht erst finden. Es weiß, wer es ist. Dem haben die Mutter, die Geschwister und der Vater das nötige Selbstbewusstsein mitgegeben. Natürlich brauchen wir auch später das, was in einer Ehe sehr schön zum Tragen kommt, wenn der Mann seine Frau stützt und ihr sagt, wie schön sie ist und wie er sich freut über alles. Und umgekehrt, wenn die Frau in einer kritischen Situation ihrem Mann sagt, jetzt lass den Kopf nicht so hängen, an dieser Sache hängt es nicht, auch wenn es mal schiefgegangen ist. Das sind die emotionalen Streicheleinheiten, die wir uns gegenseitig gönnen sollten, weil sie gut tun und einfach zur seelischen Gesundheit gehören.
Lebensfreude besteht darin, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Das Leben ist nun einmal begrenzt. Der Mensch ist nun einmal unvollkommen. Humor ist die angemessene Haltung. „Life is too important to be taken seriously“, hat Oscar Wilde gesagt. Ich schmunzle über die kleinen Unvollkommenheiten des Lebens aus einer gewissen Distanz heraus und habe keine Lust, jemanden zu verurteilen, der meinen Maßstäben nicht entspricht. Im Grunde sehnen sich alle nach einer solchen Gelassenheit. Wer will schon ständig unter einem Vollkommenheitsdruck leben?
„Fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen“, sagt Don Bosco. Das ist christliche Gelassenheit: Ich akzeptiere, dass die Welt endlich und begrenzt ist. Dann kann ich meine Rechnung aufmachen, alles abwägen und handeln. Eine Welt, in der wir uns unter dieser Voraussetzung begegnen, schaut ganz anders aus, als eine Welt, die den Perfektionisten oder Moralisten in die Hand fällt.
Eine Konsequenz aus dieser Einsicht: Sich bewusst Zeit nehmen für etwas, das Freude macht – das kann sich jeder vornehmen. Ich selbst versuche, danach zu leben. Vor Kurzem habe ich mit meiner Band in Benediktbeuern einen Auftritt mit der Rockgruppe „Deep Purple“ gehabt. Für so etwas nehme ich mir Zeit. Auch wenn einige, die sie nicht kennen und auch nicht verstehen, meinen, Rockmusik sei Musik des Teufels.
Wenn strenge Pietisten dagegen sind, stört mich das auch nicht. In meiner Allgäuer Heimat gibt es viele Reformierte. Ich war als Kind oft bei einer Apothekerfamilie fast wie zu Hause, habe mit den Kindern gespielt. Die Kinderzeitschrift, die ich da zu lesen bekam, war alles andere als unterhaltsam und lustig. Da hing sozusagen ein ständiger Trauerflor drüber. Als kleiner Bub habe ich mir damals angesichts eines so heftigen Sündenbewusstseins gesagt: „Ich könnte nicht evangelisch werden, das ist so traurig.“ Dabei habe ich später ganz andere, sehr humorvolle Protestanten kennen gelernt wie den Theologen Karl Barth, der jeden Morgen mit Mozart-Musik aufgestanden ist und hoffte, auch im Himmel Mozart-Musik zu hören.
Auch Rockmusik ist für mich ein Zeichen und Ausdruck von Lebensfreude. „On the Highway to Hell“, diesen Song einer australischen Hardrockband singe ich im Flieger, wenn’s runtergeht. Und dann singe ich mit der gleichen Freude „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin. Muss man denn alles so bierernst und tragisch nehmen? Dürfen wir solche Texte nicht auch ironisch nehmen?
Wir alle sind zur Freude geboren. Und wir sollten uns die Freude gönnen. Die Jugendlichen, die diese Musik lieben und in ihr aufgehen, ebenso wie alle anderen, Junge und Alte nicht anders als die Mönche im Kloster. Freude ist das wirkungsvollste Gegenmittel zur Angst. Wenn in meinem Kloster die Leute einmal zusammensitzen werden und überlegen, was von den Äbten übrig geblieben ist, wenn sie sich erinnern, was der eine gebaut und organisiert hat und was der andere geleistet hat und wenn sie sich fragen, was ihnen aus meiner Zeit noch in Erinnerung geblieben ist, dann würde ich mich freuen, wenn sie sagen würden: „Wir hatten keine Angst mehr.“
Das wäre für mich das schönste Kompliment.
2 Die große Frage
Die große Frage ist: Was fangen wir an mit unserer Zeit, mit unserem Leben? Welche Prioritäten sollen wir setzen? Eine Antwort aus der Regel des Benedikt scheint auf den ersten Blick schockierend: „Der Mönch soll alle Zeit den unberechenbaren Tod täglich vor Augen haben.“
Das klingt nach Lebensverneinung und Askese.
Das Gegenteil ist der Fall.
Die Aufforderung Benedikts erinnert mich an ein Bilderbuch von Wolf Erlbruch, es trägt den Titel: „Die große Frage“. Ein Kind geht herum und stellt Menschen, Tieren und Dingen „die große Frage“: „Wozu bist du, wozu bin ich auf der Welt“. Alle Befragten antworten anders. Der Bruder sagt zum Beispiel: „Um Geburtstag zu feiern, bist du auf der Welt“; die Großmutter: „Natürlich bist du auf der Welt, damit ich dich verwöhnen kann.“ Der Vogel: „Um dein Lied zu singen, bist du da“. Auch der Stein wird gefragt: „Du bist da, um da zu sein.“
Am Ende fragt das Kind auch den Tod – und der antwortet: „Du bist auf der Welt, um das Leben zu lieben.“
Wie kann das zusammenhängen: Das Wissen um den Tod und die Liebe zum Leben?
David Steindl-Rast, ein inzwischen über achtzigjähriger Benediktinerbruder, erzählt einmal seine Berufungsgeschichte. Er wuchs während des Krieges in Österreich auf und eine Grunderfahrung war der Tod. Seine jungen Freunde wurden eingezogen und starben. „Und trotzdem“, sagt er: „Den Tod täglich vor Augen – und trotzdem war meine Jugend die glänzendste, die schönste, die glitzerndste Jugend, die man sich vorstellen kann. Trotz all des Schrecklichen. Eine wunderbare, nicht zu bändigende Lebendigkeit. Und dann war plötzlich der Krieg zu Ende. Und ich habe gelebt. Ich war neunzehn und hatte nie geglaubt, dass ich jemals zwanzig werden könnte. Zufällig, wenn es so etwas wie einen Zufall gibt, hatte ich damals, weil es Untergrundliteratur war, die Regel des heiligen Benedikt gelesen. Darin steht, der Mönch soll den Tod allzeit vor Augen haben. Und plötzlich ist mir klar geworden: Wir waren so glücklich, weil wir den Tod immer vor Augen hatten. Deswegen hatten wir ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit, zum Leben.
Nicht nur in der Ausnahmesituation des Krieges merkt man es, ganz direkt und eindringlich: Unsere Zeit ist begrenzt. Die Erfahrung einer Krankheit kann das sein. Der Tod eines Gleichaltrigen oder der eines jungen Menschen. Oder ein Unfall, dem man gerade noch entkommen ist. Ich habe viele solcher Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Sie geben der Zeit, unserer Lebenszeit, eine ganz neue Qualität. Wir leben intensiver, bewusster und achtsamer.
„Den unberechenbaren Tod täglich vor Augen haben“, das rät Benedikt also nicht aus Angst, sondern um die Werte dieser Welt richtig einschätzen zu können. Der Satz findet sich in dem Kapitel über die geistlichen Instrumente, also die geistlichen Übungen. Damit ist schon gesagt, dass man diese innere Haltung gewinnen kann, die vor falschen Alternativen schützt: ganz einfach, indem man sie trainiert. Jeden Tag. Indem wir uns an unsere Endlichkeit erinnern, können wir erkennen, was wirklich wichtig ist und Bestand hat. Ein solches Bewusstsein lehrt uns Abstand, damit wir uns nicht zu schnell in Vordergründiges und Unwichtiges verwickeln lassen.
Nicht der Tod ist unser Unglück. Unglücklich werden wir, wenn wir ihn verdrängen und so tun, als könnten wir vor ihm fliehen.Wer die Flüchtigkeit der Zeit spürt, muss nicht in Panik geraten und selber fliehen. Oft genug sehe ich: Wer den Tod nicht akzeptiert, lebt so, dass er zwei oder drei Leben in eines packen will. Vieles von der Hetze in unserem Leben ist vielleicht auch davon bestimmt. Erlebnishunger als Angst, nicht genug Leben abzubekommen.
„Nur die Weisheit kennt den Ausgang von Zeit“, heißt es in der Bibel. Eine Aufforderung zur Gelassenheit. Das ist keine leichte Sache.
In meinem Heimatort gab es gegenüber unserem Haus eine Metzgerei. Die Metzgerin hatte fünf Söhne, vier sind im Krieg gefallen, der letzte Sohn sollte das Geschäft übernehmen. Als er einmal mit dem Motorrad nach München fuhr, übersah er die rote Ampel und verunglückte tödlich. Etwas Schlimmeres kann man sich für die Mutter kaum vorstellen. Dazu kam: sie hatte Zucker, und ein Bein musste amputiert werden. Die Metzgerei ist dann schließlich an entfernte Verwandte übergegangen.