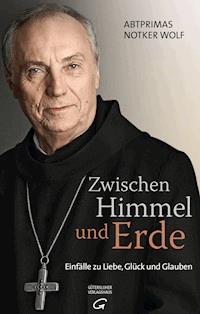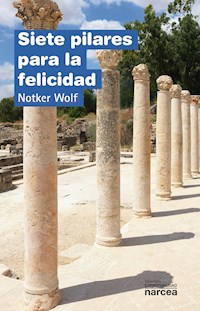© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Stunde der Populisten
Ängste müssen wir ernst nehmen – aber nicht zu ernst
Schluss mit der Angst
Mutbürger statt Wutbürger
Das Boot ist nicht voll
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Lasst uns Hoffnungsträger sein
Wir können es doch
Gottvertrauen statt Heidenangst
Gott lässt sich nicht lumpen
Fürchtet euch nicht
Über die Autoren
Vorwort
Sechzehn Jahre lang habe ich nicht mehr in meiner Heimat gelebt. Ich war immer wieder für verschiedene Termine in Deutschland gewesen. Aber ich habe hier eben nicht mehr gewohnt, und es ist etwas ganz anderes, ob man in einem Land oder einer Stadt lebt oder als Besucher kommt, selbst wenn man eigentlich von dort stammt. Mir war es nie egal, was in Deutschland passiert. Ich habe immer alle gesellschaftlichen Entwicklungen verfolgt. Mehr als ein Jahr bin ich jetzt zurück. Schon von Beginn an hat mich die neue deutsche Ängstlichkeit überrascht, auch etwas erschüttert. Ich habe die Wahlen miterlebt, bei denen die AfD die deutsche Politik vor sich hergetrieben, paralysiert und zahlreiche Anhänger gewonnen hat. Und ich erlebe in meiner bayerischen Heimat jetzt wieder einen Wahlkampf, der auf dieses um sich greifende Gefühl abzielt, sogar darauf aufbaut. Für mich war und ist es immer ein Herzensanliegen, anderen Menschen Mut zu machen. Weil ich weiß, wie wichtig das ist und wie oft mir andere Menschen Mut gemacht haben. Und ich denke, Mutmacher haben wir gerade nötig. Bitter nötig.
»Vor allem ein Gefühl bestimmt derzeit die Stimmung in Deutschland, aber auch in allen anderen Nationen: die Angst. Sie wirkt in allen gesellschaftlichen Bereichen, bestimmt Politik und Wirtschaft, aber auch das Privatleben jedes Einzelnen. Das Gefühl kennt keine sozialen Grenzen; es eint Menschen, die sonst nicht viel gemein haben. Es ist häufig das Einzige, worüber sie miteinander reden können.« So klar analysiert der Soziologieprofessor Heinz Bude die derzeitige Lage in unserem Land. Wie recht er damit hat, das haben wir gerade in den letzten Monaten und Wochen erfahren. Deutschland ist zutiefst verunsichert und hat Angst, sei es vor einer neuen Wirtschaftskrise, den nächsten politischen Eruptionen, kriegerischen Eskalationen oder so furchtbaren Anschlägen wie zuletzt in Istanbul, Jerusalem oder Berlin. Das geht übrigens nicht nur uns Deutschen so, sondern auch unseren Nachbarn. Es ist bezeichnend, dass in Österreich bei der Wahl zum Wissenschaftsbuch 2017 in der Kategorie Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften ein Buch der österreichischen Professorin Ruth Wodak gewann, der Titel: »Politik mit der Angst. Zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse«.
Woher kommt das? In der gegenwärtigen Lage könnte man ganz einfach den Schluss ziehen: Wenn es dem Menschen zu gut geht, wird er träge und nachlässig, er hält alles für selbstverständlich, er denkt, alles komme von ganz allein. Doch stimmt das wirklich? Es gibt viele in unserem Land, denen es alles andere als gut geht. Daher glaube ich, die Ursache liegt tiefer: Ein allgemeines Relativieren hat sich wie Mehltau über unser Land gelegt, und nicht nur über unseres. Religion im öffentlichen Leben ist tabuisiert worden. Warum eigentlich? Warum muss das Kreuz aus den öffentlichen Räumen verbannt werden, nur weil es einige Menschen gibt, die gegenüber der Religion, den Gläubigen oder Andersgläubigen keine Toleranz aufbringen? Toleranz galt als die große Errungenschaft der Aufklärung, in Wirklichkeit sind aufgeklärte Menschen intolerant geworden und bestimmen, was man in unserem Staate denken darf. Alles andere gilt als überholt und unmodern. Es besteht ein Unterschied zwischen der Toleranz gegenüber einer Meinung und der Toleranz gegenüber einem Menschen. Das ist ja der große Fehler der Aufklärung gewesen: Die Behauptung Lessings, die er in »Nathan der Weise« mit der Ringparabel aufstellt, im Grunde seien alle drei Religionen gleich, stimmt eben nicht. Die Muslime würden sich wehren, die Juden nicht minder, und sicher auch Gläubige anderer Religionen. Das ist nicht nur ihr gutes Recht, sondern vielleicht sogar ihre Pflicht als Gläubige. Toleranz bezieht sich nicht auf die theoretische Wahrheit, sondern auf den konkreten Pluralismus von Menschen mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen. Dann dürfen Glaubensüberzeugungen auch im öffentlichen Leben bekundet werden, solange sie nicht die öffentliche Ordnung stören.
Wer in der Philosophie des Sokrates groß geworden ist, wird alles hinterfragen, auch die Aufklärung. Diese Philosophie, deren Zentrum das ständige Fragen und Hinterfragen bildet, bietet uns eine Methode, um in unserer Zeit Orientierung zu finden. Wenn wir aufhören, immer wieder nachzufragen, wundern wir uns nicht mehr über die gegenwärtigen Wahlausgänge und die neuen totalitären Bestrebungen. Viele in der Bevölkerung sind es leid, sich einem System unterordnen zu müssen. Sie wollen einmal anderes probieren, ob in der Stadt Rom, in England, in den USA oder Österreich und erst recht in den Staaten des ehemaligen Ostblocks.
Wozu Angst führen, wie sie benutzt werden kann, das sehen wir seit mehr als einem Jahr in den USA. Dort hat mit Donald Trump ein Scharfmacher gewonnen, der aus den Unsicherheiten, dem Gefühl der Ohnmacht, aus den Ressentiments seine einzige politische Daseinberechtigung gezogen hat, der allein durch Ab- und Ausgrenzung Amerika wieder »great« machen will. Die USA sind so gespalten wie nie und das Land bewegt sich unter Trump, der die Ängste bewusst schürt und sich als einziger Beschützer und Bewahrer des Landes geriert, so weit ins Abseits, wie lange nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie. Viele Menschen passen nicht dazu: Mexikaner, Chinesen oder einfach nur Muslime.
Auch in Deutschland bringen immer mehr Menschen den Muslimen und dem Islam Vorbehalte und sogar Angst und Hass entgegen. Abgesehen davon, dass eine Generalisierung wie »der Islam« zu kurz greift, wie ja fast immer Generalisierungen, müssen die vielen Emotionen, die in diese Debatte einfließen, genau untersucht und beleuchtet werden. Das vielleicht entscheidende Problem besteht in der Frage, ob ein Muslim einen Andersgläubigen als ebenbürtig gelten lässt und anerkennt, auch wenn er einer anderen Weltanschauung folgt. Das scheint mir die eigentliche Herausforderung zu sein. Denn der Koran schreibt nicht nur einen bestimmten Glauben vor, sondern auch das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft. Der Nichtmuslim gilt als Ungläubiger und somit als Mensch zweiter Klasse. Zwar haben hohe Vertreter der Sunniten auf einer Konferenz in Grosny/Tschetschenien, die vom 25. bis 27. August 2016 stattfand, das Verhalten des sogenannten Islamischen Staats und ähnlicher Extremistengruppen als Übereifer und Fehlinterpretation deklariert, es fehlt aber eine klare Aussage hinsichtlich eines anerkennenden Verhältnisses zu andern Religionen, wie sie etwa in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils »Nostra Aetate«, der Erklärung über das Verhältnis zu den andern Religionen, und in »Dignitatis humanae«, der Erklärung zur Religionsfreiheit, zu finden ist. Auch die Katholische Kirche hat lange gebraucht, bis sie sich zu diesen Erklärungen durchgerungen hat. Aber sie sind eine unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen einer modernen, pluralen Gesellschaft.
Wir müssen diese Fragen unseren muslimischen Mitbürgern zumuten. Denn sie genießen unsere freiheitliche Demokratie und unsere Rechtsstaatlichkeit. Verglichen mit ihrem Status hierzulande genießen die Christen in arabischen Staaten lediglich eine eingeschränkte Religionsfreiheit. Das zeigt sich etwa bei der Frage der Konversion. Nur der Wechsel zum Islam ist erlaubt. Warum nicht auch umgekehrt? Immerhin haben die Christen in den Emiraten ein Existenz- und Kultrecht. Jordanien gilt als liberal. Im Nachbarland Saudi-Arabien haben die Christen nicht das geringste Recht. Erstaunlicherweise bemängeln wir bei der Volksrepublik China zurecht die eingeschränkte Religionsfreiheit, gegenüber Saudi-Arabien ist aber selten Kritik zu vernehmen. Hängt das mit unseren Waffenverkäufen zusammen, mit dem Öl? Die Fragen an die Muslime werden zu Fragen an uns selbst. Entscheidend ist: Diese Fragen können beantwortet werden, das Zusammenleben ist möglich. Manche werden mich jetzt als naiven Optimisten belächeln. Doch in Italien zum Beispiel haben jetzt erst islamische Verbände und Regierungen einen »nationalen Pakt für einen italienischen Islam« geschlossen. Freitagsgebete sind nun verpflichtend auf Italienisch, die Verbände garantieren zudem volle Transparenz bei der Frage, wer die Moscheen finanziert. Im Gegenzug will die Regierung den Bau von Moscheen erleichtern und die muslimischen Gemeinschaften unterstützen. Der italienische Innenminister Marco Minniti nannte den Pakt eine außergewöhnliche Investition in die Zukunft Italiens – eine solche Investition brauchen wir auch.
Aber auch sonst wird sich bei uns einiges ändern. Wir brauchen weiterhin die wohlwollende Neutralität des Staats gegenüber Religionen. Udo Di Fabio ist sicher zuzustimmen, wenn er betont, dass ein »Beharren auf kompromissloser Durchsetzung religiös begründeter Verhaltensgebote in öffentlichen Einrichtungen einen Rückschritt bedeute« (FAZ 22.12.16). Es wird allerdings zu neuen Diskussionen kommen, ob dadurch ein moderner Laizismus gerechtfertigt ist. Ich bin mir sicher: Unsere Gesellschaft wird die Religion erneut als öffentlichen Faktor wahrnehmen müssen, wobei der Gleichheitsgrundsatz unbedingt zu berücksichtigen ist. In der Vergangenheit kannte unsere Gesellschaft manche der aktuellen Probleme nicht, da sie wesentlich konformer geprägt war. Aber selbst damals gab es schon Unterschiede, wenn wir an die gemeinsame Verantwortlichkeit und das Zusammenwirken der kirchlichen und staatlichen Institutionen in Deutschland denken im Gegensatz zum radikalen Laizismus in Frankreich. Unsere Gesellschaft wird sich insofern ändern, als sie mit der Religion als Lebenswirklichkeit vieler Menschen wird rechnen müssen.
Wir dürfen noch weiterdenken, denn Integration kann nicht nur eine Einbahnstraße bedeuten. Sie wird sich auch auf unsere Gesellschaft auswirken. Manche politisch korrekten Axiome werden in Frage gestellt. Das betrifft unser Singletum, die Homoehen, unsere Werte von Familie und solidarischem Zusammenhalt und auch unsere Sexualethik. Wehe, wenn jemand eines unserer sogenannten Werte in Frage stellt. Er wird zugetwittert und zugefacebooked. Wo aber bleibt die wirkliche Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft? Dies und jenes scheint einfach die selbstverständliche Meinung in unserer Gesellschaft zu sein, und wehe, wenn einer daran kratzt. Dann wird selbst ein Papst Franziskus angegriffen, der wegen seiner Haltung zu Homosexuellen geschätzt wird – »Wer bin ich, dass ich über andere urteile?« –, der aber angegriffen wird wegen seiner Einstellung zur Homosexualität. In einer Reihe solcher Fragen wie Homoehen und Abtreibung arbeiten Vertreter der Katholischen Kirche übrigens mit den Muslimen in internationalen Institutionen gut zusammen.
Ohne irgendwelche Vorhersagen treffen zu wollen, bin ich der Auffassung, dass die Präsenz von Muslimen in unserer Gesellschaft einiges aufmischen wird, allem voran unsere Selbstverständlichkeiten. Und das wäre durchaus sokratisch im Sinne des ständigen Hinterfragens. Nur wünschte ich mir, dass sich auch die Muslime hinterfragen ließen. Dann würden wir zu einem Lebenskonsens kommen. Denn wenn die Muslime, wie seinerzeit Christian Wulff als Bundespräsident sagte, zu Deutschland gehören, dann müssen sie sich unseren Fragen stellen und wir uns den ihren. Allerdings gehört nicht der Islam zu Deutschland, wie auch Angela Merkel sagte, aber sehr wohl die Muslime. Meines Erachtens beruht unser Grundgesetz auf christlichen Werten – und nicht auf der Scharia.
Zugleich steht es außer Frage, dass viele Muslime die Engführungen, die es teilweise gibt, ablehnen und dagegen kämpfen. Zum Beispiel die in Istanbul geborene Seyran Ateş, die Imamin werden will und allen Anfeindungen zum Trotz für die Gleichberechtigung der Frau im Islam kämpft: »Frauen abzuwerten, davon steht nichts im Koran.« Sie möchte zeigen: »Der Koran steht wie die andern Religionen für Liebe und für die Würde des Menschen. Für die Würde jedes Menschen.« (Bild der Frau, 50/2016/36) Änderung ist möglich und erwünscht. Aber es wird Zeit brauchen, um bestimmte Dinge zu verändern, und es wird dabei noch viele Auseinandersetzungen geben. Doch das gehört zu Veränderung dazu. Wir als Christen wissen das – auch, dass wir selbst Veränderungen anstoßen und durchfechten müssen.
Die Stunde der Populisten
Was wirst du am meisten vermissen von Rom? Das war und ist vielleicht die häufigste Frage, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Gleich nach: Wie geht’s dir? Was ich vermisse, nachdem ich ein Viertel meines Lebens in Rom verbracht habe. Wobei das eigentlich gar nicht stimmt: Wenn ich zusammenzähle, wie viele Tage ich in diesen sechzehn Jahren als Abtprimas in Flugzeugen, in Wartehallen oder Zugabteilen verbracht habe, dann sind es doch deutlich weniger als sechzehn Jahre, denn ich war ja ständig unterwegs, 300000 Flugkilometer jährlich. Auf jeden Fall bin ich nach so langer Zeit wieder zurück in meiner Heimat, in Bayern. Und natürlich vermisse ich verschiedene Dinge des Alltags: die Pasta vor allem. Das klingt wie ein Klischee, ich weiß. Aber wer den Unterschied kennt, der wird verstehen, was ich meine. Das italienische Wetter, auch das fehlt mir. So schön die Jahreszeiten bei uns daheim sind, so wunderbar der weiß-blaue Himmel über Bayern sein kann – das mediterrane Wetter hat schon etwas. Und ich vermisse natürlich die Menschen, mit denen ich gearbeitet, gelacht, manchmal auch gerungen habe. Denen ich viel zu verdanken habe, persönlich und privat genauso wie beruflich und in meinem Amt. Ja, ich vermisse vieles. Doch zugleich spüre ich: Ich bin wieder in meiner Heimat, in Bayern und Deutschland. Vielleicht kehre ich sogar noch deutscher zurück als zuvor. Deutscher im Sinne von: meiner Herkunft bewusster, meiner Identität, meinem Land. Und ich spüre: Hier kenne ich doch noch einmal alles besser. Hier ist mir alles eine Nuance vertrauter, seien es die Orte, die Geschichte oder die Menschen. Nur eines, das ist mir nicht vertraut: wie ängstlich Deutschland, mein Deutschland, geworden ist.
Den Begriff der »German Angst« gibt es natürlich schon lange. Helmut Schmidt sagte zum Beispiel einmal: »Die Deutschen haben die Neigung, sich zu ängstigen. Das steckt seit dem Ende der Nazi-Zeit und Krieg in ihrem Bewusstsein.« Allerdings war ursprünglich mit dem Begriff »German Angst« gar nicht so sehr wirklich Angst im Sinne einer Furcht gemeint. Sondern eher eine gewisse Scheu, eine Zögerlichkeit, wenn es etwas zu entscheiden und wenn es zu handeln galt, eine Haltung, wie sie unser Land in letzter Zeit auch immer wieder an den Tag legt. Zum Beispiel mit seinem außenpolitischen Zögern, etwa in der Frage des Eingreifens in Libyen. Auf den Punkt brachte das einmal der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, der 2011 sagte: »Ich bin wahrscheinlich der erste polnische Außenminister in der Geschichte, der das sagt, aber: Ich habe weniger Angst vor deutscher Macht, als ich anfange, mich vor deutscher Inaktivität zu fürchten.« Wir scheinen die ewigen Bedenkenträger zu sein. Warum? Wir wollen absolute Sicherheit. Wir vertrauen nur auf uns selbst, nicht auch auf die andern.
Doch egal, ob es nun bloße Zögerlichkeit ist oder doch wirkliche Angst, ich frage mich schon: Ist Angst etwas typisch Deutsches? Ich glaube das nicht. Jedenfalls habe ich das so nicht erlebt und nicht in Erinnerung. Und es ist ja nicht so, dass ich während meiner Zeit in Rom nicht ab und zu in Deutschland gewesen wäre. Ich glaube das nicht, sondern vielmehr, dass wir derzeit eine besondere Angstsituation haben in unserem Land. Eine Situation, die von Menschen genutzt wird – wie in den meisten anderen europäischen Staaten oder auch gerade erst in den USA –, deren Worte Schimpftiraden und deren Programme Stammtischparolen sind. Es scheint die Stunde der Populisten geschlagen zu haben, wie es in Anklang an den Filmtitel »Stunde der Patrioten« heißt.
Apropos Stammtisch: Die Stunde der Populisten hat viel damit zu tun, dass viele Politiker eben nicht mehr an den Stammtischen sitzen, hier in Bayern sogar ganz wortwörtlich. Früher war ja gerade das die Stärke der CSU. Sie war nahe dran an den Leuten und damit an deren Nöten, Sorgen, Hoffnungen oder eben auch Ängsten. Der Stammtisch ist nicht nur ein Symbol für Gemütlichkeit und Bier, sondern eben auch für Begegnung, für Gemeinschaft und Austausch. Der Stammtisch ist ein Ort, an dem man zusammenkommt, der einen festen Platz und eine feste Zeit markiert, früher meistens am Sonntag nach der Kirche zum Frühschoppen, und damit einen sozialen Kitt und Kleber. Dazu gehörten früher einmal vor allem die angesehenen und wichtigen Persönlichkeiten eines Dorfes. Heute, so das Gefühl der Leute, sitzen die Eliten nicht mehr mit den Menschen am Stammtisch. Das wollen sie gar nicht. Das Wort »Stammtischparole« ist ein Synonym für niveaulos, polternd und wenig durchdacht. Doch den freien Platz am Stammtisch – jetzt im übertragenen Sinne – haben andere eingenommen, die sich gerne dort breitmachen. Und die tatsächlich Stammtischparolen wie im obigen Sinne klopfen und herausposaunen. Es sind eben jene Populisten von der AfD, der Pegida oder auch rechten Parteien wie der NPD oder früher in Bayern der Republikaner. Sie besetzen die Stammtische für sich und sind damit auf eine Art und Weise bei den Menschen, wie es viele andere Entscheidungsträger nicht mehr sind. Die Populisten sind beim populus, beim Volk.
Populisten sind Leute, so sagt man immer wieder, die dem »Volk aufs Maul schauen«. Dahinter steckt der Gedanke, dass sie dann eben auch den Leuten nach dem Mund reden, also das sagen, was ankommt, was opportun ist, was gefällt. Interessanterweise stammt die Formulierung »aufs Maul schauen« von Martin Luther, und wenn man sie so begreift, wie er das tat, dann finde ich es überhaupt nicht schlecht, dem Volk aufs Maul zu schauen. Es bedeutet schlichtweg, dass man weiß, was die Menschen beschäftigt und dass man zugleich ihre Sprache spricht. Nicht, um sich anzubiedern. Sondern um zu verstehen und um verstanden zu werden. Ich mache das als Priester ja nicht anders. Ich will mit meinen Predigten, meinen Ansprachen oder auch Texten verstanden werden. Also muss ich eine Sprache sprechen, die die Menschen sprechen und die sie anspricht. Alles andere ist Nabelschau und Blendwerk. Das mag jetzt vielleicht etwas grob klingen: Aber es würde uns und besonders unseren Eliten guttun, mal wieder mehr den Menschen aufs Maul zu schauen. Ohne ihm nach dem Mund zu reden. Einer, der das kann, ist Papst Franziskus. Er weiß um die konkreten Nöte der Menschen, der Familien, der Ehen und Erziehung und eckt dementsprechend bei legalistisch ausgerichteten Kardinälen an. Sie suchen den Buchstaben des Gesetzes, er den Menschen, und er sieht sich darin von der Botschaft Jesu bestätigt und herausgefordert.
Ängste müssen wir ernst nehmen – aber nicht zu ernst
Ich habe einmal in einem Buch geschrieben, dass ich seit einem bestimmten Tag, seit einem bestimmten Ereignis keine Angst mehr gehabt habe. Ich war damals noch nicht ganz vierzig und befand mich im Auto auf dem Weg von Rom nach St. Ottilien. Die Sonne schien und alles um mich herum blühte. Ich war in einem Glückszustand, fühlte jenen ganz bestimmten Freiheitsmoment, der beim Autofahren manchmal entsteht. Auf einmal dachte ich: Wenn mir jetzt etwas passieren würde, ein Autounfall zum Beispiel … Und ich spürte in mir: So schlimm wäre das nicht, denn ich hatte schon so viel Schönes erlebt, ich fühlte mich jetzt schon so erfüllt und beschenkt. Seitdem, so schrieb ich später, hätte ich mit dem Leben abgeschlossen und der Angst auch. Heute kann ich ergänzen: Die Geschichte stimmt. Und das mit dem Leben auch. Und auch das mit der Angst, aber nur zum Teil. Denn natürlich habe ich auch danach noch Angst gehabt und Momente erlebt, in denen ich mich gefürchtet habe. Aber, und das ist wahr: Ich hatte nie mehr eine existenzielle Angst. Ich war mit mir und dem Leben im Reinen, und vor allem mit dem Herrgott.
Ich kenne also Angst, natürlich. Etwa wenn plötzlich das Licht ausgeht oder große Hunde anfangen zu bellen … Oh ja, diese Hunde, die wie Pferde aussehen, vor denen habe ich einen Heidenrespekt. Oder auch vor halsbrecherischen Skiabfahrten, da fühle ich mein Alter. Und vor Vorträgen und Musikauftritten bin ich noch immer richtig angespannt. All diese Ängste habe ich, das gebe ich gerne zu. Es wäre auch unmenschlich, sie nicht zu haben. Denn Angst gehört zum Leben und zum Menschsein dazu. Man muss Ängste ernst nehmen, weil sie immer auch eine Warnung sein können. Angst zu haben, ist in Ordnung. Doch es ist auch wichtig, was der große Dichter Khalil Gibran geschrieben hat: »Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt, beherzt ist, wer die Angst kennt und sie überwindet.«