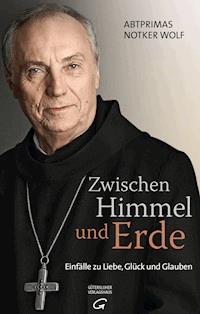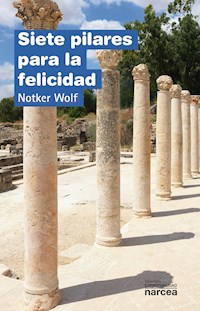Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonifatius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In welcher Gesellschaft wollen wir zukünftig leben? Deutschland ist geprägt vom Pluralismus der Lebensstile und Meinungen. Zudem kultivieren die Krisen unserer Zeit Haltungen zwischen Empörung und Einschränkung. Unterschiedliche Erfahrungen werden zu noch unterschiedlicheren Gewissheiten. Leben wir in einer Welt, die nur noch den Furchtsamen und Gehorsamen gehört? Angst treibt viele um und die Sehnsucht nach verlässlicher Sicherheit und Orientierung. Notker Wolf analysiert Berührungsängste des gesellschaftlichen Lebens, prangert schonungslos Moralwächter unserer Zeit an und zeigt, wie Unerschrockenheit dem Zeitgeist die Stirn bieten kann. Sie findet er im Paradebeispiel eines politisch unkorrekten Menschen: Jesus von Nazareth. Ein leidenschaftliches Buch für eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Traditionen, Berührungsängsten und Denkgewohnheiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTKER WOLF
MIT LEO G. LINDER
WARUM LASSEN WIR UNS VERRÜCKT MACHEN?
Neue ketzerische Gedanken
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2022 Bonifatius GmbH Druck | Buch | Verlag, Paderborn
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden, denn es ist urheberrechtlich geschützt.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München, werkstattmuenchen.com
Umschlagfoto: picture-alliance/ dpa | Marcel Mettelsiefen
Satz: Bonifatius GmbH, Paderborn
eISBN 978-3-89710-984-1
Weitere Informationen zum Verlag: www.bonifatius-verlag.de
Niemand außer diesem Fenster Sagte mir so offen, Dass das Leben schön ist. Jeden Tag als Erstes Sah ich aus diesem Fenster Den Himmel.
Sabahattin Kudret Aksal
(türkischer Dichter, 1920–1993)
INHALT
1. Stimmt etwas mit mir nicht?
2. Indianerfreie Zukunft
3. Jesus aus nächster Nähe
4. Von einem, der auszog, Menschen zu fischen
5. Aufstand der Makellosen
6. Heiliger Leichtsinn
7. Spielverderber
8. Pandemie der Angst
9. Vorsicht, Zahlen!
10. Kein Grund, zu verzagen
11. Das Reich Gottes
12. Die Wiederentdeckung der Erbsünde
13. Wer hat Angst vorm Schwarzfahrer?
14. Die Verlierer sind die Gewinner
15. Ein Festmahl für Bettler
16. Die rechte und die linke Wange
17. Der Tanz ums Goldene Kalb der Identität
18. Die Tyrannei der Minderheiten
19. Wie man etwas Besonderes wird
20. Jesus in weiblicher Gesellschaft
21. Zweierlei Arten von Angst
22. Wer sein Leben gewinnen will …
23. Darf man noch Wiener Schnitzel sagen?
24. Was bei Gott zählt
1. STIMMT ETWAS MIT MIR NICHT?
„Sag mal, hast du denn überhaupt keine Angst?“, wurde ich in der Coronazeit von einem Mitbruder gefragt. Ich überlegte. Mir fiel ein: Wenn ich in der Kirche die Stufen zum Altarraum hinuntergehe, setze ich neuerdings die Brille ab, weil ich die Treppenstufen sonst doppelt sehe und vermeiden möchte, mit einem Oberschenkelhalsbruch ins Hospital eingeliefert zu werden. Doch ist das ein Zeichen von Angst? Eigentlich nicht. Da meldet sich vielmehr mein Gefahrenbewusstsein, und das ist etwas anderes. „Nein“, antwortete ich ihm.
Er hakte nach: „Und was, wenn du dich ansteckst?“
„Man wird doch immer wieder mal krank – und dann auch wieder gesund, oder?“
„Aber du könntest auf der Intensivstation landen …“
„In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ich überlebe, oder es ist mit mir vorbei. Keine dieser beiden Möglichkeiten schreckt mich.“
Und damit war es mir ernst. Stimmt etwas mit mir nicht? Mache ich mir etwas vor? Nicht, dass ich mich gegen Vorsichtsmaßnahmen sträube, Rücksicht nehme ich schon, aber ich bleibe dabei: Angst ist mir fremd. Das war schon immer so. Es ist Jahrzehnte her, aber noch heute muss ich schmunzeln, wenn ich an die Gesichter der Polizisten nach meinem Unfall auf der Autobahn denke. Damals hatte ein Gemüselaster ohne zu blinken direkt vor mir auf die Überholspur gewechselt, ich war zu einem Ausweichmanöver gezwungen gewesen, war links gegen die Leitplanke geprallt und zurück auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert worden und schließlich auf dem Randstreifen zum Stehen gekommen – unverletzt, Gott sei Dank. Als dann die Polizei eintraf, fand sie im Wagen einen Notker Wolf vor, der ungerührt seine Antico Toscano weiterrauchte, eben jene Zigarre, die er sich zu Beginn der Fahrt angezündet hatte; sein Mitbruder auf dem Beifahrersitz aber stand unter Schock.
Es ist tatsächlich so: In heiklen Situationen höre ich eine innere Stimme. Bleib ruhig, flüstert sie mir zu. Es hat keinen Zweck, sich aufzuregen. Wenn du die Nerven verlierst, machst du die Sache nur schlimmer … Das leuchtet mir ein. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Gründe für diese seltsame Unerschütterlichkeit – zum Beispiel eine gewisse Routine im Umgang mit Gefahren, die ich mir auf zahllosen Reisen außerhalb Europas angeeignet habe. Eine brisante Situation in China fällt mir dazu ein, wo ich in einem militärischen Sperrgebiet ahnungslos Fotos gemacht hatte und am selben Abend noch im Hotel von drei Polizisten Besuch bekam. In Ländern wie China wird man schnell der Spionage verdächtigt, und Spionage kann einen Kopf und Kragen kosten; merkwürdigerweise war ich trotzdem vollkommen ruhig geblieben und nach stundenlangem Verhör heil aus der Sache herausgekommen.
Ungemütlich konnte es aber auch in Zaire (dem heutigen Kongo) werden. Jedes Mal, bevor ich mich dort in der Früh auf den Weg machte, habe ich die Mutter Gottes gebeten, mich auch diesmal wieder unter ihren schützenden Mantel zu nehmen. Einmal wollte ich aus dem Landesinneren Zaires nach Kinshasa fliegen, fand aber kein Flugzeug – die einzige Maschine mit Bestimmungsort Kinshasa war eine alte Caravelle, die getrockneten Fisch geladen hatte. Was blieb mir übrig? Den Fischen war’s egal, mir auch, und so habe ich mich auf nicht alltägliche Art aus Zaire davongemacht: auf Trockenfisch sitzend und im Tiefflug, weil der Druckausgleich in der Maschine nicht funktionierte. Wohlbehalten angekommen sind wir trotzdem, die Fische und ich.
Also, auf Reisen gewöhnt man sich die Ängstlichkeit schon ab. Als Grundstimmung kann Angst wohl nur in einer sicheren Gesellschaft aufkommen, die einem die Erfahrung vorenthält, dass heikle Situationen zu überstehen und selbst bedrohliche zu überleben sind – wo man sich, kurz gesagt, nicht auf sich selbst oder Gott, sondern auf den Staat und die Polizei verlässt. Vielleicht hat es die Angst in Deutschland deshalb so leicht, weil Corona viele Menschen hier aus ihrer Sicherheit herausgerissen hat – plötzlich und vielleicht zum ersten Mal stellen sie jetzt fest, dass ihr Leben an einem seidenen Faden hängt. Das tut es zwar immer, aber in einer Pandemie kann man die Augen nicht mehr davor verschließen. Ich dagegen habe mich mit dem Gedanken an den Tod schon in frühester Kindheit vertraut machen müssen.
In jungen Jahren war ich ständig krank, mal für drei, mal für sechs Monate im Jahr. Ob ich überleben würde, war nicht abzusehen. Mit vier Jahren wurde ich wegen einer Bronchitis in eine Kinderklinik eingewiesen, aus Platzmangel aber privat untergebracht, und dort ist es an meinem Bett zu folgender Szene gekommen: Nachdem der Arzt seine Untersuchung abgeschlossen hatte, wandte er sich an meine Mutter und meinte mit einem Blick auf mich: „Also, Frau Wolf, den können Sie vergessen. Den bringen wir nicht durch.“ Man kann sich denken: Der Ehemann im Krieg, der einzige Sohn so gut wie tot – meine Mutter ist in Tränen zerflossen, und wer weiß, vielleicht hätte der Arzt recht behalten, wäre meiner Zimmerwirtin nicht ein altes Hausmittel eingefallen. „Frau Wolf“, sagte sie, „machen Sie sich keine Sorgen! Den bringen wir sehr wohl durch, und zwar mit Schmalzwickeln.“ Und so war es. Ich verdanke diese Geschichte einer 89-jährigen Dame, die als 16-jähriges Mädchen seinerzeit dabei gewesen ist. Ich hatte gar keine Erinnerung mehr an diesen Vorfall. So bleibt mir abschließend nur zu sagen: Lungenkrankheiten wurden in jenen Tagen mit Schmalzwickeln kuriert, und mir scheinen sie gutgetan zu haben.
Durchaus möglich also, dass ich mir meine Gelassenheit schon in frühen Jahren angewöhnt habe. Ganz sicher aber verdanke ich meine Furchtlosigkeit auch einem gesunden christlichen Fatalismus. „Herr, in deine Hände lege ich mein Leben“, diesen Psalmvers singe ich in der Gemeinschaft meiner Mitbrüder an jedem Abend, bin folglich auf alles gefasst und glaube dennoch, dass es das Leben und der Herrgott gut mit mir meinen. Ich war daher keineswegs verwundert, als mir der Chefarzt einer Freiburger Klinik drei Tage vor dem ersten Lockdown beim Abschied versicherte, ich habe vom Coronavirus nichts zu befürchten. „Mit Ihrer Gelassenheit und Ihrem Humor verfügen Sie über eine sagenhafte Immunität“, sagte er. „Machen Sie sich also keine Sorgen.“
Ich widersprach ihm nicht. Ich bin überzeugt, dass es diese seelische Schutzhülle gibt. Wie oft habe ich erlebt, dass selbst Schwerkranke genesen sind, nachdem sie neuen Lebensmut gefasst hatten. Ich bin sicher: Nicht allein die Produkte der pharmazeutischen Industrie hatten für diesen Umschwung gesorgt, sondern vor allem ihr wiedererwachter Lebenswille, ihr Glaube an ihre Heilung, ihre Freude aufs Leben. Natürliche Immunität – nicht ausgeschlossen, dass meine Unbekümmertheit auch daher rührt.
Aber restlos zu klären ist es wohl nie, dass den einen kalt lässt, was den anderen in Panik versetzt. Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen, sie gründen ihr Leben auch auf unterschiedliche Gewissheiten, und ich würde keinen verurteilen, der sich größere Sorgen um seine Gesundheit macht als ich. Dennoch bin ich beunruhigt. Dennoch macht es mir beinahe Angst, wie die Angst um sich greift, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. Für mich sieht es sogar danach aus, dass Ängstlichkeit gesellschaftsfähig, ja zum Gebot der Stunde geworden ist. Das Schlimme daran ist: Wen die Angst befällt, den macht sie schwach, sie selbst aber ist mächtig. Sie hat die Macht, die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, denn wo die Ängstlichen den Ton angeben, wird Angst zur Tugend. Dann werden die Furchtsamen zu Helden und die Furchtlosen zu Verrätern. Dann wird das Sicherheitsbedürfnis der Ängstlichen auch in der Politik zum Maßstab für richtiges Handeln und die Selbstsicherheit der Unerschrockenen zum Störfaktor.
In diesem Buch möchte ich mich daher mit dem beschäftigen, was mir an unserer Welt größtes Unbehagen bereitet, nämlich die Angst. Insbesondere die Berührungsangst, weil wir alle dieser Form der Angst mittlerweile auf Schritt und Tritt begegnen, tagtäglich. Eine Pandemie geht vorüber, Corona wird vielleicht schon bald der Vergangenheit angehören, doch diese Angst wird bleiben, weil sie mehr als eine Ursache hat. Noch ausführlicher aber will ich auf jemanden eingehen, der die Angst in seinem Leben weit hinter sich gelassen hat. Der seine Anhänger immer wieder ermutigt, der sich von Menschen nichts hat bieten und vom Dämon der Ängstlichkeit nicht hat einschüchtern lassen.
2. INDIANERFREIE ZUKUNFT
Nach allem, was ich höre und lese, wird die Welt mit jedem Tag gefährlicher. Nicht nur die Gegenwart ist heute bedrohlich, auch die Zukunft verheißt nichts Gutes, und selbst die Vergangenheit steckt voll ungeahnter Gefahren. Beginnen wir mit der Vergangenheit. Ich begebe mich dafür in das Kunstmuseum einer deutschen Großstadt.
Dieses Kunstmuseum veranstaltet eine Sonderausstellung der Bilder von Wassily Kandinsky. Jetzt weiß man: Der weltberühmte Maler war ein Mann des Fortschritts; er gilt als der Erste, der den Schritt in die abstrakte Malerei gewagt hat. Allerdings hat er sich etwas erlaubt, was die Museumsleitung in größte Verlegenheit gebracht hat: Er hat Indianer gemalt, und im Titel des Bildes werden sie auch als solche bezeichnet – als Indianer eben. Was liest man nun auf dem Erläuterungstäfelchen, das neben dem Bild an der Museumswand hängt? Man liest „I…“. Mehr als der Anfangsbuchstabe und drei Pünktchen sind von den Indianern in diesem Text nicht übrig geblieben. Aber vielleicht muss man schon froh sein, dass dieses Bild überhaupt gezeigt wird. Und vielleicht ist es das letzte Mal, dass es der Öffentlichkeit zugemutet wird. Ich sehe nämlich kommen, dass auch dieses einsame große „I“, das schon wie der Entsetzensschrei eines angeekelten Menschen klingt, in absehbarer Zeit gegen Anstand und Moral verstoßen wird. Damit hätte dann auch Kandinskys Gemälde sein Daseinsrecht verwirkt. Es würde wahrscheinlich nicht verbrannt werden, aber in der Versenkung verschwinden müssen.
Wie eigentlich alles, was Europa in den letzten zweieinhalb Jahrtausenden an Kunst und Kultur, an Malerei, an Literatur, an Liedern, an Theaterstücken und später auch an Filmen hervorgebracht hat. Wie lautet der Vorwurf? Dass nichts davon auf der einzigartigen Höhe des moralischen Empfindens unserer Zeit ist. Dass alles in irgendeinem Sinne menschenfeindlich, beleidigend und damit anstößig ist, und Anstößiges muss verbannt, womöglich vernichtet werden.
Aber – kommt uns das nicht bekannt vor? Haben wir nicht schon in früheren Zeiten immer wieder Versuche erlebt, eine bestimmte Moral ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen? Mir jedenfalls kommt bei diesem Thema eine Begebenheit in den Sinn, die zu den dunklen Kapiteln der europäischen Geschichte gehört.
Um das Jahr 1550 kam der spanische Bischof Diego de Landa nach Mexiko, ins Land der Maya. Er war ein frommer und redlicher Mann. Ihn störte nicht einmal, dass er von seinen Landsleuten in Mexiko als „Indianerfreund“ beschimpft wurde, weil er geflohenen indianischen Sklaven in seinen Kirchen Asyl gewährte. Nein, dieser Diego de Landa war auch in unseren Augen untadelig. Eines Tages aber wurde er Zeuge einer blutigen Zeremonie seiner Schützlinge zu Ehren ihrer alten Götter, und von heiligem Zorn ergriffen beschloss er, hart durchzugreifen: Er ließ foltern, er ließ hinrichten, und – er übergab alle Maya-Bücher, deren er habhaft werden konnte, dem Feuer. Und während die alten Kodizes mit der wunderschönen Bilderschrift in Flammen aufgingen, schrieb er an seine Vorgesetzten in Spanien: „Wir fanden bei ihnen eine große Anzahl von Büchern, und weil sie nichts enthielten, das von Aberglauben und den Täuschungen des Teufels frei gewesen wäre, verbrannten wir sie alle …“
Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck, dass wir gerade etwas Ähnliches erleben. Überaus rechtschaffene Menschen, ähnlich wie Bischof Landa mit einem untrüglichen Gespür für Gut und Böse ausgestattet, haben entdeckt, dass unser ganzes kulturelles Erbe vergiftet ist. Literatur, Philosophie und Kunst, nichts davon scheint in ihren Augen frei von dem rassistischen Aberglauben oder den Einflüsterungen eines politisch unkorrekten Teufels zu sein. Der heilige Zorn der modernen Moralwächter darüber entlädt sich im Internet, aber auch in Aktionen, die an das Strafgericht des Bischofs Landa erinnern – ein falsches Wort, und die Hetzjagd auf den Übeltäter beginnt. Auch als Besucher einer Kandinsky-Ausstellung in einem deutschen Museum bekommt man so noch die Auswirkungen ihres Zorns zu spüren.
Uns erwartet also eine neue, eine bessere Zeit. Unsere Zukunft wird indianerfrei und damit freundlicher sein. Oder anders gesagt: In dieser Zukunft wird die Berührungsangst herrschen, denn schließlich – wir müssen vor uns selbst geschützt werden. Vor unserer ganzen verdorbenen Vergangenheit. Vor unserer verdorbenen Sprache. Vor unseren genauso verdorbenen Traditionen und Denkgewohnheiten. Aus dem moralisch einwandfreien neuen Menschen wird nie etwas, solange zum Beispiel in der Villa Medici in Rom Wandteppiche aus dem 18. Jahrhundert hängen. Auf diesen Teppichen sind Indianer abgebildet, die Teppiche verherrlichen mithin die Eroberung Amerikas und könnten beim Betrachter kolonialistische Gelüste wecken, doch keine Sorge – im Dezember 2021 wurden die anstößigen Wandbehänge vorsorglich entfernt. Genauso schändlich ein Wandbild im Bahnhof von Zürich aus dem Jahr 1926. Es zeigt einen Afrikaner, einen Orientalen und einen Menschen mit asiatischen Zügen, die Produkte ihrer Heimat anbieten, wie exotische Früchte und Tee. Ein Kaufhaus hat seinerzeit damit für sich geworben. Der sensible Betrachter von heute aber erkennt darin eine Glorifizierung der Sklaverei und muss daher vor dem Anblick dieser drei lächelnden Gestalten bewahrt werden. Man könnte dieses Wandbild einfach übermalen, nur steht es unter Denkmalsschutz; der Stadt Zürich sind aus diesem Grund die Hände gebunden, sie muss sich mit einem Warnhinweis begnügen.
Man sieht: Die Moralwächter meinen es mit uns gut. Je weniger wir mit der Vergangenheit in Berührung kommen, desto besser für uns, denn in jedem von uns schlummert ein Rassist, ein Kolonialist, irgendetwas Bösartiges, das wachgerüttelt werden könnte – durch alte Bilder, alte Texte, alte Ideen, überhaupt alles, was aus der Vergangenheit zu uns spricht. Offenbar hat sich die westliche Menschheit bis vor Kurzem auf einem furchtbaren Holzweg befunden, moralisch wie kulturell.
Doch auch die Gegenwart ist alles andere als ungefährlich. Wie schon erwähnt, bedroht sie vor allem unsere Sicherheit, nämlich Leib und Leben, und wieder bricht die Berührungsangst aus, wieder verspricht man sich von Kontaktverboten die Rettung. Welche Blüten die Berührungsangst treibt, will ich an einem eigenen Erlebnis zeigen.
Anfang Dezember 2021 flog ich nach Inkamana in Südafrika, um in einem unserer Klöster Exerzitien zu leiten. Natürlich hatten mich besorgte Menschen in Deutschland vorher eindringlich gewarnt. Gerade war die Omikronvariante des Coronavirus in Südafrika aufgetaucht, und man legte mir nahe, die Reise abzusagen. Ich flog trotzdem, ich wurde gebraucht.
Die afrikanischen Mönche nahmen den Gast aus dem coronaverseuchten Deutschland mit großer Herzlichkeit auf. In den folgenden Tagen ließen wir alle die nötige Umsicht walten, ich selbst vermied jeden Kontakt mit der Bevölkerung, und der PCR-Test kurz vor meiner Rückreise fiel negativ aus. Wie verlangt, gab ich diesen Befund von Südafrika aus an die Fluggesellschaft durch, und damit ging’s los: Ein Anrufer aus dem Gesundheitsamt im fernen Landsberg erteilte mir genaueste Verhaltensmaßregeln. Auf dem Flughafen München, so sagte er, würden mich zwei Polizisten in Empfang nehmen, um mich sozusagen umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. Nun gut.
Ich kam in München an, doch von den angekündigten Polizisten war nichts zu sehen. Gehorsam, wie ich bin, schleppte ich mein Gepäck zur ersten Teststation, wo man sich allerdings zu vPCR-Test, einem sequentiellen PCR-Test, genauso wenig in der Lage sah wie bei der zweiten, ließ wenigstens einen Antigen-Test machen und setzte mich dann zu einer befreundeten Ärztin ins Auto. Sie hatte sich bereit erklärt, mich nach St. Ottilien zu fahren, und als wir mein Heimatkloster schon fast erreicht hatten, meldete sich das Gesundheitsamt Landsberg erneut: Diese Frau dürfe mich auf keinen Fall nach Hause bringen! Ich müsse stattdessen einen Mietwagen nehmen – und jeden weiteren Kontakt mit Menschen vermeiden! Dazu war es nun zu spät, aber der Mann am anderen Ende der Leitung tat mir leid. Er stand ja selbst unter Druck, und nun befürchtete er das Schlimmste. „Aber die nächsten 14 Tage dürfen Sie Ihr Zimmer nicht mehr verlassen!“, schärfte er mir ein.
Die folgenden zwei Wochen gehören zu den unangenehmsten Erinnerungen meines Lebens. Als gesunder Mensch saß ich auf meinem Zimmer, isoliert, buchstäblich von der Außenwelt abgeschlossen, und das Essen wurde mir vor die Tür gestellt. An den Weihnachtsfeierlichkeiten meiner Mitbrüder durfte ich nicht teilnehmen. Anfangs hatte ich noch Schreibarbeiten erledigt; später saß ich nur noch herum, kraftlos und wie gelähmt, weil einem ohne körperliche Bewegung sogar die Lust am Denken vergeht. Kurz gesagt: Ans Alleinsein bin ich gewöhnt, aber das sinnlose Eingesperrtsein machte mich fertig. Ich verstehe seither besser, dass Menschen unter Quarantänebedingungen depressiv werden können.
Meine Erfahrungen der letzten Jahre lassen sich also ungefähr folgendermaßen zusammenfassen: Wir scheinen in einer infizierten Welt zu leben. Unsere seelische Gesundheit wird von dem Virus böser Worte und böser Ideen angegriffen, und unsere physische Gesundheit wird von genauso bösartigen biologischen Viren bedroht. Im Grunde müssten wir unentwegt auf der Hut sein und alles als Gefahrenquelle betrachten, unsere Kultur wie unsere Mitmenschen. Und beides müsste uns in Angst und Schrecken versetzen, denn welcher Text eines Popsongs enthält keine sexistischen Passagen? Welcher Autor des 19. Jahrhunderts hat sich um politische Korrektheit geschert? Welcher Film der letzten hundert Jahre wartet mit dem aktuellsten Frauenbild auf? Und was unsere Mitmenschen angeht – jeder, selbst die älteste und beste Freundin, könnte das Virus einschleppen und zur Gefahr für Leib und Leben werden. Wäre es da nicht wirklich das Klügste, kein Buch mehr anzufassen, keinen Song mehr zu streamen und die Tür hinter uns gut zu verriegeln?
Hütet euch! Geht auf Distanz! Lasst Bilder, Bücher und Menschen erst gar nicht an euch heran! Auf die knappste Formel gebracht, lauten die Anweisungen von Moralwächtern und Gesundheitsaposteln tatsächlich so. Aber sie wissen auch, wie wir zu retten wären, und nachdem sie die Angst geschürt haben, raten sie uns zur nächsten Angst, zur – Berührungsangst. Mit anderen Worten: Angst soll mit Angst bekämpft werden. Eine Angst soll die andere vertreiben, denn wo keine Berührung, da keine Ansteckung. Damit wären wir endgültig in einer Welt angekommen, die den Furchtsamen und Gehorsamen gehört. Aber, gefällt uns diese Welt überhaupt?
Mir nicht. Ich teile nämlich die Sorgen von Moralwächtern und Gesundheitsaposteln nicht. Ich bin zwar gerne bereit, mich über Mitmenschen jeder Herkunft und Hautfarbe freundlich zu äußern. Ich bin genauso gerne bereit, in einer Pandemie Schutzmaßnahmen zu ergreifen, und lasse mich dafür auch impfen. Aber ich lasse mir ungern vorschreiben, wie ich zu denken, wie ich zu reden, was ich mir anzuschauen oder zu lesen oder anzuhören habe und mit wem ich verkehre. Ich male nun mal lieber den Herrgott als den Teufel an die Wand und finde die Welt nicht halb so schrecklich wie jene, die mich mal warnend, mal drohend vom Segen der Berührungsangst überzeugen wollen. Mehr als jede Berührung stört mich der Verfolgungswahn von Leuten, die hinter jeder Straßenecke einen Ausländerfeind vermuten und in jedem Mitmenschen eine Gefahr für meine Gesundheit erblicken. Nur – was hilft denn tatsächlich gegen die Angst, wenn sie sich wie ein Lauffeuer ausbreitet und wie ein Steppenbrand wütet?
Meine Antwort wird Sie vielleicht überraschen. Auch für mich war es eine Entdeckung, als mir bei der Beschäftigung mit den Evangelien in den letzten Jahren allmählich klar wurde: Mit Jesus Christus haben wir das Paradebeispiel eines politisch unkorrekten Menschen vor uns. Seine Unerschrockenheit war mir bekannt. Dass er die Ängstlichkeit seiner Jünger mit freundlichem Spott bedacht hat, wusste ich – sein Kommentar „ihr Kleingläubigen“ wäre wohl treffender mit „ihr Angsthasen“ zu übersetzen. Aber vor dem Hintergrund einer verunsicherten Gegenwart habe ich die Evangelien mit anderen Augen gelesen und gemerkt: Dieser Jesus bietet dem Zeitgeist die Stirn. Er ist nicht einzuschüchtern und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er stößt seine Zuhörer vor den Kopf, nimmt in Kauf, sich Feinde zu machen, und hat auch noch Vergnügen daran. Er lässt sich in die hitzigen Auseinandersetzungen seiner Zeit hineinziehen und gibt niemals um des lieben Friedens willen klein bei; ständig muss man bei ihm mit unerhörten, ja skandalösen Äußerungen rechnen. Seine kämpferische Natur macht nur einen Teil seines Wesens aus, das ist richtig, aber wahr ist auch: Das liebe Jesuslein hat es nie gegeben (allenfalls in der Krippe) – wohl aber den Jesus, der seine Anhänger ermutigt, sich von den Meinungsführern und Sittenwächtern seiner Zeit nichts bieten zu lassen. Er könnte auch uns Heutigen einiges zu sagen haben. Mit diesem Jesus will ich mich jedenfalls auf den folgenden Seiten befassen, wobei gelegentliche Abstecher in unsere Gegenwart nicht ausgeschlossen sind.
Und noch eins: Wenn ich im Folgenden aus den Evangelien zitiere, werde ich mich an keine der gängigen Übersetzungen halten. Die Sprache der Bibel ist uns heute fremd und gleichzeitig allzu vertraut, sie vermag uns kaum noch zu packen. Dabei sind vor allem das Markus- und das Matthäusevangelium in einem forschen, mitreißenden Reportage-Stil geschrieben, auch Johannes ist ein Meister der Dramatik, und ich werde versuchen, diesen Texten durch eine etwas modernere Sprache ihre Unmittelbarkeit und Frische zurückzugeben.
3. JESUS AUS NÄCHSTER NÄHE
„Warum tun deine Jünger, was am Sabbat verboten ist?“ „Für wen hältst du dich?“ „Er ist von Sinnen!“ „Mit Steuereintreibern und Sündern sitzt er an einem Tisch!“ „Durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus!“ „Wie kann er sagen: Er ist vom Himmel herabgekommen? Wir kennen doch seinen Vater und die ganze Mischpoke!“ „Er hat den Verstand verloren!“ „Unmöglich, sich diesen Menschen anzuhören, ohne in Rage zu geraten!“ „Er ist ein Fresser und Säufer!“ „Warum hört ihr auf ihn?“ „Ist das nicht der, den sie am liebsten töten würden?“
So lauten die Kommentare, die Zwischenrufe und Randbemerkungen, wo immer Jesus auftritt. Sicher, es sind auch andere Stimmen zu hören, die Stimmen seiner Anhänger und Bewunderer, jener, die nichts auf ihn kommen lassen, und so dürfen wir annehmen, dass es bei seinen Veranstaltungen oft laut und hoch und heftig hergeht. Womöglich kommt es zu Demonstrationen und Gegendemonstrationen, und seine Gegner werden seine Verhaftung herbeisehnen.
Denn Jesus ist berüchtigt. Von einigen wohl auch gefürchtet. Kein Mann der sanften Töne jedenfalls. Hat er nicht im Tempel um sich geschlagen? Die Evangelisten berichten übereinstimmend von diesem Vorfall, wie sie uns auch die unterschiedlichen Reaktionen seines Publikums überliefern, und die sogenannte Tempelreinigung war durchaus keine symbolische Aktion: Er soll Stricke zusammengebunden haben und damit auf Geldwechsler und Taubenhändler und deren Kunden losgegangen sein, er soll Tische und Stühle umgestoßen und Opfertiere auseinandergejagt und dabei gerufen haben: „Raus mit euch! Ihr habt das Haus meines Vaters zum Kaufhaus gemacht!“ Offenbar hatten die Römer den Vorfall nicht mitbekommen, sonst wären sie eingeschritten, und von Jesus hätte man nie mehr gehört. Temperament, heißes Blut und eine ordentliche Portion Verwegenheit kann man ihm also nicht absprechen. Übrigens kaum glaubhaft, dass seine Jünger im Tempel nicht kräftig mitgemischt haben sollten; sie waren ja dabei gewesen.
Nein, kein Mann der sanften Töne. Wir werden später noch sehen, dass selbst die Bergpredigt kein Friedensgesäusel ist, sondern ein Brocken, der manchem Zuhörer schwer im Magen gelegen haben dürfte. Ich bin daher überzeugt: Keiner, der Jesus aus nächster Nähe erlebt hat, wird ihn hinterher für einen Stubengelehrten, einen abgeklärten Weisen oder einen stets lächelnden Guru gehalten haben. Nicht von ungefähr stellen die Evangelisten ein ums andere Mal fest, dass Jesus als Redner Furore macht. Und an dieser Stelle möchte ich eine persönliche Bemerkung einflechten.
Für mich gibt es keine ergreifendere Botschaft als die, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Wen diese Botschaft trifft, der spürt ihre Wucht, der kann sich ihrer Wirkung nicht entziehen. Die Anziehungskraft des christlichen Glaubens beruht auf dieser Botschaft. Aber diesmal soll mich weniger der Gottessohn im Menschensohn als vielmehr der Menschensohn im Gottessohn interessieren. Ich will die Evangelien deshalb nicht wie ein Theologe lesen, der eine zeitlose Wahrheit zu finden hofft, sondern eher wie ein Zeitungsleser, der sich auf die realistischen Details einer Reportage konzentriert. Und die Evangelien strotzen vor Realismus.
Man stelle sich vor, uns lägen nichts als die Reden und Aussprüche Jesu vor – von dem Mann selbst könnten wir uns dann kein Bild machen. Aber wir haben Glück. Die Evangelien sind sozusagen die Memoiren der Jünger. Die Lebensgeschichte Jesu erleben wir durch ihre Augen, aus ihrer Perspektive. Sie haben Jesus tatsächlich aus der Nähe erlebt, als einen Menschen unter Menschen in konkreten, oft dramatischen Situationen. Selbst im Wissen um seinen Tod und seine Auferstehung liefern die Evangelisten uns das Porträt eines zwar ungewöhnlichen, aber ganz realen Menschen mit seinen Schwächen und Stärken, der seine großen Auftritte wie auch seine weniger glanzvollen Momente hat. Mit demselben Realismus werden übrigens auch alle anderen Beteiligten beschrieben.