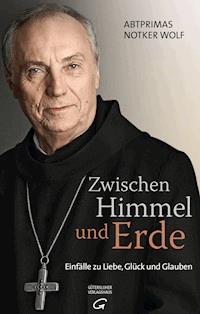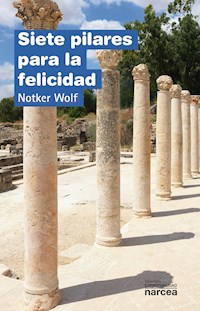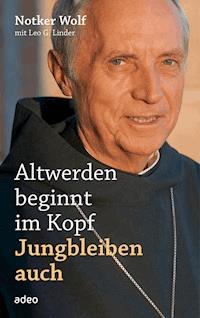
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Es ist merkwürdig. Die eigene Lage wird ernster - immerhin gehe ich nun auf die fünfundsiebzig zu -, aber die Welt nötigt mir immer häufiger ein mildes oder amüsiertes Lächeln ab. Die Welt in Gestalt von überängstlichen oder aufgeregten oder großmächtigen Zeitgenossen zum Beispiel. Zwar habe ich mir auch früher Freiheiten genommen - die Freiheit, Dinge beim Namen zu nennen, oder die Freiheit, mich lustig zu machen. Mit den Jahren hat die innere Freiheit allerdings weiter zugenommen. Sie ist ein schönes Geschenk des Alters. Mit Applaus werden die meisten von uns nicht rechnen dürfen. Umso dringender haben wir den Humor in unseren späten Lebensjahren nötig. Denn eigentlich ist es ja zum Schreien. Zum Schreien komisch und zum Schreien traurig: Die Kräfte nehmen ab - ausgerechnet jetzt, wo wir noch nie so gut waren. Wo wir noch nie so reich waren, reich an Erfahrungen, reich an Wissen, reich an Verständnis, Einsichten und Menschenkenntnis. Haben wir uns das früher nicht immer gewünscht, diese Gelassenheit, diese Selbstsicherheit, diese innere Freiheit, diese Souveränität?" Abtprimas Notker Wolf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
von Notker Wolf mit Leo G. Linder
Altwerdenbeginntim Kopf – Jungbleibenauch
Inhalt
1. Ciao, bella!
2. Ohne Plan lebt es sich besser
3. Pink Floyd lässt grüßen
4. Famose alte Männer
5. Endzeitstimmung
6. Wo Züge abfahren …
7. Ein Privileg des Alters
8. Wir werden beneidet
9. Das Erschrecken
10. Forever young
11. Euer Herz sei stark und unverzagt
12. Unheimliche Jugend
13. Ehre Vater und Mutter
14. Mein Friseur und Papst Franziskus
15. Von der Kürze des Lebens
16. Vom erfüllten Leben
17. Antwort auf Seneca
18. Hauptsache, gesund?
19. Es reicht, es ist genug
20. Seele, geliebte, du schweifende
21. Wege aus der Einsamkeit
22. Vom Verblassen der Welt
23. Postskriptum
1. Ciao, bella!
Je älter ich werde, desto schwerer macht es mir die Welt, sie ernst zu nehmen. Aus der Nähe kann sie unerbittlich, geradezu bedrohlich wirken, aber mit wachsendem Abstand nimmt sie immer komischere Züge an. Wenn mir die Welt so kommt, komisch eben oder lächerlich, ziehe ich an meiner Pfeife, grinse in mich hinein und denke: „Nur zu. Spielt euch ruhig auf. Strampelt euch ruhig ab. In mir findet ihr jederzeit einen dankbaren Zuschauer.“ Und nicht immer unterdrücke ich meine Lust, über das Schauspiel, das die Welt mir bietet, zu lästern. Natürlich ist mein Mundwerk daran schuld. Aber auch das zunehmende Alter.
Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Vor Jahren lud mich der damalige Bundespräsident Roman Herzog ein, ihn auf einer Reise durch Korea zu begleiten. Unterwegs kam ich einmal im Bus neben ihm zu sitzen. Herzog war Mitte sechzig und ich fragte ihn nach seinen Plänen für die Zeit danach.
„Herr Bundespräsident, was werden Sie nach Ablauf Ihrer Amtszeit tun? Was haben Sie noch vor?“
„Meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. An der ich im Augenblick leider gehindert werde“, entgegnete er.
Ich sah ihn an. „Ja, und das wäre?“
„Spotten.“
Ich musste lachen. Die Antwort gefiel mir. „Da haben wir beide dieselbe Schwäche – oder Stärke“, stellte ich fest. Und bedauerte ihn: Wie schrecklich, von Amts wegen den Mund halten zu müssen.
Es ist merkwürdig. Die eigene Lage wird ernster – immerhin gehe ich nun auf die fünfundsiebzig zu –, aber die Welt nötigt mir immer häufiger ein mildes oder amüsiertes Lächeln ab. Die Welt in Gestalt von überängstlichen oder aufgeregten oder großmächtigen Zeitgenossen zum Beispiel. Zwar habe ich mir auch früher Freiheiten genommen – die Freiheit, Dinge beim Namen zu nennen, oder die Freiheit, mich lustig zu machen; das offene Wort, die kleine Boshaftigkeit gehörten für mich schon immer zu den Vorzügen benediktinischer Unabhängigkeit. Mit den Jahren hat die innere Freiheit allerdings weiter zugenommen.
Diese Freiheit ist ein schönes Geschenk des Alters. Aber vielleicht ist die Lust am Lästern nur ein Übergangsstadium. Zu den richtig Alten darf ich mich ja noch nicht rechnen, und womöglich bringe ich es irgendwann zu diesem wahrhaft liebenswürdigen Humor, der die Begegnung mit alten Menschen so durch und durch erfreulich macht. Mir fallen dazu immer zwei hochbetagte Frauen ein, deren zufällige Bekanntschaft ich eines Tages in einem italienischen Bergdorf machte.
Auf dem Weg zur Pfarrei bog ich in eine enge Gasse ein und da saßen sie in trauter Zweisamkeit auf einer knorrigen Holzbank an die Hauswand gelehnt und blinzelten in die späte Nachmittagssonne. Kaum hatte ich sie erreicht, wurden sie munter und ergriffen beherzt die Gelegenheit zum Schwätzchen mit einem Fremden. Woher ich komme, wollten sie wissen, was mich in ihr Dorf führe und allerlei mehr.
Die Freude über eine willkommene Abwechslung gab ihnen immer neue Fragen ein, amüsiert stand ich Rede und Antwort, wir plauderten, wir machten Scherze, und dann forderte mich die eine mit verschmitztem Lächeln auf: „Raten Sie mal, wie alt unsere Elisabetta hier ist.“
Das war nun schwer zu sagen. Elisabetta konnte alles zwischen siebzig und hundert sein, also wiegte ich den Kopf und tippte auf „etwas über fünfundsiebzig“. Offenbar lag ich damit aber hoffnungslos falsch, denn die Fragestellerin winkte energisch ab.
„Ach was!“, wies sie mich mit gespielter Entrüstung zurecht – „zweiundneunzig!“
Und Elisabetta ergänzte mit erhobenem Zeigefinger: „Plus zwei Monate.“
Wir lachten. Ich sprach Elisabetta meine aufrichtige Anerkennung dafür aus, wie gut ihr diese zweiundneunzig Jahre standen, und versprach, an ihrem hundertsten Geburtstag wieder vorbeizukommen …
Schmunzelnd setzte ich meinen Weg fort. In solchen Augenblicken kommt es mir vor, als wären diese liebenswerten alten Menschen die reinste und erfreulichste Verkörperung unserer Spezies. Wie leicht es fällt, im Gespräch mit ihnen einen warmherzigen und humorvollen Ton anzuschlagen. Wie wohltuend dieses freundliche Geplänkel ganz ohne selbstgefällige Hintergedanken ist. Natürlich, sie verlangen vom Leben nicht mehr viel. Sie sind bescheiden geworden, sie sind anspruchslos geworden und wirken wohl gerade deshalb wie befreit. Befreit vom Wünschen und Begehren, befreit von der Gier, auch von der Lebensgier.
Das Leben wird die beiden auf ihrer Bank so oft durchgerüttelt haben, so oft in Entzücken versetzt und so oft enttäuscht haben, dass sie auf jeden Fall eins gelernt hatten: dieses Leben hinzunehmen, wie es kommt. Kein Widerstand, kein Aufbäumen, kein Vorbehalt gegen das eigene Schicksal mehr. Die Regeln der Welt hatten für sie weitgehend ihre Gültigkeit verloren; sie brauchten ja auch nicht mehr einzugreifen, sie hatten längst den Rückzug angetreten, und dieses allmähliche Abschiednehmen hatte bei ihnen einen arglosen, geradezu sonnigen Humor freigesetzt, den sie früher vielleicht gar nicht besessen hatten. Damit waren sie mir einen Schritt voraus.
Die zweiundneunzigjährige Elisabetta hatte mein Kompliment mit einem Lächeln quittiert, in dem sich ein kleiner, berechtigter Stolz mit leichter Wehmut mischte. Sind Stolz und Wehmut die entscheidenden Bestandteile dieses Humors, den uns das Alter – im günstigen Falle – schenkt? In einem anderen, mir unvergesslichen Beispiel für den Humor alter Menschen tritt jedenfalls beides, Stolz und Wehmut, deutlich zutage. Die Hauptrolle spielt hier eine Gestalt, die mir als Charakter auf der Bühne des römischen Alltags besonders ans Herz gewachsen ist: die in die Jahre gekommene Römerin.
Sie halten auf sich, diese alten Römerinnen, das sei vorausgeschickt. Sie gehen nicht aus, ohne sich vorher zu schminken, sorgfältig die Frisur zu richten und Schmuck anzulegen. Sie sind Damen, sie wollen gesehen und wahrgenommen werden, und so bewegen sie sich auch, gemessenen Schrittes und erhobenen Hauptes. Sie haben Stil und Stil kommt in Rom immer gut an. Eine solche alte Dame trat also neben mich, als ich in der Markthalle meines Viertels einkaufte, und so wurde ich Zeuge der folgenden Szene:
In voller Pracht und Schönheit baute sie sich vor dem Stand des Lebensmittelhändlers auf, nur um zunächst ausgiebig mit dem Mann zu plaudern. Er wird ihre Geschichten alle schon gekannt haben, aber – der Mensch lebt nicht vom Brot allein, und zum großen Auftritt gehört die Ouvertüre. Als Nächstes ging sie daran, ihren Einkauf mit größtem Bedacht und ebensolcher Kennerschaft zusammenzustellen. Der Schinken wurde probiert, der Käse befühlt, die Honigmelone berochen und alles Stück für Stück wie Kostbarkeiten ausgewählt – ein Schauspiel für sich.
Und als sie schließlich ihre Delikatessen in zwei Einkaufstaschen verstaut hatte und sich zum Gehen wandte, rief ihr der Verkäufer zum Abschied ein „Ciao, bella!“ nach.
„Tschüss, meine Hübsche“, so könnte man diese zwei italienischen Worte übersetzen, aber das trifft es nicht, das klingt etwas herablassend. Denn hier war es als echtes Kompliment gemeint, anerkennend und gleichzeitig natürlich humorvoll – so, als würde er in ihr immer noch die attraktive junge Frau sehen, die sie vor langer Zeit einmal gewesen war. Und wie reagierte die alte Dame? Mit einem bittersüßen Lächeln warf sie dem galanten Händler ein einziges Wort zu: „Magari.“ Was hier so viel heißt wie: „Ach ja, schön wär’s.“
Magari … Das ganze Drama des Lebens in einem einzigen Wort. Denn diese alte Römerin machte sich ja keine Illusionen. Sie hatte längst gelernt, dass man von vielem Abschied nehmen muss. Aber sie stand dazu: zu ihrem Wunsch nach Schönheit und Bewunderung genauso wie zu der Tatsache, dass ihre besten Tage weit hinter ihr lagen. Magari – wie schön es wäre … Und ich dachte auf dem immer schwerer fallenden Anstieg vom Markt hinauf zu meinem Kloster Sant’Anselmo: „Ja, das ist wohl das Klügste. Vielleicht ist es sogar weise. Wenn alles nichts mehr hilft, wenn die Jahre nicht mehr zu verbergen sind, kann man sie immer noch überspielen.“
Mit Stolz, gepaart mit Wehmut. Mit Humor eben, in allen seinen Spielarten. Als Spottlust, wie bei Roman Herzog oder mir. Als arglose Freude an harmlosen Scherzen wie bei Elisabetta und ihrer Freundin. Mit einem Einschlag lebenskluger Resignation wie bei der alten Römerin in der Markthalle. Oder in eine große, theatralische Geste verpackt wie beim römischen Kaiser Augustus, der, schon sterbenskrank, den Senat ein letztes Mal zu sich rief, geschminkt und frisiert vor der Versammlung erschien und seine kurze Abschiedsrede mit den Worten beschloss: „Wenn Ihnen meine Vorstellung gefallen hat, applaudieren Sie noch einmal.“
Mit Applaus werden die meisten von uns nicht rechnen dürfen. Umso dringender haben wir den Humor in unseren späten Lebensjahren nötig. Denn eigentlich ist es ja zum Schreien. Zum Schreien komisch und zum Schreien traurig: Die Kräfte nehmen ab – ausgerechnet jetzt, wo wir noch nie so gut waren. Wo wir noch nie so reich waren, reich an Erfahrungen, reich an Wissen, reich an Verständnis, Einsichten und Menschenkenntnis.
Haben wir uns das früher nicht immer gewünscht, diese Gelassenheit, diese Selbstsicherheit, diese innere Freiheit, diese Souveränität? Und kaum sind wir da angelangt, wo wir ein Leben lang hinwollten, sendet der Körper immer deutlichere Signale, dass es ihm langsam reicht. Eine Entscheidungsschlacht bahnt sich an. Eine Entscheidungsschlacht zwischen unserem Körper und unserem Ich, mit vorhersehbarem Ausgang.
„Sterben ist ein Scheißdreck.“ So knapp und drastisch bringt die Autorin Sibylle Berg ihr Entsetzen angesichts unserer Vergänglichkeit auf den Punkt. Und – spricht sie uns nicht aus dem Herzen? Dass wir eines Tages nicht mehr da sein sollen, ist ein unerträglicher Gedanke. Einmal in dieser Welt, wollen wir sie nicht mehr verlassen. Wir hoffen auf das Leben in seiner ganzen Herrlichkeit, Fülle, Intensität, seinem ganzen Zauber und hören nicht auf zu hoffen, gegen alle Vernunft. Der Tod ist der furchtbare Riss, der durch die Schöpfung geht.
Manche Menschen wachen, wenn sie das Alter erreicht haben, morgens schweißgebadet auf – wieder ist die Küste ein Stück näher gekommen! Die fremde Küste, an der unser Schiff zerschellen wird. Das Ende unserer Reise ist absehbar und wir erstarren. Solange wir uns erinnern, haben wir das offene Meer befahren und nichts als grenzenlose Weite um uns her gespürt, haben aus dem Gefühl gelebt, dass es weiter- und immer weitergeht – unbewusst, mit ungetrübter Selbstverständlichkeit.
Natürlich würde es ein Morgen und ein Übermorgen, ein nächstes und ein übernächstes Jahr geben, und immer würde uns unerhört Neues begegnen, immer würde Erhofftes eintreten und Unverhofftes uns in Atem halten. Das Bevorstehende war unüberschaubar, und wir lebten darauf zu, ohne dass es weniger wurde. Stets schöpften wir unseren Lebensmut aus dem unerschöpflichen Reichtum des Bevorstehenden.
Und dann ist plötzlich Land in Sicht. Ein schmaler, dunkler Küstenstreifen am Horizont zunächst, der aber mit jedem neuen Morgen näher kommt. Uns dämmert: Die Tage unserer Reise sind gezählt. Unser Kurs lässt sich nicht mehr korrigieren. Wir können zurückblicken, doch umzukehren ist uns verwehrt. Die ganzen Jahre haben wir in einem seligen Irrtum gelebt, haben wir uns an einer Illusion berauscht. In absehbarer Zeit werden wir nicht mehr mitspielen, und was jetzt noch bevorsteht, wird von uns nicht mehr sehnlich erwartet, wird nicht mehr herbeigewünscht. Diese Erkenntnis trifft uns unvorbereitet. Sie lässt manchen schweißgebadet aufwachen.
Aber – kann man überhaupt seinen Frieden schließen mit der Vergänglichkeit, dem Sterbenmüssen, diesem „Scheißdreck“? Oder ist das vergebliche Aufbäumen unserem Stolz angemessener? Ich erinnere mich an eine Todesanzeige, die eine einzige Anklage war. Eine Anklage gegen Gott, verfasst vom Ehemann der Verstorbenen. Nichts war in dieser Anzeige von Frieden, nichts von Versöhnung mit einem gnadenlosen Schicksal zu spüren.
„Wo warst du, lieber Gott?“, hieß es da. „Wo warst du, als meine Frau von einer heimtückischen Krankheit befallen und neun Monate lang falsch behandelt wurde? Wo warst du, als sie aus dem Leben gerissen wurde, nachdem sie ihre kranke Mutter jahrelang aufopferungsvoll gepflegt hatte? Wo warst du, als sie zwei Tage nach ihrer Mutter starb? Und warum bestrafst du mich mit ihrem grausamen Tod?“
Die Bitterkeit dieser Todesanzeige geht zu Herzen. Sie konfrontiert uns mit dem schauerlichen Abgrund unserer Existenz. In einem solchen Fall Humor anzumahnen, wäre obszön. Allerding habe ich oftmals erlebt, dass Kranken, Alten und selbst Sterbenden gar nichts von dieser Verbitterung anzumerken war, mit der eine Sibylle Berg unsere Vergänglichkeit verflucht, oder von der trostlosen Verzweiflung, mit der Angehörige auf Leiden und Tod eines geliebten Menschen reagieren. Mein Gedächtnis bewahrt vielmehr die Erinnerung an zahlreiche Menschen auf, die das Ende ihres Lebens gelassen kommen sahen und in einer Weise davon sprachen, die man tatsächlich nicht anders als heiter nennen kann.
Jedoch war diese Heiterkeit sozusagen ein Seitenzweig ihres Glaubens an Jesus Christus. Sie entsprang der Zuversicht, nach dem Tod durch Gottes Gnade zu einem neuen Leben bestimmt zu sein. Wenn ich an diese Menschen denke, kommt mir ihr Humor wie der kleine Bruder ihres Glaubens vor. Das schönste Beispiel für diese Haltung, die man wohl als Abgeklärtheit bezeichnen darf, ist und bleibt für mich Schwester Bertwina, die letzte deutsche Benediktinerin in einem rein koreanischen Konvent. Als ich sie in ihrem Kloster in Südkorea besuchte, feierte sie gerade ihren hundertsten Geburtstag.
Da ich es nicht an Höflichkeit fehlen lassen wollte, hatte ich mich mit einem Strauß aus hundert Teerosen auf den Weg zu ihr gemacht. Schwester Bertwina nahm die Blumen strahlend entgegen und klatschte begeistert, als ich ihr ein Ständchen auf der Querflöte darbrachte: Improvisationen über ein koreanisches Volkslied, gefolgt von deutschen Volksliedern. Dass sie überhaupt noch Freude empfinden konnte, nach allem, was sie durchgemacht hatte, war ein Wunder, denn nach dem Koreakrieg in den Fünfzigerjahren hatte sie die alltäglichen Qualen einer viereinhalbjährigen Gefangenschaft in einem nordkoreanischen Straflager einschließlich der üblichen Folterungen durchlebt.
Seltsamerweise schien diese Schreckenszeit keine Spuren in ihrem Gemüt hinterlassen zu haben, jedenfalls hegte sie nicht den geringsten Groll gegen ihre damaligen Peiniger.
„Das waren auch nur Menschen“, sagte sie mir. „Sie hatten ihre Befehle, und wer weiß, unter welchem Druck sie standen … Ich habe ihnen schon damals im Lager verziehen.“ Damit war die Sache für sie erledigt. Sie war versöhnt und die Versöhnung hatte ihr Herz vor der Verbitterung bewahrt. Im Übrigen erhob Schwester Bertwina auch keinen Anspruch auf Glück – vermutlich hatten ihr Enttäuschungen gerade deswegen nichts anhaben können.
Auf meine Frage, ob ich ihr einen Gefallen tun könne, antwortete sie: „Nein. Mein einziges Problem ist, dass es mir so gut geht.“ Und am Ende verabschiedete sie sich mit den Worten: „Auf Wiedersehen im Himmel – falls dort noch ein Platz für uns frei ist.“ Als ich ins Auto stieg, winkte sie mir fröhlich mit beiden Händen nach. Ich werde dieses Bild nie vergessen. Schwester Bertwina mit ihrer heiteren Gelassenheit war mir um mindestens einen Schritt voraus. Welches Glück, diese Frau erlebt zu haben. Eine Sternstunde.
Aber ich lerne dazu. An einem schwülen Sommerabend vor drei Jahren wollte ich mir noch rasch ein Bad in unserem klostereigenen Schwimmbecken genehmigen, war zu hastig und stieß mit dem zweiten Zeh heftig gegen die Beckenkante. Es tat furchtbar weh – Knochenhautverletzungen gehören zum Schmerzhaftesten. Ich biss die Zähne zusammen. Zeit, zum Arzt zu gehen, hatte ich keine. Später fiel mir auf: Der Zeh war krumm. Er musste beim Zusammenprall mit dem Beckenrand gebrochen und dann schräg zusammengewachsen sein. Sollte ich zum Doktor gehen, ihn noch einmal brechen und richten lassen?
„Ach was“, sagte ich mir. „Das rentiert sich nicht mehr. Für die letzten zehn, fünfzehn Jahre tut’s der auch so. Es ist die zweitbeste Lösung, aber ich kann damit laufen, das muss reichen.“ Sie sehen, in meinem Alter plant man den Tod schon ein. Aber ich finde, ich habe altersgemäßen Humor bewiesen.
2. Ohne Plan lebt es sich besser
Der Wecker reißt mich zur gewohnten Zeit um zehn vor sechs aus dem Schlaf. Ein neuer Morgen dämmert über Rom, und ich würde einiges darum geben, liegen bleiben zu dürfen.
Gestern Nacht ist es wieder spät geworden – zu viele E-Mails, zu viel Post auf meinem Schreibtisch. Also habe ich nicht auf die Uhr geschaut, einen Stapel Briefe und zwanzig Mails beantwortet und gleich noch eine neue Kolumne für Bild der Frau entworfen. Als ich die Schreibtischlampe ausschaltete, war es zwei Uhr morgens. Nichts Ungewöhnliches, denn zeitiger komme ich selten ins Bett. Nach Mitternacht, wenn das Tagespensum erledigt und der Kopf frei ist, drehe ich noch einmal auf.
Dann habe ich meine kreative Phase, und Momente der Eingebung wollen beim Schopf gepackt werden, sonst brüte ich womöglich über einem Vortrag wie ein Schüler über den Hausaufgaben und zermartere mir das Hirn auf der Suche nach einer Idee … Also dranbleiben, solange die Einfälle sprudeln. Vier Stunden Schlaf müssen reichen.
Vier Stunden Schlaf sollten reichen. Sie haben früher doch immer gereicht. Wie pflegte mein Vater in seinen letzten Jahren zu sagen? „Ich muss aufstehen, sonst verschlafe ich den ganzen Verstand …“ Und die Morgenstunden sind doch meine Zeit. In der Nacht und in der Frühe kommen mir die besten Gedanken. Im Schlaf sammelt sich so vieles an, was festgehalten und umgehend notiert zu werden verdient. Außerdem kann ich mich heute nicht beklagen.
Wie oft erwache ich mitten in der Nacht, weil mir die Zeitverschiebung zwischen Manila und Rom oder New York und Rom in den Knochen steckt. Wie oft stehe ich dann wieder auf, kehre, statt mich im Bett von einer Seite auf die andere zu wälzen, an den Schreibtisch zurück, bete ein paar Psalmen und arbeite ein weiteres Stündchen. Diese Nacht aber habe ich durchgeschlafen. Woher dann der Wunsch, liegen zu bleiben? Woher das übermächtige Bedürfnis, diesen Tag ausnahmsweise geruhsam anzugehen?
Und in meinem schläfrigen Gehirn arbeitet es weiter. „Wie lange kann das noch so gehen?“, frage ich mich. „Wie lange wird das überhaupt noch so gehen? Bis du achtzig bist? Knappe sechs Jahre wären es bis dahin“, rechne ich mir vor. „Nicht viel. Möglicherweise bleibt dir mehr Zeit. Deine Eltern sind fünfundachtzig geworden – warum solltest du deren Alter nicht auch erreichen?“
In diesem Fall hätte ich Aussicht auf elf weitere Jahre. „Elf Jahre – auch nicht eben …“ Solche Gedanken schlägt man sich am besten gleich aus dem Kopf. Nicht, dass sie mich schrecken würden. Ich habe nie mit Grausen an mein Ende gedacht, ich tue das bis heute nicht. Altersdepressionen sind mir unbekannt, genauso wie die Beklemmungen, die andere vor jedem Beginn einer neuen Lebensdekade beschleichen.
Veränderungen stelle ich trotzdem an mir fest. Seit meinem siebzigsten Lebensjahr muss ich mir eingestehen: Die Natur bremst mich. Ich werde langsamer. Vier Stunden Schlaf sind mir mindestens eine zu wenig. Und neuerdings spüre ich meine Beine. Nach zwei Stunden am Rednerpult – Vortrag mit anschließender Diskussion, alles im Stehen – weiß ich manchmal kaum noch, wie ich von der Bühne hinunterkommen soll, dabei sind es nur ein paar Stufen. Nun ja, die Gene. Auch mein Vater hat im Alter über seine Beine geklagt. Aber der stand auch von morgens bis abends in der Kleiderfabrik an der Bügelmaschine …
„Los jetzt“, sage ich mir. „Morgenstund hat Gold im Mund. Die Arbeit wartet. Du hast heute einiges vor. Der neue Strategieplan, die Sitzung des Bauausschusses – irgendwann muss die Renovierung von Sant’Anselmo ja geschafft sein. Also raus aus dem Bett!“ – Der berühmte Tritt in den eigenen Hintern …
Inzwischen sitze ich auf der Bettkante. Endgültig gesiegt hat der Tatendrang aber noch nicht. Soll ich mir meine Morgengymnastik jetzt wirklich antun? Vielleicht erst einmal rasieren. Das Gesicht, das mir aus dem Spiegel entgegenblickt, wirft mich wieder zurück – unternehmungslustig sieht anders aus. Aber nach der Rasur überwinde ich mich dann doch zu einigen Dehn- und Streckübungen, und nach der Dusche – heiß – kalt, heiß – kalt, heiß – kalt, immer im Wechsel – sehe ich im Spiegel endlich einen Notker, der wieder über sich selbst lächeln kann. „Na, bitte. Das wäre geschafft.“
Auf dem Weg zum ersten Stundengebet treffe ich im Aufzug mit zwei jungen indischen Studenten zusammen. Wir lächeln einander zu, nicken schweigend und sammeln uns fürs Gebet. Bei uns in Sant’Anselmo wird in der Frühe nur das Nötigste geredet, am besten gar nicht. Ich genieße diese Stille – auch das hat sich mit den Jahren geändert. Als junger Mönch ist mir das Schweigen schwergefallen, und heute gehöre ich zu den Verfechtern eines durchgehenden Schweigens in den Morgenstunden, zumindest, bis das Frühstück beendet ist.
Als ich die Kirche betrete, bin ich ganz aufs Stundengebet konzentriert, und sobald ich die ersten Töne des gregorianischen Wechselgesangs anstimme, endgültig hellwach. Es ist großartig, den Tag mit Gesang zu beginnen, im Chor mit meinen Brüdern, den Text der Psalmen auf den Lippen. Ich vergesse dabei mich selbst und blicke auf Gott, der mich geschaffen hat und durch den Tag geleiten wird. Die Psalmen führen mir in immer neuen Beispielen die Verankerung im Glauben vor und nichts könnte mich am Tagesbeginn in gleicher Weise aufmuntern und beleben.
Dann verstummt der Gesang. Gemeinsam mit den anderen verlasse ich die Kirche und gehe durch den Kreuzgang zum Refektorium, unserem Speisesaal, wo das gemeinsame Frühstück eingenommen wird. Es ist ein prächtiger römischer Morgen – die Sonne ist bereits aufgegangen, und ihre Strahlen wärmen die kühle Morgenluft. Amseln singen und ich pfeife leise ihre Melodie nach. Eine kommt angehüpft, ich pfeife weiter. Sie blickt auf, schaut mich kurz an und schwirrt davon – ich bin wohl doch nicht der richtige Partner für sie. Muss ja nicht sein …
Als ich den großen Saal des Refektoriums betrete, hat sich bei mir längst die gewohnte Zuversicht, die gewohnte Gelassenheit eingestellt. Nichts wird mich heute erschüttern können. Der Arbeitstag kann beginnen.
Es könnte jetzt so klingen, als hätte ich immer noch große Pläne. Nein, die habe ich nicht. Ich habe nie Pläne gehabt. Ich lebe nicht in der Zukunft. Genauso wenig lebe ich allerdings in der Vergangenheit. Ich lebe in der Gegenwart. Das heißt: Ich habe nach wie vor keine Zeit – und schon gar keine Lust –, zurückzublicken auf mein Leben und womöglich Bilanz zu ziehen. Ich habe Besseres zu tun, als alte Geschichten aufzuwärmen. Es mag sich verrückt anhören, aber meinem Lebensgefühl nach befinde ich mich weiterhin, als beinahe Fünfundsiebzigjähriger, im Unendlichkeitsdenken. Als hätte ich das Leben noch vor mir.
Ein neunundachtzigjähriger Mitbruder in einem österreichischen Kloster sagte mir einmal: „Ich weiß noch jeden Tag, wofür ich aufstehe.“ Mir geht es nicht anders. Solange die Aufbruchsstimmung nicht verfliegt, liegen die besten Jahre noch nicht hinter einem, und mich versetzt bislang jeder neue Tag in Aufbruchsstimmung – auch wenn das Aufstehen in der Frühe inzwischen mehr Überwindung kostet als in jüngeren Jahren.
Nicht, dass ich den Gedanken an meinen Tod verdrängen würde. Unwillkürlich stellt sich manchmal in den Nachtstunden die Frage ein: „Wirst du am Morgen wieder aufwachen?“ Unwillkürlich überschlage ich bisweilen die verbleibende Lebenszeit, wobei ich vom Wahrscheinlichen ausgehe – natürlich kann es jederzeit anders kommen, und schon damals, mit siebenunddreißig, als ich nach meiner Wahl zum Erzabt in meinem kleinen Fiat auf der italienischen Autobahn von Rom nach Sankt Ottilien fuhr, schoss mir plötzlich die Frage durch den Kopf: „Was wäre, wenn du jetzt durch einen tödlichen Unfall aus dem Leben gerissen würdest?“
Ich erinnere mich genau. Es war ein strahlend schöner Sommertag und auf dem Mittelstreifen der Autobahn blühten Ginster und Oleander. „Ist das herrlich“, dachte ich bei mir – und hatte auf einmal die Vorstellung, das Ende dieses Tages womöglich nicht zu erleben. Sonderbarerweise erschreckte mich der Gedanke in keiner Weise. „Du bist auf deinem bisherigen Lebensweg schon so viel Schönem begegnet“, sagte ich mir, „mehr als andere in siebzig oder achtzig Jahren.“ Beschenkt und reich wäre ich damals gestorben, auf eine dankbar stimmende Weise lebenssatt; aber ich kam heil in Sankt Ottilien an, und damit veränderte sich mein Leben grundlegend …
Nein, der Gedanke an meinen Tod ist mir seit Langem vertraut. Nichtsdestoweniger mischt sich in den letzten Jahren eine gewisse Beunruhigung ein. Die mächtige Antriebskraft der Hoffnung versiegt allmählich. Der Gedanke an die Zukunft hält nicht mehr den gleichen Trost, die gleiche Ermutigung bereit, wie das früher der Fall war. Und dann: Die Möglichkeit des Sterbens besteht zwar in jedem Alter, aber die Todesgewissheit ist eine neue Erfahrung.
Mag unser Lebenslicht auch noch genauso hell brennen wie ehedem – dass von der ganzen Kerze nur ein Stummel geblieben ist, können wir uns nicht verhehlen. Wie lange wird sie durchhalten? Noch zehn Jahre? Allenfalls fünfzehn. Ein magerer Vorrat in jedem Fall, ein kläglicher Rest, und mich beschleicht das sonderbare Gefühl: Früher, als der Zeitspeicher noch gut gefüllt war, wäre einem das Sterben leichter gefallen. Vielleicht ist man mit seiner Lebenszeit ja großzügiger, solange man aus dem Vollen zu schöpfen glaubt; vielleicht erscheinen einem die Lebensjahre umso kostbarer, je weniger davon verbleiben.
Aber schonen werde ich mich nicht. Zwar scheint mir Mäßigung durchaus angebracht, wo es zum Beispiel um Essen und Trinken geht – so begnüge ich mich seit einiger Zeit mit der Hälfte dessen, was mir schmecken würde, und den Alkohol habe ich fast ganz gestrichen. Ich nehme diese Beschränkungen bereitwillig in Kauf, weil sie mein Wohlbefinden steigern, so wie ich mich neuerdings auch mit Vergnügen meiner Hörhilfe bediene, weil sie mich vor Momenten äußerster Peinlichkeit bewahrt – immer wieder nämlich erwischte ich mich früher in Sitzungen bei einem Nickerchen.
Auf Tagungen und Konferenzen wird meist in einer Fremdsprache geredet, in Englisch, in Italienisch, nicht selten obendrein genuschelt, weshalb mich das Zuhören doppelte Anstrengung kostet, und in der Vergangenheit überkam mich nach einer Weile eine unwiderstehliche Müdigkeit, die den Sitzungsteilnehmern den unerfreulichen Anblick eines schlafenden Abtprimas bescherte. Peinlich, wie gesagt, aber damit ist es vorbei – mit meiner Hörhilfe bleibe ich auch während der zähsten Sitzung wunderbar wach. Sie ist für mich genauso selbstverständlich geworden wie meine Brille.
Derlei Zugeständnisse an mein Alter mache ich gern. Ansonsten aber keine. Kürzertreten liegt mir nicht. Ich will arbeiten. Ich muss schaffen. Manche halten mich für einen Workaholic. Mag sein, dass sie recht haben. Auf dem Sofa sitzen und fernsehen ist für mich der Albtraum. Aber Pläne habe ich nicht. Weder Pläne noch Planziele, weder ein „Regierungsprogramm“ noch glänzende neue Ideen, wie der Benediktinerorden zu optimieren oder umzustrukturieren wäre. Ich habe nicht einmal ein Konzept – aus dem einfachen Grund, weil sich während meines ganzen Klosterlebens gezeigt hat: Ohne Plan komme ich besser durchs Leben.
Tatsächlich bin ich aus den verschiedensten Gründen nie zu dem gekommen, was ich ursprünglich vorhatte. Es ist stets anders gelaufen als gewünscht oder gedacht oder vorhergesehen, und so, wie es kam, war es gut. Statt zu planen, lasse ich mich in gewisser Weise treiben, treiben in einer Strömung, der ich zu vertrauen gelernt habe. Aus meiner Perspektive sieht es dann so aus, als kämen die Aufgaben auf mich zu. Sie stellen sich mir ganz von allein, sodass man sagen könnte: Ich suche sie nicht, aber sie finden mich.
An mir ist es dann allerdings, zuzugreifen. Die Aufgaben als solche zu erkennen, zuzugreifen und mich der Herausforderung zu stellen. Etwas muss in Angriff genommen, ausgeführt und zu einem guten Ende gebracht werden? Gut, packen wir’s an – Gott macht es uns nicht bequem. Und wenn ein Projekt bewältigt ist, kommt das nächste dran – wobei ich mir die Hände reibe, wenn die neue Aufgabe noch mehr Einsatz, noch größeren Einfallsreichtum erfordert als die vorherige. Auf gar keinen Fall gebe ich Ruhe, bevor das Ergebnis sich sehen lassen kann.
Zugegeben, das ist oft anstrengend. Die Sitzungen, Tagungen und Vorträge, mal in den USA, mal in Israel, mal in Indien, die langen Flüge, die Zeitverschiebung, der ständige Klimawechsel, dazu das Chaos im Flugverkehr, die ewigen Verspätungen, die Aufholjagden … selten gehen längere Flugreisen ohne Aus- und Zwischenfälle über die Bühne, und manchmal komme ich mir vor wie ein Jongleur im Zirkus, bloß ohne Publikum. Da will ich zum Äbtetreffen in die USA und muss gleich als Erstes meinen Flug umbuchen wegen eines Pilotenstreiks bei der Lufthansa. Gut, dann fliege ich eben über Washington statt über New York nach Chicago.
In Washington landen wir mit einer Stunde Verspätung. Die Passkontrolle, von den Amerikanern mit der üblichen entnervenden Genauigkeit vorgenommen, kostet mich zwei weitere Stunden. Und als ich mein Gate für den Weiterflug nach Chicago erreiche, ist das Boarding gerade abgeschlossen – Protest zwecklos; in den Staaten kannst du nicht, wie in Deutschland, noch verhandeln und an das Mitgefühl des Bodenpersonals appellieren, da lässt sich keiner erweichen. Also suche ich einen anderen Flug heraus und komme auch am selben Tag noch in Chicago an – aber gegen Mitternacht statt um vier Uhr nachmittags. Es folgen weitere anderthalb Stunden Autofahrt, und gegen zwei Uhr morgens endlich steht einem erquicklichen Schlummer nichts mehr im Wege – nun ja, meine gewohnte Zeit.
Den nächsten Tag habe ich von morgens bis abends Termine. Anderntags geht es weiter, nach Savannah an der Ostküste – also mit dem Wagen nach Minneapolis und mit dem Flugzeug erst einmal zurück nach Chicago. Aber die Maschine landet in Minneapolis bereits mit Verspätung, sie fliegt auch mit Verspätung los, und den Weiterflug nach Savannah verpasse ich natürlich. Wann geht der nächste Flieger?
„Keine Chance“, heißt es. „Heute jedenfalls nicht mehr, die Maschinen sind alle voll.“ Aha. Es ist elf Uhr vormittags. Ich sitze in der Lounge des Flughafens von Chicago, klappe meinen Laptop auf und begebe mich selbst auf die Suche. Was entdecke ich? Einen Flug von Charlotte nach Savannah. Na bitte.
„Können Sie mich wenigstens rechtzeitig nach Charlotte bringen?“, frage ich die beiden Damen am Schalter, und jetzt machen sie sich ihrerseits auf die Suche. Sie tippen mit unbewegten Mienen auf ihren Computertastaturen herum, stundenlang, wie es mir vorkommt, während mein Triumphgefühl zusehends schwindet, bis sich das Gesicht der einen dann doch noch aufhellt – ja, gute Nachricht:
In drei Stunden gehe ein Flug nach Charlotte und jetzt habe sie mich an erster Stelle auf die Warteliste gesetzt … An erster Stelle? Das müsste klappen. Irgendein Passagier fällt immer aus. Und so ist es. Eine kleine Irrfahrt, und schon bin ich in Savannah, abermals gegen Mitternacht.
Anderntags geht es über New York zurück nach München. Am darauffolgenden Tag soll ich abends in Münster einen Vortrag halten, alle dreihundert Plätze sind bereits ausgebucht, diesmal darf nichts dazwischenkommen. Ich erreiche rechtzeitig den Flughafen von Savannah, das Boarding beginnt, ich verstaue mein Handgepäck, ich lasse mich frohgemut auf meinem Sitz nieder – und die Maschine fliegt nicht los. Mit anderthalb Stunden Verspätung heben wir schließlich ab, und als ich beim Landeanflug auf den New Yorker Flughafen Newark auf die Uhr schaue, bleibt mir gerade noch eine halbe Stunde, um den Anschlussflug zu erreichen. Das schaffe ich nie und nimmer, Newark ist ein Riesenflughafen.
Jetzt muss ich alle Register ziehen. Ich zücke mein Handy, rufe den Lufthansa-Service in Deutschland an, erkläre ihnen meine Lage und sage: „Tun Sie mir den Gefallen, das Gate B61 zu benachrichtigen und das Personal dort zu bitten, auf mich zu warten! Ich muss meinen Flug unbedingt erreichen …“ – und siehe da, diesmal warten sie tatsächlich. Als das Flugzeug in den Nachthimmel über dem Atlantik startet, Kurs Europa, Kurs München, sitzt ein zufrieden grinsender Abtprimas an Bord, der im Übrigen rechtzeitig in Münster eintraf und ganz entspannt seinen Vortrag hielt (dann aber Mühe hatte, vom Podium hinabzusteigen).
Wohl wahr, es ist strapaziös, und Pausen kenne ich kaum. Aber unermüdlich nach neuen Lösungen suchen, beweglich bleiben, geistig wie körperlich, und sich auf Unerwartetes einlassen, das gehört für mich zum Leben, nach wie vor. Meine früheren Leistungen interessieren mich nicht sonderlich. Was hinter mir liegt, ist abgehakt wie eine To-do-Liste, die man zusammenknüllt und in den Papierkorb wirft, sobald alles erledigt ist; ohnehin sollte man sich hüten, zu stolz auf das Erreichte zu sein, sonst klammert man sich an die Vergangenheit.
Was mir umso mehr am Herzen liegt, ist die Zukunft meines Ordens, und diese Einstellung hat noch stets eine belebende Wirkung auf mich gehabt. Erst kürzlich brachte jemand – für alle überraschend, auch für mich – einen neuen Vorschlag zu unseren Umbaumaßnahmen in Sant’Anselmo ein, und ich muss zugeben, im ersten Moment war ich alles andere als erfreut: „Bloß nicht schon wieder eine neue Idee! Können wir nicht ein einziges Mal bei dem bleiben, worauf wir uns längst geeinigt haben?“
Nach kurzem Nachdenken aber fand ich: „Gar nicht so übel, der Vorschlag hat was für sich.“ Kurz entschlossen habe ich mich in die veränderte Planung gestürzt, nur um festzustellen, dass sich deutlich jüngere Mitbrüder mit diesem Kurswechsel sehr viel schwerer taten. Da durfte ich nun also zusätzlich die Widerstrebenden bekneten und beknien …
Bisweilen aber wird’s auch mir zu viel. „Herrgott, hört’s denn nie auf?!“, stöhne ich dann, doch im nächsten Augenblick schaut der Herrgott auf mich hernieder, sagt freundlich: „Komm, mach weiter“ … und ich gehorche. Was – nun, ich will nicht sagen bestürzende, doch mindestens schwindelerregende Auswirkungen auf meinen Terminkalender hat, denn der ist prallvoll, lückenlos gespickt mit Vorträgen, Reisen, Sitzungen und anderen mitunter recht ausgefallenen Vorhaben.
Auf zwölf Monate hinaus bin ich ausgebucht, da ist praktisch kein Tag mehr frei. Gottlob verfüge ich über langjährige Erfahrung mit solchen Terminkalendern und weiß daher: Was zu schaffen ist, wird erledigt, und wofür die Kräfte beim besten Willen nicht ausreichen, fällt eben unter den Tisch.
Wirklich lästig finde ich auf Dauer etwas ganz anderes: Es ist regelrecht kräftezehrend, sich ständig der gut gemeinten Ratschläge all jener zu erwehren, die meinen, ich sollte endlich kürzertreten.
Ja, ich weiß. Ich bin kein Herkules von Statur. In meiner Kindheit war ich lange krank, oft bettlägerig und später im Sportunterricht eine Niete – wer beim Sprung über den Graben im Wasser landete, war ich. Ich hatte daher schon früh unter Leuten zu leiden, die mich zum Hypochonder machen wollten. „Mach langsam, übernimm dich nicht, denk an deine Gesundheit“ – nach dieser Melodie hätte ich tanzen sollen, und der Refrain zu jeder Strophe lautete zuverlässig: „Das schaffst du doch nicht, das schaffst du nie.“ Das ist die dümmste Form der Suggestion, die ich kenne, denn fürsorglicher Einspruch dieser Art untergräbt unfehlbar den Glauben an sich selbst, und am Ende versagt man tatsächlich.
Und jetzt, im Alter, wird dieser Unkenchor immer lauter. Nach jeder längeren Auslandsreise darf ich mir anhören: „Du überforderst dich, tu dir das nicht mehr an, die Zeitverschiebung muss einen Menschen auf Dauer doch zermürben …“ Oder man prophezeit mir gar: „Lange wird das nicht mehr gut gehen, du mutest dir zu viel zu, dein Zusammenbruch ist vorprogrammiert …“
Also loslassen, wie eines der beliebtesten Wörter im Zusammenhang mit Altwerden lautet? Mir einen beschaulichen Lebensabend gönnen, Stichwort Altenteil? Ich weiß nicht, was die Warner und Schwarzseher unter Glück verstehen … Gut, ich würde nie bestreiten, dass ernsthafte Besorgnis aus ihren Befürchtungen spricht. Gleichwohl sträubt sich alles in mir gegen diese Art ungebetenen Mitgefühls, weil sich eine ängstliche, eine verzagte Haltung dahinter verbirgt, ein trüber Pessimismus, der immer schon weiß: „Das kann nur schiefgehen, das muss übel enden.“
Eigenartigerweise werden immer die anderen krank. Jene, die sich schonen. Ich selbst erfreue mich gottlob einer recht stabilen Gesundheit – zur Verblüffung der Bedenkenträger. Was sich viele Menschen wohl nicht vorstellen können: Ich schöpfe aus meiner Arbeit, auch aus den Strapazen, selbst aus den Missgeschicken eine ungeheure Kraft. Und das Hindernisrennen ist mir beinahe die liebste Disziplin, weil ich nach jeder bösen Überraschung – zu meiner eigenen Verwunderung, muss ich sagen – erlebe, wie mein Kopf glasklar wird, seelenruhig und wie von selbst arbeitet und die ausgefallensten Lösungen ausspuckt. Das war früher schon so, das funktioniert auch heute noch.