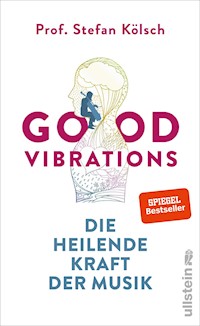
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Musik hält fit und macht gesund – und dies auf allen möglichen Ebenen, wie die Forschung beweist. Stefan Kölsch, international führender Neurowissenschaftler auf diesem Gebiet, beschreibt so anschaulich wie fundiert die Auswirkungen von Musik auf unser Gehirn, unsere Emotionen und unseren Körper und zeigt, wie die neuen Erkenntnisse für jeden praktisch anwendbar sind. Musik ist nicht nur schön ‒ sie bewahrt auch unsere Gesundheit, hält jung und verbessert den Spracherwerb. Sie hilft bei Schlaganfall, chronischen Krankheiten und Demenz. Sie wirkt geradezu Wunder bei Wachkomapatienten. Die Bedeutung von Klängen und Melodien für unsere Psyche und unseren Körper findet immer mehr Beachtung und ist inzwischen unumstritten. Stefan Kölsch zeigt uns anhand vieler Beispiele aus seinem Forschungsbereich, weshalb Musik in allen Formen eine immer größere Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung ganz unterschiedlicher Krankheiten einnimmt, sodass sie inzwischen einen neuen Wissenschaftszweig in der Gesundheitsforschung fundiert. Und er liefert zahlreiche konkrete Tipps, wie jeder von uns mit Musik im Alltag sein Wohlbefinden unterstützen und fördern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Musik ist nicht nur schön – sie bewahrt auch unsere Gesundheit, hält jung und verbessert den Spracherwerb. Sie hilft bei Schlaganfall, chronischen Krankheiten und Demenz. Sie wirkt geradezu Wunder bei Wachkomapatienten. Die Bedeutung von Klängen und Melodien für unsere Psyche und unseren Körper findet immer mehr Beachtung und ist inzwischen unumstritten. Anhand vieler Beispiele aus seinem Forschungsbereich zeigt uns Stefan Kölsch, weshalb Musik in allen Formen eine immer größere Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung ganz unterschiedlicher Krankheiten einnimmt, sodass sie inzwischen einen neuen Wissenschaftszweig in der Gesundheitsforschung fundiert. Und er liefert zahlreiche konkrete Tipps, wie jeder von uns mit Musik im Alltag sein Wohlbefinden unterstützen und fördern kann. Sein Buch ist für all jene, die sich in Sachen Heilung und Gesundheit nicht allein auf die Schulmedizin verlassen wollen.
Der Autor
STEFAN KÖLSCH, geboren 1968 in Wichita Falls (Texas), schloss zunächst ein Geigenstudium ab und erwarb anschließend Diplome in Psychologie und Soziologie, bevor er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig promoviert wurde. Er arbeitete an der Harvard University sowie im Exzellenzcluster »Languages of Emotion« der FU Berlin und folgte 2015 dem Ruf auf eine Elite-Professur an der renommierten Universität Bergen in Norwegen.
Prof. Stefan Kölsch
GOOD VIBRATIONS
DIE HEILENDE KRAFT DER MUSIK
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2050-2
© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Illustrationen im Innenteil: Olga Kölsch Lektorat: Gudrun Jänisch Umschlaggestaltung, -abbildung: www.buerosued.de
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Gewidmet meinen Freunden, allen, die noch meine Freunde werden möchten, meinen Kindern und meiner Frau, die sich immer wieder mit Engelsgeduld meine vorlesungsartigen Antworten auf Fragen anhört, die auch in einem Satz hätten beantwortet werden können.
Vorwort
Was unterscheidet den Menschen von Tieren? Einige Wissenschaftler sagen: »Sprache«, »Mathematik«, »Schach«. Douglas Adams meinte: »Das Rad, New York, die Kriege.« Und ich sage: »Musik.«
Musik erfordert die einfachste mentale Funktion, die den Menschen gerade eben von Tieren unterscheidet: Menschen können in einer Gruppe einen Takt halten, gemeinsam einen Takt klatschen, schneller oder langsamer, ja, sogar gemeinsam schneller oder langsamer werden. Was uns simpel und trivial erscheint, kann keine andere Spezies. Wir können auch gemeinsam tanzen, singen oder Instrumente spielen.
Mit anderen gemeinsam Musik zu machen weckt positive Emotionen. Und diese Emotionen setzen Heilkräfte frei. Dies brachte dem Menschen in der Evolution einen wichtigen Vorteil: länger zu leben. Zu diesem Vorteil trägt obendrein bei, dass Musik auch den sozialen Zusammenhalt fördern sowie unsere Beharrlichkeit und Ausdauer stärken kann. Als das Schiff Endurance des Polarforschers Ernest Shackleton vor mehr als hundert Jahren von Packeis zerdrückt wurde, musste sich seine Mannschaft zu Fuß durch die schneidenden eiskalten Winde der Antarktis kämpfen. Die Rettungsboote zogen sie mit Tauen durch den Schnee hinter sich her. Nur die überlebenswichtigen Dinge konnten die Männer mitnehmen: Lebensmittel, Kochgeschirr, Kleidung, Zelte und – das Banjo! Shackleton schrieb später, die Entbehrungen und Schmerzen seiner Männer seien so groß gewesen, dass des Öfteren einige von ihnen aufgeben und sterben wollten. Zu entschlafen erschien die attraktivere Alternative zu weiterem Leiden. In diesen Momenten war es die Musik, die die Männer aufmunterte, ihren Mut weckte, sie zum Durchhalten motivierte. Alle 28 Männer erreichten schließlich lebend die rettende Shetlandinsel Elephant Island. Shackleton schrieb, dass es etliche ohne Musik – die »vital mental medicine« – nicht geschafft hätten.
Wenn Musik, wie Johann Sebastian Bach sagte, unser »Gemüt belebt«, werden wir nicht nur mutiger und beharrlicher, sondern sie wirkt dann auch erholsam und heilsam. Genau davon handelt dieses Buch: Ich werde erklären, wie Musik unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, aber auch wichtige Heilungsprozesse fördert. Sie werden erfahren, was dabei im Gehirn geschieht und wie Musik dort und im Rest des Körpers regenerativ wirkt. Bei Krankheiten kann Musik wundersame Effekte haben: Parkinson-Patienten beginnen zu tanzen; Alzheimer-Patienten erinnern sich wieder; Menschen, die nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen können, können noch singen und dadurch wieder sprechen lernen; gelähmte Schlaganfall-Patienten können sich wieder bewegen; Wachkoma-Patienten reagieren plötzlich auf Musik. Was sich anhört, als sei es der Bibel entlehnt, ist in den letzten Jahren in revolutionären wissenschaftlichen Studien untersucht und belegt worden.
Für dieses Buch habe ich Hunderte von Studien zusammengetragen, die ich für jedermann und jederfrau verständlich darstellen werde. Einige davon habe ich als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Kognitive Neurowissenschaft in Leipzig, an der Harvard Medical School in Boston, der Freien Universität Berlin oder der Universität Bergen durchgeführt.
Aus einigen dieser Studien können wir erkennen: Die musikalische Natur des Menschen zeigt sich bereits bei Kleinkindern und sogar Babys. Deswegen kann jeder, ob jung oder alt, ob musikalisch gebildet oder nicht, von den heilsamen Wirkungen der Musik profitieren. Ich werde deutlich machen, wie Menschen Musik für ihre Gesundheit nutzen können und wie Musik helfen kann, die Beanspruchungen und Herausforderungen des Alltags zu meistern.
Aus meiner Perspektive als Professor für biologische und medizinische Psychologie werde ich viele Erkenntnisse aus der Hirnforschung berichten. Da ich jedoch auch Musik und Soziologie studiert habe, werde ich einige Themen zudem im Hinblick auf unsere Gesellschaft – und natürlich auf Musik – beleuchten. Dabei ist dieses Buch so geschrieben, dass jeder Abschnitt gegebenenfalls leicht überschlagen werden kann; es muss nicht der Reihe nach gelesen werden.
Seit einigen Jahren gebe ich gelegentlich wieder Konzerte, manchmal kombiniert mit Vorträgen darüber, wie Musik heilsam wirkt. Bei diesen Anlässen schaffe ich es leider nie, alle Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden. Was mich stets berührt, sind die Rückmeldungen, die ich von Menschen erhalte. Ein Arzt sagte mir, ohne Musik hätte er es nicht durch die Prüfungsphasen geschafft; ein Herr aus der ehemaligen DDR sagte mir, er hätte das System ohne den Trost der Musik nicht überlebt; eine Parkinson-Patientin erzählte mir, wie ihr Musik bei ihrer Krankheit half.
Viele Menschen wollen verstehen, wie wissenschaftlich diese Eindrücke sind und welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Mit diesem Buch möchte ich meine Faszination für dieses spannende Forschungsgebiet wiedergeben, aber vor allem auch weitergeben, was in der Wissenschaft bislang darüber bekannt ist. Wie können wir Musik nutzen, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden? Wie wirkt Musik heilsam und regenerativ? Was passiert dabei in unserem Gehirn und im Rest unseres Körpers? Um diese Fragen wird es hier gehen.
Musik kann eine sinnvolle, äußerst effiziente Ergänzung der Schulmedizin sein und manchmal sogar eine wirkungsvolle Alternative. Die heilsamen Wirkungen von Musik, die oft mit einfachsten Mitteln hervorgerufen werden können, sind vielerorts noch viel zu ungenutzt. In Good Vibrations zeige ich fachübergreifend die wichtigsten Punkte auf, die jeder für seine Gesunderhaltung kennen sollte, und erkläre anschaulich, wie wir unsere Selbstheilungskräfte mit Musik stärken können.
Einführung: Wirkungen von Musik auf die Gesundheit
Michael, ein junger Erwachsener, war seit Langem in neurologischer Behandlung und hatte mehrmals im Monat schwere epileptische Anfälle. Dazu kam ein langjähriger Mutismus: Michael konnte zwar sprechen und andere verstehen, hatte jedoch seit Jahren nichts mehr gesagt. Unterschiedliche intensive medizinische Behandlungsversuche durch Ärzte und durch einen Psychotherapeuten konnten weder die schweren epileptischen Anfälle durch Medikamente kontrollieren noch die Sprachlosigkeit beeinflussen. Die Schulmedizin war mit ihrer Weisheit beinahe am Ende – da kam der behandelnde Neurologe glücklicherweise auf die Idee, eine Musiktherapie zu empfehlen, denn Michael hörte gerne Musik und hatte als Kind oft mit dem Großvater Lieder gesungen. So kam Michael zu Karsten Becker, einem Musiktherapeuten und erstklassigen Gitarristen, mit dem ich seit unserem gemeinsamen Musikstudium eng befreundet bin.
Zur ersten Kennenlern-Sitzung mit Karsten erschien Michael mit Kopfschutz. Er war völlig verschlossen und hatte die Beine in gekauerter Körperhaltung hochgezogen. Blickkontakt und verbale Kommunikation waren nicht möglich. Karsten stellte zum Angebot einige Instrumente auf – möglicherweise würde bei Michael ja Lust aufkommen, etwas auszuprobieren. Er nahm jedoch keinerlei Kontakt auf und wurde nicht aktiv. Karsten ging an die Klangliege (eine Art Holzliege mit Saiten darunter) und fing an, die Saiten zu zupfen. Nach einigen Minuten stand Michael auf und ging durch den Raum, wobei Karsten anfing, zu den Schritten von Michael zu spielen: Er wurde mit den Schritten schneller und langsamer oder leiser und lauter. Diese »Improvisation« schien Michael Spaß zu machen. Offensichtlich wurde er durch die Musik animiert weiterzulaufen, mal schneller, mal langsamer.
Nach dieser geglückten Kennenlern-Stunde konnte Karsten in der nächsten Sitzung daran anknüpfen: Sie »spielten« nun gleichsam zusammen – Karsten auf der Klangliege, Michael mit seinen Schritten. So kamen die beiden über die Musik in direkten Kontakt und kommunizierten miteinander, wenn auch nicht mit Worten (Michael hatte ja seit Jahren nicht gesprochen). Als die Sitzung zu Ende war, ging Michael mit dem Betreuer aus der Tür, drehte sich um und fragte deutlich: »Und tanzen?« Karsten war derart entzückt, dass er sofort seine Gitarre nahm und einen beschwingten Jive spielte, zu dem Michael und sein Betreuer ausgelassen tanzten und mit den Fingern schnipsten.
In den darauffolgenden Wochen und Monaten ging es Schritt für Schritt weiter – manchmal schneller, manchmal sehr zäh. Die Musik half, Vertrauen aufzubauen. Karsten sprach, kommentierte und probierte in jeder Sitzung, Michael zum Mitmachen zu motivieren. Michael antwortete immer öfter mit »ja« und »nein«. Nach einer Weile traute er sich auch zum ersten Mal, mit Karsten gemeinsam auf der Klangliege zu spielen. Beide zupften sie die Saiten, teilweise sehr zart, teilweise so laut es ging. Dabei entstanden musikalische Momente, die in ihrem emotionalen Ausdruck kaum intensiver hätten sein können. Die Aufnahme davon hörte sich Michael noch oft an, und in den weiteren Sitzungen spielten sie nun meist zusammen auf der Klangliege. Nach dem Zusammenspielen malte Michael dann zu der aufgenommenen Musik – erst mit nur einer Farbe, in weiteren Sitzungen mit immer mehr Farben. Außerdem entdeckte Karsten, dass Michael, obwohl er kaum sprach, singen konnte und das auch gerne tat. Sie sangen Lieder wie »Der Kuckuck und der Esel« und andere, die Michael aus seiner Kindheit kannte. Michael sprach nun mehr und mehr, zunächst zwar noch stockend und in kurzen Sequenzen, aber zunehmend so, dass er sich im Alltag gut verständigen konnte.
Mittlerweile kann Michael ganz normal in Sätzen sprechen, mit Bekannten wie Unbekannten. Die epileptischen Anfälle treten kaum noch auf und er muss keinen Kopfschutz mehr tragen. Michael lernt jetzt sogar ein Instrument (Gitarre, wie Karsten) und ist psychisch richtig lebendig geworden. Er hat Pläne fürs Leben und möchte eine Ausbildung machen.
Auch wenn Michael zusätzlich zur Musiktherapie noch eine Sprachtherapie sowie Epilepsie-Medikamente bekam und die Kombination unterschiedlicher Therapien wahrscheinlich ideal für ihn war, geschah der entscheidende Durchbruch mit Musik. Musik hat etwas in ihm freigesetzt und in Gang gebracht. Die Wirksamkeit der Musik ist in diesem Fall so offenkundig, dass der betreuende Arzt keinen Zweifel daran hat, dass Musiktherapie hier eine notwendige, durch keine andere Behandlung zu ersetzende Behandlungsform war. Glücklicherweise wurde die Musiktherapie in diesem Fall von der Krankenkasse bewilligt – etwas, worauf sich Kranke in Deutschland jedoch nicht verlassen können, denn in Deutschland dürfen Ärzte Musiktherapie nicht selber verschreiben.
Für entsprechende Gesetzesänderungen ist es nun höchste Zeit, denn die Forschung zu therapeutischen Wirkungen von Musik hat sich stark entwickelt: Bis zum Jahre 2000 sind nur wenige Hundert Arbeiten dazu veröffentlicht worden, seitdem immerhin einige Tausend. Darunter sind viele, die positive Ergebnisse berichten, obwohl heilsame Effekte von Musik oft nur schwer nachzuweisen sind. In der medizinisch-pharmakologischen Forschung werden Studien meist mit einem möglichst minimalen Therapie-Protokoll durchgeführt. Beispielsweise wird ein neues Medikament in Form einer Pille so und so oft eingenommen, eine Kontrollgruppe bekommt stattdessen eine Placebo-Pille – fertig. So können die sehr überschaubaren Therapie-Parameter genau kontrolliert werden. Die Wirkung von Musik bzw. Musiktherapie nachzuweisen ist jedoch komplizierter. Ist es wirklich die Musik oder doch eher die Gruppenerfahrung, die persönliche Beziehung zum Therapeuten, die Ablenkung – oder gar alles zusammen? Welcher Anteil der Wirksamkeit mag ein Placebo-Effekt sein? Wie kann trotz eines genau definierten klinischen Studienprotokolls individuell auf jeden Patienten eingegangen werden, mit unterschiedlichen Methoden wie Singen, Spielen, Sprechen, Trommeln?
Oft können musiktherapeutische Studien nicht mit Placebo-Kontrolle durchgeführt werden, weil es aus ethischer Sicht problematisch wäre, Patienten für mehrere Monate lediglich einer Placebo-Behandlung zu unterziehen, oder weil es nicht genügend Fälle gibt. Das Störungsbild von Michael ist so selten, dass es praktisch unmöglich ist, eine kontrollierte klinische Studie durchzuführen, in der Dutzende von Patienten einer Musiktherapie- und einer Placebo-Kontrollgruppe zugelost würden. Hinsichtlich der Wirksamkeit von Musiktherapie müssen wir uns hier auf unser vernünftiges Urteilsvermögen verlassen. Allerdings stelle ich in diesem Buch überwiegend Befunde vor, die auch den strengen wissenschaftlichen Maßstäben empirischer Forschung entsprechen. Dabei werde ich nicht für jede erdenkbare Krankheit oder Störung darstellen, was Musik bzw. Musiktherapie bei ihr bewirken kann, sondern werde an einigen der wichtigsten Krankheiten beispielhaft die heilsamen, medizinisch oft kaum erklärbaren Wirkungen von Musik beschreiben – vieles kann dann auf andere gesundheitliche Probleme übertragen werden.
Ich habe auch berücksichtigt, dass es etliche wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, in denen Befunde ohne angemessene Skepsis berichtet wurden (jemand, der eine Studie zu einer Therapie durchführt, von der er zutiefst überzeugt ist, neigt gern dazu, die erhobenen Daten recht optimistisch zu interpretieren). Es wäre leicht gewesen, ein Buch zu schreiben, in dem enthusiastisch alle möglichen positiven Effekte von Musik bzw. Musiktherapie aufgezählt werden. Ich möchte hier jedoch ein Bild zeichnen, das bei allem Enthusiasmus so unvoreingenommen und wissenschaftlich fundiert wie möglich ist. Deswegen habe ich für dieses Buch Tausende Seiten wissenschaftlicher Artikel ausgewertet, die ich wiederum aus einer Masse Tausender Arbeiten mit Zehntausenden Seiten herausgefiltert habe). Insbesondere habe ich, wann immer möglich, Übersichtsarbeiten (sogenannte »systematic reviews«) bzw. Metaanalysen herangezogen. Solche Arbeiten sammeln alle Studien zu einem Thema und werten die Ergebnisse so aus, dass eine Aussage über das Bild gemacht werden kann, das sich bei Betrachtung über alle verfügbaren Studien hinweg ergibt. Daher können solche Arbeiten eine zuverlässigere Auskunft geben als eine einzige Studie.
Die wissenschaftlichen Befunde, die ich berichten werde, kommen aus unterschiedlichen Forschungsbereichen, denn das Thema der heilsamen Wirkungen von Musik wird besonders interdisziplinär in den Wissenschaftsbereichen Psychologie, Medizin, Musik, Biologie und Musiktherapie erforscht und bearbeitet. Diese Bereiche untersuchen, wie Musik wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet wird, wie Musik Emotionen hervorrufen und so den ganzen Körper beeinflussen kann, wie Musik Gedanken sowie das Immunsystem beeinflussen kann, und natürlich, welche Musik-Interventionen bei welchen Krankheiten therapeutisch wirken.
Da ich nicht allein aus der Musik komme, sondern auch aus der Neurowissenschaft, der Psychologie und der Soziologie, werde ich gelegentlich Details über Emotionen oder das Gehirn erklären, ohne dass es dabei um Musik geht. Diese Abschnitte sind für diejenigen geschrieben, die weiter in die Tiefe gehen möchten. Sie können, wenn Sie möchten, auch nur die Tipps lesen. Dabei werden Sie auf jeden Fall mindestens eine für Ihre Gesundheit wertvolle Information finden.
Eine Welt ohne Musik wäre eine Welt ohne Menschen
Warum der Mensch ohne Musik die Evolution nicht überstanden hätte
Musik ist tief in unserer Spezies verwurzelt. Ich denke, spätestens mit dem Homo sapiens ist auch Musik entstanden, möglicherweise sogar schon früher. Die ältesten bislang entdeckten Knochenfunde des Homo sapiens sind gut 300 000 Jahre alt, vermutlich existiert er jedoch schon erheblich länger.1 Ob bereits Menschenarten, die vor dem Homo sapiens existierten, Musik machten, ist unbekannt. Unwahrscheinlich ist es nicht: Vor circa 1,5 Millionen Jahren lernten die frühen Angehörigen der Gattung Homo, ihr Essen zu kochen. So konnten sie in kürzerer Zeit mehr Kalorien aufnehmen. Das war die Grundlage für das enorme Wachstum eines Organs, das metabolisch extrem kostspielig ist und beim modernen Menschen etwa zwanzig Prozent des Ruhestoffwechsels beansprucht: das Gehirn.2 Die Entwicklung des Gehirns brachte etliche neue Fähigkeiten, die keine vorige Spezies hatte, darunter auch zwei musikspezifische Fähigkeiten: in einer Gruppe einen Takt zu halten und gemeinsam Töne zu singen.
Gleichzeitig mit dieser Geburt der Musik in der Evolution des Menschen entstanden auch die gesundheits- und gemeinschaftsfördernden Effekte von Musik: Explosionsartig entwickelten sich Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sowie komplexe soziale Verbände, in denen Menschen zusammenlebten. Ob Musik Voraussetzung oder Begleiterscheinung dieser Explosion ist, lässt sich nicht sagen, jedoch sage ich aufgrund ihrer positiven Effekte auf Gemeinschaft und Gesundheit: Ohne Musik hätte es der Mensch nicht durch die Evolution geschafft.
Musik ist ein Spezialfall von Sound. Ich benutze den Begriff Sound, weil er sowohl Klänge als auch Geräusche beinhaltet, wie etwa gesungene Töne und Klatschen. Genauer gesagt besteht Musik aus Folgen von Sounds, bei denen wir einen Puls (also einen Takt) empfinden und die – wenn sie Tonhöhen haben – einer Tonleiter entsprechen. Rund um den Globus gibt es etliche Tonleitern bzw. Skalen: Außer den Tonleitern in Dur und Moll gibt es Kirchentonarten bzw. Jazz-Skalen, indische Raga-Skalen oder indonesische Pelog- und Slendro-Skalen, pentatonische Skalen, oktatonische Skalen und viele andere. Die einfachste Skala ist die pentatonische Skala. Sie besteht aus lediglich fünf Tönen, basiert auf der Obertonreihe und kann leicht bereits von Kindern im Vorschulalter gesungen werden (wie im Lied Backe, backe Kuchen).
Wenn Menschen Klänge im Takt und passend zu einer Tonleiter produzieren, erkennen wir dies als Musik. Bis auf wenige Ausnahmen basieren musikalische Traditionen des Homo sapiens auf diesen zwei Eigenschaften: Takt und Tonleiter. Sie bilden den Kern einer musikalischen Universalgrammatik mit zwei Urprinzipien (fachsprachlich »Regeln«), die so formuliert werden können: »Die Zeitintervalle zwischen Sounds seien derart strukturiert, dass sie erkennbar zu einem Takt passen« und »die Tonhöhen von Sounds seien erkennbare Elemente einer Tonleiter«. Aus dieser verblüffend schlichten Universalgrammatik heraus entwickelte sich der unermessliche Reichtum musikalischer Systeme, Stile und Kompositionen.
Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Musik Takt und Tonleitern haben muss. Trommelmusik kommt auch ohne Tonleitern aus und Meditationsmusik hat oft keinen erkennbaren Takt, so wie auch einige Stücke moderner Kunstmusik (beispielsweise Ligetis »Atmosphères«, das viele aus dem Kubrick-Film 2001: Odyssee im Weltraum kennen).
Der unmittelbare Sinn und Zweck von Takt und Tonleiter ist, dass mehrere Menschen gleichzeitig gemeinsam Musik machen bzw. erleben können. Wir können Bewegungen gleichzeitig gemeinsam am besten ausführen, wenn sie einem Takt folgen. Wenn wir gemeinsam eine schwere Kiste »auf drei« heben wollen, ergibt es keinen Sinn, wenn ich erst langsam »eins« sage, dann warte und dann unvermittelt und schnell »zwei, drei« sage. Man zählt im Takt an: »eins – zwei – drei!« Um gemeinsam klatschen, tanzen, stampfen oder rufen zu können, brauchen wir einen Takt. Und um gemeinsam singen zu können, brauchen wir eine Tonleiter, um gleiche Tonhöhen zu singen (oder in konsonanten Intervallen wie Oktaven, Quinten oder Terzen). Ohne Takt klingt es chaotisch und durcheinander und ohne Tonleiter gibt es keinen angenehmen Zusammenklang der Töne.
Die Tatsache, dass der evolutionär so erfolgreiche Mensch ausgerechnet über diese zwei speziellen Fähigkeiten verfügt – gemeinsam einen Takt halten und gemeinsam Tonhöhen singen zu können –, kann kein Zufall sein. In meinen Augen brachte die Musik dem Menschen in der Evolution einen wichtigen Vorteil – und zwar den, länger zu leben. Dieser Vorteil entstand aus einer Reihe von Effekten, die auch heute noch jedem zugutekommen können:
•Bessere Kooperation und stärkerer sozialer Zusammenhalt. Beim gemeinsamen Musikmachen kooperieren die Gruppenmitglieder. Und Menschen, die einmal miteinander kooperiert haben, kooperieren danach eher wieder miteinander und helfen sich eher gegenseitig. Musik beinhaltet also Kooperation und führt auch zu mehr Kooperation und mehr prosozialem Verhalten wie Teilen und Helfen. Somit erhöht sie die Chance, Ziele zu erreichen (beispielsweise Nahrung zu beschaffen), und minimiert das Risiko, sich zu streiten, zu verfeinden oder Krieg zu führen. Menschen waren in der Evolution auch deswegen so erfolgreich, weil sie in der Gruppe stärker waren. Wenn Menschen ihre Bewegungen beim gemeinsamen Musikmachen koordinieren, wird jede Person Teil der Gemeinschaft – es wird wie mit einer Stimme gesungen oder geklatscht. Dadurch wird aus dem »Ich« ein »Wir«, aus Egoismus wird Engagement für die Gemeinschaft.
•Positivere Emotionen und Förderung der Gesundheit. Musik kann positive Emotionen hervorrufen und dabei helfen, negative Emotionen zu regulieren. Dadurch kann sie Heilung unterstützen und die Gesundheit fördern. Entspannung und Freude wirken regenerativ, wohingegen dauerhafter emotionaler Stress ungesunde Folgen hat. Mit Musik können wir Schmerzen lindern und in schweren Zeiten besser durchhalten, anstatt vor Schmerzen und Entbehrungen aufgeben oder gar sterben zu wollen. Dadurch kann Musik in schwierigen Situationen helfen, Leben zu retten.
•Minderung von Konflikten. Wenn sich Mitglieder innerhalb oder zwischen Gruppen weniger prügeln oder gar einander die Köpfe einhauen, gibt es weniger (tödliche) Verletzungen. In Jäger- und Sammler-Kulturen rund um den Globus existieren Bräuche, sich bei Konflikten mit Gesang statt mit Waffen zu duellieren.3 Solche »Gesangsduelle« sollen Streit schlichten, normale soziale Beziehungen wiederherstellen und dadurch gewaltvolle Auseinandersetzungen, Racheakte oder gar Mord verhindern. Bräuche wie diese Gesangsduelle gibt es in unabhängigen Kulturen, sie scheinen also in der Natur des Menschen angelegt zu sein und zu existieren, seit der Homo sapiens existiert.
Ähnlich wie Musik ist Sprache natürlich ebenfalls von Menschen strukturierter Sound. Wir produzieren beim Sprechen Laute mit Melodie (so können wir Frage und Antwort unterscheiden), Rhythmus (dadurch können Gesprächspartner einander besser folgen) sowie Klangfarbe (wodurch die Stimmung des Sprechers erkannt werden kann). Sprechen kann jedoch nur eine Person gleichzeitig, sonst klingt es nicht gut und man versteht nichts mehr. Im Gegensatz dazu können bei Musik mehrere Personen gleichzeitig Klänge produzieren, wobei es immer noch gut klingt und man es immer noch verstehen kann. Dieses Vermögen von Musik übersteigt in dieser Hinsicht das der Sprache. Musik ist so gesehen die Sprache der Gruppe und Sprache ist die Musik des Individuums.
Der evolutionäre Vorteil der Sprache ist, dass eine einzelne Person mitteilen kann, was sie denkt, meint, will, wünscht, fühlt usw. Sprache kann deswegen als ein Spezialfall von Musik aufgefasst werden: Sprache besteht aus Sounds, wobei Takt sowie Tonleiter erheblich undeutlicher sind als bei Musik und die Sounds Wörter bilden, die jeweils eine spezifische Bedeutung haben. (Der Linguist Uli Reich bemerkte daher einmal, Sprache sei durch Semantik verzerrte Musik.)
Interessanterweise hängt die Bedeutung von Wörtern mit ihrem Klang zusammen. Der Klang von Wörtern ist also keineswegs zufällig (auch wenn es im Fremdsprachenunterricht oft so scheinen mag …). Das gleiche Ding bzw. die gleiche Eigenschaft wird in unterschiedlichen Sprachen zwar durch unterschiedliche Wörter ausgedrückt, beispielsweise »winzig« (deutsch), »tiny« (englisch), »bitte liten« (norwegisch), »infime« (französisch), »piccolissimo« (italienisch); wenn wir uns diese Wörter jedoch genauer anhören, erkennen wir, dass sie klanglich eine frappierende Gemeinsamkeit haben, und zwar zwei oder gar mehr »i«-Laute. In einer wissenschaftlichen Studie wurde ein Grundwortschatz von hundert Wörtern zwischen circa 4000 Sprachen verglichen, das sind zwei Drittel der uns bekannten Sprachen.4 Bei vielen Wörtern wurden Anhäufungen bestimmter Laute oder aber das systematische Fehlen bestimmter Laute gefunden: Der Laut »i« bei Wörtern für »klein«, »r« bei Wörtern für »rund«, »l« oder »u« bei Wörtern für »Zunge« oder »n« bei Wörtern für »Nase«. Weil diese Ähnlichkeiten über unterschiedliche Sprachfamilien hinweg beobachtet wurden, gehen die Autoren der Studie davon aus, dass sie unabhängig voneinander entstanden sind und nicht etwa von einer gemeinsamen Ursprache herrühren. Die Laute von Wörtern sind also längst nicht so beliebig, wie man lange Zeit dachte. Wir können aus diesem Zusammenhang des Klangs von Wörtern über unabhängige Sprachfamilien hinweg erkennen: Die tiefen evolutionären Wurzeln von Musik und Sprache sind eng miteinander verflochten.
Noch deutlicher wird diese enge Verflechtung darin, dass auch der emotionale Klang einer Stimme über den Globus hinweg durch dieselben akustischen Parameter kodiert wird. Wieso erkennen wir, dass eine Stimme fröhlich, traurig, ärgerlich, überrascht oder ängstlich klingt? Patrik Juslin und Petri Laukka analysierten dazu die Daten von circa vierzig Untersuchungen darüber, welche akustischen Merkmale von menschlichen Stimmen bestimmte Emotionen kennzeichnen.5 Dafür hatten Schauspieler/-innen Wörter oder Sätze so eingesprochen, dass ihre Stimmen entweder Freude, Trauer, Ärger, Furcht oder Zärtlichkeit ausdrückten. Einige Studien nutzten auch Aufnahmen von emotionalen Stimmen aus dem wirklichen Leben, wie Aufzeichnungen von Furchtschreien bei Flugzeugunfällen. Die Sprachaufnahmen entstammten unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Juslin und Laukka konnten bestätigen, dass jede der untersuchten Emotionen mit bestimmten akustischen Merkmalen in der Stimme kodiert wird und wir Emotionen in der Stimme erkennen können, selbst wenn wir die Sprache gar nicht sprechen. Eine fröhliche Stimme hat ein schnelleres Sprechtempo als eine traurige, eine höhere Lautstärke und höhere Variabilität der Tonhöhen (die Sprachmelodie geht häufig rauf und runter und klingt aktiv). Bei einer traurigen Stimme geht die Melodie oft nach unten und die Stimme klingt dunkler als eine fröhliche Stimme. An diesen Merkmalen kann auch ein Mensch aus Papua-Neuguinea erkennen, ob ein Deutscher sich fröhlich oder traurig fühlt.
Der Clou dieser Studie: Patrik und Petri analysierten auch ein Dutzend Arbeiten, die untersuchten, durch welche akustischen Merkmale bestimmte Emotionen mit Musik ausgedrückt werden. Dafür hatten Musiker/-innen Melodien so eingespielt, dass sie Freude, Trauer, Ärger, Furcht oder Zärtlichkeit ausdrückten. Diese Studien nutzten außer klassischer Musik auch Folkmusic, indische Ragas, Jazz, Rock, Kinderlieder und freie Improvisationen, eingespielt von Musikern unterschiedlicher Länder und Kulturen. Die Analysen zeigten, dass die akustischen Merkmale emotionalen Sprechens überwiegend die gleichen Merkmale sind, die den Ausdruck von Emotionen in unterschiedlichen Arten von Musik charakterisieren. Der Anfang des so traurig klingenden Lacrimosa(»weinend«) aus Mozarts Requiem ist ebenfalls langsam, leise (piano), und die Melodie geht oft nach unten (das sogenannte »Seufzermotiv«). Der vierte Satz aus Mozarts Serenade »Eine kleine Nachtmusik« hingegen klingt fröhlich, weil er relativ schnell ist, eine hohe Variabilität der Melodie hat (bereits die ersten vier Noten der ersten Violine spannen eine Oktave), die Melodie geht oft nach oben, das Frequenzregister ist relativ hoch.
Diese akustischen Merkmale kann man sogar digital anhand von Audiodateien messen. Wir haben uns dies für ein Emotionsexperiment zunutze gemacht und fröhlich oder furchteinflößend klingende Musik auf Basis computerberechneter akustischer Merkmale ausgewählt.6 Die Audiodateien der furchteinflößenden Musik hatten wir Soundtracks von Thriller-TV-Serien und Horrorfilmen entnommen. Der Computer zeigte an, dass sie viele geräuschhafte, zischende und perkussive Klänge hatte, also Klänge, bei denen die Tonhöhen nicht genau zugeordnet werden konnten – was Unsicherheit hervorruft. Auch Töne und Akkorde waren häufig nur schwer einer Tonart zuzuordnen und dissonant, was sie unbehaglicher machte (denken Sie an Bernard Herrmanns Musik zu Hitchcocks Psycho, insbesondere an die Duschszene).7 Als ich vor einigen Jahren das Klavierkonzert von Beat Furrer zum ersten Mal hörte, war ich hingerissen davon, wie genau es all diesen akustischen »Thriller-Parametern« entspricht. Begeistert hörte ich das Konzert damals immer wieder, weil es mich besonders an spannende Verfolgungsszenen aus älteren amerikanischen Kriminalfilmen erinnerte. Als ich dies Beat Furrer in aller Verehrung erzählte, entgegnete er mir: »Interessant – das wollte ich überhaupt nicht ausdrücken!« Macht nichts, ich bin trotzdem ein großer Fan seines Konzerts.
Übereinstimmend mit den Befunden, dass emotionale Sprache universal erkannt wird, hat meine Arbeitsgruppe herausgefunden, dass auch der Ausdruck von Emotionen in westlicher Musik durch die Imitation von emotionaler Sprechmelodie universal erkannt wird – also unabhängig davon, in welcher Kultur man aufgewachsen ist. Um dies zu erforschen, führte Thomas Fritz eine Expedition in den abgeschiedenen Norden Kameruns durch. Dort suchte er Menschen vom Volk der Mafa auf, die noch nie zuvor westliche Musik gehört hatten. Diesen spielte er westliche Musik vor, die sich entweder nach Freude, nach Trauer oder nach Furcht anhörte (allesamt kurze Klavierstücke). Nach jedem Stück sahen die Teilnehmer/-innen Fotos von drei Gesichtern: ein fröhliches, ein trauriges und ein furchterfülltes Gesicht. Dann wurden sie gebeten, auf dasjenige Gesicht zu zeigen, das am besten zur Musik passte. Die Mafa erkannten alle drei Emotionen deutlich über Zufallsniveau, was bedeutet, dass der Ausdruck von Fröhlichkeit, Traurigkeit und Furcht in westlicher Musik tatsächlich universal erkannt wird, also unabhängig von kultureller Erfahrung.8 Die Mafa haben die Emotionen zwar weniger gut erkannt als westliche Hörer, man muss jedoch berücksichtigen, dass das Konzept, Emotionen in Musik auszudrücken, für die Mafa ganz neu war – ihre Musik hat immer eine fröhliche Bedeutung, sie kennen keine Musik, die etwa nach Traurigkeit klingt. Außerdem klingt unsere Musik für die Mafa völlig anders als für uns. (Ein Mafa-Mann sagte nach einem der Experimente, er möge die Musikausschnitte von Elvis Presley besonders gerne, weil die sich genauso anhörten wie Fröschequaken …)
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen: Emotionen, die in westlicher Musik so ausgedrückt werden, dass sie ähnlich wie eine emotionale Stimme klingen, werden auch von Menschen erkannt, die zum ersten Mal westliche Musik hören. Dies liegt daran, dass das Erkennen emotionaler Stimmen zu einem erheblichen Teil biologisch-genetisch in uns Menschen angelegt ist.9 Das bedeutet auch, dass es tatsächlich eine allgemeingültige Definition darüber gibt, wie Musik positiv (zum Beispiel fröhlich) oder negativ (zum Beispiel furchteinflößend) klingt. Ob wir das dann auch so empfinden, ist eine andere Frage. Manchmal macht uns furchteinflößende (also negativ klingende) Musik einen Thriller-Film besonders vergnüglich, oder positiv klingende Volksmusik geht einem Heavy-Metal-Enthusiasten auf die Nerven. Außerdem kann Musik subjektiv empfunden natürlich auch fröhlich klingen, wenn sie überhaupt keine Emotionen imitiert bzw. porträtiert – wie bei den Mafa, deren Musik für sie immer fröhlich klingt, uns jedoch stark an ein Autohupen-Konzert erinnert.
Wir können also am Klang von Sprache erkennen, wie sich ein Sprecher fühlt, und die Bedeutung vieler Wörter hängt mit deren Klang zusammen. Da diese musikalischen Aspekte von Sprache kulturunabhängig auftreten, können wir daraus schließen, dass sie zur biologischen Grundausstattung des Menschen gehören. Emotionale Signale, die zu dieser biologischen Ausstattung zählen, können bereits von Babys erkannt werden. Sie werden durch Musik und durch den Klang von Sprache emotional berührt. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass sich die eigene Stimme im Umgang mit Babys warm und ruhig anhört und dass sie nach Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit klingt. Werden Babys Schlaf- und Wiegenlieder vorgesungen, hilft es ihnen, sich zu beruhigen – ihre Herzrate wird niedriger, ihre Bewegungen sowie ihre Atmung werden langsamer und gleichmäßiger. Für Frühgeborene sind solch beruhigende Effekte besonders wichtig, weil Aufregung für sie gefährlich ist. Tut Babys etwas weh, kann Musik zudem helfen, diese Schmerzen zu lindern.10
Auch die akustisch-musikalischen Merkmale von Schlaf- und Wiegenliedern sind übrigens universal. Diese Lieder hören sich über den gesamten Globus ähnlich an: Die Melodien gehen oft nach unten, sind relativ einfach strukturiert und repetitiv (denken Sie an Schlaf, Kindlein, schlaf).11 Deswegen klangen solche Lieder wahrscheinlich bereits vor Hunderttausenden von Jahren so ähnlich wie heute.
Manche Eltern singen ihren Babys leider keine Lieder vor, weil sie meinen, sie könnten nicht singen. Allerdings vergessen sie dabei, dass das Kind ja noch gar keine Vergleichsmöglichkeiten hat und sie sich daher vor dem Baby gar nicht blamieren können. Außerdem geht es auch nicht darum, für das Baby den Grundstein für eine spätere Opernkarriere zu legen, sondern spielerisch die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung zu unterstützen. Deswegen ist Singen in jedem Fall wichtig: Es fördert die soziale Bindung zwischen Mutter und Kind bzw. Vater und Kind, die Kommunikation und das Lernen von Sprachlauten. Zudem fördert es multisensorische Erfahrungen, also Erfahrungen mehrerer Sinne gleichzeitig (hören, sehen, fühlen, gewiegt werden). Es ist sogar gut, bereits vor der Geburt diese Lieder zu singen, weil das Baby sie dann nach der Geburt wiedererkennt und dies das Baby beruhigt. Werdende Eltern können gerne auch bereits während der Schwangerschaft gelegentlich eine Spieluhr auf den Bauch der Schwangeren legen, denn dieses Lied erkennt das Baby nach der Geburt ebenfalls wieder.
TIPPS: Singen, Sprechen und Tanzen mit Babys
•Babys werden durch den emotionalen Klang einer Stimme unmittelbar emotional angesteckt. Wenn eine Stimme unwirsch, ärgerlich, deprimiert oder ängstlich klingt, ruft dies unweigerlich negative Emotionen und Unruhe beim Baby hervor. Deshalb ist es wichtig, dass sich die eigene Stimme warm und ruhig anhört und nach Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit klingt. Beim Singen ist dies besonders leicht. Singen Sie daher einem Baby Spiel-, Wiegen- und Schlaflieder vor. Schauen Sie ihm mit einladendem Blick ins Gesicht und wiegen Sie es sanft im Takt der Musik. Insbesondere in Momenten, in denen man meint, gleich die Nerven zu verlieren, oder in denen man sich vielleicht ängstlich, deprimiert oder gar depressiv fühlt, hilft Singen, denn beim Singen eines sanften Wiegenliedes ist es schwierig, ängstlich, ärgerlich oder deprimiert zu klingen. Außerdem atmet man beim Singen zwangsläufig ruhiger und tiefer – dadurch wird man als Bonus gleich selbst ruhiger und entspannter. Singen Sie also gerade in denjenigen Momenten, in denen Ihnen am allerwenigsten danach zumute ist …
•Wenn Sie gerade nicht singen können oder das Singen einfach nicht helfen will, legen Sie Tanzmusik auf (bitte nicht zu laut stellen!) und tanzen Sie sanft mit Ihrem Baby dazu. Wippen Sie zum Beispiel gemeinsam mit dem Baby sanft im Takt der Musik.
•Falls dies noch nicht zur Beruhigung hilft, stellen Sie Hautkontakt her und streicheln Sie langsam einen Arm des Babys hinauf und hinunter (dies aktiviert Nervenfasern, die Schmerz reduzieren).
•Beim Windeln- und Kleiderwechseln: Sagen Sie dem Baby mit ruhiger, warmer Stimme, was Sie gerade mit ihm tun (das würden Sie ja ebenfalls wollen, wenn jemand ungefragt alles Mögliche mit Ihnen anstellen würde …). Kommentieren Sie nicht alles, was das Baby gerade tut (das geht bereits Babys auf die Nerven).
•Falls Sie Tipps zum Singen mit Ihrem Baby wünschen, können Sie auch Musiktherapeuten zurate ziehen. Bei Frühgeburten und bei »Wochenbettdepression« ist es äußerst ratsam, die Hilfe eines/-r Musiktherapeut/-in in Anspruch zu nehmen.
•Babys mögen Musik nicht nur aufgrund des angenehmen Klangs, sondern auch wegen ihrer klaren Struktur. Sorgen Sie daher über die Musik hinaus dafür, dass der Tagesablauf des Babys einen klaren Rhythmus hat, mit wiederkehrenden Zeiten für Schlafen, Essen, Spielen und Singen. So hat der Tag eine Struktur und das Baby kann einen biologischen Tagesrhythmus entwickeln (der natürlich den Bedürfnissen des Babys entsprechen und immer wieder an seine Entwicklung angepasst werden muss).
Der Homo sapiens besitzt zudem eine biologisch tief verwurzelte Veranlagung für Rhythmus. Dies können wir auch daraus ersehen, dass Menschen rhythmische Information gegenüber zeitlich unstrukturierter Information bevorzugen. Sie bilden obendrein unwillkürlich einen Rhythmus bzw. Takt aus zufälligen Klangereignissen: Andrea Ravignani bat in einer Studie Versuchspersonen, von einem Computer quasi zufällig erzeugte, chaotisch klingende Trommelfolgen zu imitieren.12 Die Aufnahmen davon wurden dann einer nächsten »Generation« von Versuchspersonen vorgespielt, wieder mit der Aufgabe, die Trommelfolgen zu imitieren – das wurde mehrmals so wiederholt. Die erste Person imitierte also zufällige Tonfolgen, die zweite Person imitierte das, was die erste gespielt hatte, die dritte imitierte, was die zweite gespielt hatte etc. Dabei imitierte jede Person die Trommelfolgen unbewusst etwas rhythmischer, als sie auf den gehörten Aufnahmen tatsächlich waren. Dadurch wurden nach mehreren Durchgängen aus den ursprünglich chaotischen Trommelfolgen rhythmische, musikalische Trommelfolgen – und nach mehreren »Generationen« von Versuchspersonen war aus einer zufälligen Trommelfolge ein Beat entstanden.
Faszinierenderweise waren die musikalischen Eigenschaften dieser Beats typisch für eine Reihe von statistisch-rhythmischen Universalien, die über den Globus hinweg in Musik beobachtet werden können. Zunächst einmal bekamen die Tonfolgen einen Takt. Dabei wurden die Töne entweder in Zweier-Zählzeiten gruppiert (wie bei einem Marsch) oder in Dreier-Gruppen (wie bei einem Walzer). Zudem wurden die daraus entstehenden Takte derart gegliedert, dass insgesamt kaum mehr als fünf unterschiedliche Dauern entstanden (»Viertel«, »Achtel«, »punktierte Achtel« usw.). Schließlich wurden alle diese Organisationsprinzipien dazu genutzt, rhythmische Figuren, Beats und »Riffs« für Lieder zu formen. Dadurch waren die Trommelfolgen auch besonders gut zu lernen – sie wurden also unbewusst so strukturiert, dass sie möglichst kompatibel mit den menschlichen Gedächtnis- und Kognitionsfähigkeiten wurden. Die universellen Eigenschaften des musikalischen Rhythmus sind in den kognitiven und biologischen Eigenschaften des menschlichen Gehirns und des menschlichen Körpers veranlagt.
Viele Tiere kommunizieren ebenfalls über akustische Signale, also über Sounds. Anders als Naturgeräusche und Geräuschetexturen (wie Regen, das Knistern eines Feuers, Wasserplätschern, Windrauschen) sind die von Tieren erzeugten Sounds von lebenden Organismen strukturiert und erinnern uns daher oft an Musik: die Gesänge von Vögeln, Walen oder Gibbons, das synchrone Zirpen von Zikaden, das Trommeln auf Baumwurzeln und Körperteile bei Menschenaffen. Allerdings kann keine Spezies gemeinsam Melodien singen oder in einer Gruppe flexibel einen Takt halten bzw. produzieren. Selbst Studien, die berichteten, Tiere könnten ihre Bewegungen zu einem Takt synchronisieren, haben entweder eine zweifelhafte wissenschaftliche Qualität, lassen sich nicht wiederholen oder basieren auf antrainiertem Verhalten, das in freier Wildbahn nicht zu beobachten ist. Beispielsweise zeigt das bekannte YouTube-Video des Kakadus »Snowball« zwar einen Vogel, der zur Musik der Backstreet Boys seinen Kopf hin- und herbewegt, allerdings zeigt das Video nicht die Besitzerin des Vogels, die hinter der Kamera dem Vogel mit ausladenden Gesten die Bewegungen enthusiastisch vormacht …
Was keine andere Spezies kann, können Menschen bereits wenige Monate nach der Geburt. In einer Studie von Marcel Zentner und Tuomas Eerola hörten Babys im Alter von fünf bis zehn Monaten schwungvolle klassische Musik wie etwa das Finale aus dem »Karneval der Tiere« von Saint-Saëns.13 Beim Hören fingen die Babys an zu strampeln, und zwar so, dass der Takt ihrer Bewegungen zum Takt der Musik passte – ein wirklich faszinierender Befund, denn dies zeigt die angeborene Neigung des Menschen, sich an Musik zu beteiligen. Außerdem lächelten die Babys besonders dann, wenn sie ihre Bewegungen zur Musik synchronisierten; die Beteiligung an Musik bereitet uns Menschen natürlicherweise Vergnügen. Die Babys dieser Studie stammten aus Finnland und der Schweiz. In einer späteren Studie mit Babys aus Brasilien wurden fast identische Ergebnisse erzielt – außer dass sich die brasilianischen Babys zur gleichen Musik deutlich mehr bewegten (sie wärmten sich wahrscheinlich schon mal für den Karneval auf).14 Diese Studien zeigen, dass Musik eine gemeinschaftsstiftende Funktion in uns stimuliert: jene, uns gemeinsam und im gleichen Takt zur Musik zu bewegen. Die sozialen Effekte dieser Funktion sind prosoziales Verhalten und Kooperation. Wenn vierzehn Monate alte Babys im Takt zu Musik gehopst werden, sind sie danach hilfsbereiter, als wenn sie in einem Takt gehopst werden, der nicht zur Musik passt (sie helfen dem Experimentator eher, einen »versehentlich« heruntergefallenen Stift wiederzuerlangen).15 Ähnliches wurde in einer Studie von Sebastian Kirschner und Michael Tomasello beobachtet: Wenn vierjährige Kinder gemeinsam Musik machen, kooperieren sie danach mehr miteinander und helfen sich gegenseitig mehr.16 Bereits kleine Kinder zeigen also mit ihrer erhöhten Hilfs- und Kooperationsbereitschaft evolutionär wichtige Funktionen von Musik.
Die Ursprünge der menschlichen Musikalität reichen mit der Evolution von Säugetieren Dutzende von Millionen Jahren zurück. Musik mit Takt und Tonleiter, gesungen oder gespielt in Gruppen, gibt es jedoch nur beim Menschen. Ich denke, dass die Fähigkeit, Bewegungen in einer Gruppe zu einem Takt zu synchronisieren, die einfachste mentale Funktion ist, welche die Spezies Mensch gerade eben von Tieren unterscheidet. Dies würde bedeuten, dass Musik der entscheidende evolutionäre Schritt des Homo sapiens war – möglicherweise gar der Gattung Homo. Genau dieser Schritt brachte dem Menschen Vorteile, von denen heute noch jeder Einzelne beim Erleben von Musik profitieren kann.
Unser angeborener Sinn für Musik – Auch Nichtmusiker sind musikalisch
Wenn aus der Stille vor dem Beginn eines Konzerts heraus die ersten Töne eines Stückes erklingen, geschieht im Gehirn ein neuronaler Urknall mit phänomenalen Auswirkungen. Unser Gehirn hat circa 86 Milliarden Nervenzellen. Davon befinden sich im Kortex, also in der Hirnrinde, etwa sechzehn Milliarden – das sind mehr, als jede andere Spezies besitzt.17 Jede dieser Nervenzellen hat durchschnittlich tausend Verbindungen zu anderen Nervenzellen, was Billionen von Verbindungen im Gehirn ergibt. (Zum Vergleich: Die Milchstraße hat gerade mal ein paar Hundert Milliarden Sterne.) Zu dem durch Töne hervorgerufenen Urknall im Gehirn gehört, dass bereits nach wenigen Momenten Millionen von Neuronen mit Milliarden von Verbindungen aktiv werden – in Netzwerken des Gehirns, die zuständig sind für Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Intelligenz, Sensomotorik, Emotion und Kommunikation.
Der Urknall beginnt mit der Aktivität von Nervenzellen, die zur Wahrnehmung von Richtung, Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe führt. Danach folgt das Erkennen von Harmonien, die Unterscheidung von Instrumenten und das Erkennen von Ton- bzw. Harmoniefolgen. Diese Prozesse geschehen im Hörsystem (im Hirnstamm, Thalamus und Hörkortex). Außerdem werden unterschiedliche Gedächtnisse aktiviert, angefangen mit dem sensorischen »Ultrakurzzeitgedächtnis«, das Töne über wenige Augenblicke speichert und miteinander in Beziehung setzt – dadurch können wir den Puls und das Metrum der Musik wahrnehmen und hören, ob eine Melodie nach oben oder unten geht. Um das Ende einer Melodie mit ihrem Anfang in Beziehung setzen zu können, brauchen wir zudem ein Arbeitsgedächtnis (auch »Kurzzeitgedächtnis« genannt). Kennen wir die Musik, wird unser Langzeitgedächtnis des Stückes aktiviert, und wenn wir eine persönliche Erinnerung an dieses Stück haben, kommt automatisch das autobiografische Gedächtnis ins Spiel. Wir verarbeiten die Musik auch entsprechend dem Wissen, das wir über musikalische Regeln haben, selbst wenn wir uns etwa als Nichtmusiker dieses Wissens gar nicht bewusst sind. Wir erleben außerdem emotionale Reaktionen, dabei ändert sich unser Herzschlag und unsere Atmung oder wir bekommen eine Gänsehaut.
Die Musiker/-innen auf der Bühne brauchen zudem den sensomotorischen Apparat des Gehirns, um ihre Instrumente zu spielen. Außerdem lesen sie die Noten und achten gegenseitig aufeinander, um ihre Bewegungen zu koordinieren und genau zusammenzuspielen. Schließlich richten sowohl die Musiker als auch das Publikum ihre Aufmerksamkeit gemeinsam auf die Musik. Diese Prozesse beschäftigen praktisch das gesamte Gehirn – Musik kann die Aktivität in jeder Struktur des Gehirns beeinflussen.
Als ich während meines Studiums Mitte der 90er-Jahre anfing, mich dafür zu interessieren, wie das Gehirn all diese Leistungen vollbringen kann, war noch kaum etwas darüber bekannt, wie das Gehirn Musik verarbeitet. Ich habe deswegen zunächst erforscht, was im Gehirn passiert, wenn wir Musik hören. Ich habe damit angefangen, zu untersuchen, was im Gehirn passiert, wenn wir Akkorde hören, die den musikalischen Regeln entsprechend »richtig« oder »falsch« sind. Diese Methode war ähnlich der Methode, die Gehirnaktivität der Sprachverarbeitung zu untersuchen. Solche Sprachexperimente wurden damals auch von Thomas Gunter und Angela Friederici am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaft in Leipzig durchgeführt, mit denen ich meine ersten Studien gemeinsam plante. In den Sprachexperimenten wurde zum Beispiel Gehirnaktivität auf richtige und falsche Wörter in Sätzen wie »Er sieht das kühle Bier« und »Er sieht den kühlen Bier« verglichen. Jeder, der Deutsch kann, erkennt leicht solche falschen Sätze. Wir können dies selbst dann, wenn wir vielleicht nicht genau erklären können,warum die Sätze grammatisch richtig oder falsch sind. Genauso ist es mit Musik, mit der wir vertraut sind, wie Musik in Dur und Moll, wenn wir in einem Land aufgewachsen sind, in dem solche Musik viel gehört bzw. gespielt wird. Auch hier können wir hören, ob sich eine Folge von Tönen oder Akkorden richtig oder falsch anhört, unabhängig davon, ob wir Musiker oder Nichtmusiker sind, also unabhängig davon, ob wir erklären können, warum sich diese Tonfolge richtig oder falsch anhört. (Tatsächlich sind musikalische Tonfolgen weder »falsch« noch »richtig«, sondern eher üblich und daher erwartet oder eher ungewöhnlich und daher unerwartet – die ungewöhnlichen harmonischen Wendungen bei Bach, Mozart oder Beethoven sind ja nicht falsch, sondern oft genial unerwartbar; der Einfachheit halber spreche ich hier jedoch von »richtig« und »falsch«.)
Um zu untersuchen, wie Akkordfolgen im Gehirn verarbeitet werden, baute ich sozusagen Fehler der musikalischen Grammatik in Musikstücke ein. Dafür komponierte ich etliche Akkordfolgen, die allesamt aus fünf Akkorden bestanden. Sie wurden von einem Computer auf einem Synthesizer-Klavier gespielt. Die eine Hälfte der Folgen waren normale Kadenzen (wie etwa Tonika – Tonikaparallele – Subdominante – Dominante – Tonika), bei der anderen Hälfte wurde einer der Akkorde durch einen leiterfremden Akkord ersetzt, also durch einen Akkord, der nicht zur Tonart gehörte. Insbesondere wenn diese Akkorde am Ende der Sequenzen auftauchen, kann praktisch jeder erkennen, dass sie falsch klingen.
Blick ins Labor: Messung hirnelektrischer Reaktionen auf Akkorde
Um die Verarbeitung von Akkorden im Gehirn zu erforschen, haben wir zunächst Elektroenzephalografie (EEG)-Messungen durchgeführt. Hierfür wird einem Probanden eine EEG-Kappe aufgesetzt, die bereits Elektroden enthält (meist 32 oder 64). Sie ähnelt einer Badekappe, aus der viele lange Kabel heraushängen. Anhand der Elektroden werden die elektrischen Signale des Gehirns gemessen. Wenn die Kappe korrekt aufgesetzt wird, befinden sich alle Elektroden auf einen Schlag an der richtigen Position am Kopf. Der Proband wird in eine elektrisch abgeschirmte EEG-Kabine begleitet, in der sich ein bequemer Sitz, ein Bildschirm, eine Tast-Box und ein Lautsprecher befinden. Dann wird ihm gesagt, dass er Akkordfolgen hören wird, dass gelegentlich ein Akkord von einem anderen Instrument gespielt werde und es seine Aufgabe sei, daraufhin umgehend eine Taste zu drücken. Die Tür der Kabine wird geschlossen und die EEG-Aufzeichnung gestartet – das Experiment beginnt. Der Proband hört Dutzende von Akkordfolgen, dies insgesamt 10 bis 15 Minuten.
Während der EEG-Aufzeichnung kann man anhand der Hirnstromkurven auf dem Bildschirm noch nicht erkennen, wie das Gehirn Musik verarbeitet. Die EEG-Wellen enthalten viel Rauschen, das aus Muskeln der Kopf- und Halsregion herrührt und natürlich auch von spontaner Aktivität des Gehirns, die nichts mit dem Experiment zu tun hat (immerhin ist das Gehirn ja noch mit anderen Dingen als mit dem Experiment beschäftigt). Im Vergleich zu dem Rauschen in den EEG-Wellen geht die Hirnaktivität, die mit der Musikverarbeitung zu tun hat, erst einmal unter wie das Summen einer Biene im Straßenverkehr. Deswegen werden reguläre und irreguläre Akkordfolgen viele Dutzend Male dargeboten und mehrere (15 bis 25) Versuchspersonen gemessen. So kann in der Datenanalyse aus dem zufälligen Rauschen das elektrische Hirnsignal auf den immer gleichen Akkord sichtbar gemacht werden. Dies wird das »hirnelektrische Potenzial« auf diesen Akkord hin genannt. Mich haben bei meinen damaligen Forschungen vor allem die hirnelektrischen Potenziale auf die falschen Akkorde interessiert. Diese Potenziale unterschieden sich deutlich von denen richtiger Akkorde – das Experiment hatte funktioniert und wir konnten die Verarbeitung musikalischer Grammatik erforschen.
Ich entdeckte damals, dass sich die hirnelektrischen Antworten auf richtige und falsche Akkorde bereits circa 150 Millisekunden nach Beginn der Akkorde unterschieden, also nach 150 Tausendstelsekunden – das ist weniger als ein Wimpernschlag.18 Das elektrische Hirnpotenzial auf falsche Akkorde ähnelte außerdem stark der typischen hirnelektrischen Antwort auf syntaktisch falsche Wörter: Es hatte einen ähnlichen Zeitverlauf und eine weitgehend ähnliche Verteilung über dem Kopf. Dies waren die ersten Hinweise darauf, dass Musik und Sprache in ähnlichen Netzwerken des Gehirns verarbeitet werden. Der einzige Unterschied war, dass die hirnelektrischen Antworten auf unübliche Akkorde etwas größer über der rechten Hemisphäre waren und elektrische Potenziale auf syntaktische Fehler in Sprachexperimenten typischerweise etwas größer über der linken Hemisphäre sind.
Wir führten dieses Experiment sowohl mit Musikern als auch mit Nichtmusikern durch, also mit Personen, die weder ein Instrument spielten noch im Chor sangen. Die Daten waren eindeutig: Auch die Gehirne der Nichtmusiker reagierten auf die falschen Akkorde – ihre hirnelektrischen Antworten waren kaum von denen der Musiker zu unterscheiden, sie waren lediglich etwas kleiner. Dies zeigte, dass unübliche Akkorde von Nichtmusikern mit den gleichen Hirnmechanismen verarbeitet werden wie von Musikern.
Ironischerweise konnten wir die hirnelektrischen Reaktionen auf falsche Akkorde selbst bei Personen beobachten, die von sich selber mit voller Überzeugung behaupteten, sie seien »völlig unmusikalisch«. Dieser Widerspruch kommt daher, dass wir oft gar nicht wissen, was wir alles wissen. In der Fachsprache reden wir von »implizitem Wissen« – wir können ein erstaunlich genaues Wissen von etwas haben, ohne zu wissen, dass wir dieses Wissen haben. Deswegen waren viele unserer Versuchspersonen überrascht davon, wie stark ihr Gehirn auf die falschen Akkorde reagiert hatte, sogar dann, wenn ihnen selber gar nichts Besonderes aufgefallen war. Ich erinnere mich, wie ein Freund, dem ich seine Hirnstromkurven nach dem Experiment gezeigt hatte, mich fragte: »Also dann bin ich wohl gar nicht unmusikalisch?«, und von mir wissen wollte, ob er dann vielleicht auch lernen könne, ein Instrument zu spielen; er wollte schon immer Saxofon spielen lernen. Ich konnte beides vorbehaltlos bejahen. Einige Zeit später sah ich ihn in einem Universitätskonzert Bariton-Saxofon spielen, was für ihn eine sichtbare Freude und für mich ein unvergesslicher Moment war.
Wir hatten also nachgewiesen, dass selbst diejenigen einen Sinn für Musik besitzen, die sich für unmusikalisch halten. Selbst wenn wir uns einer Fähigkeit nicht bewusst sind, können wir sie doch haben. Viele Menschen halten sich für unmusikalisch, weil sie nicht Musik studiert haben, keine Noten lesen können, kein Instrument spielen oder niemals Singen gelernt haben. (Ulysses S. Grant, der 18. Präsident der USA, soll einmal gesagt haben: »Ich kenne nur zwei Melodien: Die eine ist ›Yankee Doodle‹ und die andere nicht.«) Musikalisch nicht ausgebildet zu sein bedeutet jedoch keinesfalls, unmusikalisch zu sein. Jeder Mensch ist musikalisch, denn Musikalität ist eine natürliche biologische Grundausstattung des Menschen. Anders ausgedrückt: Wir sind von Natur aus musikalische Wesen. Deswegen kann jeder Mensch von den heilsamen Effekten der Musik profitieren.
Die Ergebnisse dieser damaligen Studien sind anschließend von Gruppen aus unterschiedlichen Ländern wiederholt worden. Meine eigene Forschungsgruppe wie auch andere Gruppen haben seitdem außerdem herausgefunden, dass das Gehirn falsche Akkorde selbst dann verarbeitet, wenn ein Proband gerade ein Buch liest und gar nicht auf die Musik achtet. Wir konnten überdies zeigen, dass diese hirnelektrischen Reaktionen nicht nur durch die für unsere Experimente entworfenen Stimuli hervorgerufen werden, sondern auch durch »echte« Musik von Bach, Beethoven und Schubert.19
Wir haben diese EEG-Experimente zudem mit Kindern durchgeführt. Davor lautete die gängige Meinung, Kinder könnten eigentlich erst ab dem Grundschulalter anfangen, Musik zu verstehen. Diese Ansicht schien mir jedoch falsch zu sein – bei meinen eigenen Kindern konnte ich ja sehen, wie sehr sie Musik mochten, wie sie mitsangen und mitklatschten und vor Lachen fast vom Stuhl fielen, wenn ich ihnen die falschen Akkorde aus den Akkordfolgen meiner Experimente vorspielte. In weiteren Forschungen fand meine Gruppe zunächst bei Fünfjährigen hirnelektrische Antworten auf ungewöhnliche Akkorde, später konnten wir solche Antworten sogar bei Zweieinhalbjährigen nachweisen.20 Dabei lautete übrigens eine typische Bemerkung der Eltern: »Also, ich höre da keinen Unterschied – da wird mein Kind erst recht keinen hören.« Weit gefehlt: Kinder nehmen meist viel mehr (und viel genauer) wahr, als ihre Eltern meinen oder gar selber wahrnehmen. Bei den Kleinkindern unserer Studie waren hirnelektrische Reaktionen auf falsche Akkorde jedenfalls nachweisbar – unsere Ergebnisse zeigten daher, dass bereits Kleinkinder anfangen, ein sehr differenziertes Musikwissen zu erwerben. Sie tun dies von sich aus und ohne dass es ihnen erklärt werden müsste (keines der Kinder hatte vorher Musikunterricht bekommen), und sie tun es allein anhand von Musik, die sie zum Beispiel im Kindergarten oder zu Hause im Radio hören. Daran können wir erkennen, dass Menschen einen angeborenen Sinn dafür haben, die Strukturen und die Regelhaftigkeiten von Musik zu erkennen und zu lernen.
Die hirnelektrischen Reaktionen der Zweieinhalbjährigen waren allerdings noch recht klein. Deshalb vermute ich, dass Kinder im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren anfangen, die syntaktischen Regelmäßigkeiten von Musik zu erkennen, abzuspeichern und auf das Hören unbekannter Musik anzuwenden – genau das Alter, in dem sie auch anfangen, auf falsche Grammatik in der Sprache zu reagieren.
Musik und Sprache im Gehirn
Rie Matsunaga, eine japanische Musikforscherin, arbeitete vor einigen Jahren als Gast in meinem Forschungsteam. Ich wunderte mich seinerzeit über ihren Namen, weil »Rie« mit einem »r« beginnt, obwohl die meisten Japaner doch gar kein »r« sprechen können. Würden die meisten Japaner zu ihr dann immer »Lie« sagen statt »Rie«? Als ich sie dies fragte, guckte sie mich recht verwirrt an – sie hatte meine Frage nicht verstanden, auch nicht, als ich sie wiederholte. Es dauerte einen Moment, bis es mir dämmerte: Japaner können nicht nur kein »r« aussprechen, sondern »l« und »r« hören sich für sie auchgleich an. Als ich Rie fragte, ob sie gar keinen Unterschied zwischen »Lie« und »Rie«, höre, nickte sie.
Auch wenn es uns selbstverständlich erscheint: Die Verarbeitung von Sprachlauten, von Sprache überhaupt und von Musik, ist eine bemerkenswerte Fähigkeit unseres Gehirns. Interessanterweise ist die Schnittmenge zwischen den neuronalen Operationen der Musik- und Sprachverarbeitung im Gehirn erstaunlich groß. Sie spiegelt die enge Verflechtung der evolutionären Wurzeln von Sprache und Musik wider. Auf den ersten Verarbeitungsstufen des Gehirns werden Sprach- und Musik-Sounds sogar praktisch gleich verarbeitet. Dies liegt daran, dass Sprache und Musik rein akustisch betrachtet aus denselben Informationen bestehen: Ihre Sounds lassen sich dadurch charakterisieren, welches Frequenzspektrum sie haben und wie ihre Intensität ab- und zunimmt. Deswegen kann ein Geigenton ähnlich wie ein »i« klingen, ein Fagott-Ton wie ein »o«, ein Hi-Hat-Ton wie ein »ts« oder eine Kastagnette wie ein »khh«. Instrumente können also Sounds produzieren, die Sprech-Sounds sehr ähnlich sind, und Sänger wie Bobby McFerrin oder der Beatboxer Tom Thum können mit ihrer Stimme Sounds erzeugen, die wie Instrumente klingen.
Jeder Vokal ist ein Ton. Die akustischen Unterschiede zwischen den einzelnen Vokalen sind lediglich Intensitätsunterschiede der Obertöne (in der Phonetik »Formanten« genannt). Die akustischen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Vokalen sind oft winzig, und sie zu hören ist eine musikalische Meisterleistung. Deutsche können Vokale wie »u«, »ü«, »ö« und »o« leicht unterscheiden, wer jedoch keine Sprache mit Umlauten spricht, kann diese Vokale oft kaum aussprechen und die Unterschiede zwischen ihnen kaum hören. Umgekehrt hat das Norwegische einen Laut »y«, der klanglich zwischen dem deutschen »i« und »ü« liegt. Selbst als Musiker habe ich Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen einem »i« und diesem norwegischen »y« zu hören und zu sprechen (immerhin fällt es Musiker/-innen leichter, solche Unterschiede zu erkennen).21 Die Tatsache, dass norwegische Nichtmusiker leicht »y« sprechen und verstehen können und deutsche Nichtmusiker keine Probleme mit Umlauten haben, zeigt, wie musikalisch der Mensch Klänge wahrnehmen kann – selbst dann, wenn man kein Musiker ist. Wer normal sprechen kann und sich dabei für unmusikalisch hält, unterschätzt also die bewundernswerten musikalischen Leistungen seines Hörsinns.
Übrigens konnten wir als Babys die Unterschiede zwischen allen möglichen Sprachlauten noch genau wahrnehmen. Erst mit circa neun Monaten fangen wir an, uns in unsere Muttersprache so einzugewöhnen, dass wir Lautunterschiede anderer Sprachen immer weniger genau wahrnehmen.22
Die akustischen Merkmale von Konsonanten sind oft eine Mischung aus Frequenzspektrum, An- bzw. Abschwellen der Intensität und der Dauer. Konsonanten sind also etwas komplizierter strukturiert als Vokale, allerdings sind auch ihre Merkmale die gleichen, die die musikalischen Klänge charakterisieren. Beispielsweise können wir anhand dieser Merkmale Schlagzeuginstrumente unterscheiden (etwa das Hi-Hat-»tsss« von einem Becken-»tschhh«) oder einen gezupften Gitarrenton (»diiiee«) von einem gestrichenen Geigenton (»niiiee«).
Weil Sprach- und Musik-Sounds akustisch aus denselben Informationen bestehen, unterscheidet das Gehirn auf den ersten Verarbeitungsstufen des Hörsystems zunächst kaum zwischen Musik- und Sprach-Sounds. Auch jenseits einzelner Sounds hat Sprache etliche Gemeinsamkeiten mit Musik: Wenn mehrere Sprach-Sounds aneinandergereiht werden – also bei Wörtern und Sätzen –, entsteht eine Sprachmelodie, anhand derer wir eine Frage von einer Antwort unterscheiden können. Außerdem entsteht ein Rhythmus, der es uns erleichtert, einem Sprecher oder einer Sprecherin zu folgen. Betonungen sind wichtig, um Inhalte besser zu erkennen. Sie zeigen, ob »PETER Geige spielt« oder »Peter GEIGE spielt«. Am emotionalen Klang hingegen können wir erkennen, wie sich ein Sprecher fühlt. Melodie, Rhythmus, Betonungen, Klang – all das sind also Merkmale von Musik und Sprache. Kein Wunder, dass das Gehirn Musik und Sprache teilweise in denselben Strukturen verarbeitet.
Die musikalischen Aspekte einer Sprache sind für Kleinkinder wichtig, um diese Sprache zu lernen. Für Kleinkinder (und noch mehr für Babys) ist es zunächst gar nicht so bedeutend, was ihnen gesagt wird oder was sie selber sagen (bzw. brabbeln), sondern wie es ihnen gesagt wird und wie sie etwas sagen (bzw. brabbeln) – also welche Musik die Sprache macht. Sie müssen erst verstehen lernen, dass die Klänge der Sprache spezielle Bedeutungen haben.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























