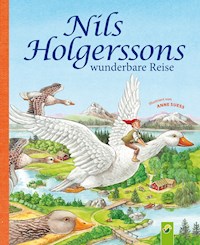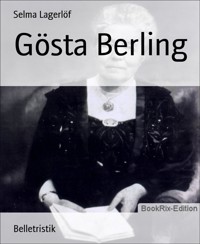
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ein opulentes Buch. Das Buch der Nobelpreisträgerin beschreibt das Leben eines abgesetzten Pfarrers in Schweden. Verschiedene Geschichten werden darin eingeflochten, verwoben mit Gösta Berlings Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Gösta Berling
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitelblatt
Gösta Berling
Erzählungen aus dem alten Wermland
von
Selma Lagerlöf
Titel del Originalausgabe:Gösta Berlings saga
Ins Deutsche übertragen von Mathilde Mann
Einleitung
Der Pfarrer
Der Bettler
Der Pfarrer
Endlich stand der Pfarrer auf der Kanzel. Die Leute in der Kirche hoben die Köpfe in die Höhe. Er war also wirklich da! So fiel denn die Predigt diesen Sonntag doch nicht wieder aus wie am letzten Sonntage und an vielen Sonntagen vorher.
Der Pfarrer war jung, von hohem Wuchs, schlank und strahlend schön. Wenn man ihm einen Helm auf den Kopf gesetzt und ihm ein Schwert und einen Harnisch umgehangen hätte, so wäre er der beste Vorwurf für eine Marmorstatue gewesen, die man getrost nach dem schönsten aller Griechen hätte benennen können.
Der Pfarrer hatte die tiefen Augen eines Dichters und das feste, runde Kinn eines Feldherrn. Alles an ihm war schön, ausdrucksvoll – durchglüht von Genialität und geistigem Leben.
Die Leute in der Kirche fühlten sich eigenartig bedrückt, als sie ihn so erblickten. Sie waren daran gewöhnt, ihn schwankenden Schrittes aus der Schenke herauskommen zu sehen in Gesellschaft lustiger Kameraden wie Oberst Beerencreutz mit dem dicken weißen Schnurrbart und Kapitän Bergh mit der gewaltigen Körperkraft.
Er hatte sich derartig dem Trunk ergeben, daß er mehrere Wochen hindurch sein Amt nicht mehr hatte versehen können, und die Gemeinde über ihn hatte Klage führen müssen, erst bei seinem Propst und dann bei dem Bischof und Domkapitel. Jetzt war der Bischof gekommen, um Visitation in der Gemeinde abzuhalten. Er saß im Chor mit seinem goldenen Kreuz auf der Brust. Die Prediger aus Karlstad und den Nachbargemeinden saßen rings um ihn herum.
Es unterlag keinem Zweifel, daß das Benehmen des Pfarrers die Grenzen des Erlaubten überschritten hatte. Zu jenen Zeiten – diese Geschichte spielt in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts – nahm man es nicht so genau, wenn die Leute tranken; dieser Mann aber hatte infolge seiner Trunksucht sein Amt vernachlässigt, und nun sollte er es verlieren.
Er stand auf der Kanzel und wartete, während der letzte Gesangvers gesungen wurde.
Während er so dastand, kam die Gewißheit über ihn, daß er in der ganzen Kirche, in allen Stühlen lauter Feinde hatte. Die Herrschaft oben in der Loge, die Bauern unten in der Kirche, die Konfirmanden im Chor – sie alle waren seine Feinde. Ein Feind spielte die Orgel, und ein Feind trat die Bälge. Alle haßten ihn, von den kleinen Kindern, die in die Kirche getragen wurden, bis hinab zu dem Kirchendiener, einem steifen, strammen Soldaten, der die Schlacht bei Leipzig mitgemacht hatte.
Der Pfarrer hätte sich auf die Knie werfen und sie um Barmherzigkeit anflehen mögen.
Aber gleich darauf überkam ihn ein dumpfer Groll. Er entsann sich sehr wohl, wie er gewesen war, als er vor einem Jahr die Kanzel zum erstenmal bestieg. Damals war er ein unbescholtener Mann, und jetzt stand er da und schaute auf den Mann mit dem goldenen Kreuz herab, der gekommen war, um ihn zu richten.
Während er das Gebet sprach, rollte eine Blutwelle nach der andern über sein Gesicht – das war der Groll.
Freilich hatte er getrunken, aber wer hatte ein Recht, ihn deswegen anzuklagen? Hatte jemand den Pfarrhof gesehen, auf dem er leben sollte? Der Tannenwald reichte finster und unheimlich bis dicht an die Fenster. Die Feuchtigkeit tropfte von den schwarzen Decken und trieb an den schimmligen Wänden herab. Bedurfte er nicht des Branntweins, um den Mut aufrechtzuerhalten, wenn der Regen oder der treibende Schnee durch die zerbrochenen Fensterscheiben zu ihm eindrang, wenn das schlecht bestellte, vernachlässigte Erdreich nicht Brot genug hergeben wollte, um den Hunger fernzuhalten?
Seiner Meinung nach war er gerade so ein Pfarrer gewesen, wie sie ihn verdienten. Sie tranken ja alle. Weswegen sollte er der einzige sein, der sich Zwang antat? Der Mann, der seine Gattin begraben hatte, betrank sich beim Leichenschmaus; der Vater, der sein Kind zur Taufe gebracht hatte, hielt hinterher ein Saufgelage. Die Gemeinde trank auf dem Heimweg von der Kirche, so daß die meisten berauscht waren, wenn sie zu Hause anlangten. Für die war ein vertrunkener Pfarrer gut genug.
Auf den Amtsreisen, wenn er in seinem dünnen Mantel viele Meilen lang über die gefrorenen Seen gesaust war, wo alle Winde sich Stelldichein gaben, auf seinen Fahrten über diese selben Seen in offnem Boot bei Sturm und Platzregen, im Schneegestöber, wenn er hatte vom Schlitten steigen müssen, um seinem Pferd einen Weg durch haushohe Schneeschanzen zu schaufeln, oder wenn er durch die grundlosen Waldmoore hatte waten müssen – da hatte er es gelernt, den Branntwein zu lieben.
Ein Tag nach dem andern hatte sich finster und schwer dahingeschleppt. Bauer und Edelmann waren gleichsam an den Staub der Erde gefesselt, am Abend aber hatte der Geist seine Fesseln abgeschüttelt, befreit durch den Branntwein. Die Inspiration war gekommen. Das Herz wurde warm, das Leben strahlend, Gesang ertönte, und Rosen dufteten. Da war ihm die Schenkstube zu einem Rosengarten unter südlichem Himmelsstrich geworden. Trauben und Oliven hingen über seinem Haupt, Marmorstatuen schimmerten durch das dunkle Laubwerk, Philosophen und Dichter wanderten unter Palmen und Platanen.
Nein, er, der Pfarrer dort oben auf der Kanzel, wußte, daß das Leben in dieser Gegend des Landes ohne Branntwein nicht zu ertragen war; alle seine Zuhörer wußten das, und nun wollten sie ihn richten.
Sie wollten ihm den Talar abreißen, weil er betrunken in das Haus ihres Gottes gekommen war. Hah! – Alle diese Menschen, hatten die denn – wollten die sich denn etwa einbilden, daß sie einen andern Gott hatten als den Branntwein! –
Er hatte das Einleitungsgebet gesprochen und beugte sich jetzt herab, um das Vaterunser zu beten.
Es herrschte atemlose Stille in der Kirche während des Gebetes. Plötzlich griff der Pfarrer mit fester Hand nach den Bändern, mit denen der Talar zusammengehalten war. Es war ihm, als wenn die ganze Gemeinde mit dem Bischof an der Spitze die Treppe zur Kanzel heraufgeschlichen kam, um ihm den Talar abzureißen. Er lag auf den Knien und wandte den Kopf nicht um, aber er konnte fühlen, wie sie an den Bändern zerrten, und er sah sie so deutlich, die Pröpste, Pfarrer, Kirchenvorsteher, den Küster und die ganze Gemeinde in einer langen Reihe, aus Leibeskräften zerrend und ziehend, um denTalar herunterzubekommen. Und er konnte es sich so deutlich vorstellen, wie alle die, die jetzt so eifrig zerrten, einer über den andern die Treppe hinabpurzeln würden, sobald das Gewand nachgab, und die ganze Reihe da unten, die nicht mitzerren konnten, die einander nur an den Rockschößen zupften – sie alle würden mitfallen.
Er sah das so deutlich, daß er nahe daran war, laut zu lachen, während er dort auf den Knien lag, aber zu gleicher Zeit trat ihm der kalte Schweiß auf die Stirn. Das war doch zu grauenhaft!
Um des Branntweins willen sollte er jetzt ein verworfener Mann werden! Ein abgesetzter Pfarrer – gab es etwas Schimpflicheres hier auf der Welt?
Er konnte ein Bettler auf der Landstraße werden, betrunken am Grabenrande liegen, in Lumpen gekleidet gehen, sich zu den Landstreichern halten.
Das Gebet war beendet. Jetzt sollte er seine Predigt halten. Da kam ein Gedanke über ihn, der ihm das Wort auf der Zunge zurückhielt. Er mußte daran denken, daß er heute zum letztenmal auf der Kanzel stehen und Gottes Lob und Ehre verkünden durfte.
Zum letztenmal – das bewegte den Pfarrer tief. Er vergaß den Branntwein und den Bischof. Er mußte die Gelegenheit ergreifen und von Gottes Ehre zeugen.
Es war ihm, als versinke der Fußboden der Kirche in einen tiefen Abgrund, als werde das Dach der Kirche abgehoben, so daß er direkt in den Himmel schauen konnte. Er stand allein, ganz allein auf seiner Kanzel, und sein Geist bekam Flügel und flog zu dem offnen Himmel empor, seine Stimme wurde stark und gewaltig, und er verkündete die Ehre Gottes.
Er war ein Mann der Inspiration. Er ließ die ausgearbeitete Predigt liegen, die Gedanken flatterten zu ihm herab wie ein Schwarm zahmer Tauben. Es war ihm, als rede ein anderer, aber er fühlte gleichzeitig, daß dies das Höchste war, was es auf Erden gibt, und daß niemand in Glanz und Herrlichkeit höher gelangen könne, als er, wie er so dastand und Gottes Ehre verkündete.
Solange die Feuerzunge der Inspiration über ihm glühte, redete er, als sie aber erloschen war und das Dach sich wieder auf die Kirche herabgesenkt hatte, und der Fußboden aus dem tiefen Abgrund herausgehoben war, da kniete er nieder und weinte, denn er war sich bewußt, daß ihm das Leben seine schönste Stunde geschenkt hatte, und daß die jetzt vorüber war.
Nach dem Gottesdienst sollte eine Kirchenversammlung und eine Untersuchung abgehalten werden. Der Bischof fragte, ob die Gemeinde Klage über ihren Pfarrer zu führen habe.
Der Pfarrer war nicht mehr zornig und trotzig wie vor der Predigt. Jetzt schämte er sich und senkte das Haupt. Ach! jetzt sollten diese elenden Branntweinsgeschichten aufgetischt werden!
Aber es kam nicht eine einzige. Es war ganz still um den großen Tisch in der Gemeindestube.
Der Pfarrer blickte auf, erst zu dem Küster hinüber – nein, der schwieg; dann zu den Kirchenvorstehern, dann zu den Bauern und den Eisenwerkbesitzern – sie schwiegen alle. Sie hielten die Lippen fest aufeinander gepreßt und sahen halb verlegen auf den Tisch nieder.
Sie warten, daß einer den Anfang machen soll, dachte der Pfarrer.
Einer der Kirchenvorsteher räusperte sich.
»Ich finde, daß wir einen guten Pfarrer haben«, sagte er.
»Der Herr Bischof haben ja selber gehört, wie er predigen kann«, stimmte der Küster ein.
Der Bischof sagte etwas von häufigem Ausfallen der Predigt.
»Der Pfarrer kann doch ebensogut einmal krank sein wie andere Menschen«, meinte ein Bauer.
Der Bischof deutete an, daß man in der Gemeinde Anstoß an dem Lebenswandel des Pfarrers genommen habe.
Da verteidigten sie ihn alle wie aus einem Munde. Ihr Pfarrer sei ja noch so jung; dazu sei nichts zu sagen. Nein, wenn er nur immer so predigen wolle wie heute, dann wollten sie ihn selbst für den Herrn Bischof nicht hergeben.
Da war kein Kläger, kein Richter.
Der Pfarrer fühlte, wie sein Herz sich erweiterte, wie leicht ihm das Blut durch die Adern strömte. Er befand sich also nicht mehr unter Feinden, er hatte sie gewonnen, als er es am mindesten dachte, er sollte auch ferner im Amt bleiben!
Nach der Visitation speisten der Bischof, die Pröpste, die Pfarrer und die Vornehmsten der Gemeinde im Pfarrhof. Eine benachbarte Pfarrersfrau hatte es übernommen, die Wirtin zu machen, denn der Pfarrer war unverheiratet. Sie hatte alles aufs beste angeordnet, und zum erstenmal gingen ihm die Augen darüber auf, daß der Pfarrhof im Grunde gar nicht so ungemütlich war. Die lange Mittagstafel war draußen unter den Tannen gedeckt und prangte festlich mit dem schneeweißen Gedeck, dem weiß und blauen Porzellan, den Gläsern und den künstlich aufgestellten Servietten. Zwei Birken waren am Eingang eingepflanzt, die Diele war mit Wacholderzweigen bestreut, vom Dachbalken herab hing ein Blumenkranz, in allen Zimmern standen Blumen, der dumpfe Geruch war vertrieben, und die grünlichen Fensterscheiben glitzerten vergnügt im Sonnenschein.
Der Pfarrer war so herzensfroh, er gelobte sich selber, nie wieder zu trinken.
An der ganzen Tafel sah man nur frohe Gesichter. Die Männer, die vorhin hochherzig gewesen waren und verziehen hatten, waren froh, und die Pfarrer und Pröpste waren froh, weil der Skandal glücklich vermieden war.
Der gute Bischof erhob sein Glas und sagte, er habe diese Reise schweren Herzens angetreten, denn es seien böse Gerüchte an sein Ohr gedrungen. Er sei ausgezogen, um einen Saulus zu finden, aber siehe, aus dem Saulus sei schon ein Paulus geworden, der mehr arbeiten werde als alle andern. Und der fromme Herr sprach weiter von den reichen Gaben, die ihr junger Bruder erhalten habe, und pries sie. Er solle nicht hochmütig werden, sondern alle seine Kräfte anspannen und acht auf sich geben, wie es dem gezieme, der eine so überaus schwere und kostbare Last auf den Schultern trage.
Der Pfarrer betrank sich nicht an jenem Mittag, aber berauscht war er trotzdem. Das große, unerwartete Glück stieg ihm zu Kopf. Der Himmel hatte die Feuerzunge der Inspiration über ihm flammen lassen, und die Menschen hatten ihm ihre Liebe geschenkt. Das Blut brauste ihm noch fieberheiß und heftig durch die Adern, als der Abend kam und die Gäste ihn verließen. Bis tief in die Nacht hinein saß er noch auf seinem Zimmer und ließ die Nachtluft durch das offene Fenster strömen, um das Glückseligkeitsfieber, diese jauchzende Unruhe zu kühlen, die ihn nicht schlafen ließ.
Da vernahm er eine Stimme: »Wachst du, Pfarrer?«
Und über dem Rasenplatz näherte sich ein Mann dem Hause. Der Pfarrer blickte hinaus und erkannte den starken Kapitän Christian Bergh, einen seiner getreuen Trinkgenossen. Ein umherstreifender Mann, ohne Haus und Heim, war dieser Kapitän Christian, und ein Riese an Gestalt und Körperkräften, groß wie ein Berg und dumm wie ein Berggeist.
»Freilich wache ich, Kapitän«, antwortete der Pfarrer. »Meinst du, dies sei eine Nacht, in der man schlafen könne?«
Und nun hört, was ihm Kapitän Christian erzählt. Der Riese hat seine Ahnungen gehabt, er hat begriffen, daß sich der Pfarrer hinfort scheuen werde zu trinken. Er würde nie wieder Ruhe haben vor diesen Pfarrern aus Karlstad, sie waren einmal dagewesen und konnten jederzeit wiederkommen und ihm, falls er in sein altes Laster verfiel, den Talar ausziehen.
Nun hatte sich aber Kapitän Christian der Sache mit seiner starken Hand angenommen, er hatte es so gemacht, daß kein Pfarrer, kein Probst und auch kein Bischof wiederkommen würde. In Zukunft konnten der Pfarrer und seine Freunde dort im Pfarrhof trinken, soviel sie wollten, denn der Kapitän hat eine Heldentat ausgeführt.
Als der Bischof und die drei Geistlichen in die geschlossene Kutsche gestiegen waren und man die Türen fest hinter ihnen geschlossen hatte, da hatte sich der Kapitän auf den Bock gesetzt und sie eine oder zwei Meilen in der hellen Sommernacht gefahren. Und er hatte sie fühlen lassen, was es heiße, mit dem Leben in der Hand dasitzen. Er hatte die Pferde in rasendem Galopp dahinsausen lassen. Das war ihre Strafe, weil sie einem ehrlichen Manne nicht gönnten, sich einen Rausch anzutrinken.
Glaubt ihr, daß er auf der Landstraße blieb? Glaubt ihr, daß er sich genierte, sie tüchtig durchzuschütteln? Er fuhr über Gräben und Stoppelfelder, er rutschte in sausendem Galopp die Hügel hinab, er lenkte in den See hinein, so daß das Wasser bis über die Räder aufspritzte, und er ließ das Gefährt Bergabhänge hinabfahren, so daß die Pferde die Vorderbeine steif vorsetzten und sich gleiten ließen. Und die ganze Zeit hindurch saßen der Bischof und die Geistlichen mit bleichen Gesichtern da und murmelten Gebete. Eine schlimmere Fahrt hatten sie niemals erlebt.
Und man kann sich vorstellen, wie sie aussahen, als sie im Gasthof zu Rissäter ankamen – lebendig, aber durchgeschüttelt wie Hagelkörner in einem ledernen Beutel.
»Was hat dies zu bedeuten, Kapitän Christian?« fragt der Bischof, als er ihnen die Wagentür öffnet.
»Es bedeutet, daß der Herr Bischof sich die Sache zweimal überlegen soll, ehe er wieder auf Visitationsreisen zu Gösta Berling kommt«, sagt Kapitän Christian, und den Satz hat er vorher gemacht und auswendig gelernt, um nicht im Text stecken zu bleiben.
»Dann grüße nur Gösta Berling und sag ihm, zu ihm käme weder ich noch ein anderer Bischof jemals wieder.«
Diese Heldentat erzählt der starke Kapitän dem Pfarrer, während er in der hellen Sommernacht vor seinem geöffneten Fenster steht. Denn der Kapitän hat soeben die Pferde im Krug abgeliefert und sich dann mit seiner Neuigkeit nach dem Pfarrhof begeben.
»Jetzt kannst du ruhig sein, Herzensbruder«, sagte er.
Ach, Kapitän Christian, wohl saßen die Geistlichen mit bleichen Gesichtern im Wagen, aber der Pfarrer hier am Fenster starrte mit einem weit bleicheren Gesicht in die helle Sommernacht hinaus. Ach, Kapitän Christian!
Der Pfarrer hob den Arm in die Höhe und schickte sich an, dem Riesen einen gewaltigen Schlag in das grobe, dumme Gesicht zu versetzen, aber er besann sich. Mit lautem Getöse schlug er das Fenster zu und blieb mitten im Zimmer stehen, seine geballte Faust dräuend gen Himmel erhoben.
Er, über dem die Feuerzunge der Inspiration geflammt hatte, er, der die Ehre Gottes verkündet hatte, er stand dort und dachte, daß Gott sein Gaukelspiel mit ihm getrieben habe.
Mußte der Bischof nicht glauben, daß der Pfarrer Kapitän Christian ausgesandt habe? Mußte er nicht glauben, daß er den ganzen Tag geheuchelt und gelogen habe? Jetzt würde er sicher Ernst machen mit dem Verfahren gegen ihn, ihn erst suspendieren und ihn dann absetzen.
Als der Morgen kam, war der Pfarrer aus dem Pfarrhaus verschwunden. Er hatte nicht bleiben und sich verteidigen wollen. Gott hatte ihn zum Narren gehabt. Gott wollte ihm nicht helfen. Er wußte, daß er abgesetzt werden würde. Gott wollte es so. Dann konnte er ja ebensogut gleich gehen.
Dies trug sich in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts in Schweden, in einer entlegenen Gemeinde des westlichen Wermland zu.
Es war dies das erste Unglück, das über Gösta Berling hereinbrach; es sollte nicht das letzte bleiben.
Denn für die Pferde, die weder Sporen noch Peitsche dulden, ist das Leben nicht leicht. Bei jedem Schmerz, der sie trifft, fahren sie dahin auf wilden Wegen, den gähnenden Abgründen zu. Sobald der Weg steinig ist und die Fahrt schwer wird, wissen sie sich nicht anders zu helfen, als die Fuhre umzuwerfen und in tollem Galopp dahinzusprengen.
Der Bettler
An einem kalten Tag im Dezember kam ein Bettler den Brobyer Hügel hinaufgewandert. Seine Kleidung bestand aus den elendsten Lumpen, und seine Schuhe waren so zerrissen, daß der kalte Schnee seine Füße durchnäßte.
Der Löfsee ist ein langes, schmales Gewässer in Wermland, das sich an ein paar Stellen zu einem schmalen Sund verengert. Er erstreckt sich nach Norden zu bis an die finnischen Wälder und nach Süden bis an den Wenersee. Mehrere Kirchspiele liegen an seinen Ufern, von allen aber ist die Broer Gemeinde die reichste und größte. Sie nimmt einen guten Teil des östlichen wie auch des westlichen Ufers ein, an letzterem aber liegen die größten Güter, Edelsitze wie Ekeby und Björne, weitberühmt wegen ihres Reichtums und ihrer Schönheit, sowie Broby, ein größerer Flecken mit einem Krug, Gasthaus, Thinghaus, Amtmannswohnung, Pfarrhof und Marktplatz.
Broby liegt an einem steilen Abhang.
Der Bettler war an dem Kruge vorübergekommen, der an dem Fuß des Hügels liegt, und arbeitete sich nun nach dem auf dem Gipfel gelegenen Pfarrhof hinauf.
Vor ihm her ging ein kleines Mädchen, das einen Schlitten zog, auf dem ein Sack Mehl lag.
Der Bettler holte das kleine Mädchen ein und begann eine Unterhaltung mit ihm.
»Das ist doch ein kleines Pferd für eine so schwere Last«, meinte er.
Das Kind wandte sich um und sah ihn an. Es war ungefähr zwölf Jahre alt, klein, mit spähenden, scharfen Augen und einem zusammengekniffenen Mund.
»Gott gebe, daß das Pferd kleiner und die Last größer wäre, dann hielte sie wohl länger vor«, erwiderte das Mädchen.
»Ist es vielleicht dein eigenes Futter, was du da schleppst?«
»Ja, Gott sei’s geklagt. Ich muß mir meine Nahrung selber verschaffen, so klein ich bin.«
Der Bettler schob von hinten an dem Schlitten. Das Mädchen wandte sich um und sah ihn an.
»Du brauchst nicht zu glauben, daß du etwas dafür bekommst«, sagte sie.
Der Bettler lachte laut auf. »Du bist wohl die Tochter des Pfarrers von Broby,« sagte er, »das kann man merken.«
»Freilich bin ichs. Einen ärmeren Vater hat manch ein Kind – einen schlechteren Vater hat keins. Es ist die reine Wahrheit, wenngleich es auch eine Schande ist, daß sein eigen Kind es sagen muß.«
»Er ist wohl geizig und böse obendrein, dein Vater?«
»Geizig ist er und böse obendrein, aber seine Tochter wird, wenn sie am Leben bleibt, noch schlimmer als er, das sagen alle Leute.«
»Darin mögen die Leute recht haben. Ich möchte wohl wissen, wie du zu dem Sack Mehl gekommen bist.«
»Es kann wohl nicht schaden, wenn ich dirs sage. Ich nahm heute morgen Korn aus des Vaters Scheune, und nun bin ich damit zur Mühle gewesen.«
»Wird er dich denn nicht sehen, wenn du nun damit angeschleppt kommst?«
»Du scheinst mir noch ziemlich grün zu sein! Vater ist auf einer Amtsreise!«
»Da kommt jemand hinter uns den Hügel hinaufgefahren. Ich kann den Schnee unter den Schlittenkufen knirschen hören. Wenn er das nun wäre?«
Die Kleine lauschte und spähte; dann fing sie an zu brüllen. »Das ist Vater!« schluchzte sie. »Er schlägt mich tot. Er schlägt mich tot!«
»Ja, nun ist guter Rat teuer, und ein schneller Rat ist besser als Gold und Silber«, sagte der Bettler.
»Weißt du was,« sagte das Kind, »du kannst mir helfen. Nimm den Strick und zieh den Schlitten, dann glaubt Vater, daß es der deine ist.«
»Was soll ich denn damit machen?« fragte der Bettler und warf den Strick über die Schulter.
»Geh damit hin, wohin du willst, komm aber, sobald es dunkel wird, nach dem Pfarrhof. Ich werde dir schon aufpassen.«
»Ich kann es ja versuchen.«
»Gott gnade dir, wenn du nicht kommst!« rief das Mädchen und lief dann, so schnell es konnte, um vor dem Vater nach Hause zu kommen.
Der Bettler wandte den Schlitten schweren Herzens und schob ihn nach dem Krug hinab. Der Ärmste hatte seinen Traum gehabt, während er dort auf nackten Füßen durch den Schnee watete. Er hatte von den großen Wäldern nördlich vom Löfsee – von den großen finnischen Wäldern geträumt.
Hier unten in der Broer Gemeinde, wo er jetzt an dem schmalen Sund entlang wanderte, der den oberen und den unteren Teil des Sees miteinander verband, in diesen reichen, fröhlichen Gegenden, wo ein Schloß neben dem andern, ein Eisenwerk neben dem andern liegt, hier war ihm der Weg zu schwer, jedes Zimmer zu eng, jedes Bett zu hart. Hier empfand er ein schmerzliches Sehnen nach dem Frieden der großen, ewigen Wälder.
Hier hörte er den Dreschflegel auf die Tenne fallen, als solle das Dreschen nie ein Ende haben. Holz- und Kohlenladungen kamen unablässig aus den unerschöpflichen Waldungen herab. Endlose Reihen erzbeladener Wagen zogen in tiefen Spuren, die Hunderte von Vorgängern hinterlassen hatten, die Wege entlang. Hier sah er Schlitten von Gehöft zu Gehöft fahren, und es war ihm, als führe die Freude die Zügel, als stehe Schönheit und Liebe hinten auf den Kufen. Ach, wie sich der arme einsame Wanderer nach dem Frieden der großen Wälder sehnte!
Dort oben, wo die Bäume wie schlanke Säulen aus der ebenen Fläche emporragen, wo der Schnee in schweren Schichten auf den unbeweglichen Zweigen liegt, wo der Wind keine Macht hat, sondern nur ganz leise mit den Nadeln der Wipfel spielen kann,dort wollte er tiefer und tiefer in den Wald hinein wandern, bis ihn die Kräfte eines Tages verlassen würden und er unter den großen Bäumen umsank, um vor Hunger und Kälte zu sterben.
Er sehnte sich nach dem großen, sausenden Grab oberhalb des Löfsees, wo ihn die zerstörenden Mächte übermannen konnten, wo es endlich dem Hunger, der Kälte, der Ermattung und dem Branntwein gelingen mochte, die Herrschaft über diesen elenden Körper zu gewinnen, der allem zu widerstehen schien.
Er war nach dem Krug hinuntergekommen und wollte dort bis zum Abend warten. Er trat in die Schenkstube und saß in stumpfer Ruhe auf der Bank neben der Tür, von den ewigen Wäldern träumend.
Die Schenkwirtin hatte Mitleid mit ihm und gab ihm ein Glas von ihrem starken, süßen Branntwein. Und sie gab ihm noch eins dazu, weil er sie so inständig darum bat.
Mehr wollte sie ihm nicht geben, und der Bettler geriet in helle Verzweiflung. Er mußte mehr haben von diesem starken, süßen Branntwein. Er mußte noch einmal fühlen, wie ihm das Herz im Leibe hüpfte, wie die Gedanken im Rausch aufflammten. O, dies herrliche Kornbräu! Des Sommers Sonne, des Sommers Vogelsang, des Sommers Duft und Schönheit umfluteten ihn auf seinen Wogen. Noch einmal, ehe er in Nacht und Finsternis verschwindet, will er Sonne und Glück trinken.
Und so vertauschte er denn erst das Mehl, dann den Mehlsack und schließlich den Schlitten – alles gegen Branntwein. Damit trank er sich einen tüchtigen Rausch an und verschlief den größten Teil des Nachmittags auf einer Bank in der Schenkstube.
Als er erwachte, sah er ein, daß ihm nur eins hier auf der Welt übrigblieb. Sintemal dieser elende Körper die ganze Herrschaft über seine Seele gewonnen hatte, sintemal er das vertrinken konnte, was ihm ein Kind anvertraut hatte, sintemal er eine Schande für die Erde war, mußte er sie von der Last all dieses Elends befreien. Er mußte seiner Seele die Freiheit schenken, mußte sie zu Gott gehen lassen.
Er lag auf der Bank in der Schenkstube und ging mit sich selber ins Gericht: »Gösta Berling, abgesetzter Pfarrer, angeklagt, das Eigentum eines hungernden Kindes vertrunken zu haben, wird zum Tode verurteilt. Zu welchem Tode? Zum Tode im Schnee.«
Er griff nach seiner Mütze und wankte hinaus. Er war weder ganz wach noch ganz nüchtern. Er weinte aus Mitleid mit sich selber, mit seiner armen, erniedrigten Seele, der er die Freiheit schenken mußte.
Er ging nicht weit und entfernte sich auch nicht vom Wege. Am Rande des Weges hatte der Wind den Schnee hoch aufgetürmt, dort legte er sich hin, um zu sterben. Er schloß die Augen und versuchte zu schlafen.
Niemand weiß, wie lange er so gelegen haben mochte, aber es war noch Leben in ihm, als die Tochter des Brobyer Pfarrers die Landstraße dahergelaufen kam, eine Laterne in der Hand, und ihn am Wegesrande im Schnee liegen sah. Sie hatte stundenlang auf ihn gewartet, jetzt war sie die Brobyer Hügel hinabgelaufen, um sich umzusehen, wo er denn nur blieb.
Sie erkannte ihn sofort und fing an ihn zu schütteln und aus Leibeskräften zu schreien, um ihn zu erwecken.
Sie mußte wissen, was der Mann mit ihrem Mehlsack gemacht hatte. Sie mußte ihn ins Leben zurückrufen – wenigstens so lange, daß er ihr sagen konnte, was aus ihrem Schlitten und ihrem Mehlsack geworden war. Ihr Vater würde sie totschlagen, wenn sie seinen Schlitten fortgebracht hatte. Sie beißt den Bettler in den Finger, zerkratzt ihm das Gesicht und schreit wie eine Verzweifelte.
Da kam jemand die Landstraße entlang gefahren.
»Wer zum Teufel schreit denn da so?« fragte eine barsche Stimme.
»Ich will wissen, was er mit meinem Schlitten und mit meinem Mehlsack gemacht hat«, schluchzte das Kind und schlug den Bettler mit den geballten Fäusten vor die Brust.
»Schämst du dich nicht, einen erfrorenen Mann so zu zerkratzen? Fort mit dir, du wilde Katze!«
Eine große, grobknochige Frau entstieg dem Schlitten und näherte sich dem Schneehaufen. Das Kind ergriff sie beim Nacken und schleuderte es auf die Landstraße. Dann beugte sie sich herab, schob den Arm unter den Rücken des Bettlers und hob ihn in die Höhe. So trug sie ihn bis an den Schlitten und legte ihn hinein.
»Komm mit in die Schenke, du wilde Katze!« rief sie der Pfarrerstochter zu, »damit wir hören, was du hierüber zu erzählen weißt.«
* * * *
Eine Stunde später saß der Bettler auf einem Stuhl neben der Tür in der besten Stube der Schenke, und vor ihm stand die willensstarke Frau, die ihn aus dem Schnee errettet hatte.
So wie Gösta Berling sie jetzt auf dem Heimwege vom Kohlenfahren in den Wäldern sah, mit rußigen Händen, eine Tonpfeife im Munde, bekleidet mit einem kurzen, ungefütterten Pelz aus Lammfellen und einem Kleide aus gestreiftem Beiderwand, mit eisenbeschlagenen Schuhen an den Füßen, ein Messer in einer Scheide in das Mieder gesteckt, so wie er sie da vor sich stehen sah, das graue Haar über dem alten, schönen Gesicht glatt in die Höhe gestrichen – so hatte er sie wohl tausendmal beschreiben hören, und er wußte, daß er mit der weit und breit bekannten Majorin aus Ekeby zusammengetroffen war.
Sie war die mächtigste Frau in Wermland, die Herrin über sieben Eisenwerke, gewohnt zu befehlen und zu gebieten. Und er war nur ein elender, zum Tode verurteilter Bettler, der nicht das Geringste besaß und der es fühlte, daß ihm jeder Weg zu schwer, jede Stube zu eng war. Sein Körper bebte vor Angst, während ihr Blick auf ihm ruhte.
Sie stand schweigend da und sah herab auf diesen Haufen menschlichen Elends vor ihr, auf die roten, geschwollenen Hände, die abgezehrte Gestalt und den herrlichen Kopf, der trotz des Verfalls und der Vernachlässigung in wilder Schönheit strahlte.
»Er ist Gösta Berling, der tolle Pfarrer?« fragte sie.
Der Bettler saß unbeweglich da.
»Ich bin die Majorin auf Ekeby.«
Es ging ein Beben durch den Bettler. Er faltete seine Hände und erhob die Augen mit sehnsuchtsvollem Blick. Was wollte sie ihm? Wollte sie ihn zwingen zu leben? Er bebte vor ihrer Stärke. Er war ja doch dem Frieden der ewigen Wälder so nahe gewesen!
Sie begann den Kampf, indem sie ihm sagte, daß die Tochter des Brobyer Pfarrers ihren Schlitten und ihren Mehlsack wiederbekommen, und daß sie, die Majorin, für ihn wie für so viele andere ein Heim im Kavalierflügel auf Ekeby habe. Sie biete ihm ein Leben in Lust und Freude an.
Er aber antwortete, daß er sterben müsse.
Da schlug sie mit der geballten Faust auf den Tisch und sagte ihm ihre Ansicht offen heraus.
»Also sterben will Er – sterben? Ja, darüber würde ich mich nicht wundern, wenn Er überhaupt lebte. Aber seh Er nur Seinen abgezehrten Körper, Seine ohnmächtigen Glieder, die matten Augen an – glaubt Er wirklich, daß da noch viel zu töten ist? Glaubt Er, daß man, um tot zu sein, unter einem zugenagelten Sargdeckel zu liegen braucht? Glaubt Er nicht, daß ich es Ihm ansehen kann, wie tot Er ist, Gösta Berling, tot! Ich sehe, daß ein grinsender Totenkopf auf Seinen Schultern sitzt, und es scheint mir, als sehe ich die Würmer durch Seine Augenhöhlen aus- und einkriechen. Merkt Er nicht, daß Er den Mund voll Erde hat? Kann Er nicht hören, wie die Gebeine rasseln, sobald Er sich bewegt? Er hat sich in Branntwein ertränkt, Gösta Berling, und tot ist Er. Was sich jetzt in Ihm rührt, ist nur das Totengebein, und dem will Er es nicht gönnen zu leben – wenn man das überhaupt Leben nennen kann? Es ist fast, als wolle Er den Toten einen Tanz über die Gräber im Mondschein mißgönnen.
»Schämt Er sich, daß Er Pfarrer gewesen ist, weil Er jetzt sterben will? Es wäre ehrenvoller, wenn Er jetzt Seine Gaben dazu verwenden wollte, Nutzen zu schaffen auf Gottes grüner Erde – das kann Er mir glauben. Weshalb ist Er nicht gleich zu mir gekommen? Da hätte ich die Sache schon für Ihn ordnen wollen. Ja, nun erwartet Er wohl viel Ehre davon, eingekleidet und auf Hobelspäne gelegt und eine schöne Leiche genannt zu werden!«
Der Bettler saß ruhig, halb lächelnd da, während sie ihre heftigen Worte über ihn hindonnern ließ. Das hat keine Not, jubelte er, keine Not! Die ewigen Wälder warten, und sie hat keine Macht, meine Seele davon abzuwenden.
Die Majorin aber schwieg und ging ein paarmal im Zimmer auf und nieder; dann nahm sie Platz am Kamin, setzte die Füße auf den Rost und stützte die Ellbogen auf die Knie.
»Tausend Teufel auch,« fuhr sie fort und lachte vor sich hin. »Was ich da sage, ist so wahr, daß ich es selber kaum gemerkt habe. Glaubt Er nicht, daß die meisten Menschen in dieser Welt tot oder doch halbtot sind? Glaubt Er etwa, daß ich lebe? Ach nein! Ach nein!
»Ja, sieh Er mich nur an! Ich bin die Majorin auf Ekeby, und ich sollte meinen, daß ich die mächtigste Frau in ganz Wermland bin. Winke ich mit einem Finger, so springt der Landrat, und winke ich mit zweien, so springt der Bischof, und winke ich mit dreien, so tanzen Domkapitel und Ratsherren und alle Grundbesitzer in ganz Wermland Polka auf dem Markt zu Karlstad. Tausend Teufel, ich sage Ihm, Pfarrer, ich bin nichts als eine aufgeputzte Leiche. Unser Herrgott weiß am besten, wie wenig Leben in mir ist.«
Der Bettler beugte sich vor und lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit. Die alte Majorin saß vor dem Feuer und wiegte sich hin und her. Sie sah ihn nicht an, während sie sprach.
»Glaubt Er nicht,« fuhr sie fort, »daß ich, wenn ich ein lebendiges Menschenkind gewesen wäre, das Ihn dort so elend und traurig mit Selbstmordgedanken im Herzen sitzen sah – daß ich sie da nicht alle mit einem Atemhauch aus Seinem Herzen hätte vertreiben können? Da hätte ich Tränen für Ihn gehabt und Gebete, die alles in Ihm aufgerührt hätten, und ich hätte Seine sündige Seele erlöst. Jetzt aber bin ich tot. Gott allein weiß, wie wenig Leben noch in mir ist.
»Hat Er gehört, daß ich einstmals die schöne Margarete Celsing war? Das war nicht gestern, aber noch heute kann ich dasitzen und meine alten Augen rot weinen über sie. Weshalb mußte Margarete Celsing sterben und Margarete Samzelius leben? Weshalb soll die Majorin auf Ekeby leben? Kann Er mir das sagen, Gösta Berling?
»Weiß Er, wie Margarete Celsing beschaffen war? Sie war schlank und fein und sittsam und unschuldig, Gösta Berling. Sie gehörte zu denen, auf deren Grabe die Engel weinen. Sie kannte nichts Böses, niemand hatte ihr Kummer gemacht, sie war gut gegen alle. Und schön war sie.
»Da war ein herrlicher Mann, Altringer hieß er. Gott mag wissen, wie es kam, daß er da oben in die wilde Einöde des Elfdals hinaufgeriet, wo ihrer Eltern Gut lag. Ihn sah Margarete Celsing, er war schön, er war ein Mann, und er liebte sie. Aber er war arm, und sie kamen überein, daß sie fünf Jahre aufeinander warten wollten, wie es im Liede heißt.
»Als die drei ersten Jahre verstrichen waren, meldete sich ein anderer Freier. Er war häßlich zu schauen, ihre Eltern glaubten aber, daß er reich sei, und sie zwangen sie durch Reden und Versprechungen, durch Schläge und böse Worte, ihn zum Manne zu nehmen. An jenem Tage starb Margarete Celsing.
»Seit jener Zeit hat es keine Margarete Celsing gegeben, sondern nur eine Majorin Samzelius, und sie war nicht gut, nicht sittsam; sie glaubte an viel Böses und gab nicht acht auf das Gute.
»Du weißt es wohl, wie dann alles gekommen ist. Wir wohnten in Sjö, hier am Löfsee, der Major und ich. Aber er war nicht reich, wie die Leute gesagt hatten.
Ich hatte oft schwere Tage.
»Da kam Altringer heim, und nun war er reich. Er ward Besitzer von Ekeby und unser Nachbar. Er kaufte auch noch sechs andere Güter am Löfsee. Er war tüchtig, unternehmend; ein herrlicher Mann war er. Er stand uns bei in unserer Armut, wir fuhren in seinem Wagen, er sandte uns Speisen für unsere Küche, Wein für unsern Keller. Er füllte mein Leben mit Fest und Freude. Als der Krieg ausbrach, reiste der Major fort, was aber kehrten wir uns daran! Den einen Tag war ich sein Gast auf Ekeby, den nächsten Tag kam er nach Sjö. Ach, es ging wie ein Freudenreigen an den Ufern des Sees entlang!
»Dann aber fingen sie an, Böses über mich und Altringer zu reden. Hätte Margarete Celsing gelebt, so würde es sie sicherlich betrübt haben, mir aber tat es nichts. Doch wußte ich noch nicht, daß ich, weil ich tot war, so gefühllos war.
»Die bösen Gerüchte über uns fanden ihren Weg bis zu meinem Vater und meiner Mutter, die da oben zwischen den Kohlenmeilern im Elfdalswalde lebten. Die Alte besann sich nicht lange; sie reiste hierher, um mit mir zu reden.
»Eines Tages, als der Major fort war und ich mit Altringer und mehreren anderen zu Tische saß, kam sie nach Sjö. Ich sah sie in den Saal eintreten, aber ich fühlte nicht, daß es meine Mutter war. Gösta Berling. Ich begrüßte sie wie eine Fremde und bat sie, an meinem Tische niederzusitzen und teil an der Mahlzeit zu nehmen. Sie wollte mit mir reden, als wenn ich ihre Tochter sei, aber ich sagte ihr, sie irre sich, meine Eltern lebten nicht mehr, sie seien beide an meinem Hochzeitstage gestorben.
»Da ging sie auf das Spiel ein. Siebzig Jahre zählte sie, dreißig Meilen war sie in drei Tagen gefahren. Jetzt setzte sie sich ohne weitere Umstände an den Mittagstisch und aß mit uns; sie war eine kräftige alte Frau.
»Sie meinte, es sei doch traurig, daß ich just an dem Tage einen solchen Verlust erlitten habe.
»Das Traurigste bei der Sache war, entgegnete ich, daß meine Eltern nicht einen Tag früher gestorben wären, denn dann wäre nichts aus der Hochzeit geworden.
»Frau Majorin sind also nicht glücklich in Ihrer Ehe? fragte sie darauf.
»Ja, sagte ich, jetzt bin ich glücklich. Ich werde stets glücklich sein, dem Willen meiner teuren Eltern zu folgen.
»Sie fragte, ob es der Wille meiner Eltern gewesen sei, Scham und Schande über sie und mich selber zu bringen und meinen Gatten zu betrügen. Wenig Ehre erzeige ich meinen Eltern, indem ich mich selber in der Leute Mund bringe.
»Sie müssen so liegen, wie sie sich gebettet haben, erwiderte ich. Und übrigens mag die fremde Dame wissen, daß ich mich nicht darein finde, daß jemand die Tochter meiner Eltern verhöhnt.
»Wir aßen allein, wir beide. Die Männer rings um uns her saßen schweigend da und konnten weder Messer noch Gabel rühren.
»Die Alte blieb einen Tag und eine Nacht, um sich auszuruhen. Aber solange ich sie sah, konnte ich nicht begreifen, daß es meine Mutter war. Ich wußte nur, daß meine Mutter gestorben sei.
»Als sie reisen wollte, Gösta Berling, und ich neben ihr auf der Treppe stand und der Wagen vorgefahren war, da sagte sie zu mir: Einen Tag und eine Nacht bin ich hier gewesen, ohne daß du mich als Mutter hast anerkennen wollen. Auf öden Wegen bin ich hierhergereist, dreißig Meilen in drei Tagen. Und aus Scham über dich zittert mein alter Körper, als sei er mit Ruten gepeitscht. Möchtest du verleugnet werden, wie ich verleugnet worden bin, verstoßen werden, wie ich verstoßen bin. Möge die Landstraße dein Heim, der Graben dein Bett, der Kohlenmeiler deine Feuerstätte werden. Schande und Verschmähung sei dein Lohn, mögen dich andere schlagen, so wie ich dich jetzt schlage!
»Und sie versetzte mir einen harten Schlag auf die Wange.
»Ich aber hob sie auf, trug sie die Treppe hinab und setzte sie in den Wagen.
»Wer bist du, daß du mich verfluchst? fragte ich. Wer bist du, daß du mich schlägst? Das leide ich von niemand!
»Und ich gab ihr die Ohrfeige zurück. Im selben Augenblick fuhr der Wagen, aber da, in dem Augenblick, Gösta Berling, wußte ich, daß Margarete Celsing tot war. Sie war gut und unschuldig. Sie kannte nichts Böses. Die Engel würden auf ihrem Grabe geweint haben. Hätte sie gelebt, sie würde niemals ihre Mutter geschlagen haben.«
Der Bettler an der Tür hatte gelauscht, und die Worte hatten für einen Augenblick das Sausen der ewigen Wälder übertäubt. Sieh, diese reiche Frau stieg zu ihm herab in ihren Sünden, ward seine Schwester in ihrem Elend, nur um ihm Mut zum Leben zu machen. Er sollte erkennen lernen, daß auch auf den Häuptern anderer Sorge und Schuld lastete. Er erhob sich und trat auf die Majorin zu.
»Willst du jetzt leben, Gösta Berling?« fragte sie mit einer Stimme, die von Tränen fast erstickt war. »Weshalb willst du sterben? Du hättest ein tüchtiger Pfarrer werden können, nie aber war der Gösta Berling, den du in Branntwein ertränktest, so strahlend unschuldsrein wie die Margarete Celsing, die ich in Haß erstickte. Willst du jetzt leben?«
Gösta fiel vor der Majorin auf die Knie. »Vergib mir«, sagte er, »aber ich kann nicht!«
»Ich bin eine alte Frau,« sagte die Majorin, »verhärtet in bitterem Kummer, und ich sitze hier und gebe mich selber einem Bettler preis, den ich halb erfroren in einer Schneewehe am Wege gefunden habe. Es geschieht mir recht. Geh Er nur hin und werd’ Er ein Selbstmörder, dann kann Er jedenfalls nichts von meiner Torheit erzählen.«
»Ich bin kein Selbstmörder, ich bin ein zum Tode Verurteilter. Mache mir den Kampf nicht zu schwer! Ich kann nicht leben. Mein Körper hat die Obergewalt über meine Seele gewonnen, deswegen muß ich die freigeben, damit sie zu Gott kommen kann.«
»Er glaubt also, daß sie zu Gott kommt?«
»Lebt wohl, Majorin Samzelius, und habt Dank!«
»Leb wohl, Gösta Berling!«
Der Bettler erhob sich und ging mit hängendem Kopf und schleppenden Schritten auf die Tür zu. Diese Frau machte ihm den Weg zu den ewigen Wäldern schwer.
Als er an die Tür kam, mußte er sich umwenden. Da begegnete er einem Blick der Majorin, die regungslos dasaß und ihm nachsah. Er hatte niemals eine solche Veränderung in einem Gesicht wahrgenommen, und er stand still und starrte sie an. Sie, die eben noch böse und drohend gewesen war, saß still da wie verklärt, und ihre Augen strahlten vor erbarmender, mitleidiger Liebe. Es war etwas in ihm, in seinem verwilderten Herzen, das vor diesem Blick schmolz; er lehnte seine Stirn gegen den Türpfosten, hob die Arme über dem Kopf in die Höhe und weinte, als wenn sein Herz brechen sollte.
Die Majorin warf die Tonpfeife ins Feuer und kam zu ihm hin. Ihre Bewegungen waren plötzlich so sanft wie die einer Mutter.
»Nun, nun, mein Junge!«
Und sie zog ihn zu sich auf die Bank neben der Tür, so daß er, den Kopf in ihrem Schoß, weinte.
»Will Er noch sterben?«
Er wollte aufspringen. Sie mußte ihn mit Gewalt festhalten.
»Jetzt sage ich Ihm zum letztenmal, daß Er tun kann, was Er will. Das aber verspreche ich Ihm, wenn Er leben will, so werde ich die Tochter des Brobyer Pfarrers zu mir nehmen und sie zu einem tüchtigen Menschen erziehen: dann kann Er ja Gott danken, daß Er ihr Mehl stahl. Nun, will Er?«
Er hob den Kopf in die Höhe und sah ihr in die Augen.
»Ist das Euer Ernst?«
»Freilich ist es das, Gösta Berling.«
Da rang er die Hände in unsagbarer Angst. Er sah vor sich die eingeschüchterten Augen, die zusammengekniffenen Lippen, die kleinen, abgemagerten Hände. Das arme kleine Wesen sollte Schutz und Pflege haben, das Brandmal der Erniedrigung sollte aus ihrem Körper getilgt werden, wie das Böse aus ihrer Seele. Jetzt ward ihm der Weg zu den ewigen Wäldern verschlossen.
»Ich werde mir das Leben nicht nehmen, solange sie unter Eurem Schutz steht«, sagte er. »Ich wußte es ja, daß die Majorin stärker sei als ich, daß sie mich zwingen würde zu leben.«
»Gösta Berling,« sagte sie feierlich, »ich habe um dich gekämpft wie um meine eigene Seligkeit. Ich sagte zu Gott: Wenn noch eine Spur von Margarete Celsing in mir ist, so mache, daß sie sich zu erkennen gibt und den Mann verhindert, sich das Leben zu nehmen! Und Gott erhörte mein Flehen, und du hast sie gesehen, und deswegen konntest du nicht gehen. Und sie flüsterte mir zu, daß du vielleicht um des armen Kindes willen den Gedanken an den Tod aufgeben würdest. Ach, ihr fliegt so kühn, ihr wilden Vögel, Gott aber kennt das Netz, das euch fangen kann.«
»Er ist ein großer, wunderbarer Gott!« sagte Gösta Berling. »Er hat mich zum Narren gehabt und mich verworfen, aber er will mich nicht sterben lassen. Sein Wille geschehe.«
Seit jenem Tage wurde Gösta Berling Kavalier auf Ekeby. Zweimal versuchte er es, sich loszumachen und sich einen Weg zu bahnen, um von der eigenen Arbeit zu leben. Das einemal gab ihm die Majorin ein Haus in der Nähe von Ekeby; er zog dahin und wollte versuchen, als Arbeiter zu leben. Es gelang ihm auch eine Zeitlang, aber er ward bald der Einsamkeit und der täglichen Arbeit müde und wurde wieder Kavalier. Das zweitemal ward er Hauslehrer auf Borg bei dem jungen Grafen Heinrich Dohna. Dort verliebte er sich in Ebba Dohna, des Grafen Schwester; als sie aber starb, gerade als er sie zu gewinnen meinte, gab er jeden Gedanken, etwas anderes als ein Kavalier auf Ekeby zu werden, auf. Es schien ihm, als seien einem abgesetzten Pfarrer alle Wege zur Wiederherstellung seiner Ehre verschlossen.
Gösta Berlings Sage - Die Landschaft
Nun muß ich diejenigen, die den langen See, die reichen Ebenen und die blauen Berge schon kennen, bitten, daß sie einige Seiten überschlagen. Sie können es ruhig tun, das Buch wird trotzdem lang genug.
Ein jeder wird verstehen, daß ich gezwungen bin, diese drei Szenerien denen zu beschreiben, die sie noch nicht gesehen haben, denn sie waren der Schauplatz, auf dem Gösta Berling und die Kavaliere ihr lustiges Leben lebten. Aber für diejenigen, die sie gesehen haben, ist es gar leicht zu verstehen, daß dies die Kräfte eines Menschen übersteigt, der nur die Feder führen kann.
Am liebsten würde ich mich damit begnügen, von dem See zu erzählen, daß er der Löfsee heißt, daß er lang und schmal ist, daß er sich von den großen einsamen Wäldern im nördlichen Wermland bis hinab in die Niederungen des Wenersees nach Süden zu erstreckt; von der Ebene, daß sie zu beiden Seiten des Sees dahinläuft, und von den Bergen, daß sie mit ihren ragenden Ketten das ganze Tal umschließen. Aber das ist nicht genug für mich, wenn ich den See meiner Kindheitsträume und das Leben meiner Kindheitshelden schildern will.
Die Quellen des Sees liegen hoch oben im Norden, und da ist ein herrliches Land für einen See. Wald und Berge werden niemals fertig, Wasser für ihn zu sammeln, Elfe und Bäche stürzen das ganze Jahr hindurch in ihn hinab. Er hat feinen, weißen Sand, auf dem er sich ausstrecken kann, Landzungen und Inseln, die er widerspiegeln kann, da ist freier Spielraum für den Wassermann und die Meerfrau, und er wächst groß und schön heran. Da oben im Norden ist er munter und freundlich. Ihr solltet ihn nur an einem Sommermorgen sehen, wenn er ganz wach daliegt und unter dem Nebelschleier blitzt, wie lustig er da ist. Er verbirgt sich erst eine Weile, dann schlüpft er leise, ganz leise aus seiner lichten Hülle heraus, so bezaubernd schön, daß man ihn kaum wiedererkennen kann. Aber dann, mit einem Ruck, wirft er die ganze Decke ab und liegt da, bloß und frei und rosenrot und strahlt im Morgenlicht.
Aber der See begnügt sich nicht mit Spiel und Lustigkeit; er bricht sich einen Weg durch einige Sandhügel nach Süden zu, schnürt sich zu einem engen Sund zusammen und sucht sich ein neues Reich. Das findet er, wird bald wieder groß und mächtig, hat eine bodenlose Tiefe auszufüllen und eine fleißige Gegend zu schmücken. Aber nun wird das Wasser auch dunkler, die Ufer werden weniger abwechselnd, die Winde schärfer, der ganze Charakter wird strenger. Aber es ist noch immer ein stattlicher, ein herrlicher See. Mannigfach sind die Schiffe und die Holzflöße, die auf ihm fahren, und selten findet er vor Weihnacht Zeit, sich zur Winterruhe zu legen. Oft ist er schlechter Laune; er kann weiß schäumen und Boote umstürzen, aber er kann auch in träumerischer Ruhe daliegen und den Himmel abspiegeln.
Aber der See will noch weiter hinaus in die Welt, obwohl die Berge fester werden und der Platz enger wird, je weiter er hinabkommt, so daß er schließlich wie ein schmaler Sund zwischen sandigen Ufern dahinkriechen muß. Dann breitet er sich zum drittenmal aus, aber nicht mit derselben Schönheit und Macht.
Die Ufer liegen flach und einförmig da, mildere Winde wehen, und der See legt sich früh zur Winterruhe. Er ist noch schön, doch er hat die Wildheit seiner Jugend und die Kraft seines Mannesalters eingebüßt – er ist ein See wie alle anderen. Mit zwei Armen tastet er sich nach dem Wenersee hin, und wenn er den gefunden hat, stürzt er sich in Altersschwäche steile Abhänge hinab, und mit dieser letzten Heldentat begibt er sich zur Ruhe.
Die Ebene ist ebensolang wie der See, aber es wird ihr schwer, vor Seen und Bergen weiter zu kommen, gleich von der Schlucht am nördlichen Endpunkt des Sees an und bis sie sich behaglich an den Ufern des Wenersees zur Ruhe legt. Natürlich würde die Ebene am liebsten an dem See entlang laufen, von dem einen Ende bis zum andern; aber das erlauben ihr die Berge nicht. Die Berge sind mächtige Mauern aus Granitgestein, mit Wäldern bedeckt, voll von Schluchten, es ist schwierig, dort zu wandern; reich sind sie an Moos und Flechten, und in alten Zeiten waren sie die Heimstätte für Unmengen von Wild. Oft stößt man oben auf den weitausgedehnten Bergrücken auf ein Moor mit Schlammboden oder auf einen Sumpf mit schwarzem Wasser, und hier und da findet man einen Köhlerplatz oder eine offene Stelle, wo Holz geschlagen ist, oder ein Stück abgesengter Heide, und das zeugt davon, daß die Berge auch Arbeit ertragen können; gewöhnlich aber liegen sie in sorgloser Ruhe da und begnügen sich damit, Licht und Schatten ihr ewiges Spiel auf ihren Abhängen spielen zu lassen.
Mit diesen Bergen liegt die Ebene – die fromm und fruchtbar ist und die Arbeit liebt – in einem ewigen Krieg.
»Könnt ihr euch nicht damit begnügen, Mauern um mich her zu errichten?« sagt die Ebene zu den Bergen; »das ist Sicherheit genug für mich.«
Aber die Berge lauschen dieser Rede nicht. Sie entsenden lange Reihen von Hügeln und kahlen Hochebenen bis ganz hinab an den See. Sie bauen prächtige Aussichtstürme auf jeder Landzunge und weichen so selten von dem Ufer des Sees zurück, daß sich die Ebene nur an ganz einzelnen Stellen in dem weichen Sand des Ufers rollen kann. Aber es nützt ihr nicht, zu klagen.
»Freue du dich, daß wir hier stehen«, sagen die Berge. »Denk an die Zeit vor Weihnacht, wenn die eiskalten Nebel Tag für Tag über den Löfsee dahinrollen. Wir tun gute Dienste da, wo wir stehen!«
Die Ebene klagt darüber, daß sie zu wenig Platz und zu schlechte Aussicht hat.
»Du Törin!« antworten die Berge; »du solltest nur fühlen, wie es hier unten am See weht. Man muß allermindestens einen Rücken aus Granitstein haben und einen Pelz aus Tannen, um das aushalten zu können. Und im übrigen kannst du froh sein, daß du uns ansehen darfst!«
Und darüber ist die Ebene auch wirklich froh. Sie kennt sehr wohl jedes wunderliche Wechseln von Licht und Schatten, das über die Berge hinhuscht. Sie hat sie in der Mittagsbeleuchtung gleichsam bis zu dem Horizont hinabsinken sehen, niedrig und ganz hellblau, hat sie sich in der Morgen- und Abendbeleuchtung zu ehrwürdiger Höhe emporheben sehen, klar, blau wie der Himmel im Zenit. Zuweilen kann das Licht so scharf auf sie herabfallen, daß sie grün oder schwarzblau werden, und jede Furche, jeden Weg, jede Schlucht sieht man da aus meilenweiter Entfernung.
Aber dann geschieht es an einzelnen Stellen, daß die Berge ein wenig zur Seite weichen und die Ebene nach dem See hinablugen lassen. Aber wenn sie dann den See in seinem Zorn erblickt, wie er faucht und speit gleich einer Wildkatze, oder wenn sie ihn mit dem kalten Rauch bedeckt sieht, der daher kommt, daß die Wasserleute büken oder brauen, da gibt sie gar bald den Bergen recht und zieht sich wieder in ihr enges Gefängnis zurück.
Seit Olims Zeiten haben die Menschen die herrliche Ebene bebaut, und sie ist gut bevölkert. Wo sich nur ein Bach mit seinem weißschäumenden Wasserfall das Ufer hinabstürzt, lag ein Sägewerk oder eine Mühle.
Auf den offenen, hellen Stellen, wo die Ebene bis an den See hinabging, lagen Kirchen und Pfarrhäuser; aber am Talrande, halbwegs am Abhang, auf den mit Steinen angefüllten Feldern, wo kein Korn gedeiht, lagen die Gehöfte der Bauern, die Offiziershäuser und hin und wieder ein Herrensitz.
Aber man darf nicht vergessen, daß die Gegend in den zwanziger Jahren lange nicht so angebaut war wie jetzt. Große Strecken, die heute fruchtbare Felder tragen, lagen damals als Wald, Sumpf und See da. Die Bevölkerung war auch nicht so zahlreich und ernährte sich teils durch Fuhren, teils durch Arbeit in Mühlen und Sägewerken und an fremden Orten; der Ackerbau konnte ihnen das Leben nicht fristen. Zu jener Zeit kleideten sich die Bewohner der Ebene in selbstgewebte Stoffe, sie aßen Haferbrot und begnügten sich mit zwölf Schilling Tagelohn. Die Not war oft groß unter ihnen; aber sie wurde gemildert durch einen leichten und munteren Sinn, durch Tüchtigkeit, Handgeschicklichkeit, die namentlich an fremden Orten zur Entfaltung gelangten.
Aber alle diese drei, der lange See, die reiche Ebene und die blauen Berge, bildeten die schönste Landschaft, und das tun sie noch heutigen Tages, und das Volk ist noch heute kräftig, mutig und gut begabt. Jetzt hat es auch große Fortschritte in bezug auf Wohlstand und Bildung gemacht.
Möge es denen gut ergehen, die dort oben an dem langen See und an den blauen Bergen wohnen! Was ich hier schildern will, sind einige von ihren Erinnerungen.
Die Christnacht
Sintram heißt der böse Gutsherr auf Fors, mit dem schwerfälligen Körper, den langen Affenarmen, dem kahlen Kopf und dem häßlichen, grinsenden Gesicht, der nichts Schöneres kennt als Unfrieden stiften.
Sintram heißt er, der nur Landstreicher und Raufbolde als Knechte annimmt, der nur keifende, verlogene Mägde in seinem Dienst hat, er, der die Hunde bis zur Raserei quält, indem er ihnen Knopfnadeln in die Schnauze steckt, der sich am glücklichsten zwischen bösen Menschen und wilden Tieren fühlt.
Sintram heißt er, dessen schönstes Vergnügen es ist, sich wie der leibhaftige Teufel auszukleiden mit Hörnern und Schwanz und Pferdefuß, und der dann plötzlich aus den dunklen Ecken, aus dem Backofen oder hinter dem Holzschober hervorstürzt, um furchtsame Kinder und abergläubische Frauen zu erschrecken.-
Sintram heißt er, der sich freut, wenn er alte Freundschaft in flammenden Haß verwandeln und die Herzen mit Lügen vergiften kann.
Sintram heißt er – und eines Tages kam er nach Ekeby.
* * * *
»Zieht den großen Brennholzschlitten in die Schmiede, stellt ihn in die Mitte des Raumes, legt einen Karren darüber, den Boden nach oben gewendet, dann haben wir einen Tisch. Hurra, der Tisch soll leben!
»Jetzt herbei mit Stühlen und mit allem, was sich zum Sitzen benutzen läßt! Herbei mit dreibeinigen Schusterhockern und leeren Kisten! Herbei mit zerfetzten Lehnstühlen ohne Lehne, und her mit dem alten Einspännerschlitten ohne Kufen und mit der alten Karosse! Ha, ha! her mit der alten Karosse! Das soll die Rednertribüne sein. Nein, seht nur, das eine Rad ist ab, und der ganze Wagenkasten fehlt! Es ist nichts als der Bock übriggeblieben. Das Polster ist zerfetzt, die Krollhaare quellen daraus hervor, das Leder ist rot von Alter. Hoch wie ein Haus ist das alte Stück Rumpelzeug. Stoßt, stoßt, sonst stürzt es um!«
Hurra! Hurra! Es ist Christnacht auf Ekeby!
Hinter den seidenen Gardinen des Doppelbettes schlafen der Major und die Majorin, schlafen und glauben, daß auch der Kavalierflügel schläft. Knechte und Mägde können schlafen, übersättigt von dem festlichen Reisbrei, müde von dem starken Weihnachtsbier, nicht aber die Herren im Kavalierflügel. Kann überhaupt jemand glauben, daß der Kavalierflügel schläft?
Keine barfüßigen Schmiede rasseln mit den eisernen Stangen, keine rußgeschwärzten Knaben ziehen die Kohlenkarren hinter sich her, der große Hammer hängt wie ein Arm mit geballter Faust oben unterm Dach. Der Amboß steht leer, die Öfen sperren ihren roten Schlund nicht auf, um Kohlen zu verschlingen, die Bälge knirschen nicht. Es ist Weihnacht. Die Schmiede schläft.
Sie schläft, schläft! O du Menschenkind, sie schläft, wenn die Kavaliere wachen! Die langen Zangen stehen aufrecht auf dem Fußboden, halten Talglichter in ihrem Schnabel. Aus dem Zehnkannenkessel aus blankem Kupfer schlägt die blaue Flamme des Punsches zu dem dunklen Dach empor.
Beerencreutz’ Hornlaterne hängt an dem Stangeneisenhammer. Der gelbe Punsch schimmert in der Bowle wie die helle Sonne. Hier ist ein Tisch, und hier sind Bänke. Die Kavaliere feiern Weihnachten in der Schmiede.
Hier ist Lärm und Lustigkeit und Musik und Gesang. Das mitternächtliche Getöse weckt niemand. Aller Lärm, alles Geräusch aus der Schmiede ertrinkt in dem mächtigen Brausen des Gießbaches da draußen.
Da ist Lärm und Lustigkeit. Wenn die Frau Majorin sie jetzt sähe?
Nun, was dann? Sie würde sich sicher bei ihnen niederlassen und einen Becher mit ihnen leeren. Eine tüchtige Frau ist sie, sie läuft nicht davon vor einem donnernden Trinkliede, vor einem Spiel Rabouge. Die reichste Frau in ganz Wermland, barsch wie ein Kerl und stolz wie eine Königin. Gesang liebt sie, gellende Waldhörner und Violinen. Wein und Spiel hat sie gern und lange Tische, umringt von fröhlichen Gästen. Sie sieht es gern, wenn die Vorräte schwinden, wenn Tanz und Lustbarkeit in Kammer und Saal herrschen und der Kavalierflügel voller Kavaliere ist!
Seht sie dort rings im Kreise um die Bowle sitzen, Kavalier an Kavalier! Es sind ihrer zwölf, zwölf Männer! Keine Eintagsfliegen, keine Modehelden, sondern Männer, deren Ruf erst spät in Wermland ersterben wird, mutige Männer, starke Männer!
Keine dürren Pergamente, keine zugeschnürten Geldbeutel, sondern arme Männer, sorglose Männer, Kavaliere vom Morgen bis zum Abend.
Keine Hängeweiden, keine schläfrigen Stubenhocker, wegefahrende Männer, fröhliche Männer, Ritter von tausend Abenteuern.
– – Jetzt hat der Kavalierflügel schon seit Jahren leer gestanden. Ekeby ist kein Zufluchtsort für heimatlose Kavaliere mehr. Pensionierte Offiziere und arme Edelleute fahren nicht mehr in wackeligen Gefährten auf den Landstraßen Wermlands umher; hier aber sollen sie wieder auferstehen, die Fröhlichen, Sorglosen, die ewig Jungen!
Alle diese weitberühmten Männer konnten ein oder mehrere Instrumente spielen. Alle sind sie so voller Eigenheiten, voller Redensarten, Einfälle und Lieder wie der Ameishaufen voller Ameisen, aber ein jeder von ihnen hat doch seine besondere vorzügliche Eigenschaft, seine hochgeschätzte Kavaliertugend, die ihn von den übrigen unterscheidet.
Zuerst von alle denen, die um die Bowle herumsitzen, will ich Beerencreutz nennen, den Obersten mit dem großen weißen Schnurrbart, den Rabougespieler, den Bellman-Sänger, und neben ihm seinen Freund und Kriegskameraden, den wortkargen Major, den großen Bärenjäger Anders Fuchs, und als dritten im Bunde den kleinen Ruster, den Trommelschläger, der lange Bursche des Obersten gewesen war, aber infolge seiner Geschicklichkeit im Punschbrauen und im Generalbaß Kavalierrang erhalten hatte. Dann muß der alte Fähnrich, Rutger von Örneclou, erwähnt werden, der Herzenbrecher in Perücke, steifer Halsbinde und Jabot, der geschminkt war wie eine Frau. Er war einer der hervorragendsten Kavaliere, und das war auch Christian Bergh, der starke Hauptmann, ein gewaltiger Held, aber ebenso leicht an der Nase herumzuführen wie der Riese im Märchen. In Gesellschaft dieser beiden sah man oft den kleinen, kugelrunden Patron Julius, fröhlich und munter, ein heller Kopf, Redner, Maler, Liedersänger und Anekdotenerzähler. Er ließ seine gute Laune gewöhnlich über den gichtbrüchigen Fähnrich und den dummen Riesen aus.
Hier sah man auch den großen Deutschen Kevenhüller, den Erfinder des selbsttätigen Wagens und der Flugmaschine, ihn, dessen Name noch in den sausenden Wäldern widerhallt. Ein Ritter war er von Geburt wie von Gestalt, mit großem, gedrehtem Schnurrbart, spitzem Kinnbart, Adlernase und kleinen schiefen Augen in einem Netz sich kräuselnder Falten. Hier saß der große Kriegsheld, Vetter Kristoffer, der nie aus den vier Wänden des Kavalierflügels herauskam, es sei denn, daß eine Bärenjagd oder sonst ein verwegenes Abenteuer in Aussicht war; und neben ihm Onkel Eberhard, der Philosoph, der nicht des Scherzes und der Lustbarkeit halber nach Ekeby gezogen war, sondern um ungestört von Nahrungssorgen seine große Arbeit in der Wissenschaft der Wissenschaften verrichten zu können.
Zu allerletzt nenne ich die Besten der ganzen Schar: den sanften Löwenberg, den frommen Mann, der zu gut war für diese Welt und sich so blitzwenig auf ihr Treiben verstand, und Liliencrona, den großen Musiker, der ein gutes Heim hatte und sich stets dahin sehnte, der aber doch auf Ekeby bleiben mußte, weil sein Geist des Reichtums und der Abwechselung bedurfte, um das Leben ertragen zu können.
Alle diese elfe hatten ihre Jugend hinter sich und waren ein gutes Stück ins Alter hineingekommen; in ihrer Mitte aber gab es einen, der nicht mehr als dreißig Jahre zählte und dessen geistige wie körperliche Kräfte noch ungebrochen waren. Das war Gösta Berling, der Kavalier der Kavaliere, er, der allein ein größerer Redner, Sänger, Musiker, Jäger, Trinkheld und Spieler war als alle die andern zusammengenommen. Welch einen Mann hatte nicht die Majorin aus ihm gemacht!
Seht ihn an, wie er jetzt da oben auf dem Rednerstuhl steht! Die Dunkelheit senkt sich von dem rußgeschwärzten Dach in schweren Festons auf ihn herab. Sein blondes Haupt schimmert daraus hervor wie das der jungen Götter, jener jungen Lichtträger, die das Chaos ordneten. Schlank, schön, abenteuerbegehrlich steht er da.
Aber er redet mit tiefem Ernst.
»Kavaliere und Brüder! Die Mitternacht naht heran, das Fest ist weit vorgeschritten, es ist Zeit, den Becher auf das Wohl des Dreizehnten am Tische zu trinken!«
»Lieber Bruder Gösta,« ruft Patron Julius, »hier ist kein Dreizehnter, wir sind nur zwölf!«