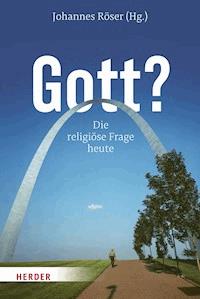
Gott? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was verliert eine Kultur, eine Gesellschaft, ein Staat, wenn Gott mehr oder weniger sang- und klanglos aus dem Leben der Bürgerinnen und Bürger verschwindet? Und was könnten sie gewinnen, wenn der Sinn für die Gottesfrage wächst? 135 Autorinnen und Autoren aus den verschiedensten Bereichen gehen diesen Fragen nach und lassen Hoffnungen und Zweifel, Erfahrungen und Enttäuschungen, Sehnsüchte und Erwartungen zur Sprache kommen – Trost, Ermutigung und Anregung für viele, die sich mit dem gesellschaftlichen Verdrängen des Lebenswichtigsten nicht abgefunden haben: ob es einen wahren, ewigen Grund gibt für die menschliche Existenz, für Geist und Materie, für das Dasein des Universums. »Die Beiträge dieses Buches widmen sich der Frage aller Fragen: Gott? Dabei wird deutlich, es ist in erster Linie ein Tasten und Suchen, ein Ahnen und Vermuten, ein Versuch zu erkennen jenseits eines plakativen, manchmal auch nur vermeintlichen Wissens. Glauben aber funktioniert nicht ohne Wissen. Und Wissen gibt es nicht ohne Glauben. In dieser Spannung nähern sich die Texte dem, was das Menschsein vielleicht doch unbedingt angeht. So ist ein wahres ›Gottes-Lesebuch‹ entstanden in einem weiten Spannungsbogen, voller Unruhe und Neugier. Diese Publikation fördert den Dialog über ein modernes Christsein in einer modernen Welt.« (Johannes Röser, Chefredakteur) Dieses Buch ist entstanden aus Anlass des siebzigjährigen Bestehens der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART. Sie ist allen Reformkräften verbunden, die für Gewissenserforschung, Wahrhaftigkeit, Freimütigkeit und religiöse Erneuerung eintreten. Als unabhängige und überregionale Wochenzeitschrift beleuchtet sie die Horizonte hinter den Schlagzeilen und richtet sich an alle, die einen persönlichen christlichen Lebensstil und ein zeitgemäßes Glaubensverständnis angesichts heutiger Welterfahrung suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Röser (Hg.)Gott?
Johannes Röser (Hg.)
Gott?Die religiöse Frage heute
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.deSatz: SatzWeise GmbH, TrierHerstellung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN Print 978-3-451-38297-0ISBN E-Book 978-3-451-81445-7
Inhalt
Vorwort – Auf der Spur des Ewigen und Dynamischen
I. Der Unbekannte, fern und nah
Ulla Hahn: Mein Gott
Gotthard Fuchs: „Gott ist eine Anstrengung, die Götter sind ein Vergnügen“
Heinrich Timmerevers: Suchet, wo Christus ist
Renate Kern: Auf dem Ozean der globalisierten Welt
Albert Gerhards: Der leere Thron
Klaus Berger: Den ich lieb wie keinen
Klaus P. Fischer: Glauben auf den zweiten Blick
Dieter Kittlauß: Wie bei einer Wette
Andreas R. Batlogg: Mehr Gott wagen
Otto Betz: Der ferngerückte Nahegekommene
Johannes Röser: Im wahren Beten zum „falschen“ Gottesbeweis
Michael Heinz: Ein Gottes-Lob der Einfachheit
Daniel Benga: Die Tränen des Menschen und der Gott, der sie abwischt
Rudolf Mitlöhner: Der Glutkern „Te Deum“
Carla Amina Baghajati: Durch Selbsterkenntnis zur Gotterkenntnis
Jürgen Kuhlmann: Und nur Kletten wachsen auf meinem Grab?
II. In moderner Gesellschaft
SAID: der kassiber
Barbara Zehnpfennig: Ich, Ich – nur Ich?
Daniel Bogner: Freiheit von, Freiheit zu …
Winfried Kretschmann: Den Leerraum wahren
Axel Bernd Kunze: Flagge und Kreuz
Reiner Haseloff: Natur und Vernunft zusammenhalten
Metropolit Augoustinos (Labardakis): Spielen mit Heraklit
Michael Kretschmer: Reden wir miteinander – nicht übereinander
Sebastian Kurz: Modern mit christlichen Wurzeln
Helmut Krätzl: Christsein in der Zivilgesellschaft
Tanja Kinkel: Die schwierigen Zehn Gebote
Clemens Klünemann: Lob der Säkularisierung
III. Stadt – Land – Gott
Stephan Reimund Senge: Am Strand von Ninive
Andreas Bieringer: „Schau an der schönen Gärten-Zier“
Volker Resing: Zwischen Borghorst und Berlin
Philipp Gessler: Gott in der „Stadt ohne Gott“
Michael N. Ebertz: Der innerweltliche Lebensabschnittssinn
Malu Dreyer: Wie hältst Du’s mit Gott?
Norbert Jachertz: Deutsche Verhältnisse
Stephan Langer: Gottes Häuser
Peter Hahnen: Der „andere“ Ort
Norbert Schwab: Zwei Sphären, doch eins: beten und denken
IV. Das Jenseits im Diesseits – das Sein und das Nichts
Patrick Roth: Der Untergang des Hauses Eli
Volker Gerhardt: Die Gegenwart Gottes oder Über die Aktualität des Glaubens
Holger Zaborowski: Ideen haben Folgen
Bernd Irlenborn: Im „Halbschatten“ um die Rechtgläubigkeit
Peter Neuner: Der Sinn aus dem Nichts
Hans-Rüdiger Schwab: Über die Welt hinaus denken
Ludger Schwienhorst-Schönberger: Was man früher Andacht nannte
Barbara Henze: Im Anfang war das Gespräch
Mariano Delgado: Geburtshilfe des Glaubens nach Johannes vom Kreuz
Alois Odermatt: Das Absurde und die Zweite Geburt
Wolfgang Bretschneider: Der Name, der wie eine Frage klingt
Lorenz Wachinger: Das Licht des Nichts
Julian R. Backes: Das biblische Koan
Sebastian Painadath: In der Schwingung des Geistes
V. Das Wissen der Wissenswelt
Norbert Scholl: Die Lehre verblasst, die Neugier wächst
Wolf-Rüdiger Schmidt: Die Religion im Licht der Evolution
Arnold O. Benz: Wirklich ist, was wirkt – und was wir wahrnehmen
Herbert Pietschmann: Das Machbare und das Unverfügbare
Armin Grunwald: Naturwissenschaften haben keine Messgeräte für Transzendentes
Klaus Müller: Die Digitale Theologie des Silicon Valley
Jochen Teuffel: Wenn eine künstliche Superintelligenz alles besser weiß
Amelie Tautor: Der Schöpfergeist hat einen Schöpfer
VI. Seele und Leib suchen den Sinn
Daniela M. Ziegler: Donum vitae
Helmut Jaschke: Das Ja zum Leben, wie es ist
Christina Herzog: Im Netzwerk der Menschengeschichten
Martin Kämpchen: Der Klang der Symbole
Elena Griepentrog: Der versteckte Schatz
Hermann Schalück: Was sucht ihr? Wo wohnst du?
Monika Renz: Von der Frage zur Erfahrung
Matthias Alexander Schmidt: Exerzitien auf der Straße
Jakob Paula: Das Wespengleichnis
Melanie Wolfers: Mit sich selbst befreundet sein
Johannes Warmbrunn: In der allumfassenden Wirklichkeit
Paul Petzel: Dass die Welt nicht zum Teufel geht
Erich Guntli: Die „böse Lust“ und die Lust auf Gott
VII. Im Geist der Weltverantwortung
Jürgen Moltmann: „Der du trägst das Leid der Welt“
Dorothea Sattler: Das Gericht
Thomas Brose: In Metropolis
Ingeborg Gabriel: Ein Glaube, der Hoffnung weckt
Armin Laschet: Bekenntnis, Toleranz und Einmischung
Josef Epping: Suchet nicht, was droben ist
Pirmin Spiegel: Die Armen habt ihr immer bei euch
Irene Leicht: Wer sein Ich übersteigt
Christian Hartl: Eine kleine Philosophie der Freundschaft
Klaus Werger: Menschenwürde aus Gottes Würde
Wolfgang Thönissen: Gerecht oder barmherzig?
Matthias Mühl: Das bejahte Leben, die bejahte Welt
VIII. Glauben heißt leben
Michael Albus: Neue Lieder singen
Friedrich Schorlemmer: Ich glaube ihm – nicht an ihn
Monika Warmbrunn: Der Geschmack fürs Unendliche
Wunibald Müller: Das Leben, der Nachbar der Ewigkeit
Veit Schäfer: Der „Geist der Wahrheit“, unerschöpflich
Ralf Meister: Die Schnipsel in der Pappschachtel
Eduard Nagel: Der fremde Gast im Gottesdienst
IX. Die Sprache der Kunst
Andreas Knapp: Haben wir für Gott noch Worte?
Christoph Gellner: In der Sehnsucht nach der dunklen Energie
Jürgen Springer: Graubrotsehnsucht
Magda Motté: Lieber das hingestotterte Gebet
Joachim Hake: Gott, Güte und Licht
Georg Langenhorst: Ein Zuschauen, das wir alle brauchen
Johanna Domek: Bei den „Glaubenskämpfern“ auf der Bühne
Peter B. Steiner: Über das Geistige in der Kunst
Burghard Preusler: Wenn die Kirchgänger Wohnzimmeratmosphäre wollen
Martin Struck: Moderner Sakralbau als Symbolverfall
Julia Krahn: Über die Mauern unserer Existenz schauen
Eva Petrio: Das allen Menschen gemeinsame Herz
Eckhard Jaschinski: Musik für die Ewigkeit
Monika Grütters: Weltschau der Kulturen, auch mit einem Kreuz
X. Horizonterweiterung Theologie
Eckhard Nordhofen: Das große Gegenüber
Paul Weß: Warum Gott zur Frage wurde – und wo eine Antwort zu suchen wäre
Wolfgang Beinert: Das Spiel auf dieser Bühne – und verstehen es nicht
Gerhard Kardinal Müller: Die Fehlurteile des Atheismus
Ulrich H. J. Körtner: Das Missverständnis des Sünders
Thomas Ruster: Gott, die Kontingenz und der Geist
Manfred Rekowski: Weltlich, aber Gottes Eigentum
Ulrich Willers: An meinen atheistischen Freund
XI. Die große Erzählung – von Abraham bis Jesus
Jan-Heiner Tück: Die Verstörung von Morija und Golgatha
Christoph Dohmen: Toleranz und Monotheismus
Andrea Pichlmeier: Lukas und das Weltwissen
Engelbert Groß: Der verwundete Jesus der Zärtlichkeit
Robert Vorholt: Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho
Martin Schirmers: Der Salzgeschmack auf unserer Zunge
Robert Weber-Locher: Weihnachtlicher Faktencheck
Ralf Miggelbrink: Im Bekenntnis zu dem Mann aus Nazareth
Andreas Benk: Gott steht auf der Seite der Anderen – Sechzehn Tweets von gegenüber
XII. Auf dem Weg ins Erwachsenwerden
Christian Heidrich: Darf’s ein bisschen mehr sein?
Heike Helmchen-Menke: Die kleinsten Christen in der Gegenwart
Albert Biesinger: Kann man Gott lernen?
Gregor Tischler: Der Katechismus hilft nicht mehr
Sabine Pemsel-Maier: Nur noch ein höheres Wesen?
XIII. Wie sich die Kirche erneuert hat und erneuern kann
Joachim Jauer: Den Menschensohn wecken
Manfred Scheuer: Wider die Müdigkeit
Joachim Wanke: Der alternative Horizont
Hans Waldenfels: Aus der Mitte der Eucharistie
Franz-Xaver Kaufmann: Per Ecclesiam ad Deum?
Michael Seewald: Erkennt ihr nicht, so bleibt ihr nicht
Thomas Söding: Mehr als Ritus und Ethos
Register der Autorinnen und Autoren
Vorwort – Auf der Spur des Ewigen und Dynamischen
Der französische Philosoph und Politologe Olivier Roy beobachtet eine „Dekulturierung“ der Religion, insbesondere des Christentums, in der modernen Gesellschaft. Parallel zur beschleunigten Distanzierung der Bevölkerung von der religiösen Praxis verschwinde der Glaube selbst mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. Allenfalls im Privaten habe er da und dort noch Platz, aber auch das immer weniger. Die Kirchen selbst hätten sich weitestgehend aus dem „Management der Gesellschaft“ zurückgezogen, zurückziehen müssen, weil ihnen das Vertrauen von unten entzogen werde.
Hinzu komme eine „Entzauberung der Welt“ durch die Wissenschaften, durch fortgesetzte Aufklärung und Entmythologisierung vieler Lebensbereiche. Zwar gebe es nach wie vor genügend Rätsel und Mysterien des Daseins, die es auch wieder verzaubern, doch dies werde kaum mehr aufs Religiöse bezogen.
Für Olivier Roy heißt das nicht zwingend, dass die Menschen zu Atheisten würden. „Aber die Bedeutung der Religion in unserem Leben und Alltag nimmt ab.“ Vor allem verschwinde die Gottesfrage zusehends aus dem menschlichen Bewusstsein. Jedenfalls lebten wir in säkularen Gesellschaften in dem Sinn, „dass Religion allenthalben aus der Leitkultur verschwunden ist“.
Trotz ihres Autoritätsverlustes treten die Kirchen als Institutionen mit moralischen Mahnungen und Forderungen noch selbstbewusst an die Öffentlichkeit. Vor allem mit Sozialmoral. Nicht nur die Kirchenleitungen präsentieren sich mit medial gern aufgenommenen und verbreiteten quasi-politischen Appellen und Warnungen als außerparlamentarische Werteagentur für den Ruck durch die Gesellschaft. Das wird zumindest beifällig zur Kenntnis genommen. Aber wird es auch zu Herzen genommen?
Ach, wie nützlich solche Religion doch ist, die sich mit dem schweren Glaubensverlust, der Gotteskrise, dem Schweigen und „Verschwinden“ Gottes aus der Wahrnehmung gar nicht erst beschäftigt. Die Menschen sehnen sich weiter nach Sinn, nach Erfüllung, nach Glück – aber auch nach Gott, nach ewigem Leben, nach einem Jenseits als Vollendung des Diesseits? Kirche als Sozialdienstleister ja, Gott nein?
Was verliert eine Kultur, eine Gesellschaft, ein Staat, wenn Gott mehr oder weniger sang- und klanglos aus dem Leben der Bürgerinnen und Bürger verschwindet? Und was könnten sie gewinnen, wenn der Sinn für die Gottesfrage wächst? Der Publizist und frühere Kulturstaatsminister Michael Naumann sagte einmal, die Hauptaufgabe der Kirche sei es, die Gottesfrage wachzuhalten, sie wieder zu wecken. Das Christentum könne für moderne Menschen wieder attraktiv werden, aber nur, wenn es die Fähigkeit habe und entwickle, „die Sehnsucht nach dem Numinosen, Rätselhaften, Unerklärbaren zu stillen“. Soziale Dienstleistung sei nicht die zentrale Aufgabe des Christseins, vielmehr „die Vorbereitung auf das Eschaton“, also die Vorbereitung auf das Reich Gottes, auf das ewige Leben, das im diesseitigen Leben schon beginnt.
Die Beiträge dieses Buches widmen sich der großen Frage, der Frage aller Fragen: Gott? Dabei wird deutlich, es ist in erster Linie ein Tasten und Suchen, ein Ahnen und Vermuten, ein Versuch zu erkennen jenseits eines plakativen, manchmal auch nur vermeintlichen Wissens. Glauben aber funktioniert nicht ohne Wissen. Und Wissen gibt es nicht ohne Glauben. In dieser Spannung nähern sich die Texte dem, was das Menschsein vielleicht doch unbedingt angeht. 135 Autorinnen und Autoren haben sich beteiligt: Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Theologen, Naturwissenschaftler, Politiker, Journalisten, Kulturschaffende, Bildungsengagierte aus verschiedensten Berufsfeldern. So ist ein wahres „Gottes-Lesebuch“ entstanden in einem weiten Spannungsbogen, voller Unruhe und Neugier, was auch die Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART kennzeichnet. Das siebzigjährige Bestehen dieser Publikation für Religion, Theologie, Kultur und Gesellschaft ist der Anlass, den entscheidenden Horizont des menschlichen Daseins auszuleuchten, auf der Spur des Ewigen und Dynamischen: Gott – nicht nur eine Frage.
Johannes Röser, Chefredakteur der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART, Freiburg im Breisgau.
I. Der Unbekannte, fern und nah
Ulla Hahn
Mein Gott
Ist was? frag ich
die Freunde wenn sie ihn
sehen über meinem Schreibtisch
(neben Schiller und John Donne)
den Mann den jeder
man kennt den
ernsten Mann am Kreuz
den noch keiner lächeln sah
Wie sie da gucken die Freunde
(ein bisschen verlegen) und
die Schultern zucken
(etwas mitleidig)
Ist was? frag ich
Dann fragt niemand weiter
Einzelkind (was den Vater angeht)
reichlich Halbgeschwister
Machte sich aber nicht viel
aus Familie ( kleine Verhältnisse
Adoptivvater Zimmermann aufm Dorf)
Kehrte ihr bald den Rücken (säte nicht
mähte nicht und sein himmlischer Vater
ernährte ihn doch) schlug sich
als Wunderheiler durch
mit einem großen Herzen für
die kleinen Leute und einer forschen
Lippe gegen die da oben (Ihr sollt
Gott mehr gehorchen als den Menschen)
Aufsässig furchtlos eigensinnig
praktischer Arbeit abhold
Den hab ich geliebt
wenn ich die Mutter
mundtot machte mit Lukas:
nicht die hauswirtschaftende
Martha vielmehr Maria
zuhörend von Jesus gefesselt
habe ‚das Bessere‘ erwählt
und mich mit göttlichem Segen
in meine Bücher vergrub
Hab das gottschlaue Lieben verlernt
bei den Weiden am Rhein
unter menschlichen
Lippen- und anderen Zärtlichkeiten
So viele Vaterunser der Reue und Buße
Vergebene Liebesmüh
Mein Kinderheld fuhr
in den Himmel auf
Ich blieb unten
Da bin ich noch
Manchmal aber
lese ich wieder
in seinen alten Briefen
(die von den vier Kurieren
überbrachten)
oder besuch ihn bei sich zu Haus
(Mit Brot und Wein
Musik und Kerzenschein)
Dann frag ich ihn
Wofür das alles? Dein Leben
Leiden Sterben
Für den
der fragt
sagt er und lächelt
befreit
von seinem Kreuz
nimmt mich
in seine Arme
flüstert mir ins Ohr:
Irgendwann
stell ich dich meinem Vater vor.
Lass dir Zeit. Ich kann warten.
Und meine Freunde?
Bring sie doch mal mit.
Auch Miriam, Shixin, Fatima und Keiko.
In meines Vaters Haus
sind viele Wohnungen.
Und mit fünf Broten und zwei Fischen
krieg ich alle satt.
Bibelstellen:
Lukas 10,38ffJohannes 14,2Matthäus 14,17ff
Dr. Ulla Hahn, Schriftstellerin, Lyrikerin, Hamburg.
Gotthard Fuchs
„Gott ist eine Anstrengung, die Götter sind ein Vergnügen“
Zwei Momentaufnahmen vorneweg: Tragisch ist es, dass in unserem Kulturkreis schon das Wort „Gott“ immer noch die Vorstellung einer abgehobenen Sonderwelt mehr oder weniger „transzendenter“ Art hervorruft. Viele, wenn nicht alle Formen des Atheismus beziehen sich mit Recht kritisch auf diese tendenzielle Spaltung der Wirklichkeit und des Lebens. Wenn überhaupt sinnvoll von dem Geheimnis, das wir Gott nennen, gesprochen werden kann – sei es bejahend oder bestreitend –, muss es mit der ganzen Wirklichkeit zu tun haben und darf nicht unterschwellig eine Zweit- und Sonderwelt nahelegen. Der Gottesglaube ist kein Auskunftsbüro für das Jenseits und eignet sich nicht zur Behauptung von „Tiefsinn“. Wer oder was mit „Gott“ sinnvoll gemeint ist, muss in der Alltagsrealität aufweisbar sein als deren Wahrheit, als die Wirklichkeit der Wirklichkeiten. Da kommt nicht zweitrangig etwas zu der vermeintlich normalen Welt hinzu. Gott kommt allem, was ist, immer schon zuvor und bleibt ihm gegenüber. Alle großen Theo-Logen unterstreichen und entfalten das, zum Beispiel in der Rede vom ens absolutum oder summum ens, vom absoluten Sein oder dem höchsten Sein – und besonders vom Jenseits des Seins. Gott als die Wirklichkeit, als das, über das hinaus nichts Größeres gedacht und gelebt werden kann.
Das Zweite: Gott ist, wenn überhaupt, kein exklusives Thema der Kirchen mehr. Dieser Tatbestand ist, jedenfalls in christlicher Perspektive, hoch erfreulich. Wenn sinnvoll von Gott die Rede sein soll, geht es um Lebens- und Überlebensfragen, auf die jeder Mensch ansprechbar ist und die mit der Zukunft von Erde und Welt zu tun haben: Wie können wir Verhältnisse schaffen, in denen jeder Mensch gerecht leben kann, ohne dass wir den Planeten zerstören? Was ist mit den unschuldigen Opfern der Geschichte, was mit den Täter(innen)? Was mit dem Gelingen der Liebe angesichts des Todes? Warum, trotz und in aller Vergänglichkeit, das Schöne und Gute? Warum die Gewalt und das Böse? Was ist mit dem Einzelnen im Kosmos? Die Verkirchlichung des Christlichen und seine „Verreligiosisierung“ waren zwar immer wieder im Gang, mündeten jedoch in Engführungen. Manche Klage über den modernen Menschen, der mit „Gott“ nichts anfangen könne, spiegelt zunächst einmal nur die Befreiung aus solch kirchlicher und religiöser Gefangenschaft. Auch der Atheismus je unterschiedlicher Prägung ist die Destruktion einer Art von Gottesrede, die ihre existentielle Erdung, ihre geschichtliche Kraft und ihre vitalisierende Energie verloren hat.
Die dadurch entstehenden Leerstellen haben eine sogartige Anziehungskraft für Formen des Religiösen und „Heiligen“, die man gern in jenem „Feuerbach“ der Religionskritik gereinigt sähe, dem sich auch das westliche Christentum seit der Aufklärung ausgesetzt sieht, zwecks kräftiger Reinigung seines Wahrheitsanspruchs. Zu den ideologieverdächtigen Formen postsäkularer Selbst- und Weltdeutung gehört die Konjunktur dessen, was man religionsgeschichtlich Polytheismus nannte. An Religion ist ja in der Postmoderne kein Mangel, und theologisch mindestens ebenso herausfordernd wie die verschiedenen Atheismen sind die Polytheismen neo- und interreligiöser Spielart. Martin Luthers Kurzformel einer schon augustinischen Einsicht bringt es auf den Punkt: „Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott oder dein Abgott“. Oder mit Gilbert Keith Chesterton: „Wer nicht an Gott glaubt, glaubt nicht an nichts, sondern an alles.“
Die Gottesfrage entpuppt sich als Frage nach den Mächten und Gewalten, von denen Menschen, Gruppen und Gesellschaften bestimmt und abhängig sind. Die frei flottierende Rede vom Religiösen und Spirituellen, vom Mystischen gar, verdeckt diese polytheistischen Abhängigkeitsstrukturen, die biblisch „Götzen“ heißen. In welchem der vielen Erbauungsbücher aus der Abteilung „Spiritualität“ oder gar „Mystik“ kommt zum Beispiel zentral das Thema „Geld“ vor ? Dabei sollte doch seit Walter Benjamins Aussage von 1921 eines längst klar sein: „Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken“, denn „er dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die die ehemals so genannten Religionen Antwort gaben“. Wo aber in den gängigen Mystik-Diskursen und Mystikbüchern wird – zum Beispiel – thematisiert, dass es auch eine braune „Mystik“ der Nazis und eine schwarze der Faschisten gab und gibt und dass auch die heutige Konsumkultur ihre „Mystik“ hat?
Zum Wesen der Religion(en) und ihrer jeweiligen Mystik(en) gehört schattenstark auch ihr mögliches Unwesen, was schon der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte beschrieben hatte. Um die Frage nach „Gott und Götzen“ lapidar zu markieren, genügt Thomas Manns Satz aus dem Roman „Joseph und seine Brüder“: „Gott ist eine Anstrengung, die Götter sind ein Vergnügen.“ Denn vergleichbar der lebenslangen Liebesbindung an einen Menschen ist die biblische Glaubensbindung an einen Gott eine durchaus herausfordernde Geschichte, die ihr eigenes Glück und ihren eigenen Stress hat. Polytheismus geht leichter: Zwar bleibt der Reiz der Vielfalt vergnüglicher, und solche Pluralität hat durchaus ihren Gewinn. Aber die entschiedene Bindung an eine Person setzt besondere Energien frei und eröffnet durch Einwurzelung eine besondere Dichte und Weite. Die größte Not des Atheisten sei es, dass er nicht wisse, wohin mit seinem Dank, bestätigte der Schriftsteller Elias Canetti aus eigener Erfahrung. Und das gilt auch für das Bitten und Klagen. Eine erste und einzige „Adresse“ zu haben, gehört zu den Kostbarkeiten biblischer Glaubenserfahrung und Gottespraxis.
Im „ersten heidnischen Jahrhundert nach Christus“, wie der Philosoph Peter Sloterdijk unsere Zeit bezeichnet, gilt es also, neu zu fragen, was denn die christliche Pointe im neo- und interreligiösen Gespräch sei – nicht, um sich elitär und imperial über andere zu erheben, sondern um des aufrichtigen Dialogs und um jener Streitkultur willen, an der sich Leben und Überleben aller entscheidet. „Gott klingt wie eine Antwort. Und das ist das Verderbliche an diesem Wort, das so oft als Antwort gebraucht wird. Er hätte einen Namen haben müssen, der wie eine Frage klingt“, so der Schriftsteller Cees Nooteboom. Um diesen Namen neu buchstabieren zu lernen, ist der Wink der Philosophin Simone Weil hilfreich: Die Erfahrungen von Schönheit und Unglück seien die unmittelbarsten Zugangswege zum Geheimnis göttlicher Gegenwart. Hier begegne mitten im Bedingten das Unbedingte. Wer nicht an Gott glauben kann, achte umso mehr auf dieses Doppelalphabet von Sehnsucht und Verzweiflung: Wohin fließen beglückend Leidenschaft und Hoffnungsenergie – und wo ist zahnwehhaft der Schmerz zu spüren, dass es nicht stimmt mit dem Leben und der Welt? Der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Clive Staples Lewis bekannte: „Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind Sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken.“
Sagen wir also unverblümt und direkt, was das Besondere am biblischen Gottesglauben ist – und das, wie es sich theologisch gehört, mit einem klassischen Kernsatz, den Papst Leo I. geprägt hat: „Der Unbegreifliche wollte sich begreiflich machen.“ Christenmenschen können und wollen nicht Gott sagen ohne Jesus, den sie deshalb (ihren) Christus nennen, ihren Schatz. In der realen Geschichte dieses Menschen erkennen sie glaubend jenes erste und letzte Geheimnis aller Wirklichkeit, über das hinaus kein größeres gewusst und gelebt sein kann. Nicht nur Liebe ist sein Wesen, sondern Feindesliebe, schlechterdings zuvorkommende schöpferisch vergebende Präsenz. Warum denn sonst ist jeder Mensch ansprechbar auf Lob, Anerkennung und Wertschätzung, so stumpf oder verschlossen er auch geworden sein mag? Weil er aus einer größeren Liebe stammt und kein Blindgänger der Evolution ist! In der Jesus-Revolution kommt diese Schöpfungszuversicht neu und ursprünglich wieder zur Geltung. Gott ist (Feindes-) Liebe, und die gilt es zu praktizieren.
Die damit verbundene Passion – Leidenschaft und Leiden – deckt auf, wie die Verhältnisse seit Kain und Abel jenseits von Eden noch sind: gewaltförmig, von Angst und Gier schwer angefressen. Deshalb ist biblischer Gottesglaube ohne konfliktfähige Gewaltlosigkeit und heilende Leidsensibilität nicht zu haben. „Der falsche Gott macht aus dem Leiden Gewalt. Der wahre Gott macht aus der Gewalt Leiden“, formulierte Simone Weil. Und das schafft Gerechtigkeit und Frieden.
Solche Unterscheidung von Gott und Götzen wird konkret im jeweiligen Lebensentwurf, in Selbst- und Weltgestaltung. „Gott kennen, heißt wissen, was zu tun ist“, sagte der Philosoph Emmanuel Levinas. Im Sinne des christlichen Taufversprechens lautet die zentrale Frage nicht, ob Gott ist, denn die Welt ist voller Götter, und jeder Mensch braucht was zum Anbeten. Sondern: welcher Gott?
Darin erscheint biblisch die Frage Gottes nach uns: Adam / Eva, wo bist du? Ganz im Sinne des Gedichtes von Andreas Knapp:
von gott aus gesehen
ist unser suchen nach gott
vielleicht die weise wie er uns auf der spur bleibt
und unser hunger nach ihm das mittel
mit dem er unser leben nährt
ist unser irrendes pilgern
das zelt in dem gott zu gast ist
und unser warten auf ihn
sein geduldiges anklopfen
ist unsere sehnsucht nach gott
die flamme seiner gegenwart
und unser zweifel der raum
in dem gott an uns glaubt
Dr. Gotthard Fuchs, Priester und Publizist, Wiesbaden.
Heinrich Timmerevers
Suchet, wo Christus ist
DDR-Gründung, Prager Frühling, Mauerbau und eine friedliche Revolution, die zusammenführte, was zusammengehörte: Wie kaum eine andere Region hat Sachsen in den letzten Jahrzehnten Veränderungen erlebt. Nimmt man allein die siebzig Jahre, in denen die Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GEGENWART aktuelle Themen des Glaubens aufgriff, so lassen sich für Mitteldeutschland zentrale politische, gesellschaftliche und kirchliche Wegmarken aufzeigen. Die Einrichtung der für die DDR zentralen Priesterausbildung (1952 in Erfurt), die Einführung der Jugendweihe (1954), die Synoden in Dresden (1969–1971 und 1971–1973) und die Manifestation der wiedererlangten Freiheit durch den Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen (1996) sind kirchlicherseits nur einige Stationen. Die Wahl der Ereignisse zeigt, dass die vergangenen siebzig Jahre die Kirche in Sachsen herausgefordert haben.
Nicht vergessen werden darf dabei, dass jede Entscheidung nicht nur von Menschen gestaltet und getroffen wurde, sondern dass ihre Konsequenzen auch Menschen zu tragen – und nicht wenige auch zu erleiden – hatten. Dass wir heute die Frage nach Gott in der Gesellschaft öffentlich stellen und sie in ein Verhältnis zu politischen Meinungen und abweichenden Weltanschauungen bringen dürfen, ist das Verdienst Zehntausender, die sich entschieden haben, in diesem Land die Frage nach dem, was das Irdische übersteigt, wachzuhalten. Mit Respekt verneige ich mich vor den Lebensleistungen und Glaubenszeugnissen dieser Menschen.
In den vergangenen Jahren habe ich viele persönliche Schicksale von Menschen hören dürfen, die um die Frage nach Gott gerungen und mit ihrer Lebensgeschichte den Glauben verteidigt haben. Es sind vielfach Menschen, die in einer mehrfachen Minderheit leben: (1) Katholisch, weil die Mehrheit der Christen evangelisch ist; (2) als Getaufte, weil die Mehrheit sich in den letzten Jahrzehnten von der Glaubenszugehörigkeit abgewendet hat; (3) kulturell, weil durch die Migration aus dem Sudetenland, Schlesien und aus Ländern Südosteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg die eigenen – religiösen – Traditionen nicht zur existierenden Alltagskultur Sachsens passten. Noch heute ist in den Begegnungen spürbar, dass über Generationen hinweg Menschen aufgrund ihres Glaubens und der daraus erwachsenden Konsequenzen in Sachsen immer wieder zwischen Gehen und Bleiben herausgefordert waren. Mit großer Achtung nehme ich dies wahr. Denn es führt mir angesichts meiner eigenen Biografie vor Augen, wie wenig selbstverständlich es sein kann, die Frage nach Gott durch alltägliche Symbole und Rituale gestellt zu bekommen, sondern dass man sich immer wieder neu einen Sprach- und Praxisraum hierfür zu erkämpfen hat. Zugleich wünsche ich mir aber auch angesichts dieser Erfahrung eine Sensibilität der rückblickenden Beurteilung. Als Christen sind wir herausgefordert, einen barmherzigen Umgang mit jenen zu finden, die sich für das Gehen entschieden haben, weil ihr Glaube zur Gestaltung des Lebens in der Minderheitenposition nicht ausreichte.
Inzwischen sind es mehr als achtzig Prozent, die sich auf dem Standesamt nicht mehr zum christlichen Glauben bekennen. Dies war vor siebzig Jahren noch anders: Damals waren über neunzig Prozent christlich, das Land war orthodox protestantisch geprägt. Die Uhren lassen sich nicht zurückdrehen. Stattdessen lohnt der Blick auf die Menschen, die heute das Leben in Mitteldeutschland gestalten, ohne dass Gott bei ihnen eine Rolle spielt. Sie stellen – bereits seit mehreren Generationen – nicht mehr die Frage. Gott hat sich aus der Identität der Menschen geschlichen. Wer etwa eine Krise wie das Lebensende bewältigen will, zieht nicht mehr eine eschatologische Dimension heran, wie sie uns Christen mit der Auferstehungshoffnung gegeben ist, sondern sucht naturwissenschaftliche Erklärungsmuster. Oder duckt sich vor der Realität des Todes weg. Gerade in Pflegeheimen und Krankenhäusern erlebe ich, wie einsam Menschen in ihrem Ringen mit dem eigenen Lebensende sind. Ein Mitarbeiter erzählte mir, dass seine Angehörigen beim – eigentlich selbstverständlichen – Begleiten des Sterbeprozesses ihrer Verwandten im Pflegeheim anschließend vom Pflegepersonal für die Anwesenheit bewundert wurden. Mir scheint, als flüchteten viele, weil sie merken, dass sie gerade an dieser Nahtstelle mit den naturwissenschaftlichen Erklärungen an Grenzen kommen.
Inwiefern in solchen Situationen Religion einen Zweifel auslöst, der zur Sinn- und Gottessuche über den Krisenmoment hinaus motiviert, ist umstritten. Die Frage nach Gott scheint – so einige Wissenschaftler – mit dem Krisenende ebenso erledigt. Der Erfurter Religionsphilosoph Eberhard Tiefensee stellte mit Blick auf die Religiosität Mitteldeutschlands fest, dass einerseits weltanschauliche Fragen für die existenzielle Auseinandersetzung und persönliche Entscheidung obsolet sind und andererseits auch außerhalb des Christlichen keine außerkirchliche Religiosität existiert (vgl. „Die Frage nach dem ‚homo areligiosus‘ als interdisziplinäre Herausforderung“, in dem von Benedikt Kranemann u. a. herausgegebenen Band „Mission – Konzepte und Praxis der katholischen Kirche in Geschichte und Gegenwart“, Würzburg 2009). In Dresden zum Beispiel wird bei öffentlichen Großveranstaltungen wie dem Adventssingen im Fußballstadion oder einem Gottesdienst auf dem Platz vor der Frauenkirche deutlich, dass eine grundsätzliche Sehnsucht nach Ritualen vorhanden ist, die auf eine grundgelegte Religiosität verweisen kann. Inwiefern sie einen umfänglichen, individuellen Reflexionsprozess zur eigenen Religiosität und deren Konsequenzen auslöst, wäre an geeigneter Stelle zu erforschen.
Das in Gesprächen wahrnehmbare religiöse Fragen lässt die „Rückkehr des religiösen Zweifels“, so der Soziologe Heiner Meulemann, erahnen. Zugleich aber löst die offensichtliche Konfrontation mit Religion als Deutungsmöglichkeit Ängste aus. Hierin liegt auch eine der Erklärungen für die über die Landesgrenzen hinweg wahrnehmbare Stimmung in der sächsischen Bevölkerung. Die Fremdheit der eigenen religiösen Wurzeln verunsichert genauso wie die Fremdheit des Islams oder anderer religiöser Praktiken. Eine bislang kulturell nicht beheimatete Religion erscheint in diesem Landstrich hingegen als Fremdkörper, der – insofern er sich auch innerhalb der Gesellschaft durch Zeichen und Rituale äußert – als gesellschaftlicher Rückschritt empfunden wird. Hatten doch gesellschaftlich anerkannte Multiplikatoren über Jahrzehnte hinweg das Ende des Aberglaubens und der Religion propagiert, indem sie dem Glauben die Vernünftigkeit abgesprochen hatten. Es geht daher viel weniger um die Frage der „wahren Religion“ oder einer Sehnsucht nach der künftigen kulturprägenden Existenz des Christentums. Stattdessen bietet die Wiederkehr des Religiösen im öffentlichen Raum innerhalb einer nachreligiösen Gesellschaft an sich das Konfliktpotenzial.
Wer also die Frage nach Gott in der Verwandtschaft, im Freundeskreis oder in gesellschaftlichen Gruppen außerhalb des Christlichen tatsächlich stellen will, riskiert Unverständnis und Ablehnung. Hieran wird deutlich, dass wir die Frage nach Gott nicht zuerst in den Ministerien und Plenarsälen stellen müssen, sondern in der persönlichen Begegnung in den Familien, bei der Arbeit und im Fußballverein. Wenn wir künftig in Mitteldeutschland die religiöse Frage neu stellen, gilt es, den Menschen ohne Wenn und Aber anzunehmen. Dies heißt, ihn sowohl mit seiner Geschichtlichkeit, Vernunft- und Sprachbegabung als auch seiner Fähigkeit zur Freiheit und Verantwortung anzuerkennen. „Ein ‚Areligiöser‘ ist nicht weniger Mensch als ein Christ – sondern anders Mensch“, so Tiefensee. Diese Haltung verlangt auch von Christen einen enormen Perspektivwechsel. Viel zu oft tragen wir das Bild in unseren Köpfen, man müsse dem defizitären Menschen, dem Gott abhanden gekommen ist, etwas „on top“ mitgeben. Stattdessen lohnt es sich, das Eigene vom Anderen her zu denken und den Dialog in die Mitte eigener Missionsvorstellung zu stellen.
Mich persönlich fordert mein Bischofswort Suchet, wo Christus ist zu diesem Perspektivwechsel auf. Viel zu oft gelingt es mir nicht, Christus im Anderen zu entdecken und ihn vom Anderen her zu denken. Wie werden wir zu Emmausjüngern, die sich selbst auf den Weg der Suche machen und die Wege der Menschen ihrer Umgebung mitgehen? Ich wünsche mir ein wanderndes Volk Gottes, das neue Wege einschlägt. Ein Volk, das selbst immer wieder um den Weg ringt, weil es miteinander spricht und miteinander sucht. Ein Volk, das so viele Zugänge zu Gott findet, wie es Menschen im Volk gibt und trotzdem zu einer Einheit zusammenfindet. Und ein Gottesvolk, das die Menschen auf dem Weg nicht überzeugt, weil es überredet oder mit Vorteilen lockt. Ich wünsche mir ein Volk, das durch sein Sprechen und Handeln den Anderen als gleichwertig akzeptiert und ihm den Glauben anbietet. Ich wünsche mir angesichts der postmodernen Gesellschaft Sachsens ein Gottesvolk, welches das Christuszeugnis nicht als lähmende Pflicht erlebt, sondern als Freude, die dem Evangelium entspringt, „wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet“, wie es im Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (14) von Papst Franziskus heißt. Dann werden wir ein Gottesvolk, das sich verändert, weil es die Positionen der Anderen nicht ignoriert, und das trotzdem auf dem Fundament des Glaubens gründet. Ich möchte dazu ermutigen, das Evangelium auf diese Weise ins „Mitteldeutsche“ zu übersetzen, wie es bereits Bischof Joachim Wanke vor einigen Jahren formulierte. Gerade weil die Katholiken in Sachsen schon über Generationen als migrante Minderheit um Gehen und Bleiben gerungen haben, bringen sie einen enormen Erfahrungsschatz für das weiterwandernde Gottesvolk mit. Ihre Geschichte und ihre Stellung in diesem Land sind die Quelle für unsere Lebens- und Zeugniskraft.
Weil für die Mehrheit der Bevölkerung Sachsens in Krisen wie dem Lebensende der Glaube nicht mehr als sinnstiftender Horizont zur Verfügung steht, sehe ich gerade hier eine Möglichkeit des Dienstes der Christen an den Menschen. In extremen Lebenslagen, etwa bei austherapierten Krebskranken, haben wir inzwischen auf dem ganzen Kontinent Strukturen der klinischen und pastoralen Betreuung entwickelt. Aber haben wir sie auch, wenn Menschen im Krankenhaus oder Pflegeheim ihren Weg des Abschieds beginnen? Ich frage mich dies in letzter Zeit häufiger, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Mitarbeitende des Bistums hierfür lediglich begrenzte Möglichkeiten schaffen können. Viel entscheidender ist die Haltung des Einzelnen. Bin ich in der Lage, mich als Christ mit dem irdischen Lebensende eines nahen Verwandten oder guten Freundes konfrontieren zu lassen und mit ihm meine Hoffnung zu teilen? Ob in eigenen Worten, im Gebet oder im Schweigen – es wäre ein wertvoller Beitrag, Christus im Sterbenden zu suchen und zugleich eine „Kunst des Sterbens“ mitzugestalten. Nicht, weil wir als Christen eine höhere ethische Qualifikation haben, sondern weil wir von einem Gott überzeugt sind, mit dem das Leben eine Sinnrichtung erhält und im Tod die Grenzziehung aufgehoben wird. Es ist nur ein Beispiel von vielen, bei denen ich wahrnehme, dass wir als Christen uns stärker als bisher in einen Dialog mit den Menschen begeben könnten, damit wir selbst die Suche nach Christus nicht verlieren. Es wäre eine Übung, den Weg mitzugehen und die Perspektive des Anderen einzunehmen.
Die größte Gefahr ist, dass wir uns abschließen und meinen, wir hätten mit dem Empfang der Sakramente Christus bereits vollumfänglich in der Welt ein Antlitz verliehen. Wer aufmerksam am Abend in den Spiegel schaut, merkt, dass dem nicht so ist. Ich bin froh, dass uns in den aktuellen „Erkundungsprozessen“ des Bistums Dresden-Meißen die Frage leitet, wie wir Menschen mit Christus in Berührung bringen können. Dass diese Frage von dem Hirtenwort „Eucharistisch Kirche sein“ meines Vorgängers und jetzigen Berliner Erzbischofs Heiner Koch ausgeht, macht deutlich, wo wir die Mitte unseres Glaubens immer wieder suchen können. Ich bin überzeugt, dass der Altar als geistliche Mitte Ausgangspunkt und Ziel von uns als wanderndem Emmausvolk ist.
Als Bischof begleite ich dieses Volk Gottes. Auch meine Suche nach Christus ist nicht abgeschlossen. Ich bin dankbar, dass ich als Fremder in dieses Land geführt wurde und dass Menschen mit ihren Haltungen meine Suchrichtung neu justiert haben. Meine Erfahrungen wünsche ich gern jedem. Gerade die Berichterstattung der vergangenen Jahre hat den Landstrich in einem anderen Licht erscheinen lassen, als ich die Mehrheit der Menschen selbst in dieser Zeit erlebe. Der Perspektivwechsel, der vom Austausch verschiedener Erfahrungen lebt, kann eine Chance für den innerdeutschen Verständigungsprozess sein, der auch innerhalb unserer Kirche noch nicht abgeschlossen ist. Ich erlebe in meinen Begegnungen mit Menschen in Sachsen und ganz Mitteldeutschland wichtige Erzählungen von der Sehnsucht nach Freiheit, ohne dass die Betreffenden in eine „Ostalgie“ oder Abgrenzung gegenüber anderen verfallen. Derartige Erinnerungen waren mir als Geschichte bisher nicht fremd. Mit Leben gefüllt sind sie, seitdem ich in Sachsen bin. Auf neue Weise verbinde ich mit den geschichtlichen Daten Biografien von Menschen – und das Wirken Gottes in dieser Region. Ich wünsche mir aus den Bistümern Suchbewegungen, die Menschen zu verstehen. Unsere Kirchen sind klein, aber unser Herz ist weit. Wir wollen zeigen, wo Christus in Mitteldeutschland lebt. Der Journalismus ist eine wichtige Brücke, um Erfahrungen über Distanzen hinweg auszutauschen und Meinungen einzuordnen. Als Volk Gottes kann man Christus letztlich nur durch die persönliche Begegnung und den Dialog suchen. Damit können Veränderungen gestaltet werden, weil es dem Einzelnen neue Horizonte eröffnet und eine Voraussetzung für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist.
Heinrich Timmerevers, Bischof von Dresden-Meißen.
Renate Kern
Auf dem Ozean der globalisierten Welt
Variation 1Am heimischen Schreibtisch in München: Gott? – Eine Bestandsaufnahme
Wo anfangen, um das komplexe Thema nicht allzu sehr zu vereinfachen? Meine Assoziationen überschlagen sich. Schlagworte wie Individualisierung, Differenzierung, Komplexität, Pluralisierung, Globalisierung, Säkularisierung, Beschleunigung werden mit der heutigen modernen Gesellschaft in Verbindung gebracht. Sie beschreiben die Rahmenbedingungen gegenwärtigen Theologisierens, des Christseins und Kircheseins – zumindest bei uns. Auf die religiöse Frage haben Kirchen und Theologie im westlich-europäischen und zumal deutschen Kontext längst kein Monopol mehr. Nicht selten findet man inzwischen die wenige, noch verbliebene religiös-theologische Fachliteratur im Buchhandel unter der Rubrik „Esoterik“, im besseren Fall bei „Spiritualität“. Seelsorgliche Hilfe und Heil(ung) im weitesten Sinn bietet der boomende Mark psycho-spiritueller Angebote und alternativer Heilweisen: achtsamkeitsbasierte Meditation allüberall.
Der christliche Binnenraum wird beherrscht von Diagnosen des Mangels: Glaubensabbrüche und Werteverlust, zunehmende Kirchenaustritte, weniger Gottesdienstbesucher, Priestermangel und fehlender Ordensnachwuchs… Als Reaktion gibt es strukturelle Maßnahmen: Schließung von Kirchen, Zusammenlegung zu Großpfarreien oder Seelsorgeeinheiten, Inanspruchnahme von Unternehmensberatung, Dialogprozesse und Evangelisierungsprogramme, theologisch-pastorale Forschungsprojekte zu Transformationsprozessen. Es wird problematisiert, analysiert, diskutiert. Man müht sich, man plant – und tut gleichzeitig oft so, als ginge es einfach so weiter wie bisher.
Und wo ist „Gott“? Er kommt vor in altehrwürdigen Texten und Formeln, in einst dicht gefüllten Riten, die oft lebensfremd, floskelhaft-entleert wiederholt und praktiziert werden. Vielleicht hat der Lösungsvorschlag des Soziologen Hartmut Rosa zum Problem der Beschleunigung und Steigerungslogik der Moderne auch Kirche und Theologie etwas zu sagen: Wo gibt es in diesem geschäftigen Treiben Räume der Stille, des wirklichen Schweigens und Hörens, der Resonanz zu Gott? Sind Kirche und Theologie bereit dazu, über den Binnenraum hinaus in „Resonanz“ zu gehen zur „Spiritualität“ von modernen, „säkularen“ Menschen?
Variation 2Im Sameeksha-Ashram von Pater Sebastian Painadath in Kerala, Indien:Gott! – Eine interkulturell-interreligiöse Erzählung
Mit dem Notebook auf dem Schoß sitze ich in der Karwoche am schattigen Flussufer. Vorläufig wird meine Aufmerksamkeit von drei spielenden Buben im Grundschulalter angezogen, die sich hier sichtlich zu Hause fühlen. Sie holen eine reife Papaya vom Baum, öffnen sie gekonnt und teilen sie untereinander auf. Nach dieser Stärkung kommen sie näher und nehmen Kontakt mit mir auf: „Name?“, „Country?“ Die dritte Frage gilt der Religion: „Are you Christian?“ – „Yes, and you?“ – „I’m a Muslim“, lässt mich der Wortführer wissen und deutet auf die beiden anderen: „They are Christians“.
In dieser schlichten Szene verdichten sich meine Erfahrungen der vergangenen Tage in Indien. „Gott“ beziehungsweise Religion ist hier in den verschiedensten Färbungen allgegenwärtig. Ich begegne ihr auf Schritt und Tritt. Schon seit Tagen tönt aus der Ferne indische Musik, denn im nahe gelegenen Bhagavathi-Tempel wird das Tempelfest gefeiert. Allmorgendlich gibt es ein Ritual am Fluss, zu dem das Bild der Göttin auf einem geschmückten Tempelelefanten herbeitransportiert wird, trommelnd und klingelnd begleitet von einer kleinen Prozession. Am Tag der Hauptfeier erlebe ich zusammen mit einer weiteren Deutschen auf beeindruckende Weise, dass wir Fremde auch im Tempel willkommen sind. Der Toleranz und integrativen Kraft des Hinduismus begegnen wir ebenso bei einem Besuch im Ramakrishna-Ashram. Ein junger Mönch versichert uns dort, dass jede Religion ein Weg zur Verwirklichung sein kann. Eine davon reißt mich täglich aus dem Schlaf. Pünktlich um fünf in der Früh ertönt der Ruf des Muezzin, der noch vier weitere Male am Tag zu hören ist. In Bussen und Auto-Rikshas hängen Rosenkränze, Bilder von christlichen Heiligen und hinduistischen Göttern, mit Blumen umkränzt.
Den Palmsonntagsgottesdienst feiere ich in der Pfarrei vor Ort morgens um sechs im syro-malabarischen Ritus mit. Die Prozession scheint angesichts der Menge der vielen (auch jungen!) Menschen kein Ende zu nehmen. In der Kirche sitzen wir so eng gedrängt am Boden, dass es schwierig ist, die Beine irgendwo unterzubringen. Beim Besuch einer indischen Ordensschwester, die gerade auf Heimaturlaub ist, erfahre ich, dass zu ihrer Kongregation fast 7000 Schwestern gehören, davon etwa 800 in der Ausbildung.
Systemisch-psychologisch gesehen mögen diese bunten Impressionen aus Indien zum „Reframing“ unserer kirchlich-religiösen Nöte dienen. Man könnte auch von Horizonterweiterung sprechen. Nein, wir sind nicht der Nabel der Welt. Anderswo sieht es ganz anders aus.
Variation 3Im Hier und Jetzt oder immer und überall: Gott – Eine existentielle Meditation
Gott –
Kein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen.
Kein Wort genügt.
Unbegreiflich, unsagbar, unaussprechlich.
Stimme verschwebenden Schweigens (Martin Buber)
Lebendige Präsenz
Zuhause.
Mit einer Anleihe bei Karl Rahner:
Unendliches Geheimnis,
das alles ist und darum so aussieht, als wäre es nichts,
das keine Wege braucht, weil es schon da ist,
das sich ausspricht, indem es schweigt,
das uns umfängt und durchdringt.
„Grund aller Wirklichkeit,
Meer, zu dem alle Bäche unserer Sehnsucht pilgern,
namenloses Jenseits hinter allem, was uns vertraut ist“.
Schweigender Einklang.
Gott – ein kleines Wort für das große Glück meines Lebens.
Variation 4Am See Gennesaret und darüber hinaus: Gott … – Eine biblisch inspirierte Provokation
„Gleich darauf forderte Jesus die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind …“ (Mt 14,22–24).
Zweitausend Jahre später ist aus dem Fischerboot eine bunte, vielgestaltige Flotte geworden. Ein dazugehöriger stattlicher Dampfer mit dem Namen „Katholische Kirche in Deutschland“ (KKD) kreuzt die Ozeane der globalisierten modernen Welt – wie zahlreiche Paddler, Surfer, Ruderboote, Segelschiffe, Yachten, Frachter und Dampfer anderer (Orts-)Kirchen, verschiedener Religionen und Weltanschauungen auch. Die Wellen und Wogen schlagen hoch, der Gegenwind scheint stärker denn je. Immer mehr Menschen seilen sich ab, schippern per Boot zum Luxuskreuzer „Säkular“ hinüber. An Bord von KKD herrscht emsige Aktivität, wird beraten, geplant, gesteuert. Die Mannschaft müht sich nach Kräften. Fast unbemerkt kommt inmitten der Meere der Welt einer über das Wasser: Der „unbekannte Christus“ (Raimon Panikkar), Ikone des „unbekannten Gottes“ (Paulus). Christen übersehen ihn womöglich, weil sie den bekannten kennen, bisweilen gar zu „haben“ glauben. Manche schreien, weil sie meinen, es sei ein Gespenst. Doch der Chef-Kapitän des römischen Dampfers tritt unerwartet in Aktion: „Weil Du es bist, befiehl, dass ich an die Grenzen gehe und auf dem Wasser zu Dir komme.“ Der unbekannt-bekannte Christus lächelt: „KOMM!“ Da steigt er aus dem Schiff, geht ihm über das Wasser entgegen und ruft uns zu „KOMMT MIT!“ …
Dr. Renate Kern, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Systematische Theologie der Universität Essen.
Albert Gerhards
Der leere Thron
„Gesegnet bist Du auf dem Thron der Herrlichkeit Deines Reiches, der Du thronest auf den Cherubim allezeit, würdig allen Lobes und erhöht in die Äonen.“ So heißt es in der Thronzeremonie der byzantinischen Liturgie nach dem „kleinen Einzug“ mit dem Evangeliar, eine Anleihe aus dem Lobgesang der drei jungen Männer im Buch Daniel (3,53f). In der Rede vom Weltgericht bezieht Jesus die Inthronisation auf sich: „Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen“ (Mt 25,31). Am Ende der Bibel steht die Vision von der neuen Stadt, dem Himmlischen Jerusalem: „Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen“ (Offb 22,3).
Das Mosaik in der Zenokapelle der römischen Kirche Santa Prassede (9. Jh.) stellt einen leeren Thron dar, die „Hetoimasia“ (Etimasie). Nur ein Kreuz ist auf ihm zu erkennen. Er ist bereitet für den wiederkommenden Christus, und die „Apostelfürsten“ Petrus und Paulus stehen ihm zu Diensten. Ein Osterbild ohne den Auferstandenen? Tatsächlich geht es nicht nur am Karfreitag, sondern auch an Ostern um Erfahrungen von Abwesenheit und Verlust: die Gott-Verlassenheit Jesu in der Stunde des Todes (vgl. Mk 15,34; Mt 27,46), die Trauer um seinen Tod und dann das leere Grab: „Man hat meinen Herrn weggenommen“ (Joh 20,13). Dass der Gekreuzigte lebt, fiel den Gefährtinnen und Gefährten Jesu nicht weniger schwer zu glauben als den heutigen Menschen.
Der Thron ist leer. Es gibt archäologische Zeugnisse von unbesitzbaren Thronen, so in spätantiken syrischen Kirchen mit einer thronförmigen Buchablage: Der Thron steht für einen anderen bereit, der nicht vertreten werden kann. Auch ist auf Darstellungen der Hetoimasia ein Buch zu erkennen, und zwar jenes, das vom Fleisch gewordenen Wort handelt, das Buch der Schrift. Der Glaube an die Auferstehung, an das neue Leben, ist von Anfang an durch das Wort weitergegeben worden. Kann man aber dem Wort allein trauen? Im Zeitalter der Lüge scheint dies noch weniger ratsam zu sein als früher. Heute wie damals wollen die Menschen nicht nur hören, sondern auch sehen, fühlen, schmecken. Die Kirche hat im Lauf der Zeit für die Kar- und Ostertage sinnenfreudige Rituale entwickelt, um symbolische Erfahrungen zu vermitteln. Dreimal wird Christus in einem Symbol mit jeweils ansteigendem dreimaligem Ruf begrüßt: mit dem „Ecce lignum crucis“ (Seht das Holz des Kreuzes) bei der Prozession mit dem Kreuz am Karfreitag, dem „Lumen Christi“ (Licht Christi) bei der Prozession mit der Osterkerze zu Beginn der Ostervigil und dem „Alleluja“ bei der Prozession mit dem Evangeliar im anschließenden Wortgottesdienst der Eucharistiefeier. Christus kommt in seine Gemeinde, aber seine Präsenz ist keine physische, sondern eine real-symbolische, die sich am Ende noch einmal sakramental verdichtet: „Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja!“ (Kommuniongesang von Ostern).
Der Thron ist leer. Aber er wartet darauf, in Besitz genommen zu werden durch alle, die auf den Tod Jesu getauft sind, um mit ihm zu leben (vgl. Röm 6,3f) und die so zu Mitgliedern des Volkes von Propheten, Priestern und Königen geworden sind (vgl. Offb 1,6). Dies geschieht immer dann, wenn ein jeder oder eine jede selbst zum Realsymbol wird in der Nachfolge des Gekreuzigt-Auferstandenen: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe“ sagt Jesus nach der Fußwaschung (Joh 13,15). Die Erfüllung des Mandatum, die Verkündigung der Osterbotschaft in Wort und Tat, mit Geist, Seele und Leib, ist Auftrag der Christenheit „bis er kommt“ (1 Kor 11,26). Insofern ist die Zeit „nach Christus“ ein dauernder Advent, eine Hetoimasia im Bewusstsein seiner Abwesenheit, aber in Erwartung seiner Wiederkunft und der begründeten Hoffnung, dass am Ende die Leere gefüllt wird.
Prof. Dr. Albert Gerhards, Liturgiewissenschaftler, Bonn.
Klaus Berger
Den ich lieb wie keinen
Das Mädchen von Piräus sagt nicht: „Ich werde ihn lieben“. Sondern sie singt von der Gegenwart: „Ein Schiff wird kommen, und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht“. Und auch: „… meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen“. Das Mädchen, das am Hafen wartet, steht für uns alle. Wir haben alle nahe am Wasser gebaut. Denn ziemlich nahe unter der klugen, vernünftigen Oberfläche stoßen wir bei allen auf das, was sie unter allen Umständen und um jeden Preis lieben. Wie in einer Vulkanlandschaft ist die Humusschicht nur dünn, so dass wir sehr bald auf heiße, glühende Lava stoßen. Man kann diese Lava Traum nennen oder Sehnsucht. Ich nenne sie die verdeckte, aber doch eben kompromisslose, reine und absolute Liebe. Und es kommt wohl nur darauf an, diese sehr nahe liegende Schicht unter dem richtigen Winkel anzubohren und so gut wie möglich freizulegen. Denn da und in dieser Hinsicht sind wir schon die radikal Verliebten. Wir sind es schon, und nicht: Wir könnten oder wollen es werden. Es gilt jetzt: „Ich bin verliebt in die Liebe“, wie Chris Roberts gesungen hat (1969).
Der heilige Augustinus (354–430), der größte christliche Theologe, hilft uns, die nächsten, jetzt fälligen Sätze zu formulieren. Denn nach einer stürmisch und mit allen Sinnen durchlebten Jugend entdeckt er sein Herz und ist so ehrlich zu sagen, dass es nie zufrieden sein wird. Er hat immer geliebt, und in jeder Liebschaft war ein Stückchen davon, ein Brocken Lava. In der augustinischen Theologie des Herzens bildet sich ab, wie Augustinus allmählich gelernt hat, darüber zu sprechen.
Obwohl Theologe bin ich nicht so unvorsichtig, einfach zu sagen, selbstverständlich sei Gott das Ziel dieser Liebe, von Anfang an und auch jetzt. Wir Theologen fallen den Mitmenschen immer viel zu schnell mit der Tür ins Haus, mit perfekten Lösungen. Und wir wundern uns dann, wenn diese Lösungen als zu aufdringlich und auch als zu kurz geschossen erscheinen. Selbst der heilige Augustinus hat ein halbes Leben für eine ihn selbst zufriedenstellende Antwort gebraucht. Denn das unruhige Herz gilt immer, aber Augustinus kann trotzdem sagen: „Spät habe ich dich geliebt.“ Neu ist hier die eindeutige Ausrichtung auf das „Dich“. Und er erzählt dann nicht irgendwelche frommen Geschichten, sondern spricht von der „ewigen Schönheit“. Denn unser Glaube ist schön.
Und mit unserem Perfektionismus könnte sich der Satz bewahrheiten: Nachchristlich wird der Glaube viel schwieriger, als er vorchristlich war. Aber auch das ist in jeder Liebe ähnlich.
Denken wir uns also mit dem heiligen Augustinus und dem Mädchen aus Piräus etwas wie ein Gespräch zu dritt. Augustinus: Man sollte schon hingehen an den Strand. Ich treffe da oft interessante Leute wie neulich den kleinen Jungen, der sich vergeblich bemühte, das weite Meer in ein Sandloch zu schaufeln. Wie wollen wir da Gott begreifen? – Das Mädchen aus Piräus würde fragen: Und wenn kein Bräutigam kommt? Meine biologische Uhr tickt unaufhaltsam. – Und ich würde ergänzen: In der mittelalterlichen Variante des Motivs vom ankommenden Schiff („Es kommt ein Schiff …“) heißt es: „Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff an Land. Das Wort tut Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt!“ Denn Sehnsucht ist der Stoff, aus dem unsere Seele gemacht ist, aber das Schiff braucht einen Anker. Sonst bleibt alles nur Traum. Maria ist der Landeplatz, an dem das Schiff vor Anker ging.
Aber dann beginnen die Fragen erst. Denn zum Beispiel zum Stichwort „biologische Uhr“ erwarten viele Menschen eine Antwort auf die Frage, was denn nach dem Tod kommt. Denn das ist außer dem vulkanischen Herzen dasjenige, das allen Menschen gemeinsam ist. Ich fand am witzigsten und am schönsten die treuherzige Antwort Martin Luthers: „Wir sollen schlafen, bis er kommt und klopft an das Gräblein und spricht: Doktor Martinus, steh auf! Da werde ich in einem Augenblick auferstehen und werde ihm ewiglich glücklich sein“ (Weimarer Ausgabe 37,151).
Prof. Dr. Klaus Berger, Neutestamentler, Heidelberg.
Klaus P. Fischer
Glauben auf den zweiten Blick
Menschen, die an den biblischen Gott glauben, sind im Urteil vieler so etwas wie Abenteurer, Aussteiger, Hasardeure. Sie setzen in die Lebensrechnung eine unbekannte Größe, ein unbestimmbares X ohne ausweisbaren Nutzwert ein. Sie überlassen das Produkt ihrer Lebensleistung dem Zufall. So genau man zu wissen meint, was der Mensch ist, so wenig weiß man, wer oder was, ja ob sich überhaupt etwas hinter dem Wort „Gott“ verbirgt.
Daran hat schon die Bibel Schuld. Gottes Selbstoffenbarung im Buch Exodus erweist es deutlich: „Ich bin und werde da sein für euch“ (3,14). Dies sei, heißt es verblüffend, Gottes „Name für immer“. Doch was ist Gott? Die alte Weisheit, die „das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen“ will, versagt hier. Auch soll Mose dem Bundesvolk einschärfen, sich kein Bild von Gott zu machen (Ex 20,4). Kein Bild, kein Name. Und keine anderen Götter zum Vergleich!
Gottes Unbekanntheit verstärkt sich noch in jener Szene, in der der Teufel Jesus eine alternative Karriere vor Augen hält, die sicherer sei als der Ruf Gottes, und ihm einen Test vorschlägt. Doch Jesus erklärt, Gott sei nicht zu testen, keinem Experiment zu unterwerfen, ob und wie er „funktioniert“. Die Frohe Botschaft von Gott, wie sie die Bibel seit Mose bereithält, lautet, Er selbst wolle für jene, die Ihm vertrauen, die gute, sichere Zukunft, Treue, Hilfe und Rettung vor todbringenden Mächten sein.
Doch die Menschen der europäischen Neuzeit, von Kolonialismus und Kapitalismus beflügelt, verwandten viel Mühe darauf, den Gott des Glaubens, der sich zusagt, aber unberechenbar bleibt, als menschliche Selbsttäuschung zu entlarven – im „Glauben“, damit etwas zutiefst Unberechenbares loszuwerden. Doch zuinnerst ist der Mensch unbewusst religiös, will er sein Herz an Größeres wenden, als er selber ist. So weiß auch Martin Luther: Das, woran ein Mensch sein Herz hängt, sei eigentlich sein Gott. Den verführerischsten der „anderen Götter“ kennt schon die Bibel. Sie könnten nicht Diener Gottes sein und zugleich Diener des Mammons, erklärt Jesus den Jüngern (Mt 6,24; Lk 16,13). Später entdeckt Karl Marx: Die ökonomische Struktur einer Gesellschaft spiegelt sich in ihren Bewusstseinsformen.
Die offene und kaschierte Herrschaft des Mammons sowie die Gier nach Besitzanhäufung nehmen die Gesellschaft derart in Anspruch, dass ihr der Gott der Bibel verblasst, unwirklich erscheint wie eine Gestalt aus Kinderträumen. Realistischer scheint eine zur Weltanschauung erhobene „wissenschaftliche“ Deutung zu sein, die den Menschen als eine bloß zufällige Mutation in einer langen Evolution des Lebens und des Universums sieht, inklusive seiner Hoffnungen und Untaten. Ob die Menschheit lebt oder sich abschafft, berührt das Weltall nicht, lässt es buchstäblich kalt. Wenn die Natur so „denkt“ und „handelt“, wie man sagt, als sei sie ein „Subjekt“, müssen die Schwachen sich anpassen oder gehen. Eine solche Sicht hat Rückwirkung auf den Menschen: Er sei kein „Abbild Gottes“, kein Träger übernatürlicher Würde. Der Einzelne sei wertlos, jeder sei ersetzbar. Verwirft der moderne Mensch die „Hypothese Gott“, ist er auf sich allein gestellt. Die Zukunft erscheint offen, jedoch leer. Eine leere Zukunft ist aber unheimlich. So suchen viele den persönlichen Halt in der Astrologie als Lebenshilfe, in kosmischen Energien oder in angeblich verschüttetem Wissen der Vorfahren, bei Kelten, Mayas… Andere setzen auf Futurologie und Science-Fiction. Doch am Ende seiner Bemühungen sieht der Mensch nur sich selber in einem matten Spiegelglas: eine diffuse, in Parteien, Lobbygruppen und Kampfverbände zersplitterte, künftige Menschheit.
Der Heidelberger Kinder- und Jugendpsychiater Michael Kaess schlug Alarm: Die unklare Zukunft, unsichere Berufschancen und strenge Auswahl sowie Zeitdruck erzeugten zunehmend bei jungen Leuten krankmachenden Stress: Depressionen, Verweigerungshaltung, Leistungsabfall, aggressiven Trotz. Zukunftsangst breite sich aus, die eigenen Ressourcen könnten nicht reichen, man werde zum Opfer des Fortschritts.
Die Menschen wünschen sich aber, von anderen wahrgenommen zu werden. Der Soziologe Hartmut Rosa spricht von der Sehnsucht nach „Resonanz“. Jeder Mensch tritt mit der Ahnung ins Dasein, auf eine letzte Realität, auf etwas Umgreifendes hin gepolt zu sein, auf etwas, das ihm die entscheidende Resonanz gibt.
Was das bedeutet, lässt eines der „Galgenlieder“ von Christian Morgenstern ahnen:
Ein Hase sitzt auf einer Wiese,
des Glaubens, niemand sähe diese.
Doch, im Besitze eines Zeißes,
betrachtet voll gehaltenen Fleißes
vom vis-à-vis gelegnen Berg
ein Mensch den kleinen Löffelzwerg.
Ihn aber blickt hinwiederum
ein Gott von fern an, mild und stumm.
Der Hase sieht bloß die Wiese. Der Mensch sieht Hase und Wiese. Ein Gott sieht alle drei. Eine dreifache Resonanz – unsichtbar, doch real.
Wirklich ist nicht nur, was man vor sich sieht. Das Leben von Hase und Mensch ist auch hintergründig, selbst ohne deren Wissen. Der letzte und wesentliche Hintergrund ist ein Gott, dessen Auge auf ihnen ruht. Paul Gerhardt hat das so gedichtet: „O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ / und meine Seel’ ein weites Meer / dass ich dich möchte fassen.“
Der Mensch ist abgründiger, als das Tagesbewusstsein denkt und weiß. Auch jene, die im Dienst des vielköpfigen Mammons sich aufreiben und „funktionieren“, erleben die Endlichkeit dieser Welt und ihrer Wertschätzung. Und manche Nachdenklichen entdecken dann doch den Glauben auf den zweiten Blick.
Das Evangelium wird nie überflüssig, nie ausgekostet sein. Es wird weiter die Menschen geben, die von Gott hören wollen, aber die sich wegen des vorlauten Geschreis der Straße ihm nur diskret nähern, wie ehedem Nikodemus, der sich bei Nacht zu Jesus wagte, um seine Botschaft zu erfahren (Joh 3,2). Die Botschaft jenes Gottes, der schon Mose sagte: „Ich bin da! Fürchte dich nicht! Ich werde mit dir sein!“
Dr. Klaus P. Fischer, Priester und Oratorianer, Lehrbeauftragter für Theologie an der Universität Heidelberg.
Dieter Kittlauß
Wie bei einer Wette
Mit den riesigen Teleskopen auf Hawaii wurde am 19. Oktober 2017 eine schwarzrote, um sich selbst rotierende kosmische „Zigarre“ entdeckt, die aus den Weiten der Milchstraße diagonal in unser Sonnensystem eindrang. Sie war ca. 500 Meter lang und 80 Meter breit. Die Schwerkraft der Sonne reichte nicht aus, um ihre Geschwindigkeit von 160 000 Stundenkilometern abzubremsen, sodass der Blaue Planet verschont blieb. Deshalb fliegen wir, die Kinder dieser Erde, weiter in elliptischer Bahn und wahnwitziger Geschwindigkeit um unsere Sonne.
Die Philosophen und Theologen der Generationen vor uns haben erstaunlich präzise Modelle und Theorien des Sternenhimmels erstellt. Wir aber können die Laufbahnen unserer Raketen und Satelliten, die wir zu fernen Himmelskörpern schießen, bereits über Jahre, ja Jahrzehnte hinweg im Voraus programmieren. Wir können sogar weit über den Rand unserer Galaxis Milchstraße hinausschauen und entfernteste kosmische Prozesse im Computer simulieren. Wir durchschauen die wechselseitige Bedingtheit von Raum und Zeit. Aber das gehört auch zu unserer Wirklichkeit: Selbst den unserer Sonne am nächsten Stern Alpha Centauri sehen wir nur so, wie er vor 4,3 Jahren war. Ganz zu schweigen von der Herrlichkeit des Sternenhimmels: Was wir jetzt sehen, sind die Bilder aus der weit zurückliegenden Vergangenheit.
Genauso verborgen ist uns der Blick in die Tiefe der Materie. Je genauer wir deren Strukturen erkennen und analysieren, umso weiter verschiebt sich die Erkennbarkeit, und umso unschärfer wird das, was wir erkennen. Es geht uns wie der Zecke, die sich zwar am Grashalm mühsam hocharbeitet, und doch umso weniger von der Welt um sie herum versteht, je weiter sie klettert. Aber im Unterschied zur Zecke ist für uns Menschen die Deutung unserer Welt und unseres eigenen Lebens in ihr existenziell bedeutsam. Davon zeugen die Religionen und Weltanschauungen von der fernen Vergangenheit bis in die Gegenwart.
Die frühjüdischen Priester im babylonischen Exil erkannten nur, was sie mit ihren biologischen Augen gesehen haben. Aber ihre theologische Deutung vom Ursprung unserer Welt aus einer Mitte ist beeindruckend bis heute. Ihre bildhafte und abstrakt personalisierte Sprache ist genial. Um die Einmaligkeit der Weltentstehung für alle Generationen verbindlich festzulegen, begannen sie ihre Kosmologie, die Schöpfungserzählung, mit dem Wort Bereschit – Im (als) Anfang schuf … –, ohne dass dieses Wort noch einmal wiederholt wurde.
Ob diese Deutung heute noch gilt, ist eine Frage, die sich – vielleicht sogar dringlicher als früher – allen Menschen stellt. Denn weder mit unseren biologischen Augen noch mit unseren Teleskopen und Elektronenmikroskopen finden wir diese Mitte, egal, wie wir sie nennen mögen. Selbst wenn sich auf anderen Sternen oder Galaxien Leben gebildet hätte, das mit uns kommunizieren könnte, wird es nach heutigen Erkenntnissen nie unser Nachbar werden. Die Gottesfrage entscheidet, ob wir allein sind oder „unter dem Schutz seiner Flügel“ stehen. Aber die Deutungen, die eine Antwort ohne Gott suchen und finden, dürfen in ihrer Ernsthaftigkeit nicht grundsätzlich hinterfragt werden, denn auch alle religiösen Sichtweisen bewegen sich in einem Raum des undurchschaubaren Geheimnisses und der existenziellen Unsicherheit. Was uns alle eint, ist die Abwesenheit Gottes in unserer Welterfahrung. Egal, wo wir hingehen oder hinschauen, nirgendwo finden wir diese Mitte, der das Frühjudentum den Namen „Der immer bei uns ist“ gab. Das Psalmwort „Stiege ich zum Himmel empor, so bist du dort, und machte ich die Unterwelt zu meinem Lager, du bist da!“ (139,8), gilt für uns nicht mehr. Das ist die Situation der heutigen Menschen.
Aber da gibt es ein Paradoxon. Viele Menschen – und es sind nicht nur Christen – haben dennoch die tiefe Überzeugung, dass es eine Kraft gibt, die uns alle verbindet und eint. Der deutsche Zen-Meister Willigis Jäger hat dafür das Bild vom Meer „gemalt“, das die Welle ausschickt und wieder zurückholt. Wir sind die Welle, aber nicht das Meer. Die mittelalterliche Scholastik hat das Bild vom Sein gebraucht, das alles verbindet und durchdringt. Viel wichtiger aber ist die Sehnsucht, die uns in unserem oft mehr als beschwerlichen Leben ein Ziel gibt, jenes „Prinzip Hoffnung“ des „Ohne-Gott“-Philosophen Ernst Bloch, das Gerechtigkeit und Vollendung selbst in einer aussichtslosen Extremsituation erahnen lässt. Gott ist nicht da in dieser mal arktisch kalten und mal siedend heißen kosmischen Welt. Er hat sich nicht versteckt in den Tiefen der Erde und auch nicht im Mikrokosmos des Materiellen; und doch gab es und gibt es Milliarden Menschen, die zutiefst davon überzeugt sind, zu einer Mitte zu gehören, aus der sie kommen und zu der sie zurückkehren werden.
In der Neurologie gibt es gewichtige Stimmen, die von einem einheitlichen Bewusstsein sprechen, an dem jeder Mensch partizipiert. Die christliche Theologie hat dafür das uns heute fremde und doch so tiefsinnige Wort „Gnade“ geprägt. Die Bibel gebraucht eine metaphorisch-bildhafte Sprache für dieses Gott-mit-uns-Wissen, so als ob da neben uns einer steht, der uns begleitet, uns stützt und uns hält. Und da gibt es noch eine auf den ersten Blick seltsame Tatsache: Die religiöse Erfahrung wird stärker, wenn wir uns darauf einlassen. Wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht. So drückt es die neutestamentliche Sprache aus.
Gotteserfahrung gibt es nicht, ohne dass sich das Herz öffnet. Wir stehen in einer bis in die weite Vergangenheit zurückreichenden Kette von Menschen, die – jeder auf seine Art – diese religiöse Erfahrung haben, dass das Leben tiefer wird, wenn wir uns für die uns verborgene Mitte unserer Welt öffnen. Wo Euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt die biblische Sprache. „Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch.“ Diese Erfahrung wird uns von Jeremia überliefert (29,13–14). Vor fast 3000 Jahren lebte dieser frühjüdische Prophet. Mit Gott scheint es wie mit der Liebe zu sein, die uns nur geschenkt wird, wenn wir sie vorher geschenkt haben.
Der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal vermutete sogar, dass der Gottesglaube die vernünftigere Lebensvariante sei. Es gebe nur die Alternativen, dass es Gott gibt oder ihn nicht gibt, und dazwischen gebe es keinen Mittelweg. Wie bei einer Wette müsse sich jeder Mensch auf eine dieser Varianten einlassen. Und dann sieht Pascal die Gottesbejahung auf der Gewinnseite. „Denn wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles, wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie also ohne zu zögern darauf, dass es ihn gibt.“ Rein logisch hat Pascal recht. Wer ohne Gott leben will, weil er diesen nicht für eine Wirklichkeit, sondern für ein Phantom hält, wird nicht ohne Weiteres glücklicher und zufriedener, denn er muss mit der oft tödlichen Kälte und Grausamkeit dieser Welt ganz alleine fertig werden – und zwar immer im Angesicht unseres eigenen Endes. Viele religiöse Menschen erleben zwar auch diese Rätsel und das Grausame, aber sie fühlen sich getragen und sogar geliebt.
Zur Zeit des Propheten Jeremia gab es einen solchen religiösen Menschen. Sein Psalmgebet ist uns durch die Jahrtausende erhalten geblieben: „Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast den Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück naht deinem Zelt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen“ (91, 9–13). Pascal hat insofern recht, dass sich jeder Mensch in seinem Leben wie bei einer Wette entscheiden muss, ohne eine Garantie zu haben. Aber richtig ist auch, dass ein Leben mit Gott keinesfalls die schlechtere Variante ist. Die neutestamentliche Tradition spricht deshalb von dem Schatz, den man suchen müsse.
Dieter Kittlauß, Theologe, Autor, Sterbe- und Trauerbegleiter, Bendorf.
Andreas R. Batlogg
Mehr Gott wagen
„Unverbrauchbare Transzendenz Gottes“ – der Begriff erwärmt nicht gerade das Herz. Aber was Karl Rahner damit meinte, worauf er damit hinwies, das ist mir in den letzten Jahren zunehmend wichtig geworden. Es handelt sich bei dem zugrunde liegenden Text nach seiner eigenen Einschätzung um eine Art „Kapuzinerpredigt“, gehalten als Rundfunkvortrag im Rahmen des Salzburger Humanismusgesprächs 1979 („Die unverbrauchbare Transzendenz Gottes und unsere Sorge um die Zukunft“, in „Schriften zur Theologie“ Bd. 14, Zürich 1980). Der 75-jährige Rahner warnte davor, Gott „zum Mittel unserer Zukunftssorge und zum Analgetikum unserer Lebensangst“ zu machen. Man müsse es „vielmehr fertigbringen, die Transzendenz Gottes unverbraucht (wenn man so sagen kann) sein zu lassen.“





























