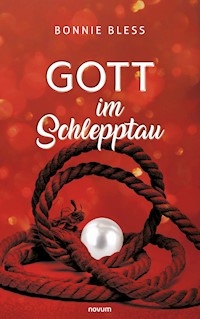
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum premium Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hat alles, was dir widerfährt, einen tieferen Sinn? Kriegst du wirklich nur so viel zu tragen, wie du tragen kannst? Wie viele Schicksalsschläge braucht es, bis ein Mensch daran zerbricht? Mit ihrer berührenden und dennoch verspielten Art, über Tiefschläge des Lebens zu erzählen, nimmt Bonnie dich auf eine Reise mit – zu sich und schlussendlich zu dir selbst. Eine auf Wahrheit basierende Geschichte über sexuellen Missbrauch, Traumaarbeit, Sucht, Hochsensibilität, ADHS mit Autismus-Spektrum und mehr. Eine Bombenmischung, die Bonnie um die Ohren fliegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnnis
Impressum 3
Gott im Schlepptau 4
Wer ist Gott, und wo lebt er? 10
Gott lebt in der Kirche 29
Gott ist eine Erfindung, wie der Nikolaus und das Christkind 44
Gott gibt es wirklich 59
Religion oder universeller Glaube 79
Die Suche nach mir selbst 105
Zu mir stehen 126
Personalisierter Lernweg 180
Kommunikation 270
Teil zwei des Lernweges 293
Mein Schlüsselerlebnis, die Solofahrt im Ballon 311
Frauenreise zum Zweiten 315
Die Ballonprüfung 348
Das wichtigste Kapitel für dich 405
Resümee 408
Danksagungen 415
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-126-4
ISBN e-book: 978-3-99130-127-1
Lektorat: Lucas Drebenstedt
Umschlagfoto: Tomert, Toscawhi, Marusea Turcu | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Gott im Schlepptau
Zu meiner Person:
Ich komme aus dem letzten Jahrhundert, genau genommen aus dem Jahr 1973. An meinem Geburtstag war in unserem Dorf Fasnacht. Dieses Fest war mir eher ein Gräuel als eine Freude. Die Masken und Verkleidungen waren mir lange ein Rätsel. Weshalb gehen Menschen als eine andere Person oder gar als Tier verkleidet zu einem Fest?
Ich wurde von Geschichten geprägt, kaum konnte ich lesen, zog ich mich in mein Zimmer zurück und ließ die Geschichten aus dem Buch lebendig werden. Mein erstes Buch habe ich bestimmt drei Mal hintereinander gelesen. „Fridolin der Dackel“, der sein Halsband verlor, sich auf die Suche danach machte und es wiederfand.
Pippi Langstrumpf war meine Freundin, sie machte mir Mut, ohne Erziehung überleben zu können. Als Kind mochte ich alle Geschichten von Michael Ende. „Die unendliche Geschichte“ ließ mich viele Tränen vergießen. Und Fuchur der weiße Drache wurde zu meinem starken Freund in der Fantasie. „Jim Knopf“ zog mich auf die Insel, und ich ließ mich auf die Fantasiereise ein.
Besonders gefiel mir „Momo“, diesen Film sah ich mir immer wieder an.
Am allerliebsten schaue ich Tierdokumentationen. Die Ordnung in der Tierwelt, und wie sich jede Art ihrer Umgebung anpasst, sich auf sich selber konzentriert und dennoch zum Wohl aller lebt, bewundere ich noch heute.
Beim Menschen wäre das auch möglich. Was vielen im Weg zu einem harmonischen Miteinander steht, ist die Gier nach mehr, nach Macht und danach, Recht zu haben.
Als Jugendliche und junge Erwachsene zog ich mir wohl alle Walt-Disney-Filme rein. Walt Disney, ein Mann mit einer Gabe, Lebensweisheiten in Zeichentrickfilme zu verpacken.
Mein Lieblings-Walt-Disney ist „Die Schöne und das Biest“.
„Das Dschungelbuch“ und „Tarzan“ berührten mich sehr. Kinder, die von Tieren aufgezogen wurden, erinnerten mich an mich selber. Als Erwachsene gefielen mir „Matrix“, „The Sixth Sense“, „The Fifth Element“ und natürlich ein Walt-Disney-Film, „Alles steht Kopf“. Enorm berührt hat mich der Film „Dr. Dolittle“. Für mich sind es nicht bloß schöne Geschichten, sondern Botschaften aus dem Leben, erzählt von weisen Menschen.
Ich halte mich gerne in Wäldern auf oder in den Bergen und an kleinen Seen. Die Bewegung ist ein gutes Werkzeug, um Gefühle in mir zu verarbeiten, sei es auf dem Bike, im Fitnesscenter, mit dem Hund durch den Wald zu rennen oder ganz achtsam und ruhig zu spazieren. Ich mag die Ruhe in der Natur, höre gerne den Klängen des Windes und der Vögel zu. Ich gehe auch drei bis vier Mal im Jahr zu einem Festival, wo es laute Musik gibt, dazu zu tanzen, befreit mich. Musik mag ich, Pop, Rock, Techno und sogar ein wenig Hardstyle. Je nachdem, was gerade passt. Ländler, Jazz und Opern finde ich grauenhaft. Grauenhaft sind auch Horrorfilme, da bin ich einfach zu stark im Mitgefühl. Ich fühle alles, was ich im TV sehe, an meinem Körper. Das Abgrenzen fällt mir schwer. Ich bin gerne alleine und dennoch ein Familienmensch. Tiere sind mir, seit ich mich erinnern kann, treue Begleiter. Und ich vertraue ihnen noch heute, mehr als den Menschen.
Meine Lieblingszahl ist die 2. Und seit ich zwei Jahre alt bin, weiß ich, dass das Jahr 2022 das Jahr des großen Wandels sein wird und ich Menschen das Naturwissen weitergeben darf.
Ich mag Ringelsocken und Kapuzenshirts, damit lebe ich meine Kindlichkeit aus.
Ich begleite drei Kinder durchs Leben. Ich sehe mich bei ihnen als Grenzensetzerin (in Ausbildung), Begleiterin, Beraterin und vor allem als liebende Mutter. Meine Kinder zu beobachten erfüllt mich besonders. Diese Wunder gleich drei Mal zu erleben ist für mich das Höchste. Sie darauf aufmerksam zu machen, worum es in einem für sie aktuellen Thema geht, und zu sehen, wie sie oft meine Ratschläge nach erstem Abwehren annehmen, umsetzen und sich etwas verändert, finde ich die dankbare Seite des Mutterdaseins. Die Launenabtreterin oder die fiese, strenge und nervende Mutter zu sein gehört eben auch dazu.
Ich koche gerne und esse noch lieber, die vielen Geschmäcker sind etwas ganz Besonderes. Ich bin eine Genießerin, ob ein gutes Essen, eine Massage, oder Sonne im Gesicht oder einfach mal faul in der Badewanne rumzuliegen. Ich bin ein „Sumsi mit Po“, was rückwärts Optimismus heißt. Das ist meine stärkste Eigenschaft. Die hält mich am Leben. Und die anderen Tage, an denen vieles schiefzulaufen scheint, kuschle ich mich gerne an eine meiner Katzen. Ihr Schnurren ist ein Seelenbalsam für mich. Oder ich lege mich in den Arm meines Partners Allen, denn nirgends beruhige ich mich so schnell wie bei ihm.
Ich wecke gerne Gefühle in anderen Menschen, dazu reflektiere und provoziere ich sehr gerne.
Ich kann eine Klugscheißerin sein, manchmal bin ich eine Prinzessin, ein Clown, und manchmal verhalte ich mich kindisch oder auch stur. Mit Kritik kann ich noch schlecht umgehen, das lässt mich überheblich oder gar verletzend werden nur um meine innere Unsicherheit zu überspielen. Ich habe akzeptiert, dass ich eben nie alles kontrollieren kann, auch wenn ich das immer noch gerne möchte. Ich bin geduldig mit meinen Mitmenschen und ungeduldig mit mir, denn ich möchte Erkanntes schneller verändert haben. Und ich möchte am liebsten alles perfekt machen. Doch das geht nicht, und das zu akzeptieren, ist eine schwere Sache für mich. Ich weiß von meiner Betriebsblindheit, und bin dennoch häufig beratungsresistent. Ich hebe auch mal ab, am liebsten im Korb des Heißluftballons.
Ich träume gerne, ebenso in der Nacht. Ich liebe es, mit Worten zu jonglieren, und schreibe sehr gerne, da bin ich in meinem Element, da vergesse ich die Zeit. Und da ich lange Geschichten mag, schreibe ich viel, ich bin eine Frau. Dennoch gebe ich mir Mühe, auf den Punkt zu kommen.
Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch.
Weshalb schreibe ich dieses Buch:
In erster Linie schreibe ich dieses Buch für mich. Als Martin Fürst in einem Kommunikationsseminar den Spruch mit dem Projektor an die Wand projizierte:
„Manchmal muss man sprechen, um zu verstehen, was man denkt.“
dachte ich mir:
„Ich sollte mir mal alles aufschreiben, um zu verstehen, wie ich funktioniere.“
Wie oben erwähnt faszinierte mich der Film „Momo“ enorm. Und wenn ich mich heute so umschaue, vor allem im TV und in den Zeitschriften, denke ich, sind wir da angekommen, was der Film erzählt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Bücher mit dem Titel „Generation Beziehungsunfähig“ geschrieben werden, wo Menschen arbeiten, um Dinge zu kaufen, die sie häufig gar nicht benötigen, nur um andere Menschen zu beeindrucken, denen sie oft sogar egal sind.
Schmerzen werden betäubt, Symptome bekämpft. Unreinheiten im Gesicht werden weggeschminkt, Falten weggespritzt, und wenn alles nichts mehr hilft, gibt es die Schönheitschirurgie. In den Zeitschriften wird mit perfekt geschminkten und „gephotoshopten“ Modellen suggeriert, wie wichtig ewig jugendliches, frisches, perfektes Aussehen ist. Ein Mann mit grauen Haaren nennt die Welt sexy, eine Frau mit grauen Haaren wird als alt und verbraucht gesehen.
Es sind heute nicht rauchende, graue Männer wie im Film „Momo“, sondern mimiklose Stars, die unsere Zeit stehlen wollen. Wie viel Zeit wir Menschen geben, um unseren inneren Durst nach mehr, besser, schneller, schöner zu stillen, ist enorm gestiegen. Und wozu das alles? Um Anerkennung von außen zu erhalten? Macht das langfristig zufrieden?
Ich war lange der Meinung, dass mich solche Werbung oder Bilder überhaupt nicht beeinflussen. Bis ich mich eines Morgens vor dem Spiegel fragte, ob ich wohl meine Zornesfalte mit Botox behandeln lassen sollte. In meinem Buch geht es nicht um Oberflächlichkeit, ich gehe tiefer, viel tiefer. Unser Unterbewusstsein hat mehr Einfluss auf uns, als uns bewusst ist. Eine Psychologin meinte einmal, dass das Unterbewusstsein ein Dreiviertel unserer Handlungen beeinflusst und dies ohne, dass wir es bemerken. So viel zum freien Willen.
Mein bildlicher Vergleich dazu:
Die Spitze des Eisberges, welche aus dem Wasser schaut, entspricht etwa dem Teil, der uns bewusst ist. Unter dem Wasser ist er aber der größere und vor allem tragende und wirkende Teil.
Ich schreibe dieses Buch, weil ich erfahren will, weshalb ich als Erwachsene so geworden bin, wie ich als Kind niemals werden wollte. Eine Erwachsene, welche mehr in der Vergangenheit oder Zukunft lebt als im Moment, die Ja sagt, obwohl sie Nein sagen will, eine Frau, die lächelt, obwohl sie traurig, schockiert oder verunsichert ist. Die schlecht zuhört und lieber lange spricht, als etwas zu tun. Ich wollte mich bewusst mit meinen Lebensthemen, Mustern und meinen Bewältigungsstrategien auseinandersetzen. Ich wollte erkennen, wie ich kompensiere, wenn mir Gefühle oder Erlebnisse zu unangenehm werden. Das Schreiben half mir wirklich dabei, und ich begann die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Ich habe sehr viel geschrieben und damit alte Geschichten aus der vergessenen Schublade heraufgeholt, habe die daraus entstandenen Gefühle verarbeitet. Ich habe mein Geschriebenes nochmal gelesen. Danach kam die schwierigste Aufgabe, zu kürzen, eben auf den Punkt zu kommen. Ich will ein Buch schreiben und kein Drehbuch für eine Serie.
In diesem Buch geht es darum, wie es ist, sich von Fremdbeeinflussung zu befreien und das angehäufte Wissen über sich und seine Strategien im richtigen Moment auch abrufen und in seinen Alltag einbringen zu können. Wie ich mich aus der Opferhaltung durch die Prägung des Umfeldes und meinen bisherigen Erfahrungen befreite und mich zum Schöpfer meines Lebens entwickelte. Mit viel Witz und Lebensweisheiten erzähle ich euch zum Teil sehr persönliche und auch schmerzhafte Geschichten. Es sind Anregungen dazu, dass egal was dir geschehen ist, du es zugelassen hast, es immer den Moment der Wende gibt – und das beginnt mit der Selbstverantwortung. Es lohnt sich, die authentische Reise zu dir.
Da ich dieses Buch in erster Linie für mich schreibe, schreibe ich im Du, denn ich sage nun mal „du“ und nicht „Sie“ zu mir.
Alles, was du hier liest, beruht auf meinen Erfahrungen und ist meine persönliche Meinung.
Also lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage, aber achte auf die Gefühle, die sich melden, wenn du dieses Buch liest.
Es ist mir auch wichtig mitzuteilen, dass ich nichts Neues schreiben kann, aber ich kann Vergessenes oder Verdrängtes wieder in Erinnerung bringen.
Ich mag Sprichwörter und Lebensweisheiten. Denn in solchen Sätzen verbirgt sich eine große Kraft. Und vor allem bringt ein Sprichwort Lebensgeschichten mit wenigen Worten auf den Punkt. Und das fasziniert mich als Frau besonders. Hier meine erste eigene auf mein Leben selbst geformte Lebensweisheit:
„Ich war ein Opfer meiner Vergangenheit, heute bin ich Schmied meiner Zukunft.“
Bonnie Bless
Wer ist Gott, und wo lebt er?
Als Kleinkind war für mich die Welt in Ordnung. Ich lebte mit meiner Mutter alleine in einem Zweifamilienhaus in einem ländlichen Kleinort namens Herzogenbuchsee. Ich war ein lebensfrohes Kind, mit einem ungekämmten hellblonden Lockenkopf, ähnlich wie Momo, und hatte große strahlende blaue Augen. Meine linke Wange zierte ein rotes Muttermal, das wie ein Klecks von der Erdbeermarmelade des zu schnell verzehrten Frühstücksbrotes aussah. Was absolut zu mir passte, denn meine Mutter nannte mich öfters Schmutzfink. Ich hatte oft schmutzige Finger, weil ich mich tagsüber nur draußen aufhielt und gerne in der Natur war.
Ich hatte viele Fragen übers Leben, welche mir meine Mutter jedoch kaum beantwortete. Ich dachte, sie sei einfach dumm. Mein Vater lebte in einem anderen Haus, da er meine Mutter nicht mehr liebte. Ich hatte einen besten Freund, Redli. Einer, der auf alles eine Antwort wusste und wirklich immer recht hatte.
Wir trafen uns meistens draußen, manchmal besuchte er mich auch zu Hause. Wir spielten mit den Bauklötzen, bemalten die Straßen mit bunten Kreidebildern, beobachteten die Bäuerin, welche über den schmalen Weg links neben unserem Häuschen wohnte. Diese Bäuerin nahm sich manchmal Zeit für mich, hörte mir und meinen Erlebnissen mit Redli zu und lachte herzhaft darüber.
Manchmal spielten Redli und ich mit den Kindern der großen Familie, welche die Straße entlang in einem riesengroßen Haus lebten, das neben dem Wohn- und Schlafzimmer auch Schulzimmer hatte. Von ihrem großen Spielplatz sah man direkt auf den eingezäunten Wiesenplatz des Freibades, wo mein Vater das Restaurant führte.
Jedenfalls fühlte ich mich bei diesen Kindern wohl. Sie lachten, wenn sie fröhlich waren, und nie über mich, sie schrien, wenn sie wütend waren, und sie weinten, wenn sie traurig waren. Sie waren echt, so wie sie Redli nannte. Doch meine Mutter mochte diese Kinder nicht, denn als sie mich mit ihnen spielen sah, verbot sie mir nochmal dorthin zu gehen. Als ich wissen wollte, weshalb sie mir es verbot, erklärte sie mir:
„Die sind nicht gut für dich. Die haben nicht alle Tassen im Schrank.“
Und ich fragte mit meinen 2,5 Jahren nach:
„Warst du bei denen zu Hause, dass du das weißt?“
Ich konnte mit zwei Jahren sehr gut sprechen, zum Erstaunen vieler Menschen, bis auf den Buchstaben F, den ersetzte ich mit dem S.
Ich erhielt wie so oft die Antwort:
„Ach du wieder.“ Und sie erklärte mir: „Die sind behindert.“
Ich schloss für mich damit ab, die Familie behindert, hat nicht alle Tassen in den Schrank geräumt und haben somit eine Unordnung, so wie ich im Zimmer. Mochte mich meine Mutter deswegen nicht, weil ich unordentlich war?
Meine Mutter stand in der Küche unseres wirklich sehr ordentlich gehaltenen Haushaltes und trank ihren Kaffee wie immer, bevor sie das Abendbrot auf den Tisch legte, daher ging ich in mein Zimmer und setzte mich zu Redli und den bunten Bauklötzen. Im TV hatte ich zuvor eine Sendung gesehen, wo sie Farben gemischt hatten. Aus Gelb und Blau war Grün geworden. So nahm ich einen blauen und gelben Bauklotz und stellte den blauen auf den gelben. Doch es entstand kein Grün.
„Weshalb funktioniert das bei mir nicht?“, wollte ich von Redli wissen.
„Weil sie zu fest sind.“
„Was bedeutet sest?“
„Sie sind hart. Wenn du dir so einen Bauklotz auf den Kopf schlägst, schmerzt es dich.“
Ich testete es natürlich sogleich und oha, das schmerzte wirklich sehr, so sehr, dass ich weinen musste. Meine Mutter blickte in mein Zimmer und fragte, was geschehen sei. Ich erklärte ihr, dass ich mir den Bauklotz auf den Kopf geschlagen hatte.
„Weshalb machst du den sowas?“
„Redli hat mir erklärt, dass ein Bauklotz hart ist, und ich wollte wissen, ob das stimmt.“
„Ach du wieder. Geh noch etwas raus, aber bleib hier vor dem Haus.“ Befahl sie mir mit müden Worten. Sie fügte noch hinzu:
„Warte kurz, ich habe noch etwas von deiner Patentante für dich mitgekriegt.“ Als sie wieder vor mir stand, hielt sie ein Geheimnis hinter ihrem Rücken fest.
Ich freute mich enorm, als sie mir die kleine Schachtel mit Straßenkreide vor mein Gesicht hielt. Ich packte sie mir, eilte aus dem Haus und setzte mich auf die Straße. Es war eine kaum befahrene Straße, sie führte nur zum Haus der „Familie behindert“. Zu meiner Kindheitszeit durften Kinder noch bedenkenlos auf Straßen ihre farbigen Kunstwerke bis zum nächsten Regen verewigen.
Redli saß neben mir und schaute mir zu. Ich entdeckte blaue und gelbe Kreide. So konnte ich mein Experiment weiterführen. Ich hielt die gelbe und die blaue Kreide aneinander und wieder wurde es nicht grün. Enttäuscht blickte ich zu Redli, welcher mich anlächelte und aufbot einen Kreis zu malen.
Ich nahm zuerst Gelb und malte einen Kreis, was eher einem Ei glich. Während ich malte, begriff ich, dass die harte Kreide auf der Straße in viele kleine Teile zerbrach und dadurch weich wurde. Danach griff ich voller Aufregung zur blauen Kreide und begann über das Gelb zu malen. Und es wurde wirklich grün. Ich war begeistert und blickte dieses Wunder lange an. Ich stellte fest, dass wenn ich viel Blau auf wenig Gelb malte, es ein anderes Grün gab, als wenn ich wenig Blau auf Gelb malte. Am besten gefiel es mir, wenn ich zuerst Blau malte und dann mit Gelb darüberfuhr. Ich experimentierte so lange, bis meine Mutter mich rief. Ich wollte ihr unbedingt meine Erkenntnis zeigen. Doch wie meistens hatte sie für mich bloß einen müden Blick und die mir so bekannten Worte „ach du wieder“ übrig.
Ich erlebte viele spannende Abenteuer mit Redli. Wir erkundeten zusammen das ganze Dorf.
Wenn ich meiner Mutter erzählte, was ich während ihrer Abwesenheit mit Redli erlebte, hörte sie mir kaum zu. Bis ich einmal zusammen mit Redli bei der Schulhaustreppe auf dem kleinen Steg, wo die Velos rauf- und runterfuhren, stürzte und mir Redli beim Aufstellen des Dreirades nicht helfen wollte. Ich versuchte mit aller Kraft mein Dreirad aufzustellen, doch ein Rad blieb an der untersten Stufe hängen, und nach vorne konnte ich es auch nicht ziehen, da es einfach zu schwer war.
Ich zog und schob, doch nichts half. Redli machte mich darauf aufmerksam, dass es bald dunkel werde. Er meinte:
„Komm, wir holen deine Mutter.“
„Nein, ich will mein Dreirad nicht alleine lassen.“
„Dann warte ich hier auf dich, bist du wiederkommst.“
Ich rannte die etwa einen Kilometer lange Strecke nach Hause und weinte. Umso dunkler es wurde, umso ängstlicher wurde ich. (Kurze Information. Ich hatte bis zu meinem Alter von 42 Jahren Angst im Dunkeln. Erst jetzt, als ich diesen Teil schrieb, verstand ich, wo diese Angst entstanden war. Ich habe sie aufgearbeitet, wie, erzähle ich erst später.)
Nirgends war ein Mensch draußen, ich fühlte mich alleine. Dumm von mir, Redli beim Dreirad zu lassen. Meine kurzen Beine brauchten eine Ewigkeit für den Heimweg. Zu Hause angekommen sah meine Mutter sehr verärgert aus, bis sie meine Tränen sah. Ich erklärte ihr, dass mein Dreirad liegen geblieben sei.
„Bist du sicher, dass es in diese Richtung geht? Die Nachbarin hat dich in die andere Richtung fahren sehen.“
Ich war mir sicher, obwohl ich auch wusste, dass ich zuvor mit Redli den anderen Weg gefahren war. Doch dieser Weg war der richtige.
„Es ist dort, wo die großen Kinder in die Schule gehen.“
„Das ist doch viel zu weit weg.“ Doch ihr blieb nichts anderes übrig, als ihrer kleinen 2,5-jährigen Tochter, die sie willensstark an der Hand zog, zu folgen.
Als wir beim Dreirad ankamen, war es bereits ganz dunkel, das Dreirad war da, Redli war weg.
„Redli wollte auf mein Dreirad aufpassen, während ich dich hole.“
„Hör auf zu lügen und von diesem Redli zu sprechen, den gibt es gar nicht, du warst alleine unterwegs, die Nachbarin hat dich gesehen.“
Ich fragte mich, weshalb meine Nachbarin meine Mutter angelogen hatte. War das vielleicht auch ein Kind, mit dem ich nicht spielen sollte, so wie die Kinder der „Familie behindert“?
Meine Mutter schimpfte noch sehr lange und zu Hause kriegten wir wieder Besuch. Also meine Mutter, denn ich musste ins Bett. Ich hatte einen schlimmen Alptraum, einen, den ich immer wieder mal träumte. Ein Monster kam in mein Zimmer und bot mir einen großen Lutscher an, er schmeckte widerlich und war einfach zu groß, um in ihn den Mund zu stecken, ich musste beinahe erbrechen.
Am nächsten Tag war meine Mutter krank. Sie lag im Bett und bat mich den Fiebermesser aus dem Bad zu bringen. Er fiel mir im Flur auf den Boden und zerbrach. Es kullerten ein paar silberne Tropfen auf den Boden, welche ich wieder in den Fiebermesser stecken wollte. Als ich sie mit den Fingerspitzen ganz vorsichtig berührte, staunte ich darüber, wie weich sie waren. Ich versuchte einen Tropfen aufzuheben, doch aus einem Tropfen wurden dann drei. Es war ähnlich wie mit der großen Kreide, wenn etwas Großes zerbricht, gibt es viele kleine Teile. Ich saß da und blickte fasziniert darauf. Bis ich von der Stimme meiner Mutter genervt aus meiner Faszination gezerrt wurde.
„Mama, komm und schau einmal.“ Rief ich sie freudig zu mir. Als sie im Flur stand, freute sie sich aber nicht. Nein, sie schrie mich sogar an:
„Lass deine Finger davon, das ist gefährlich. Immer muss ich alles alleine machen, geh in dein Zimmer und bleib darin, ich will dich nicht mehr sehen.“
Das war zu viel für mich. Ich ging ins Zimmer und zog mich an. Ich hörte meine Mutter telefonieren. Sie sprach mit meiner Großmutter und schimpfte über mich, wie so oft. Ich hörte, wie sie sagte, dass sie einfach nicht mehr kann, dass ich ihr zu anstrengend sei.
Ich schlich mich aus dem Haus und lief weg. Ich landete in der Natur beim Gedenkstein an Ulrich Dürrenmatt. Zwischen zwei großen Kastanienbäumen setzte ich mich auf die rote Bank, schloss meine Augen und begann zu weinen. Ich fühlte zu viel, und zum ersten Mal in meinem kurzen Leben wollte ich wieder dorthin zurück, wo ich zuvor gewesen war. Nur wie kam ich dorthin?
Ich hörte einen Vogel zwitschern:
„Es wird alles wieder gut.“
Ich öffnete meine Augen und blickte direkt in Redlis Augen. Er hatte ein freches Grinsen, seine roten Haare waren vom Wind zerzaust und sein Gesicht war mit Sommersprossen übersäht. Ich konnte wieder lächeln.
„Redli, ich will zurück. Kommst du mit mir ins Spital, dort wo ich aus die Welt gekommen bin?“
„Das ist noch zu früh, du wirst noch viele Geburtstage feiern, bevor du zurückgehst.“
„Dann brauche ich eine neue Mutter, am besten eine, die einen Mann hat. Komm, wir suchen eine neue Mama für mich.“
Redli begleitete mich ohne zu sprechen, und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ich spazierte in einem großen Quartier umher und beobachtete die Häuser und die Gärten. Ich sah eine Katze, die mir zurief:„Komm mir nach.“
Ich gehorchte ihr. Die Katze setzte sich vor eine Haustüre, und ich klingelte.
Eine wunderschöne Frau öffnete mir die Türe, sie sah sehr ähnlich aus wie meine Großmutter.
„Hallo, willst du meine Mama sein?“, fragte ich sie.
Die Frau, welche sich die Hände an ihrem blau-weiß gestreiften Küchenschurz trocknete, fand ihre Sprache nicht. Sie blickte mich mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen etwas irritiert an. Sie hatte wunderschöne blau leuchtende Augen, und ich mochte sie auf Anhieb. Daher spazierte ich an ihr vorbei in die Küche und setzte mich neben die Katze auf den Boden.
Die hübsche Frau kam in die Küche und fragte, woher ich komme und wo meine Mutter sei.
„Ich bin meiner Mutter zu siel, sie mag mich nicht, weil ich eine Unordnung im Zimmer habe und meine schmutzigen Singernägel nicht selber reinigen kann.“ Die Frau korrigierte meine fehlenden Buchstaben F nicht, sie verstand mich.
Ich kraulte ihre Katze, welche sich sogleich auf den Rücken legte.
„Bauch streicheln?“,fragte ich die Katze. Die Katze zeigte mir anhand innerer Bilder eine Stelle, wo sie es gar nicht gerne mochte, wenn sie dort berührt wurde. Dort war einmal ihr Bauch geöffnet und wieder zugenäht worden, und diese Stelle zwickte, wenn man sie dort berührte.
Ich begann ihren Bauch zu streicheln und die Katze schnurrte.
„Das ist aber seltsam, niemand, nicht einmal mein Mann, darf die Katze am Bauch anfassen.“
Ich erklärte ihr, woran das lag. Ich freute mich, ich hatte meine neue Mutter gefunden, und sie hatte sogar einen Mann.
Kurze Zeit danach kam ihr Mann nach Hause. Sie bat mich in der Küche zu bleiben und zog die Türe hinter sich zu. Ich hörte sie sprechen. Die Küchentüre ging auf und ein grauhaariger, sympathischer, schlanker Mann, der absolut glattrasiert war, blickte verwundert zur Tür hinein.
„Du bist also das Mädchen, das unsere Katze am Bauch streicheln kann.“ Sprach er mich über seine Brille blickend an.
„Ja, soll ich dir zeigen, wie du es auch darfst?“
„Gerne.“ Er setzte sich zu mir auf den Boden, das kannte ich bisher nur von Kindern. Er schien wirklich Zeit zu haben und vor allem Interesse.
So zeigte ich ihm die Stelle, die die Katzendame zwickte, wenn sie dort berührt wurde. Meine neue Mama begann Brot zu schneiden und legte kaltes Fleisch, Käse und Essiggurken auf den Tisch.
Sie fragte mich, ob ich eine warme oder kalte Schokolade will.
Ich antwortete erstaunt:
„Gibt es das auch warm?“
Der Mann stand auf und meinte zu mir:
„Ich komme gleich wieder, ich muss kurz jemanden anrufen.“
Wir aßen zusammen Brot und viel kaltes Fleisch und Essiggurken. Dazu trank ich meine erste warme Schokoladenmilch. Es war ein Fest in meinem Mund. Und ich erhielt noch eine zweite.
Es klingelte an der Haustüre, der Mann stand auf und ich hörte meine Großeltern an der Türe.
„Wo ist sie?“, fragte meine Großmutter.
„Sie ist in der Küche.“
Und schon stand sie da, sie wirkte aufgeregt und erfreut zugleich und irgendwie auch wütend.
„Was machst du denn hier, Bonnie?“
„Ich habe mir eine neue Mutter gesucht. Und was machst du hier?“
Nicht meine Großmutter antwortete mir, sondern der Mann.
„Ich war mir ziemlich sicher, dass du ein Bless-Kind sein musst. Ihr seht alle ähnlich aus, deswegen habe ich Heinz, deinen Großvater angerufen, wir kennen uns vom Feldschießen.“
Als meine Großeltern gehen wollten, verabschiedete ich mich von ihnen.
„Nein, du kommst mit uns“, erklärte mir meine Großmutter, die ich bis heute Mutti nenne.
„Ich will aber nicht mehr zurück zu Mami.“
„Du kommst mit zu uns nach Hause. Deine Mami braucht etwas Zeit für sich.“
Ich war für Tage bei meinen Großeltern. Die Schwester von meiner Großmutter war meine Patentante, und sie kümmerte sich ab diesem Ereignis zusammen mit meiner Großmutter mehr um mich.
Denn da mich meine Mutter kaum verheiratet geboren hatte, sie nun schon wieder geschieden war und sie, weil sie keinen Mann zu Hause hatte, viel arbeiten musste, brauchte ich jemanden, der sich tagsüber um mich kümmerte, denn es konnte ja nicht sein, dass ein Kind so viel Zeit alleine verbringen muss. Das wurde mir von meiner witzigen und liebevollen Patentante erklärt.
Und bei meiner Patentante erfuhr ich zum ersten Mal etwas von Gott. Denn bei ihr gab es ein Abendritual. Sie sang mir das Lied „Ig ghöre es Glöggli“, was so viel bedeutet wie „ich höre eine Glocke“. Dieses Lied singen wir in unserem Schweizerdialekt, was ich gerne übersetze:
„Ich höre eine Glocke, die läutet so nett, der Tag ist vergangen, nun geh ich ins Bett, im Bett tu ich beten und schlafe dann ein, der liebe Gott im Himmel wird auch bei mir sein.“
Somit war für mich als kleines Kind eines klar, Gott wohnt im Himmel. Und mein „Gotti“, wie wir die Patentante in der Schweiz nannten, war ja sicherlich mit dem lieben Gott verwandt. Denn sie hieß fast gleich, und sie war auch lieb.
Gott faszinierte mich, ich wollte wissen, was er den ganzen Tag dort oben im Himmel machte.
Wenn es im Sommer donnerte, bekam ich Angst. Um mich zu beruhigen, meinte meine Patentante, dass dem lieben Gott im Himmel der Stuhl umgefallen sei. Dann wurde ich ruhig.
Wenn es regnete, goss der liebe Gott seine Blumen. Und auf meine Frage, wer Gott sei, erhielt ich von meiner Patentante die Antwort: „Gott ist derjenige, der die ganze Welt, mit allen Pflanzen, Tieren und Menschen gemacht hat.“
„Dann hat er auch mich gemacht?“
„Ja und Nein. Gott hatte zwei Menschen geschaffen, Adam und Eva, daraus sind dann alle weiteren Menschen entstanden, denn Adam und Eva haben Kinder gekriegt und die haben auch wieder Kinder gekriegt. Ich glaube, dass Gott aber Ja sagt zu jedem Menschen, bevor er von einer Frau und einem Mann gemacht wird.“
„Wie machen Menschen Kinder?“
Und ich erfuhr, dass ein Mann anders ausgestattet war als eine Frau. Und dass es beide braucht, um ein Kind zu zeugen. Ich wollte es genauer wissen, aber meine Patentante vertröstete mich auf ein anderes Mal. Ich begann genauer hinzuschauen und sah, dass Männer fester sind und Frauen weicher. Frauen hatten den Kopf voller als Männer. Sie waren im Innern in vielen Punkten sehr verschieden.
Im Alter von drei Jahren stand ich wieder einmal bei meiner Patentante vor dem Spiegel, um meine frisch gewaschenen Haare zu kämmen. Sie war die Einzige, die mir die Haare waschen konnte. Sie legte mir einen Waschlappen auf die Augen und spülte das Wasser über den Hinterkopf, um die Haare vom Shampoo zu befreien. Meine blonden Locken wurden durch das Waschen zerzaust und es war eine schwere Arbeit, wieder etwas Ordnung auf meinem Kopf zu schaffen. Als ich nach gefühlten Stunden endlich damit fertig war, schaute ich mir das Ergebnis an. Auf einmal blickte ich mir tief in die Augen und weiter hinein direkt in meine eigene Seele und was ich da sah, berührte mich enorm. Ich sah irgendwie Gott, da war ich mir damals sicher. Viele Fragen stiegen in mir hoch: „Weshalb bin ich hier? Weshalb sehe ich so aus, wie ich aussehe? Würde ich die gleiche sein, wenn ich andere Eltern hätte? Weshalb hören die Erwachsenen nicht, wie die Tiere mit ihnen sprechen?“ Wozu sind wir Menschen überhaupt hier? Wie hat Gott den Menschen, die Tiere und Pflanzen gemacht? Ich sah, wie wir Menschen auf die Erde kamen, ausgestattet mit einem großen Farbkasten, und wie die meisten vergessen hatten, wie viele verschiedene Farben jeder von ihnen hat, und dass es eine meiner Aufgaben ist, den Menschen zu helfen, wiederzuerkennen, dass sie ihr Leben mit all den verschiedenen Farben selber malen dürfen.
Ich wollte Antworten auf alle meine Fragen und so eilte ich zu meiner Patentante und stellte natürlich alle Fragen in einem Sprechtempo, welches von der Neugier eines Kindes zeugt.
„Weißt du Bonnie, das sind philosophische Fragen, und darauf gibt es keine klaren Antworten, nur verschiedene Theorien. Es gibt die wissenschaftlichen und die religiösen, und da gibt es auch wieder verschiedene.“
Sie erzählte mir ein paar Ansichten, mögliche Antworten aus der Sicht des katholischen Glaubens. Ich hörte zum ersten Mal, dass es verschiedene Formen von Glauben gab.
Ich fragte auch die Mutter meines Vaters, für sie war es klar.
„Du bist auf der Erde, weil dich deine Eltern gezeugt haben. Und nein, du würdest nicht du sein, wenn du andere Eltern hättest.“
Mein Vater antwortete mir:
„Was du für Fragen stellst. Also, ich glaube daran, dass vor dem Leben und nach dem Tod nichts ist.“
Mein Großvater antwortete mit einem Lächeln.
Umso mehr Menschen ich meine Fragen stellte, umso verunsicherter wurde ich.
Die Frage „Weshalb sind wir hier?“ war doch eine Frage. Wie konnte es denn sein, dass ich so viele verschiedene Antworten erhielt, wie ich Menschen fragte? Ich bekam zu hören: „Das Leben hier macht keinen Sinn.“ – „Das ist alles lauter Zufall.“ – „Das ist Evolution, wir stammen vom Affen ab“ – „Gott hat uns geschaffen, und jedes Wesen hat eine Aufgabe zu erfüllen.“
Es gab eine Frage, welche mich sehr beschäftigte.
„Wo war ich, bevor ich hier in diesen kleinen Körper gekommen bin?“
Jede Antwort, die ich erhielt, stellte mich nicht zufrieden. Es war mir klar, dass ich weder hinter dem Mond am Erbsenlesen gewesen war, noch dass ich auf dem Mond mit dem Sand gespielt hatte.
Der einzige, der meine Fragen für mich zufriedenstellend beantwortete, war Redli.
Zusammen saßen wir im Wald und ich ließ mir die Entstehungsgeschichte zeigen. Was ich davon noch weiß, ist ein Bruchteil dessen, was er mir damals zeigte. Aber eines war mir als Kind völlig klar, die Natur zeigt uns alles, wie es ist.
In der Natur finden wir alles, was wir brauchen, jede Krankheit kann mit natürlichen Mitteln geheilt werden. Außer der Mensch wartet so lange, bis die Krankheit stark fortgeschritten ist. Beinahe jede Erfindung hat ihren Ursprung in der Natur. Der Mensch kopiert vieles, vielleicht einfach, um wieder Geld damit zu verdienen.
Sogar der Klettverschluss ist eine Kopie von den kleinen Kügelchen der Pflanze Articum lappa, die so schwer aus den Hunde- und Katzenhaaren zu entfernen sind. Der Erfinder war ein Schweizer. Die Schallimpulse der Delfine oder Fledermäuse wurden kopiert und für die Seefahrt gebraucht. Saugnäpfe wurden schlicht und einfach von den Tintenfischen kopiert. Wobei ich der Meinung bin, dass alles, was in der Natur zu finden ist, schlicht und einfach origineller und ausgereifter ist. Der Mensch kopiert sehr vieles, aber nicht nur aus der Natur, ein Kind kopiert die größeren Kinder und die Erwachsenen, es sind eben ihre Vorbilder. Und meine Vorbilder waren häufig unbewusste Menschen wie meine Mutter.
Ich wurde bald sechs Jahre alt und ich zog mit meiner Mutter in den Park. Im Haus lebte eine alte Frau, welche nur einer Brust hatte. Die andere hatte sie verloren, weil Gott ihre Sünden so strafe, hatte die alte Frau, welche ein Gesicht mit vielen tiefen Furchen hatte, mir im Treppenhaus erzählt.
„Gott bestraft einen?“, wollte ich von meiner Mutter wissen.
„Gott bestraft uns, wenn wir sündigen, so steht es in der Bibel.“
„Und weshalb hat die alte Frau nur noch eine Brust?“
„Weil sie Krebs hatte.“
Ich stellte mir das schrecklich vor, lauter kleine Krebse, die ihre Brust abgefressen hatten.
So war das damals, ich wurde schlecht beraten oder schlichtweg überhört.
Vor unserem Wohnblock gab es einen großen Spielplatz.
Das fand ich richtig toll. Einen sehr großen Sandkasten und einen Baum, dem ich meine Gedanken erzählen konnte, wenn Redli nicht da war. Meine Mutter mochte ja Redli überhaupt nicht, und so sprach ich nicht mehr über ihn. Er kam auch nie mit zu meiner Patentante. Als ich ihn einmal fragte, woran das liegt, meinte er:
„Wozu, du hast dort ja deine Patentante.“
Meine Patentante hörte mir immer zu, wenn ich von Redli erzählte. Sie meinte auch einmal:
„Nimm ihn ruhig einmal mit, ich würde ihn gerne kennen lernen.“
Ich stellte fest, dass Redli kam, ohne Hallo zu sagen, und ging, ohne sich zu verabschieden. Er war mein Freund, aber er war irgendwie auch seltsam. So seltsam wie ich, jedenfalls nannten uns die anderen Kinder auf dem Spielplatz so.
Ich mochte es nicht, mit den Kindern zu spielen, ich fand sie doof und auch irgendwie dumm. Sie wussten kaum etwas übers Leben, und sie fanden meine vielen Fragen und Erklärungen seltsam.
Nach dem Winter war es soweit, ich kam in den Kindergarten. Somit lernte ich Regula, ein Mädchen, kennen, das in den Kindergarten gleich nebenan ging. Sie war eine Schlaue, sie kannte Gott und sie wusste, was der einzig richtige Weg zu Gott war.
Wir zogen wieder um und ich hatte einen langen Weg, um zum Kindergarten zu gelangen. Über die große Straße neben dem Dorfbrunnen vorbei, eine endlos lange Straße an dem großen Restaurant meines Vaters (er arbeitete auch im elterlichen Betrieb mit, nicht nur im Restaurant des Frei- und Hallenbades) vorbei und wieder eine Kurve und einen schier endlos langen Hügel hinauf.
Am Anfang fuhr mich meine Mutter mit dem Auto in den Kindergarten. Doch weil das Auto so teuer war, musste sie es verkaufen. Und ich musste den langen Weg zu Fuß gehen. Es gab viele Möglichkeiten, von mir zu Hause in den Kindergarten zu kommen. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Ich suchte den schnellsten, den schönsten mit den Augen und den schönsten mit dem Gefühl, ich fand einen unglaublich langen Weg, den meine Mutter gar nicht toll fand, da das Essen dadurch kalt wurde. Doch auf diesem Weg lief ich bei einem Pferd vorbei. Dieses Pferd wollte von mir berührt werden, und am liebsten hätte ich es mit nach Hause genommen. Aber ich durfte nicht, da ich nicht Pippi Langstrumpf war.
Manchmal blieb ich stehen, weil ich den Bienen und Ameisen zusehen wollte. Ich konnte von der Natur so viel lernen. Hier war alles logisch, hier machte alles Sinn, hier verstand man mich ohne Worte.
Im Frühling war es besonders schlimm für meine Mutter, weil ich regelmäßig zu spät kam, aber ich konnte nichts dafür, es zog mich einfach an, so wie andere Kinder gerne Süßes naschen, Frauen Schuhe kaufen und Männer zusammen am Stammtisch ein Bier trinken, so erfüllte es mich, den Tieren und Pflanzen zuzusehen.
Auch im Wald fühlte ich mich tagsüber sehr wohl. Im Kindergarten hatten wir Bäume im Garten. Ich saß manchmal die ganze freie Zeit beim Baum, zur Belustigung der anderen Kinder.
Obwohl Redli nicht in denselben Kindergarten wie ich ging, wartete er immer auf mich vor dem Zuhause, um mich in den Kindergarten zu begleiten. Eines Morgens, nachdem wir ein paar Schritte gegangen waren, blickte er mich aufgeregt an und meinte:
„Du musst nach Hause gehen, deine Mutter braucht dich.“
Ich rannte, so schnell ich konnte, zurück nach Hause. Als ich die Türe öffnete, hörte ich meine Mutter weinen. Ich schlich in die Stube und sah sie am Telefon, sie bemerkte mich nicht. Erst als sie den Hörer aufgelegt hatte, erblickte sie mich. Ganz verunsichert stand ich vor ihr, mit meiner blauen Kindergartentasche und dem Bärenumhänger aus Ton um den Hals, den ich mit meiner kleinen Hand fest umklammerte. Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter weinen sah.
Sie kam auf mich zu und teilte mir irgendwie distanziert mit, dass meine Urgroßmutter gestorben sei, sie sei sehr traurig, da sie für sie wie eine Mutter gewesen sei.
Ich wusste ja nicht, was das Wort „gestorben“ wirklich bedeutete, aber es fühlte sich sehr traurig an.
Auf der Beerdigung meiner Urgroßmutter überschlugen sich die Ereignisse für mich.
Ich saß neben meinem Urgroßvater. Meine Urgroßmutter stand neben dem Mann in schwarz vor uns. Sie hatte ihre dicken weißen Haare heute besonders schön gebürstet. Und sie strahlte. Sie winkte mir. Ich zeigte auf sie und sagte:
„Schau, Papa.“
So nannte ich meinen Urgroßvater, weil alle in der Familie ihn so nannten.
„Da steht ‚Mama‘, du musst nicht traurig sein, sie ist erwacht.“
Zuvor war mir erklärt worden, dass meine Urgroßmutter in der großen Holzkiste liege und für immer schlafe. Mein Urgroßvater sagte nichts, aber sein Blick traf mich mitten ins Herz.
Ich sah in seinen Augen immer diese innige Liebe zu mir, wenn er mich anblickte.
Aber jetzt hier in der Kirche, nach dem ich ihn angesprochen hatte, sah er mich mit leeren Augen an. Und ein Gefühl voller Traurigkeit lag für mich tiefberührend in seinem Blick.
Meine Augen füllten sich mit Tränen und ich fühlte solch einen Schmerz in mir, dass ich richtig schluchzen musste. Meine Mutter, die hinter mir saß, sprach zu mir:
„Weine nicht, du hast sie ja kaum gekannt.“
Aber ich weinte ja nicht, weil sie gegangen war, sondern weil ich so ob der Leere und des Schmerzes in den Augen meines Urgroßvaters erschrocken war.
In der Kirche erfuhr ich, dass meine Großmutter nun bei Gott im Himmel angekommen sei.
Sie stand nicht mehr neben dem Mann.
Lag sie denn nun in der Kiste oder war sie im Himmel? Ich stand wieder einmal vor einem unlösbaren Rätsel und niemand wollte mir erklären, was hier genau ablief. Ich fragte mich, ob das so ähnlich ist wie mit den Zaubertricks meines Onkels. Er hatte eine Kiste, worin er verschiedene Teile hatte, und er konnte kleine Häschen aus weichem Material in ein Ei stecken und wirklich wegzaubern. Dachte ich jedenfalls lange Zeit, bis er mir erklärte, dass Zauberei gut getarnte Tricks sind. Aber ein Zauberer verrate nie seinen Trick. Vielleicht war das hier ja auch so ein Trick meiner Urgroßmutter. Und sie hatte sich aus der Kiste neben den Pfarrer gezaubert und nun wieder weg.
Nach der Kirche gingen wir ins Restaurant um zusammen zu essen. Was ich immer sehr genoss. Nach dem Dessert hob sich die Stimmung und es wurde wieder eine Bierpredigt gehalten und gewitzelt.
Ich sah Redli an der Türe stehen und war erfreut, dass er auch hier war. Ich rannte los aus dem Speisesaal um die Ecke, einfach weg von den seltsamen Erwachsenen, raus mit Redli in die Natur. Als ich um die Ecke kam, stand da eine Serviertochter. Redli konnte ausweichen und verschwand, ich nicht. Ich prallte ungebremst in die Serviertochter rein. Und die vier Kaffee mit Schnaps und restlichen Kaffees flossen auf meinen Rücken runter. Wie das brannte. Ich schrie und meine Patentante stand kaum, schon hörte ich sie mich neben mir, sie hob mich hoch und eilte zum Waschtrog und ließ das kalte Wasser über meinen Rücken laufen. Alle versammelten sich und als meine Patentante mir den Pullover auszog, wurde es still. Meine Großmutter sagte:
„Sie muss zum Arzt.“
So fuhren wir zum Arzt. Dieser lobte meine Patentante für ihr rasches Handeln, damit habe sie mich vor schlimmen Verbrennungen geschützt. Nur auf der rechten Schulter seien zwei Blasen, aber die werden völlig ausheilen. Das sind sie nicht. Mein Körper füllte diese Blasen mit Haut und ich trug sie bis zu meinem 16. Lebensjahr als zwei aufstehende, vier mal zwei Zentimeter große Hautkugeln auf meiner rechten Schulter. Mit 16 Jahren wurden sie entfernt und ich erhielt eine kosmetische Schönheitsnaht.
Auf dem Weg vom Arzt zurück nach „weiß ich nicht mehr, wohin“ fragte mich meine Patentante, weshalb ich gerannt sei. Ich erzählte ihr von Redli, dass er da gewesen war und ich mit ihm hatte rausgehen wollen. Später hörte ich, wie die Erwachsenen zusammen sprachen, als ich so tat, als sei ich eingeschlafen. Dass Redli der unsichtbare Freund sei und dass ich mir den einbilde, weil ich so oft alleine sei. Ich fragte mich:
„Was ist eingebildet?“Ich erinnerte mich, wie meine Mutter einmal zu einer anderen Frau gesagt hatte, dass sie eingebildet sei.„Ist ein Gebilde mit diesem Wort verwandt?“
Das Auto blieb stehen und somit wurde ich aus meinen Gedanken gerissen.
Meine Patentante wollte sich wieder mehr um mich kümmern. Was sie wirklich auch getan hat. Ich durfte immer zu ihr, und an den Geruch, wenn ihre Haustüre aufging, erinnere ich mich noch genau.
Bei ihr gab es jeden Mittag, wenn ich da war, etwas aus dem Süßigkeitenschrank, aber nur etwas Kleines. Während sie in der Küche Ordnung machte oder Wäsche bügelte, hörte ich mir die Kasperlitheater-Schallplatten-Kindergeschichte an. Und ich tauchte ein in die innere Fantasiewelt. Ich vermisste Redli sehr, er war nach dem Zusammenstoß mit der Servicetochter nie mehr aufgetaucht. Und nach diesem Zusammenstoß lebte ich ohne Redli weiter.
Ich lebte alleine mit meiner Mutter. Aus diesem Grund war ich die einzige Zuhörerin am Esstisch. Und meine Mutter hatte viel zu erzählen, also eigentlich immer das Gleiche, aber eben jeden Tag aufs Neue.
„Männer sind zu nichts zu gebrauchen, und auf der Arbeit ist die Mitarbeiterin eine blöde Kuh.“
Als ich Tage später mit meiner Großmutter in Solothurn durch die Gassen spazierte und wir vor einem Eingang mit großen Fenster standen, sagte meine Großmutter zu mir:
„Schau, hier arbeitet deine Mutter.“
„Und wo ist die Kuh?“
„Welche Kuh?“
„Mami hat gesagt, auf der Arbeit hat es eine Kuh, aber hier sehe ich nur Kleider in den Fenstern.“
Auch sonst sprach meine Mutter oft seltsames Zeug:
„sie sollte sich das auf die Stirne schreiben“,„einen Bären aufbinden“,„den Nagel auf den Kopf treffen“,„es hat mir die Zehennägel aufgerollt“,„das ist mir ein Dorn im Auge“,„in Stein gemeißelt“,„Tomaten auf den Augen haben“,„die hat Haare auf den Zähnen“,„mir ist ein Groschen gefallen“,„die Kirche im Dorf lassen“,„der hat Dreck am Stecken“,„wir müssen den Gurt enger schnallen“,„scheiß die Wand an“,„den Finger aus dem Arsch nehmen“,„sich in die Nesseln legen“,„an die Säcke gehen“,„auf dem Schlauch stehen“,„da ist der Wurm drin“,„auf den Keks gehen“,„an den Nerven zerren“,„mir platzt gleich der Kragen“.Solche Redewendungen verstand ich als Kind wortwörtlich. Und ich wollte ebenfalls eine Feige, wenn die Großmutter meinen Onkel fragte, ob er eine Ohrfeige will, damit er sich wieder anständig benimmt.
Ich verstand das Gekichere nicht, wenn mein Onkel Manfred mitteilte, dass das Essen heute besonders abscheulich schmeckt, und den Teller hinstreckte, um noch mehr davon zu bekommen. Oder wenn mein Vater sich schmerzverzerrt den Kopf rieb, weil seine Frau ihm zuvor die Spieldose auf den Kopf geschlagen hatte, lächelte und sagte: „Es hat überhaupt nicht weh getan.“
Weshalb sprachen Menschen etwas aus, das überhaupt nicht zur Körpersprache passte oder sagten Dinge, die so nicht da waren?
Auf Schweizerdeutsch gibt es diverse Ausdrücke, die ich auf Hochdeutsch so nicht übersetzen kann. Wenn wir jemanden hochnehmen, ihn auf die Schippe nehmen, sagen wir zum Beispiel:
„Er hat mich angezündet.“
Ich war damals sechs Jahre alt, als meine Mutter mir erzählte:
„Oh dieser Typ da drüben, der hat mich gestern im Ausgang angezündet.“
Ich sah sie mit großen ungläubigen Augen an und fragte:
„Mit dem Feuerzeug oder mit Streichhölzern?“
Sie überhörte meine Frage. Ich schaute mir meine Mutter genauer an, nirgends eine Spur von verkohlten Haaren. Das war dann wohl wieder eine dieser Lügen.
Die Erwachsenen erzählten mir auch einmal: „So wie du in den Wald rufst, so ruft es zurück.“ Ich stand vorm Wald und rief, doch keine Antwort. Erst als ich später mit acht Jahren einmal auf dem Berg ganz laut „Arsch“ rief, hörte ich den Berg zurückrufen: „Arsch, Arsch, Arsch.“ Also nicht der Wald, sondern der Berg rief zurück. Ging es also im Leben darum, zu lügen, Geschichten zu erzählen, die so nicht wirklich waren, andere zu täuschen?
Die Erwachsenen hatten meiner Meinung nach vom Leben keine Ahnung, der einzige, der alles wusste, war Redli. Da Redli weggezogen oder eben doch nur eingebildet war, entstand das Bedürfnis in mir, mit anderen Kindern zu spielen. Regula vom Parallel-Kindergarten wirkte am schlauesten auf mich und so entschied ich mich mehr mit ihr zu spielen. Sie saß öfters mit mir beim Baum im Kindergarten, und wir spielten draußen, auch wenn es regnete. Sie lebte nur über die Straße von meiner Großmutter und in ihrem Garten stand ebenfalls ein sehr großer Baum, auf den wir oft raufkletterten. Von ihr lernte ich, dass ich mit einem Plastiksack schneller als mit Schlitten im Schnee den Hang hinunterrutschen kann, dass Frösche aus Kaulquappen entstehen und sehr viel über Gott. Somit begann für mich eine neue Erkenntnis über Gott, denn Regula absolut davon überzeugt. Gott lebt in der Kirche.
Gott lebt in der Kirche
Wenn ich bei Regula zu Besuch war, durfte ich das Stück Brot und das Stück Schokolade nicht einfach essen. Da stupste sie mich und flüsterte: „Wart, bis meine Mutter gebetet hat.“
Ich blickte in das Gesicht ihrer Mutter und sah die geschlossenen Augen und das gesenkte Gesicht. Ich blickte Regula und ihre anderen Geschwister an, alle saßen sie am Tisch mit geschlossenen Augen. Bis auf den Jüngsten falteten alle ihre Hände zusammen. Der Jüngste legte eine Hand in die andere. Die Mutter sprach etwas von Dank und Lob und einem Preis und beendete es mit dem Wort „Amen“.
Ich war verwirrt, was das gerade gewesen war. Durch Redli hatte ich gelernt, dass ich Menschen direkt ansprechen soll, wenn ich etwas nicht verstehe.
So fragte ich: „Was habt ihr da gemacht?“
Da Regula ihren Mund voll hatte, antwortete mir ihre Mutter.
„Wir haben gebetet. Gott gedankt, dass wir etwas zu Essen haben.“
„Also du hast gebetet, die anderen waren ja still“, berichtigte ich.
Sie blickte mich geduldig an.
„Ja, ich habe gebetet, und meine Kinder senken ihren Kopf und falten ihre Hände zum Zeichen, dass sie voller Demut sind, Gott gegenüber und auch mir.“
„Aber weshalb dankst du Gott, wenn du das Brot selber gebacken hast?“
„Nur durch Gottes Barmherzigkeit wächst der Weizen auf den Feldern. Der Müller mahlt daraus das Mehl und wir können es kaufen.“
„Und du bist dir sicher, dass Gott dich gehört hat, der wohnt doch im Himmel.“
Ein Gelächter entstand am Tisch. Auch der Mutter huschte ein Lächeln über ihr sonst so ernstes Gesicht. Regula blickte mich an und meinte:
„Gott lebt nicht wirklich im Himmel. Er kann überall sein, aber wir gehen zu ihm in die Kirche.“
„Ich habe aber gelernt, dass Gott im Himmel lebt. Aber ja, es stimmt, der Pfarrer hat an der Beerdigung meiner Urgroßmutter gesagt, dass wir Gott in der Kirche begegnen können. Doch ich wusste nicht, welcher Mann den nun Gott ist.“
„Das sagt man so, doch Gott lebt nicht wirklich im Himmel. Und er ist auch kein Mensch“, meinte Regula.
„Darf ich den einmal mit euch mitkommen in eure Kirche?“, wollte ich wissen.
„Natürlich“, antwortete mir Regulas Mutter.
Ich ging kurze Zeit danach mit in die Sonntagsschule, so nannte es Regula. Wir saßen nicht in der großen Kirche in unserem Dorf auf dem Hügel, sondern gingen ins Kirchgemeindehaus. Denn sie gehörte einer anderen Gemeinschaft an. Auf jeden Fall sah ich Gott nicht. Und ich fragte Regula natürlich auch, ob Gott heute nicht da sei.
„Doch, Gott ist immer hier.“
„Aber ich sehe ihn nicht.“
Ich fragte mich, ob es wohl bei ihr so sei wie bei mir mit Redli, dass nur sie ihn sehen kann.
„Gott kannst du nicht mit deinen Augen sehen, sondern mit deinen Herzensaugen. Gott spürst du. Dort wo sich Menschen versammeln und zu ihm beten, dort ist auch Gott.“
Ich sah ihn nicht und ich spürte ihn auch nicht. Aber das war mir irgendwie egal, denn ich fühlte mich wohl. Es war schön, so viele Menschen um mich zu haben, die alle zusammen den biblischen Geschichten lauschten. Und das Allerschönste, nach dem Sitzen, Lauschen und Singen spielten wir zusammen. Die Erwachsenen taten ebenfalls Dinge, sie saßen nicht bloß am Tisch und unterhielten sich wie die Erwachsenen, die immer bei meinem Vater im Restaurant saßen.
Einmal hörte ich folgende Geschichte: An einem Sonntag besuchten viele Menschen die Kirche, um etwas zu spenden. Eine alte Frau kam und gab 2 Münzen. Ein paar Männer beschimpften die Frau und nannten sie geizig. Da kam Jesus zu den Männern und meinte: „Die Frau gibt alles, was sie hat, und ihr nennt sie geizig?“
Ich war fasziniert über diese Sonntagsschule und ging immer wieder hin, nicht um Gott zu finden, sondern um den Geschichten über Jesus zu lauschen.
Der war ein ganz besonderer Mann. Er konnte Wasser in Wein verwandeln, heilte Menschen durch die Berührung und setzte sich für die schwachen und beschmutzten Menschen ein. Ein Satz prägte sich stark ein:„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“
Als ich Regula fragte, wer dieser Jesus eigentlich sei, erklärte sie mir, dass er der einzige Sohn Gottes sei. Diese Antwort ließ mich an Regulas Intelligenz zweifeln. Wie konnte denn jemand Gottes Sohn sein, der so viel später auf die Welt gekommen war als Adam und Eva?
Irgendwann hörte ich, dass es eine Sünde sei, wenn Eltern mit Kindern oder Geschwistern untereinander Kinder zeugen. Das sei Inzucht und mache die Kinder krank.
„Aber die Entstehungsgeschichte von Adam und Eva erzählt von zwei Jungen, Kain und Abel, wie genau sind dann daraus neue Menschen entstanden?“, wollte ich wissen.
„Adam und Eva haben gesündigt, da sie Gott nicht gehorcht und vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Dadurch wurden sie aus dem Paradies geworfen. Sie mussten arbeiten, und sie bekamen noch mehr Kinder, auch Mädchen“, wurde mir erklärt.
„Aber dann haben sie wieder gesündigt, da sie in der Familie miteinander Kinder gemacht haben?“
Ich bekam keine Antwort darauf.
Für mich ergab diese Version damals einfach keinen Sinn. Es fühlte sich unlogisch an, die ganze Welt wäre auf Sünden aufgebaut. Doch ich war erst kurz vor dem Schuleintritt und Gedanken kreisen zu lassen war mir noch fremd.
Es gab ein Thema, welches mich noch mehr interessierte und das war mein Schuleintritt. Es war klar für mich, dass ich mit Regula in eine Schulklasse kommen würde, doch zu welcher Lehrerin? In der Familie wurde schon darüber gesprochen, obwohl draußen noch Schnee lag.
Ich vermisste Redli und die Gespräche mit ihm. Ich saß mehr vor dem TV und schaute mir zusammen mit meinem Onkel und meiner Tante, welche bloß fünf und sechs Jahre älter waren als ich, Zeichentrickfilme an. Tom und Jerry war ihre Lieblingsserie. Mir gefiel diese Sendung nur, wenn sie zusammen ein Team waren. Tom bekam sonst ständig eines auf den Deckel. Und nach einem Unfall war er immer wieder vollständig. Das fand ich doof. Auch doof fand ich, dass der kleine Engel und der kleine Teufel, die den beiden auf den Schultern erschienen, immer dieselbe Rolle hatten. Der Engel war immer der Gute, der Teufel war immer der Böse.
Schon in der Sonntagsschule sprachen sie schlecht über den Teufel, dass er die Menschen zum Sündigen versuchte. Ich störte mich sehr daran, jemandem einfach ein „immer gut“ oder „immer schlecht“ aufzuzwängen. Niemand war immer gut oder schlecht, aber mir glaubte das kein Mensch. Bevor ich abends einschlief, begann ich zu beten, auf meine für mich selber erfundene Weise. Ohne die Augen zu schließen und ohne meine Hände zu falten. Ich sprach einfach leise in mein Zimmer, ich wusste, dass jemand da war, der mir zuhörte. Ich nannte es „Engfel“, eine Mischung aus Engel und Teufel.
Der Winter war zäh, das Iglu, welches mein Onkel Daniel gebaut hatte, wollte einfach nicht schmelzen. Ich hatte genug vom Schnee und der Kälte. Ich sehnte mich nach dem zarten Grün an den Bäumen und den Blumen, die aus dem harten Boden ihre Köpfe der Sonne entgegenstreckten. Ich wollte wieder barfuß unterwegs sein, den kleinen Tieren zusehen, die wärmere Luft des Frühlings einatmen, den frisch gemähten Rasen riechen.
Vielleicht lag meine erste für mich spürbare Ungeduld auch daran, dass ich endlich wissen wollte, ob ich bei der alten Schachtel eingeschult werden würde. Die Erwachsenen hatten mich angesteckt, in die Zukunft zu eifern.
Endlich war es soweit, zusammen mit meiner Mutter und vielen anderen Kindern, mit ihren Eltern und den Lehrern saßen wir im Singssaal des Schulhauses. Es roch miefig und mir waren die vielen Leute zu viel. Mir war eher unwohl, als dass ich mich auf das Projekt Schule freute. Es hieß von zu Hause, dass nun der Ernst des Lebens für mich anfängt. Es vorbei sei mit „nur spielen“, es gehe nun „ans Eingemachte“. Was auch immer das wieder zu bedeuten hatte.
Als ich meinen Namen hörte, horchte ich kurz auf. „Bonnie Bless kommt zu Fräulein Ammon.“
„Gott sei Dank“, dachte ich mir.„Das Fräulein ist die junge Frau. Weshalb sage ich ‚Gott sei Dank‘, hat Gott mir nun dabei geholfen oder war es mein Engfel?“
„Mami, ich bin so froh, dass ich nicht zu der alten Schachtel komme.“
„He, das sagt man nicht“, züchtigte sie mich mit einem strafenden, aufgesetzten Blick, „Du täuscht dich. Fräulein Ammon ist die ältere Dame.“
Ich war sprachlos, wie konnte das sein? Ein Fräulein war doch eine junge Frau, eine, die noch nicht verheiratet war. Und zu Hause hatten sie doch das Fräulein Ammon alle „alte Schachtel“ genannt, weshalb sagte sie nun „die ältere Dame“? Vor allem hatte ich doch immer wieder darum gebeten, dass ich nicht zu der alten Schachtel komme.
Ich blickte zu meiner neuen Lehrerin und sah in ihrem Gesicht, dass es für mich zwei schreckliche Jahre sein werden. Sie sah irgendwie böse aus, sie lächelte nicht, sondern blickte streng über ihre Brille, woran eine silberne Kette hing. Wenn sie die Brille von der Nase nahm, ließ sie diese an der silbernen Kette hängen, das sah irgendwie seltsam aus. Ich überhörte, dass Regula ebenfalls zu ihr in die Klasse eingeteilt worden war. Erst als wir uns bei der großen, braunen, aus Eisen gefassten, schweren Schulhaustüre trafen, berichtete Regula mir davon. Immerhin durfte ich zwei Jahre mit Regula an meiner Seite durch dieses wirklich sehr unangenehme Erlebnis gehen.
Mit dem Schuleintritt begann für mich wirklich ein neues Kapitel.
Ich war der Sündenbock der Klasse. Ich war ein Einzelkind, ein Scheidungskind, das einzige in der Klasse, sah aus wie ein Junge, und das Allerschlimmste an mir war, dass ich mit der linken Hand schrieb.
„Das ist vom Teufel, aber was kommt schon dabei raus, wenn ein Kind ohne Vater aufwächst.“
Die Lehrerin band meinen linken Arm am Stuhl fest und ich musste mit der rechten Hand schreiben lernen. Ich fühlte mich ab dem ersten Schultag als schlechter Mensch. Schon meine Patentante hatte gemeint, ich sei dem Teufel vom Karren gefallen. Und nun nannte mich die Lehrerin „Teufelsbraten“, „zu nichts zu gebrauchen“, „nur Flausen im Kopf und ständig am Träumen“.
Ich war oft in meiner Tagtraumwelt, denn ich hielt es sonst in diesem Schulzimmer nicht aus. Zu hart war dieses Fräulein Ammon, welche mein Onkel Manfred auch die „ewige Jungfrau“ oder die „verbitterte Liese“ nannte. Was das zu bedeuten hatte, wusste ich damals nicht, denn ich erhielt keine Antwort von meiner Mutter. Denn die war ständig müde vom vielen Arbeiten und dem nächtelangen Wegbleiben.
Dass mein linker Arm an den Stuhl gebunden wurde, damit konnte ich irgendwann etwas umgehen, nur wenn die Lehrerin, welche übrigens mit uralten fast 60 Jahren noch bei ihrer fast schon toten Mutter lebte, meine wackeligen Buchstaben wieder ausradierte und mich tadelte, ich solle doch bitte schöner schreiben, fühlte ich mich wieder sehr ungewollt.
Es gab nur ein Fach, wo sie nie mit mir schimpfte, und das war im Turnen. Da war ein anderes Mädchen, das sie nicht mochte. Es war das Mädchen, das nicht einmal im Turnunterricht ihren Rock auszog. Ich glaube Fräulein Ammon mochte nur Regula. Sie machte auch kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Lieblingsschülerin war. In ihrem ersten Zeugnis standen lauter Sechser, was in der Schweiz die beste Note ist. Ich hatte bloß in Sport eine Sechs, sonst war es ein schlechtes Zeugnis, aber was konnte schon dabei rauskommen, ich war ja vom Teufel. Ob mein Vater davon wusste, dass er mit dem Teufel verwandt war? Meine Cousine fand ja, dass mein Vater stinkt. Das jedenfalls verstand ich, als wir bei einem Restaurant vorbeiliefen und sie sagte: „Hier stinkt es.“
Dabei roch es nach meinem Vater, nach einer Mischung von Fritteusen-Pommes-Frites und Zigarettenrauch.
Meine Mutter mochte meinen Vater überhaupt nicht mehr sehen. Wenn er mich abholte, kam sie nie mit vor die Türe. Und sie schimpfte ständig über ihn. War er vielleicht sogar der Teufel? Ich mochte ihn. Er hatte zwar immer viel Arbeit in seinem Restaurant, aber ich durfte immer mithelfen, er hatte Geduld mit mir, und er war in einem Punkt absolut zuverlässig, genauso wie Mathe. Wenn ich selten einmal an Wochenenden bei ihm war, kam er abends zu mir, umarmte mich und gab mir einen Gutenachtkuss. Seine Kochbluse versprühte den Duft von Zigarettenrauch und den typischen Küchengeschmack. Ich verband diesen Duft mit dem Gefühl der Umarmung.
Das was ich mochte, mochten andere nicht.
Jedenfalls war für mich eines klar, ich war schlecht und ungewollt, seltsam, da ich viel träumte, weinte, wenn ich traurig war, und lachte, wenn etwas Lustiges geschah. Redli hatte mich früher „echt“ genannt, so wie die behinderten Kinder. In der Parallelklasse gab es ein Mädchen mit einem sehr großen Kopf. Auch sie war vom Teufel, das erklärte einmal Fräulein Ammon diesem Kind. Daher beschloss ich mit ihr öfters meine Zeit zu verbringen. Doch die Familie zog bald weg aus unserem Dorf. Und wieder hatte ich bloß Regula. Denn die anderen Kinder der Schule mochten mich nicht. Weil ich eben seltsam war.
Wir hatten bei Fräulein Ammon auch Religionsunterricht, das war das einzige, was mir an ihrem Unterricht gefiel, denn dann wirkte sie entspannt und las uns Geschichten vor. Sie begann ganz am Anfang, und ich hörte zum ersten Mal alles der Reihe nach. Wie Gott den Menschen aus Staub geschaffen, ihm mit seinem Atem das Leben geschenkt hatte. Adam war auf der Welt gewesen, um den Tieren Namen zu geben.
„Also er war dafür verantwortlich, dass wir zu der Katze ‚Katze‘ sagen. Vielleicht, weil er von ihr gekratzt wurde, als er sie am Bauch streichelte.“ Das fragte ich mich selbst.
Ich erinnerte mich an die Katze, welche mich zum Haus geführt hatte, als ich eine neue Mama gesucht hatte. Dort, wo ich meine erste warme Milchschokolade getrunken hatte. Die Erinnerung löste ein schönes Gefühl aus und ich lächelte vor mich hin.
Fräulein Ammon war inzwischen schon beim Baum der Erkenntnis angelangt und fand mein Lachen total unpässlich, rief erzürnt meinen Namen und fragte die ganze Klasse:
„Wer lacht denn schon dabei, wenn erzählt wird, dass der Teufel Eva versucht hat und wir dadurch dieses schlimme Leben hier auf der Erde führen müssen?“
Meine Antwort purzelte einfach aus meinem Mund, ohne darüber nachzudenken:
„Eine Tagträumerin.“





























