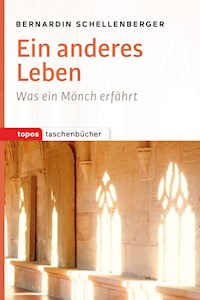Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag der Ideen
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch zeigt Bernardin Schellenberger das Klosterleben in faszinierender Fülle: Er beschreibt das Kloster selbst, die Räume und deren Nutzung, die einzigartige Atmosphäre und die Regeln und Verhaltensweisen der Mönche im Gebet und in der Arbeit. Das Buch ist die umfassende Darstellung eines "Insiders", der ab 1966 ein Jahrzehnt lang in der seit dem 12. Jahrhundert fast unveränderten Lebensordung der Zisterzienser lebte. Als ehemaliger Prior und Novizenmeister und als spiritueller Lehrer sowie profunder Kenner der alten Quellen schildert er in Form einer autobiografi schen Erzählung den Alltag und die Spiritualität der Mönche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernardin Schellenberger, geboren 1944, war zunächst Franziskanernovize, ehe er von 1966 bis 1981 als Trappist nach der Regel Benedikts lebte. Ab 1975 unterwies er als Novizenmeister junge Mönche darin. Von 1981 bis 1991 formulierte er als Seelsorger die Erfahrungen der Mönche für eine Dorfgemeinde um. Seit 1991 übersetzt er sie als freier Schriftsteller, Referent und Kursleiter in Impulse zur Spiritualität für alle Interessierten.
Bernardin Schellenberger
Gott suchen – sich selbst finden
Erfahrungen mit der Regel Benedikts
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Originalausgabe erschien 2005 im Kreuz Verlag unter dem Titel:
Die Stille atmen. Leben als Zisterzienser
Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 1. Auflage 2016
© 2016 Verlag der Ideen, Volkach
www.verlag-der-ideen.de
eISBN 978-3-942006-21-7
Covergestaltung und Satz:
Jonas Dinkhoff, www.starkwind-design.de
Printed in Germany
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Zur Einführung
Mein Eintritt
Eine alternative Gesellschaftsform
Erste Erfahrungen bei der Arbeit
Ein Rundgang durch die Anlage
Der Kreuzgang
Gebet und Alltagsleben
Meine Aufnahme als Novize
Das Skriptorium
Die Lesung
Die Zisterzienser
Die romantische Ader der Zisterzienser
Der Aufstieg durch das Tal der Demut
Die Trappisten
Schweigen
Unser Gesang
Die körperliche Arbeit
Das Dormitorium
Der Kapitelsaal
Der Glöckner
Ämter im Kloster
Das Stundengebet
Sterben im Kloster
Das Refektorium
Das Kirchengebäude
Ausklang
Anmerkungen
Bildnachweis
Bernardin Schellenberger am Weidetor um 1977
Vorwort zur Neuausgabe
Vor zwei Jahrzehnten reagierte der Buchmarkt auf ein reges Interesse für Klöster. Es erschien eine Fülle von zum Teil hervorragenden Bildbänden über die Klöster des Mittelalters. Sie zeigten allerdings fast immer nur leere Klosteranlagen. Das regte mich an – als »Insider« und vertraut mit der spirituellen Tradition der Benediktiner und Zisterzienser – ergänzend dazu ein Buch über die Spiritualität und das Alltagsleben der Mönche und Nonnen zu schreiben, die diese Gebäude mit Leben erfüllt hatten.
Das mit reichem Bildmaterial ausgestattete Buch im Großformat mit dem Titel »Die Stille atmen: Leben als Zisterzienser« erschien 2005 und erfreute sich regen Interesses. Es hätte für die Besucher der 150 ehemaligen und 40 noch bestehenden Anlagen von Zisterzienserklöstern im deutschsprachigen Raum eine wertvolle Handreichung und für deren Klosterbuchhandlungen ein Longseller werden können. Aber leider wurden im Zug einer Verlagsübernahme die gedruckten Exemplare bereits 2007 verramscht und die Herstellungsunterlagen vernichtet, was ich zufällig im Internet entdeckte. Bald setzten viele Nachfragen bei mir ein, ob und wo das Buch noch zu erhalten sei. Für die paar im Internet angeborenen Exemplare wurden abenteuerliche Summen verlangt.
Zu meiner Überraschung schlug mir dann Herr Uwe Dinkhoff vom »Verlag der Ideen« vor, dieses »verlorene« Buch neu herauszugeben. Getreu seinem Verlagsnamen hatte er die Idee, es ganz anders zu gestalten. Der Text sollte der gleiche bleiben, aber er schlug ein kleineres, handliches Format vor. Dank meines umfangreichen Bestands an Bildern konnte er das Buch auch neu illustrieren. So ist keine Kopie des ursprünglichen Buchs entstanden, sondern es liegt jetzt ein wunderschön gestaltetes neues Buch vor.
Sein jetziger Titel weist darauf hin, dass dieses Buch Einsichten und Praktiken aus der Regel und Tradition des heiligen Benedikt bietet, von denen man sich auch außerhalb des Klosters zu einem fruchtbaren geistlichen Leben inspirieren lassen kann.
Bernardin Schellenberger, im August 2016
Mein Sprung ins 12. Jahrhundert
Zur Einführung
Am 16. März 1966 fuhr ich als Zweiundzwanzigjähriger in ein Kloster, fest entschlossen, dort für immer zu bleiben. Mein Ziel war die Abtei Mariawald in der Eifel, wo Reformierte Zisterzienser lebten, allgemein als »Trappisten« bekannt. Die Fahrt erwies sich als Reise in eine andere Welt und Zeit. Dort fand ich nämlich noch bis in die kleinsten Einzelheiten des Alltagslebens eine Lebensform vor, wie sie im 12. Jahrhundert von den Gründern des Zisterzienserordens eingerichtet worden war. Sie hatte zwar im Spätmittelalter einen Niedergang erfahren, war jedoch im Zug einer Reform ab 1664 im Kloster La Trappe in der Normandie wieder genau rekonstruiert und von da an mit unglaublicher Beharrlichkeit dreihundert Jahre lang aufrecht erhalten worden.
Die Geschichte des Ordens und dieser Reform werde ich an anderer Stelle in diesem Buch noch etwas ausführlicher schildern.
An diesem Frühjahrstag 1966 reiste ich also praktisch ins 12. Jahrhundert zurück. Von da an konnte ich ein knappes Jahrzehnt lang persönlich erfahren, wie ein damaliger Zisterziensermönch gelebt hat. Aus dieser Erfahrung einer Art von »Zeitreise« heraus möchte ich hier als Zeuge der damaligen klösterlichen spirituellen Kultur schreiben. Es gibt sie inzwischen in dieser Form nicht mehr, denn sie löste sich binnen weniger Jahre auf. Heute sind von ihr weithin nur noch Schriften, Bilder und vor allem leere Gebäude – Gehäuse, »nackte Namen« – übrig geblieben. Sie geben nur noch eine schwache oder heutigen Menschen womöglich sogar eine falsche Vorstellung davon, wie man darin im Alltag gelebt und vor allem: wie man ihn erlebt hat.
Wir waren in der zweiten Hälfte der sechziger und der ersten Hälfte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts noch derart von der »Welt« getrennt, dass ich für diese zehn Jahre ein »blackout« habe und mich darüber – über die damalige Politik, Kultur, Literatur, Musik usw. – erst im Nachhinein informieren konnte. Natürlich gab es auch damals schon »Lücken« und »Löcher« vom einen Zeitalter ins andere, aber sie waren insgesamt noch so gering, dass ich glaube, noch die »alte« Lebensweise in so gut wie ungebrochener Form erfahren zu haben. In der Folge erlebte ich auch ihre rasche Auflösung mit; da setzte dann (ab 1975) meine schriftstellerische Tätigkeit ein, in deren Verlauf ich etliche Aspekte dieser Problematik erörtert habe.
Im Orden der Reformierten Zisterzienser waren 1927 die aus der Zeit von Abt Stefan Harding (1109 – 1133) stammenden Gebräuchebücher1 noch einmal leicht überarbeitet und veröffentlicht worden.21964 hatte man sie vereinfacht.3 In dieser Form fand ich sie bei meinem Eintritt 1966 vor, jedoch hielt man sich im Alltag noch fast ganz an die alten, lange gewohnten Gebräuche. 1967 und 1969 fanden in Rom zwei entscheidende Generalkapitel (Versammlungen aller Äbte des Ordens) zur Durchführung des vom II. Vatikanischen Konzil angeordneten »Aggiornamento«, der »zeitgemäßen Erneuerung« des Ordenslebens, statt. Ab ungefähr 1960 hatten tatsächlich viele Mönche die traditionelle Lebensform als zu starr, ja erstickend empfunden. Der Abstand zur modernen Welt und Psyche schien zu groß geworden zu sein. Das Ergebnis war, dass 1969 die allgemeine Verbindlichkeit der Gebräuchebücher aufgehoben wurde. Jede Gemeinschaft sollte künftig ihren Alltag und ihre Disziplin selbst gestalten. Die zentrale Autorität beschränkte sich auf den Erlass knapper Rahmenrichtlinien in Form einer »Erklärung über das Zisterzienserleben« und eines elf Punkte umfassenden »Statuts für Einheit und Pluralismus.«4 Beide Texte umfassen zusammen nicht mehr als zwei Druckseiten.
In der Praxis ging das Leben im Wesentlichen noch einige Jahre im alten Stil weiter. Aber zusehends griff die Unsicherheit um sich, was noch gültig und verpflichtend sei. Wie in vielen anderen Klöstern war man auch im meinigen von der Aufgabe, eine über achthundert Jahre lang bis in alle Einzelheiten festgelegte Lebensform zu revidieren und »zeitgemäß« kreativ neu zu gestalten, überfordert. Nach wenigen Jahren begann die alte Ordnung zu zerfallen; fast jeder vertrat andere Ansichten, was noch wichtig und weiterhin zu beobachten sei. Der gesamte Orden wurde von einer gewaltigen Krise erfasst. Allein im Zeitraum von 1962 bis 1972 sank seine Mitgliederzahl von 4400 auf 3400 Mönche. Sie waren entweder enttäuscht, weil er seine alte Form verloren hatte, oder im Gegenteil, weil die Reformen nicht konsequent genug waren. Im Gefolge dieser Krise geriet auch ich aus dem Orden, 1983 praktisch, 1991 auch juristisch.
Im vorliegenden Buch will ich die Zeit davor behandeln, sozusagen die Zeit »vor dem Sündenfall«, die Zeit der »ersten Naivität«, mit der ich mich als Novize und junger Mönch in die Welt der Tradition versenkte und sie mit allen Poren aufsog. Ich will das nicht aus Nostalgie tun, sondern aus Dankbarkeit, denn in dieser Zeit verlebte ich etliche der glücklichsten Jahre meines Lebens. Sie haben mich für mein ganzes weiteres Leben geprägt.
Mit meiner Schilderung möchte ich ein anschauliches Bild der Praxis des früheren klösterlichen Alltagslebens bieten, damit es beim Besuch einer alten Klosteranlage vorstellbar wird. Sie soll das beisteuern, was in den vielen Büchern voller Bilder leerer Klosterräume fehlt. Ich möchte beschreiben, wie man sich in diesen Räumen gefühlt hat. Mehr noch: Ich möchte an die Spiritualität erinnern, von der und für die sie geschaffen wurden. Sie ist inzwischen fast vergessen, könnte aber heutigen Menschen noch wertvolle Impulse liefern. Wenn man sie nicht kennt, kann man kaum den Sinn dieser Klosteranlagen erfassen. So begebe ich mich hier also an die etwas traurige, aber hoffentlich nützliche Arbeit der Archivierung einer in dieser Form versunkenen Welt.
Über die Gründe, warum diese Welt versunken ist, ließe sich ein eigenes Buch schreiben; es sind ja auch schon viele Bücher darüber geschrieben worden. Die Faktoren sind vielfältig. Es gibt äußere wie innere. Ich will hier nur kurz einige nennen:
Zisterziensermönche leben ganz von der Arbeit ihrer eigenen Hände. Wirtschaftlich kann eine Klostergemeinschaft heute aber nicht mehr autark von ihrer Land- und Waldwirtschaft leben und sich ernähren. Sie muss beträchtliches Kapital erwirtschaften, um ihren hohen finanziellen Verpflichtungen (Steuern, Versicherungen usw.) nachzukommen. Als Wirtschaftsunternehmen wird sie zudem unvermeidlich in die heutige Wachstums- und Wettbewerbsdynamik hineingesogen, die den Mönchen fremd ist.
Die Technisierung hat, genau wie im sonstigen bäuerlichen Leben, jene Weisen und Gemeinschaftsformen des Arbeitens weithin getilgt, die ein wichtiges Element der menschlichen und spirituellen Erfahrung waren.
Vor allem aber hat sich die Psyche der Menschen verändert, namentlich in Folge der alles durchdringenden, allgegenwärtigen Kommunikationsmittel, die sie von Kind an prägen und geradezu abhängig machen. Die Fähigkeit, lange allein zu sein und zu schweigen, verkümmert dabei zusehends. Rundfunk, Fernsehen, Computer und Mobiltelefone respektieren keine Klausurmauern und werden auch gar nicht energisch aus ihnen ferngehalten. Ein weiterer Umstand ist demographischer Natur: Es gibt im Abendland immer weniger kinderreiche Familien, die früher das Hauptreservoir des Klosternachwuchses bildeten. Ob letzterer ein schwerwiegender Grund ist, sei dahingestellt. Wahrscheinlich spielen eine gewandelte Gottesvorstellung und der Zeitgeist eine wichtigere Rolle. Beides fördert alles andere als mönchische Vorstellungen von einem erfüllten Leben. Auf jeden Fall treten immer weniger Menschen ins Kloster ein, so dass der harmonische Kosmos der »klassischen« zisterziensischen Klosterwelt kaum mehr aufrechterhalten werden kann.
Abgesehen davon wird auch theologisch in Frage gestellt, ob man eine solche Alternativwelt überhaupt einrichten dürfe – was allerdings angesichts des fehlenden Nachwuchses eine akademische Frage bleibt.
Im Orden der Reformierten Zisterzienser ist die Suche nach einer neuen Form des Mönchslebens weitergegangen (es gibt daneben den Orden der nicht – im Stil der Trappisten – reformierten Zisterzienser, der namentlich in Österreich über etliche Klöster verfügt). Auch wenn die Zahl der Mönche geringer geworden ist, hat die Zahl der Klöster in den letzten Jahrzehnten trotzdem stark zugenommen5. Das zeigt, dass sich die Struktur des Ordens grundlegend ändert: Aus früher großen Abteien mit einer festen Ordnung werden eher kleine flexible Gemeinschaften, die sich den Herausforderungen und spirituellen Fragen der heutigen Zeit zu stellen versuchen.
Für meine Schilderungen der Klosterform vor dieser neuen Epoche des Ordens will ich vorwiegend auf meine eigenen Erinnerungen zurückgreifen, die, wie ich beobachte, mit zunehmendem Alter wieder deutlicher zum Vorschein kommen. Außerdem stehen mir meine Tagebuchaufzeichnungen aus der damaligen Zeit zur Verfügung.
Ich werde manches bis in kleinste Details beschreiben und hoffe, damit nicht zu langweilen, sondern im Gegenteil ein möglichst anschauliches Bild zu entwerfen.
Sogar die Trappisten haben natürlich in manchen geringfügigen Einzelheiten anders als die Zisterzienser des 12. Jahrhunderts gelebt, aber dennoch dürfte ihre Lebensweise noch am genauesten diejenige von damals wiedergeben. Zudem gibt es die perfekte Standardform des mittelalterlichen Mönchslebens ohnehin nicht, denn immer wurde im konkreten Kloster etliches den jeweiligen Umständen und Mentalitäten der Zeit und der Menschen angepasst.
Ab und zu werde ich andere Zeugen aus dem letzten Jahrhundert der Reformierten Zisterzienser zitieren, von denen ausführlichere Schilderungen vorliegen, nicht zuletzt zur Vergewisserung meiner Leser/innen und meiner selbst, dass ich bestimmte Züge nicht allzu subjektiv oder einseitig schildere, sondern andere es genauso oder ähnlich erlebten und empfanden.
Zu diesen Zeitzeugen gehören vor allem Thomas Merton (1915–1968), der ab Ende 1941 in der amerikanischen Abtei Gethsemani lebte, und Ernesto Cardenal, der von Mai 1957 bis Juli 1959 unter Merton dort Novize war, dann jedoch das Kloster wieder verließ.
Außerdem führe ich gelegentlich einen merkwürdigen Zeugen an: Dr. Eugen Rugel, der 1938 das Buch »Ein Trappist bricht sein Schweigen. Volksfremde Religion: Erkenntnisse aus einem 15-jährigen Klosterleben« veröffentlichte6. Rugel war Mönch des elsässischen Klosters Oelenberg gewesen und hatte sich nach seinem Austritt von den Nationalsozialisten dazu missbrauchen lassen, in einem abstrusen Machwerk von 530 Seiten das katholische Klosterwesen als perverses Produkt einer »volks- und rassefremden Religion« zu entlarven und sich am »Kampfe um die Religion seines Blutes und seiner Art« zu beteiligen. An den Stellen, wo Rugel seine Alltagserfahrungen aus dem Trappistenkloster schildert, muss er sich amüsanterweise immer wieder geradezu gegen seinen Willen positiv äußern, was ihn also in diesem Punkt ziemlich vom Verdacht befreit, etwas zu beschönigen oder zu idealisieren.
1977 erschien in Frankreich ein Roman, der in der Abtei La Grande Trappe spielt, und im folgenden Jahr wurde er auf Deutsch veröffentlicht: »Cosmas oder Die Begierde nach Gott.«7 Der Autor Pierre de Calan (geb. 1911), von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler und Bankpräsident, verrät genaueste Detail- und Milieukenntnisse des Klosters, weshalb er sich ebenfalls hie und da mit treffenden Charakterisierungen zitieren lässt.
Vor allem aber lasse ich immer wieder die lateinischen Autoren aus dem 12. Jahrhundert zu Wort kommen, also der Anfangszeit der Zisterzienser, mit denen ich etliche Jahre in derartiger Gleichzeitigkeit gelebt habe, dass sie mir zeitweise näher waren als die heutigen Zeitgenossen.
Ich widme dieses Buch dem Andenken der unzähligen Mönche und Konversbrüder, von denen nicht wenige geradezu »von Gott betrunken waren«, hommes ivres de Dieu, wie jemand formuliert hat. Sie haben keinen Wert darauf gelegt, bekannt zu werden. Gerade deshalb sollte wenigstens bekannt bleiben, dass es sie gegeben hat und wie sie gelebt haben.
Die andere Welt
Mein Eintritt
Den Eindruck werde ich nie vergessen. Er ist mir nach fast vierzig Jahren noch genauso lebendig vor Augen und im Gemüt wie damals.
Es war am dritten Tag nach meiner Anreise, am 19. März 1966. Erstmals stand ich mittags kurz nach zwölf im Refektorium, im Speisesaal, hinter drei Reihen ungefähr vierzig schwarz-weißer und brauner Gestalten mit Kapuzen auf dem Kopf, alle ausgerichtet auf das große Kreuz an der Stirnseite des kahlen Raumes. Da stand ich junger, unsicherer Weltmensch mit dem Blick auf vierzig Unbekannte, Geheimnisvolle; mir noch abgewandte schweigende Mönche, zu denen ab sofort auch ich gehören sollte; hatte vor mir vierzig Männer, die zum Teil schon Jahrzehnte lang hier gebetet, gesungen, gearbeitet, gelebt und fast immer geschwiegen hatten. Die Szene hatte etwas Atemberaubendes, ja geradezu Numinoses an sich – eine intensive Ahnung von etwas geheimnisvoll Anderem, als man es sonst in der Welt erfährt.
Am Gebet vor dem Mittagessen, um halb zwölf, hatte ich noch auf der Gästeempore des Klosters teilgenommen, am Westende der Kirche. Von dort hatte ich die Mönche zum Teil in ihrem Chorgestühl gesehen. Ein hölzerner Lettner mit schmalen spitzbogigen Durchbrüchen trennte ihren Bereich vom Kirchenschiff, war aber nicht so hoch, dass er den Blick von oben ganz versperrt hätte.
Nach dem viertelstündigen Psalmensingen entzogen sich die Mönche meinem Blick, weil sie sich zur Betrachtung niederknieten. Einige schritten nach vorn. Im stillen Raum war nur das weiche Schlappen ihrer weißen Gewänder zu vernehmen. Sie verneigten sich tief vor dem Altar und verließen die Kirche nach links. Ich wartete kniend an der Brüstung der Empore. Nach zehn Minuten sah ich, wie sich der Novizenmeister, Pater Pius, den ich als einzigen schon kannte, erhob und ebenfalls hinausging. Kurz danach erschien er, wie vereinbart, bei mir und winkte mir wortlos, ihm zu folgen. Es war so weit: Mein Einzug in den Konvent – oder, wie er immer sagte: in »die Gemeinde«, begann.
Wir stiegen die knarrende Holztreppe des Gästehauses hinunter. Er schloss mit einem Dreikantschlüssel die Tür zur Klausur auf. Es ging einige Meter durch einen kurzen, fast lichtlosen Flur, dann durch die große Holztür, und wir standen im gotischen Kreuzgang. Wir schritten den Südflügel vor. Kurz vor der Kirchentür der Mönche machte mir der Novizenmeister ein Zeichen, ich solle warten. So standen wir schweigend nebeneinander. Da schlug es zwölf, und als die Schläge verklungen waren, tat die Glocke im Kirchturm drei helle Schläge. Der Novizenmeister ließ sich auf die Knie nieder, setzte seine Hände auf den Boden, kauerte Richtung Osten am Boden. Ich stand ratlos daneben. Noch einmal drei Schläge. Ich begriff: »Der Engel des Herrn«, das auch in der »Welt« übliche Gebet am Morgen, Mittag und Abend. So begann ich es rasch zu beten, um bis zum dritten Anschlag der Glocke aufzuholen; kniete mich wenigstens hin, als Geste des guten Willens, es dem Novizenmeister nachzutun. Schließlich läutete die Glocke in vollem Schwung. Der Novizenmeister erhob sich.
Ich hörte, wie die Tür des Kircheneingangs der Mönche, ganz vorne im Flügel rechts, geöffnet wurde. Dann kamen sie heraus, einer hinter dem anderen, die Köpfe ganz in den großen Kapuzen verborgen, in ihren weiten, weißen, wallenden Chorgewändern. Fünfzehn, zwanzig werden es gewesen sein. Der Novizenmeister und ich schlossen uns ganz am Ende an. Es ging langsamen Schritts durch den Ostflügel. In der lautlosen Stille rauschte wieder nur der dicke Wollstoff der Gewänder. »Die Mönche nahen durch den Kreuzgang, / In Kutten, die geschwätzig sind wie Wasser, / Ich seh sie nicht, doch hör ich ihre Wellen«, dichtete Thomas Merton.8
Der Zug verschwand durch eine Tür am Nordende des Flügels. Mir bedeutete der Novizenmeister, ich solle vor der Tür warten; er ging als Letzter hinaus. Eine halbe Minute später kam die Kolonne der Mönche wieder herein. Sie hatten ihre Chorgewänder abgelegt und waren jetzt in ihrem normalen schwarz-weißen Habit zu sehen. Die Köpfe waren immer noch in den großen, jetzt schwarzen Kapuzen verborgen, die Augen zu Boden gesenkt – keiner schaute mich an – beide Hände unter der Brust seitlich in das Skapulier gesteckt. Der Zug bewegte sich langsam durch den Nordflügel auf ein großes Holzportal zu, das des Refektoriums. Im rechten Winkel davon quollen von rechts braune Gestalten herein, ebenfalls in Kapuzen verhüllt, und fädelten sich in die Reihe ein. Zur Linken des Portals hing ein kupferner Wasserbehälter, aus dem ein dünner Faden Wasser rieselte, daneben war ein weißes Rollhandtuch. Der Novizenmeister reichte mir, nachdem er sich die Hände daran trocken gestreift hatte, als Letztem das Handtuch.
Dann betrat ich den Raum und stand im Rücken der vierzig Menschen-Geheimnisse. Ich war in eine neue Welt eingetreten, in der nichts, überhaupt nichts mehr so war wie in meinem bisherigen Leben, auch nicht das kleinste Detail des Alltags.
Alle warteten lautlos. Nach einer halben oder ganzen Minute rauschte an der Tür wieder ein Gewand; eine weitere Gestalt kam herein und schritt bis nach vorn vor den Tisch: der Abt, zu erkennen an der violetten Quaste auf seinem Rücken. Ich wusste vom Novizenmeister, dass er außer Haus gewesen und es unsicher sei, ob er bis zum Mittagessen wieder da sein könne.
An seinem Platz in der Mitte vor dem Tisch der Stirnwand angekommen, sprach der Abt laut: »Benedicite« (»Sprecht den Segen«). Die Mönche antworteten einstimmig mit dem gleichen Ruf. Dann rezitierten sie ein längeres lateinisches Tischgebet, gegen dessen Ende sie sich tief verbeugten.
Hierauf nahmen sie Platz an den beiden Tischreihen längs der Seitenwände und an der dritten Tischreihe längs der Mitte. Die Tische aus dicken rohen Eichenplatten waren lang und schmal und nur einseitig besetzt. Auch ich begab mich an meinen Platz als Vorletzter in der linken Tischreihe, den mir der Novizenmeister zuvor bei einer Führung durchs Haus gezeigt hatte, zog den lehnenlosen Hocker unter dem Tisch vor und setzte mich darauf.
Ein Klingelzeichen des Abtes ertönte. Von einer Lesekanzel am unteren Ende des Saals las ein Mönch aus der Heiligen Schrift vor, in einem Singsang immer auf einer Tonhöhe, ohne jede Akzentuierung. Das sei der tonus rectus, erfuhr ich später, eine Art rein »objektives« Vorlesen, das ich später auch lernen musste. Jeder, der gut vorlesen konnte, hatte der Reihe nach eine Woche lang den Dienst des Tischlesers zu versehen.
Alle Gestalten saßen immer noch kapuzenbedeckt reglos an ihrem Platz. Nach einigen Sätzen ertönte mit der Tischglocke ein zweites Zeichen; der Vorleser fuhr in seinem Singsang fort, aber jetzt schlugen alle ihre Kapuzen zurück und ich sah zum ersten Mal Gesichter, nämlich die der Mönche auf der Gegenseite – alte, junge, bärtige, rasierte. Aber es war keine Zeit zum Schauen. Alle bewegten sich geschäftig. Es ging darum, den Essplatz herzurichten, wie es der Novizenmeister mit mir geübt hatte.
Das Gedeck sah folgendermaßen aus: Ein grauer HalbliterSteingut-Becher mit zwei großen Henkelgriffen war mit einem hölzernen Schneidbrett bedeckt. Er stand auf dem Ende einer dreiteilig gefalteten, ungefähr 80 Zentimeter langen und – ausgebreitet 40, jetzt, gefaltet also ungefähr 13 Zentimeter breiten – Serviette, die von vorne nach hinten über ihn geschlagen war. Vorne steckte zwischen Serviette und Becher das Besteck: Löffel und Gabel aus Holz geschnitzt, dazu ein einfaches Messer. An den umwickelten Becher war rechts schräg ein umgestülpter Blechteller gestellt; darunter daran lag ein metallener Schöpflöffel. Oben auf der Serviette über dem Becher befand sich ein schmales längliches Holzschild mit dem Namen des Platzinhabers; bei mir stand darauf »Ave Maria«.
Ich musste nun, wie geübt, rasch den Blechteller und das Holzschild beiseite legen, die Serviette zu mir her aufdecken, mir das gefaltete Ende fest in den Kragen stecken, hierauf Besteck, Schöpflöffel, Becher und Schneidbrett ebenfalls beiseite stellen, die untere Hälfte der Serviette auseinander falten – rechts, dann links –, sie also als Tischtuch ausbreiten, und darauf das ganze Gerät wieder anordnen. Kaum war ich so weit, kam ein Tischdiener in weißer Schürze mit einem riesigen Holztablett, von dem er mir einen Blechnapf mit Kohlsuppe auf mein Tuch stellte.
Ich hatte eben mit dem Holzlöffel zu essen angefangen, da stand ein anderer, ebenfalls mit einer weißen Schürze über einem braunen Habit, mit einem kleinen Metalltablett vor mir, auf dem mehrere Stapel geschnittenen Schwarzbrots lagen. Es war ein alter, leicht gebückter Mann mit weißem Bart und wasserklaren Augen. Als er mir zulächelte und bedeutete, ich solle mir soviel Brot nehmen, wie ich wolle, war es, als ginge in der kühlen Atmosphäre des Raums mit diesem Gesicht eine strahlende Sonne auf. Er leuchtete mich verunsicherten Menschen mit einer Liebenswürdigkeit an, als habe er schon immer auf mich gewartet und sei glücklich, dass ich endlich angekommen sei. Seinen Namen erfuhr ich später. Das war Bruder Johannes, der Wärter des Refektoriums. Keiner der sicher fast hundert jungen Männer, die im Lauf von drei Jahrzehnten als Postulanten oder Novizen in diesem Raum saßen und früher oder später wieder gingen, wird ihn ganz vergessen haben.
Auf die Frage, ob es nicht ein allzu raues Klima sei, wenn nur Männer unter sich lebten und alle weibliche Wärme fehle, konnte ich später von Bruder Johannes erzählen. Er war eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, dass unter solchen Umständen einige Mitglieder der Gemeinschaft geradezu weibliche Qualitäten entwickeln. Er hatte einen Blick für jeden: erkannte, in welcher Verfassung jeder war; merkte, wenn einer das Fasten zu weit trieb; ging zum Abt und erbat die Erlaubnis, einem Bruder, den er zu schmal werden sah, eine »Zulage«, eine Extra-Portion, hinstellen zu dürfen; munterte mit seinem Lächeln die Traurigen auf; freute sich mit den Frohen; verstand mit seiner feinen Mimik mit jedem kurz zu kommunizieren – und das alles leise, unaufdringlich. Er kannte die Namenstage aller Brüder und stellte immer jedem einen Strauß seiner selbst gezogenen Blumen an seinen Platz im Refektorium und besorgte außerdem vom Koch als Festessen ein Rührei oder einen kleinen Pfannkuchen auf einem kleinen Blechteller. Man meldete ihm Versäumnisse zu den Mahlzeiten – was namentlich im Sommer bei dringenden Ernteeinsätzen vorkam – indem man sein Namensschild auf der Tasse für »abwesend« umdrehte oder für »komme später« quer legte, worauf dann Bruder Johannes im Wärmeschrank immer verlässlich in zwei Blechnäpfen eine kräftige Portion zurücklegte.
Kurz nach Bruder Johannes kam ein jüngerer Mönch vorbei, der aus einem hölzernen Tragekasten Drittel-Liter-Bierfläschchen verteilte, mir freundlich zunickte und mir zur Auswahl zuerst ein Pils-, dann ein Malzbier entgegenstreckte und dabei fragend mit der Schulter zuckte. Ich zeigte auf das Malzbier. Er stellte mir die Flasche hin und öffnete sie. Kaum hatte ich meine Suppe ausgelöffelt, kam wieder ein Tischdiener mit einer riesigen Blechschüssel voll Kartoffeln vorbei und bedeutete mir, davon auf meinen Blechteller zu schöpfen; dann machte er die Runde mit dicken Bohnen. Wer wollte, konnte seine Speise noch etwas salzen und sich dazu mit der Messerspitze aus einer der kleinen Schalen voller Salz zwischen den Plätzen bedienen. Sie waren lose mit einem runden dünnen Holzdeckel bedeckt.
Zum Schluss des Essens musste man sein Besteck am Platz selbst spülen. Dazu standen in größeren Abständen, für jeden in Reichweite, hohe graue Steingutkrüge mit Wasser, das bei Bedarf auch zum Trinken diente. Man füllte sich einen kräftigen Schuss in den großen Becher, steckte das Besteck hinein, rieb es mit den Fingern im Wasser sauber, trocknete es an seiner Serviette ab, schüttete das Spülwasser in den leeren Blechnapf, rieb den Becher trocken und packte hierauf sein Gedeck wieder genau so zusammen, wie man es vorgefunden hatte. Blechteller und Blechschüssel stellte man vorne an die Tischkante. Es wurde nach der Mahlzeit vom Spüldienst abgeräumt. Spätestens bei diesem Reinigen, dem »Purifizieren« zum Schluss, ging einem auf, dass die ganze Anordnung des Gedecks und der Ritus bewusst in Entsprechung zu dem Ritus gesetzt war, den der Priester am Altar vollzog: Jede Mahlzeit wurde so in Parallele zur liturgischen Mahlfeier gesetzt. Essen war durchaus nichts Profanes.
Ernesto Cardenal schrieb über diesen Essensritus: »Wir aßen mit Holzlöffeln, die nie zum Abwasch vom Platz genommen wurden. Wir hatten eine Tasse aus glasiertem Ton, und darin spülte man seinen Löffel mit den Fingern und ein bisschen Wasser. Diesen Löffel bekam sonst niemand mehr; wenn man fortging oder starb, wurde er fortgeworfen … Die Tontasse hatte zwei Henkel, und zum Trinken musste man sie mit beiden Händen heben. Das war geschriebenes Gesetz. Wenn man die Tasse mit nur einer Hand hob, konnte man deswegen im Schuldkapitel beschuldigt werden. P. Merton sagte uns bei einem seiner Vorträge, dass unser Leben voller lächerlicher Regeln sei, die jedoch alle irgendeinen Sinn hätten. Das mit der Tasse war eine Tradition aus dem 4. Jahrhundert und stammte anscheinend von den Wüstenvätern. Man sollte sie mit beiden Händen nehmen, wie es Kinder tun, damit man sich selbst auch wie ein Kind fühlt.«9 Bis der letzte im Raum so weit war und wieder reglos mit gesenkten Augen vor seinem Gedeck saß, dauerte die gesamte Mahlzeit höchstens 25 Minuten. Der Abt gab mit seiner Tischglocke ein Zeichen, alle standen auf und stellten sich wieder vor die Tischreihen zum gemeinsamen Dankgebet. Es mündete in einen langen Psalm, bei dessen ersten Versen die Mönche ganz unten an den Tischreihen anfingen, in Zweierreihe das Refektorium zu verlassen. Alle zogen in Prozession durch den West- und Südflügel des Kreuzgangs in die Kirche und stellten sich dort an ihre Plätze im Chorgestühl, mit Blick zum Altar. Als der Psalm beendet war, verbeugten sich alle tief zu einem abschließenden Gebet, das einer vorsang. Danach verließen alle formlos die Kirche; manche knieten sich hin und blieben noch einige Zeit dort. Ich blieb kurz stehen, weil ich nicht wusste, wie es weiterging, aber gleich winkte mir der Novizenmeister, mit ihm in den Kreuzgang herauszukommen.
Alle Mönche, denen wir im Kreuzgang begegneten, wandten mir jetzt ihre Gesichter zu, grüßten mit einer leichten Verneigung und lächelten mich liebenswürdig an. Es war, als würden nach der offiziellen Veranstaltung des Mittagessens plötzlich alle Gesichter wie Blumen aufgehen.
Das war nicht nur mein persönlicher, ausnahmsweiser Eindruck. Ernesto Cardenal schrieb vom Tag seines Einzugs in die Abtei: »Und überall Lächeln. Von alten Mönchen und jungen Novizen.«10
Da die Mönche schweigend gemeinsam leben, entwickeln sie – das konnte ich schon bei dieser ersten Begegnung spüren – unwillkürlich eine ausgeprägte Mimik und Gestik. Pierre de Calan lässt den Trappistenabt sagen: »Wenn der Tausch der Blicke die Sprache der Zärtlichkeit, des Vertrauens, der Freundschaft ist, so gilt das vielleicht noch mehr für ein Kloster … Wenn es stimmt, dass wir unter uns eine gewisse Zurückhaltung beobachten, die eine andere Form des Schweigens darstellt, und wenn wir uns nicht mit der Zudringlichkeit und mit der Neugierde für Einzelheiten betrachten, die man in der Welt in einen Blick hineinlegen kann; wenn die Blicke, die wir tauschen, willentlich kurz und maßvoll sind, so sind sie doch offen, glücklich und ohne absichtliches Verbergen … Zwei Mönche, die sich anblicken, haben nichts voreinander zu verbergen, denn sie wissen sich auf der Suche nach einer Wahrheit und einer Liebe, die größer sind als sie beide. In einem Augenblick begegnen sich zwei Seelen und sagen einander, was lange Gespräche nicht auszudrücken vermöchten: dass jeder in den Augen des andern das Licht und die Freude erkennt, die er in sich selbst empfindet.«11
Das klingt etwas allzu ideal, denn im Alltag empfinden Mönche nicht pausenlos Licht und Freude, sondern zeitweise durchaus auch Verdruss; aber zweifellos wird der Gesichtskontakt zwischen den Schweigenden außergewöhnlich intensiv – so intensiv, dass mir heute noch, nach rund vierzig Jahren, das Gesicht jedes meiner Mitbrüder lebendig vor Augen tritt, sobald mir sein Name kommt.
Eine alternative Gesellschaftsform
Ein Zisterzienserkloster war praktisch als eine »alternative Gesellschaftsform« eingerichtet, auch wenn der Begriff unbekannt war; es war ein autarker Mikrokosmos. Das Zentrum bildete die von einer Klausurmauer gegen die Außenwelt abgeschirmte Klosteranlage. Sie umfasste wie ein kleines Dorf Kirche, Wohnhäuser und Häuser mit allen notwendigen Handwerksbetrieben und Werkstätten sowie Ställe, Scheunen, Speicher und Obst-, Gemüse- und Blumengärten. Umgeben war sie von den klostereigenen Feldern, Wiesen und Wäldern, die die Mönche bewirtschafteten. Bei den frühen Zisterziensern galt der Grundsatz, man wolle nur so viel Land besitzen, wie die Mönche eigenhändig bewirtschaften konnten. Das konnte ziemlich viel sein, wenn man bedenkt, dass manche Abteien in ihrer Blütezeit über mehrere hundert Mönche verfügten, aber grundsätzlich galt alles darüber hinaus als »Diebstahl an den Armen«, rapina pauperum, wie 1156 der Zisterzienser Idung schrieb.12
Diese große Zahl genügsamer Arbeiter stellte in der damaligen Gesellschaft ein gewaltiges Leistungspotenzial dar. So wurden die Abteien zu wichtigen Wirtschaftsfaktoren und konnten mit ihren überschüssigen Produkten Handel treiben und Gewinn erwirtschaften. Zum Teil setzten sie ihn für soziale Zwecke wie die Speisung von Armen und Errichtung von Hospizen für Kranke und Obdachlose ein. Aber bald gelangten die Klöster zu beträchtlichen Reichtum, mehrten ihren Grundbesitz gewaltig und kamen vom Prinzip ab, alles selbst zu bewirtschaften. Schließlich wurde der größte Teil der Ländereien um hohe Abgaben verpachtet oder von Klosterangestellten bestellt; und am Ende gab es in den Abteien oft nur noch ein, zwei Dutzend Mönche, die riesige Ländereien verwalteten.
Im 17. Jahrhundert kehrten die Trappisten zum alten Grundsatz zurück. Sie konnten das unter anderem deshalb tun, weil ihre Lebensform viele Novizen anzog und folglich ihre Kommunitäten wieder größer wurden.
Der intakte Mikrokosmos eines klassischen Zisterzienserklosters erfordert ein Minimum von dreißig bis vierzig Mönchen. Sind es weniger, so muss man, um alle Werkstätten weiterführen zu können, Arbeiter einstellen. Von da an sind dann die Mönche nicht mehr unter sich und können nicht mehr ihre Disziplin, namentlich des Schweigens und der Trennung von der Außenwelt, aufrechterhalten. Außerdem ist die von acht Stundengebets-Zeiten strukturierte Tagesordnung so eng, dass sie mit ihrem Rhythmus und ihrer Symbolik ihre volle Fruchtbarkeit im Grunde genommen nur für den »gewöhnlichen Mönch« entfalten kann. Sobald man eines der vielen notwendigen Ämter hat, kann man sich nicht mehr entspannt von ihr tragen lassen, sondern sie wird zum engen Schema. Man muss bei etlichen Gebetszeiten fehlen, seine Zeit des Lesens und privaten Meditierens kürzen oder in jede »Zwischenzeit« so viel an Arbeit und Organisieren hineinpressen, dass das kein kontemplatives Leben mehr ist, sondern hektisch wird. Wenn in einer Kommunität von achtzig Mönchen das Dutzend der für die verschiedenen Bereiche Verantwortlichen aus dieser Notwendigkeit heraus zeitweise nicht beim Chorgebet erscheint, fällt das nicht weiter auf; ist das in einer Kommunität mit nur zwanzig Mönchen der Fall, dünnt der Chor derart aus, dass der Gesang nur noch mit Mühe durchzuhalten ist.
Die Trappisten kannten bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts dieses Problem kaum, weil sie in großen Zahlen rechnen und leben konnten. Bei meinem Eintritt zählte die Abtei Mariawald noch knapp fünfzig Mönche. Das Kloster in der Eifel mit seiner gotischen Kirche und Klosteranlage war 1486 als eine späte Neugründung des rheinländischen Zisterzienserklosters Bottenbroich gegründet worden. Bis zu seiner Aufhebung im Jahr 1802 war es ein relativ kleines Priorat geblieben, das heißt, es verfügte über keinen Abt und war nicht ganz selbstständig, sondern wurde von einem Prior, einem Stellvertreter des Bottenbroicher Abtes, geleitet. Nach der Aufhebung zerfiel es zur Ruine, die 1860 der Abt des Trappistenklosters Oelenberg im Elsass aufkaufte und mit Mönchen seines Klosters wieder aufbaute und besiedelte. Oelenberg verfügte damals über 120 Mönche und wuchs trotz des Auszugs der Mariawalder Gründergruppe bis 1911 auf 180 Mann an. Auch das Priorat Mariawald entwickelte sich, obwohl die Mönche während des Preußischen Kulturkampfs von 1875 bis 1887 noch einmal vertrieben wurden, so gut, dass es 1909 über 100 Mönche beherbergte und zur Abtei erhoben werden konnte. Der Grundbesitz, den die Mönche bewirtschafteten, umfasste 1966 noch rund hundert Hektar.
Von Mariawald war zudem bereits wenige Jahre nach der Neubesiedlung eine kleine Gruppe nach Bosnien ausgeschwärmt und hatte dort in Banja Luka das Kloster Mariastern gegründet, das bis zu 200 Mönche zählte – 1939 waren es 150 – die nach dem Krieg bis auf eine Handvoll vertrieben wurden. Der Gründer von Mariastern, Abt Franz Pfanner, war schon bald nach Südafrika weitergezogen und hatte dort Mariannhill gegründet, das 1885 zur Abtei erhoben wurde und auf über 300 Mönche anwuchs. Pfanners Genie, Hunderte von jungen Männern für das Mönchsleben zu begeistern, erinnert unwillkürlich an seinen Ordensvorfahr Bernhard.
Einige der Gründungspioniere von Mariannhill mit Abt Franz
Wo immer man sich in der Gemeinschaft bewegte oder aufhielt, sei es in der langen Kolonne beim Schreiten durch den Kreuzgang, im Gänsemarsch des Arbeitstrupps oder wenn man jemandem über den Weg lief, sei es, dass man ins Chorgestühl trat oder im Kapitelsaal Platz nahm, kannte man ein für alle Mal seinen Rang und Ort: Er richtete sich nach dem Zeitpunkt des Eintritts in die Gemeinschaft. Für eine kurze Anfangszeit war man überall der Vorletzte und anschließend der Letzte, bis ein noch Späterer eintrat. Diese Reihenfolge galt überall: Man ließ dem jeweils Älteren mit einer leichten Verbeugung und einem Lächeln den Vortritt, was im Allgemeinen etwas Heiteres und Spielerisches an sich hatte, besonders in der Begegnung mit den älteren Konversbrüdern. Die Alten genossen diese Wertschätzung, ja Verehrung seitens der Jüngeren, die sich in dieser Geste äußerte. Sie war selten reine Formalität, sondern meistens ein kurzer Austausch von Sympathie, ja Zuneigung.
Die Mönchsgemeinschaft eines Zisterzienserklosters bestand aus zwei verschiedenen Gruppen: den Chormönchen und den Laienbrüdern; die letzteren wurden »Konversen« oder »Konversbrüder« genannt. Der Begriff ist abgeleitet vom lateinischen Wort »conversio« für »Bekehrung«: vom »Weltleben« »bekehrte« Brüder. Er ist zutreffender als das Wort »Laienbrüder«, denn auch die meisten Chormönche waren »Laien« im Sinn von Nicht-Klerikern und Nicht-Priestern. Bei uns gab es zudem immer noch einige »Oblaten«. Das waren Männer, die nach einer Probezeit ein Versprechen ablegten, sich ganz an die Lebensordnung der Gemeinschaft zu halten. Sie legten keine Gelübde ab und verpflichteten sich nicht auf Lebenszeit. Manchmal waren es Witwer oder Geschiedene.
Als Mönche im strengen Sinn galten die Chormönche. Ihre Zeit wurde vorwiegend mit dem Chorgebet ausgefüllt. Auf acht Tagzeiten verteilt, beanspruchte es täglich fünf bis sieben Stunden Zeit. Alle waren außerdem zu täglich rund fünf Stunden praktischer, vorwiegend manueller Arbeit verpflichtet (»Handarbeit« genannt). Diese gewöhnlich zwei Stunden am Vormittag und drei Stunden am Nachmittag reichten jedoch für alle notwendigen Arbeiten nicht aus. Darum hatten die Zisterzienser von Anfang an den Stand der Konversbrüder eingeführt. Sie beherrschten gewöhnlich nicht das Latein, waren nicht zum Chordienst verpflichtet und nahmen nur an wenigen Gebetszeiten in der Kirche teil. Außerdem hatten sie einige kürzere, einfachere Gebetszeiten für sich. So konnten sie wesentlich mehr Zeit der praktischen Arbeit widmen. Ein »Brüdermagister«, einer der Mönche, gab ihnen regelmäßig Unterweisungen und stand ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Konversbrüder waren bei den Zisterziensern ursprünglich durchaus kein zweitrangiger Stand. Der bereits zitierte Idung nennt ihn sogar an erster Stelle, als er erläutert: »Wir haben im Bereich unseres Klosters zwei Klöster, nämlich eines von Laienbrüdern und eines von Klerikern.«13 Der Stand der Konversbrüder erfreute sich im Lauf der Geschichte zeitweise größeren Zuspruchs als derjenige der Chormönche. Die Abteien Clairvaux und Pontigny zählten ums Jahr 1150 je 300 Konversbrüder, jedoch nur 200 bzw. 100 Chormönche; die englische Abtei Rievaulx, deren Klosterruinen noch heute viele Besucher beeindrucken, war im Jahre 1165 von 150 Chormönchen und 500 Konversbrüdern bevölkert.
Mariannhill etwa 1910: Unterricht der Konversbrüder
Bereits ein, zwei Generationen später kam es zur Entfremdung und Krise zwischen den beiden Gruppen. Die Chormönche fühlten sich als »Herren« (in Maulbronn wird ihr Refektorium bis heute als »Herrenrefektorium« gezeigt) und die Konversbrüder empfanden sich als unmündige »Laien« abgewertet. Sie lebten zum Großteil als Verwalter und Arbeiter auf den gewaltig angewachsenen Außenhöfen der Klöster und damit fern dem Klosteralltag und der Unterweisung und Aufsicht des Abtes. Aus der Zeit zwischen 1168 und 1308 sind 123 Revolten von Konversbrüdern dokumentiert.14 Sie setzten die Mönche bei den Abtswahlen unter Druck, nahmen gewaltsam Klostergüter in Besitz ein, sperrten die Lebensmittellieferungen für den Konvent. Schließlich kam es zu massenhaften Austritten. Im Spätmittelalter und in der Barockzeit, als die Disziplin und das Gemeinschaftsleben verfielen, gab es in den Klöstern nur noch wenige Konversbrüder.
Jedoch ab dem 18. Jahrhundert nahm ihre Zahl in den reformierten Klöstern der Trappisten zum Teil wieder ähnliche Dimensionen wie in der Frühzeit an. Zur deutschen Gründung Mariannhill in Südafrika gehörten 1909, im Jahr ihrer Verselbstständigung als Missionskongregation, 50 Mönche und 270 Konversbrüder, während damals im Mariawalder Konvent mit rund hundert Mann ungefähr die Hälfte Konversbrüder waren; 1958 war das Verhältnis 37:28. Im gleichen Jahr 1958 zählten die Abtei Gethsemani in den USA 76 Chormönche und 142 Konversen, die kanadische Abtei Lac 82 Chormönche und 64 Konversen.
Die Konversbrüder galten bei uns als die »kontemplativeren« Mitglieder der Klostergemeinschaft als die Chormönche. Sie zogen den ausgiebigen liturgischen Feiern eine schlichtere Form des Betens vor; vielen gelang es, Arbeit und Gebet auf überzeugende Weise zu einer Einheit zu verschmelzen. Ihr Tageslauf war nicht derart zerhackt wie derjenige der Chormönche, die in kurzen Abständen von der Glocke zu den Stundengebeten gerufen wurden.
Unsere Konversbrüder standen gewöhnlich zur gleichen Zeit wie wir Chormönche auf. An hohen Feiertagen standen wir Chormönche früher auf, weil die nächtlichen Gesänge besonders ausgiebig waren. Da konnten sie etwas länger schlafen; nicht zuletzt deshalb hatten sie von den Chormönchen getrennte Schlafsäle.
Nach dem Aufstehen versammelten sie sich eine gute halbe Stunde lang im hinteren Teil der Kirche und jeder betete still für sich den vorgesehenen Teil des »Brüder-Offiziums«, während wir Chormönche unsere Vigilien sangen.
Das »Brüder-Offizium« war in genau die gleichen acht Tagzeiten aufgeteilt wie dasjenige der Chormönche, bestand jedoch nicht aus Psalmen, sondern jeweils aus einer bestimmten Anzahl von Vaterunsern, »Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist…« und Ave Marias: zu den Vigilien 20 Vaterunser und 20 »Ehre sei…« und 10 Ave Marias (an Sonn- und Festtagen doppelt so viele), zu Laudes und Vesper je 10 dieser drei Gebete, zu den übrigen Tagzeiten je fünf.
Nach dieser ersten Gebetszeit versammelten sich die Konversbrüder im »Laboratorium«, einem Arbeitssaal, in dem sie schweigend gemeinsam bestimmte Arbeiten verrichteten: Gemüse putzten, Besteck, Holzschuhe oder Werkzeug schnitzten, irgendetwas reparierten usw. Das dauerte nicht zu lange, denn kurz bevor wir Chormönche mit unseren Vigilien fertig waren, kam der Glöckner, um sie mit einem Zeichen wieder in die Kirche zu den Laudes zu rufen. Wieder betete jeder für sich an seinem Platz still die betreffende Anzahl Vaterunser usw., während wir Mönche die Laudes sangen. Nach den Laudes dienten die Konversbrüder bei den Einzelmessen der Priestermönche an den zahlreichen Nebenaltären; wer keinen Dienst hatte, nahm an der »Brüdermesse« teil, die ein Priestermönch in einer Kapelle hielt.
Die Brüder kamen während des weiteren Tages nur noch zweimal, gegen 6.15 Uhr zur Prim und um 18.30 Uhr zur Komplet, in die Kirche; nur sonntags waren sie bei allen Gottesdiensten anwesend. Werktags verrichtete jeder die übrigen vier Tagzeiten still für sich dort, wo er gerade bei der Arbeit war, wenn möglich dann, wenn die Glocke die Chormönche zur entsprechenden Tagzeit in den Chor rief. Arbeitete eine Gruppe von Konversbrüdern gemeinsam, zum Beispiel auf dem Feld, so unterbrachen sie beim Zeichen der Glocke die Arbeit. Die Brüder stellten sich in zwei einander zugewandten Reihen auf – so wie man im Chor in der Kirche stand – und beteten ihre Vaterunser, »Ehre sei …« und Ave Marias laut und abwechselnd im Chor.
Die Erfahrung, dass diese einfachere, aus vielen Mantra-artigen Wiederholungen bestehende Form des Gebets genauso, ja gelegentlich besser zur kontemplativen Vertiefung verhalf als die komplizierteren liturgischen Gebetszeiten, ist schon früh bezeugt. Zur Zeit Bernhards hatte ein Konversbruder, ein besonderer Marienverehrer, gehofft, am Fest Mariä Himmelfahrt am feierlichen Nachtgottesdienst teilnehmen zu können. Aber er wurde in dieser Nacht zum Hüten der Schafe in einiger Entfernung vom Kloster eingeteilt. Als er gegen halb zwei in der Nacht vom Kloster her die Glocke zum Beginn des Gottesdienstes läuten hörte, begann er unter freiem Himmel traurig allein seine »Vaterunser« und »Ave Maria« zu beten. Doch da wurde mit einem Mal sein Herz von so großer Freude und tiefer Erfahrung der Nähe Gottes und Marias erfüllt, dass er in lauten Jubel ausbrach und das Fest intensiver erlebte als alle in der Kirche Versammelten. Abt Bernhard erzählte das in einer Predigt allen Mönchen:
»Einer von unseren bescheidensten und einfachsten Konversbrüdern, der sich im Gehorsam gezwungen sah, dieses frohe Fest allein für sich in den Hügeln und Wäldern zu feiern, erlebte dort einen derart köstlichen, hingebungsvollen, feierlichen Nachtgottesdienst, dass keiner von uns hier, mochte er noch so in der Kontemplation geweilt haben und ins Gebet vertieft gewesen sein, auch nur im Entferntesten den Grad seiner Kontemplation erreicht hätte, der ihm in seiner Einfalt und Demut beschieden war.«
Brüder im »Laboratorium«
In diesem Bericht heißt es weiter: »Da staunten alle, aber vor allem staunten nicht nur, sondern freuten sich die Konversbrüder und wurden gewaltig ermutigt, denn oft hielt sie der Gehorsam an Feier- wie Werktagen bei verschiedenen Arbeiten fest. Damit wurde es ihnen zur Gewissheit, dass es bei der Gottesverehrung nicht auf Klausur und Kirchenmauer ankommt und die aus irdischer Notwendigkeit anstehenden Arbeiten kein Hindernis dafür sind, im Geist die Hände zu Gott zu erheben, sofern man nur aufrichtigen Herzens Gott zu dienen begehrt.«15
Es gab aus diesem Grund etliche Gebildete und Akademiker, die nach einer Karriere in der »Welt« schließlich das verborgene, ruhigere Leben im Stand der Konversbrüder demjenigen der Chormönche vorzogen.
Der Mönch Cäsar aus dem Zisterzienserkloster Heisterbach im Siebengebirge (er lebte um 1180 bis nach 1240) berichtet im 1. Buch seiner »Wundergeschichten« ausdrücklich, »dass einige bei ihrem Eintritt aus Demut Laienbrüder werden«:
»So groß ist die Macht der Demut, dass um ihretwillen oft Geistliche, die zum Orden kamen, sich für Laien ausgegeben haben. Sie wollten lieber das Vieh hüten als Bücher lesen, sie hielten es für besser, Gott in Demut zu dienen, als wegen der heiligen Weihen oder der Gelehrsamkeit den andern zu befehlen.«16
Eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die diesen Entschluss fassten, war der Theologe Alanus von Lille (ca. 1115 bis 1202/03); er verbrachte seine letzten Lebensjahre als Konversbruder in Cîteaux in der Landwirtschaft.
Als im Orden der Reformierten Zisterzienser, den Forderungen der Zeit gemäß, 1965 mit dem Dekret der »Unifikation« der Stand der Konversbrüder abgeschafft bzw. mit dem der Chormönche »vereinheitlicht« wurde, stürzte das viele Konversbrüder in eine schwere Krise. Manche legten weder ihr braunes Gewand ab noch beteiligten sie sich am Chorgebet, das – nicht zuletzt um dieser »Vereinheitlichung« willen – fast ganz vom Latein auf die jeweilige Landessprache umgestellt und verkürzt wurde.
Chormönche und Konversbrüder unterschieden sich durch die Farbe ihrer Kleidung, die ursprünglich aus ungefärbter Schafwolle bestand: für die Chormönche aus der Wolle weißer, für die Konversbrüder aus der Wolle brauner Schafe. Die weiße Wolle wurde nicht gebleicht, so dass sie meistens eher grau aussah. Deshalb wurden die Zisterzienser mit Vorliebe als die »grauen Mönche«, monachi grisei, bezeichnet.17
Der Schnitt der Kleidung war der gleiche. Sie bestand aus einem »Habit« (vom lateinischen »habitus«, »Kleidungsstück«), einem kurz über die Knöchel reichenden Rock mit langen Ärmeln. Er verfügte hinten am Kragen über einen großen Knopf, an dem man die beiden Enden eines öfter austauschbaren, ca. 15 Zentimeter breiten Kragenstreifens einknöpfen konnte. Darüber wurde das »Skapulier« gezogen (»scapulare«, vom lateinischen »scapulum«, »Schulter«), ein wenigstens 35 Zentimeter breiter, langer Stoffstreifen, der in der Mitte über eine Öffnung für den Kopf verfügte, an die eine Kapuze angenäht war, und über Rücken und Vorderseite über den Habit herabfiel; er war beidseitig ca. 10 Zentimeter kürzer als der Habit. Das Skapulier der Chormönche war schwarz, dasjenige der Konversbrüder von der gleichen braunen Farbe wie der Habit. Habit und Skapulier wurden mit einem ungefähr 5 cm breiten, naturfarbenen Ledergürtel zusammengehalten. Dieser Gürtel war ungefähr zwei Meter lang. Am Ende der einen Seite waren zwei lange Knopflöcher eingeschnitten, die andere Seite war ungefähr 80 Zentimeter weit in zwei Hälften aufgeschlitzt, an die im Abstand von zehn Zentimetern schmale Lederknoten angenäht waren, mittels derer sie sich in den beiden Knopflöchern befestigen ließen. Die beiden durchgefädelten Enden fielen an der linken Hüfte nach hinten herunter.
Im Chor und Kapitelsaal und nach Belieben in der Freizeit trugen die Chormönche ab ihrer endgültigen Gelübde (der »Feierlichen Profess«) die »Kulle« (bei den Benediktinern »Kukulle« genannt, lateinisch »cuculla«, »Obergewand«), ein weites Chorgewand mit in der Mitte ungefähr 3 Metern Umfang und mit einen guten halben Meter weiten langen Ärmeln, die bis 20 Zentimeter über den Boden herabfielen, jedoch im Chor gewöhnlich in viele Falten gerafft auf den Unterarmen getragen wurden. An die Kulle war eine ungefähr 30 Zentimeter tiefe Kapuze angenäht, die man über die etwas kleinere Kapuze des Skapuliers zog.
Die Konversbrüder trugen statt der Kulle einen bis kurz über den Boden reichenden Mantel-Umhang mit angenähter Kapuze. Er hatte auf Handhöhe beidseitig eine Innentasche, in die man die Hände steckte, um ihn damit vorne geschlossen zu halten.
Man gab dieser Kleidung im Lauf der Zeit etliche symbolische Deutungen, die alle etwas künstlich wirken. Vermutlich wurde sie von den ersten Zisterziensern, zu deren Zeit die Schafzucht und der Wollhandel eine große Rolle spielten, aus ziemlich pragmatischen Gründen gewählt: Sie hielten sich an einen überkommenen Kleiderschnitt und verwendeten den unbehandelten Stoff, den sie selbst herstellen konnten.
Ich kann allerdings bestätigen, was Ernesto Cardenal von der Kulle schrieb: Man stehe, ja schwebe in diesem weiten, wallenden Gewand wie in einer weißen Wolke.
Für die Konversbrüder war der uralte Brauch der frühen Wüstenmönche, die ja auch weitgehend »Laien« waren, verbindlich, nie den Bart zu rasieren, weshalb sie gelegentlich auch als »fratres barbati«, »bärtige Brüder« bezeichnet wurden. Die Chormönche dagegen durften keine Bärte tragen, sondern mussten sich mindestens einmal wöchentlich rasieren.
Das stellte übrigens eine bemerkenswerte Versöhnung zweier unterschiedlicher Traditionen dar, die bis heute fortleben. In den meisten orthodoxen Ostkirchen – denen der Griechen, Russen, Kopten, Armenier usw. – ist Mönchen, Priestern und Bischöfen das Tragen von Bärten vorgeschrieben; es gehört geradezu zu ihrer Identität – man denke etwa an die Mönche auf dem Berg Athos. Die »Lateiner« dagegen, die Angehörigen der römischen Kirche, führten für Klerus und Mönche schon früh den römischen Brauch ein, sich glatt zu rasieren. Darüber kam es im 6. Jahrhundert zu derartigen Kontroversen, dass Papst Gregor der Große schrieb: »Wenn die Heiligkeit vom Bart abhängt, dann ist niemand heiliger als der Ziegenbock.«18
Zu meiner Zeit war die Vorschrift bereits etwas gelockert, dass alle Konversbrüder einen Vollbart tragen mussten; aber im Wesentlichen hielt man sich noch an diese Ordnung. Konversbrüder wie Chormönche rasierten jedoch regelmäßig das Kopfhaar. Dieser Brauch der »Tonsur« hat sich umgekehrt bei den orientalischen Mönchen nur im Ritual der Mönchsweihe erhalten, wo man dem Kandidaten heute noch symbolisch mit der Schere eine winzige Haarsträhne abschneidet, obwohl er dann das Haar lang trägt.
Bei uns gehörte zum Ritus der Einkleidung die Tonsur in Form einer totalen Kopfrasur; die Chormönche trugen ab ihrer Feierlichen Profess (der endgültigen Mönchsweihe) die »Corona« (lateinisch »corona«, »Krone«), einen 2 cm breiten Haarkranz, den man bei der Kopfrasur stehen ließ.
Rasiert wurde der Kopf ungefähr jeden Monat, namentlich vor den höheren Feiertagen. Es gab eine genaue Liste mit 13 Jahresterminen: vor dem 1. Adventssonntag, vor Weihnachten, um Pauli Bekehrung (25.1.), um das Fest des heiligen Matthias (24.2.), usw. Nach der jeweiligen Großaktion sahen die Mönche immer »wie eine Herde frisch geschorener Schafe aus, die aus der Schwemme steigen« (Hoheslied 4,2). Bernhard ließ es sich nicht entgehen, darüber eine amüsante Predigt zu halten.19
Eine Zeit lang versah ich das Amt des Klosterfriseurs und kann mich wohl rühmen, einer der letzten zu sein, der diese Corona noch freihändig zu schneiden vermochte, ohne dass der Mönch anschließend aussah, als habe er einen nach hinten geschobenen Hut oder einen schrägen Heiligenschein auf. Was diese Prozedur betraf, waren die Mitbrüder ziemlich empfindlich.
Bis in die neuere Zeit rasierten sich die Chormönche nur alle acht Tage, kamen also fast immer mit jenem Stoppelbart daher, wie man ihn bei Abt Rancé auf einem seiner bekanntesten Porträts sieht. Zu meiner Zeit war ein »Rasierzimmer« eingerichtet, in dem für den ganzen Konvent an vier Stellen unter Spiegeln Elektrorasierer hingen, die man nach Belieben selbst benutzen konnte.
Die Chormönche waren bei Weitem nicht alle Priester. Da der Orden keine Seelsorge ausübte, sondern nur Priester für die eigene Gemeinschaft brauchte, die sich bei der Feier des Gottesdienstes abwechseln konnten und als Beichtväter für die Mitbrüder zur Verfügung standen, bestand grundsätzlich nur der Bedarf nach einigen wenigen Priestern.
Als allerdings im Spätmittelalter die Praxis der »Privatmesse« aufkam und für immer wichtiger gehalten wurde, ließen die Äbte möglichst viele Chormönche zu Priestern weihen, damit im Kloster täglich möglichst viele »Messopfer« dargebracht werden konnten. Bei uns im Kloster gab es mindestens 16 Nebenaltäre, auf denen morgens nach dem Nachtoffizium je ein Priester mit einem Konversbruder oder Novizen als Ministrant seine Privatmesse feierte. Der Zisterzienser Idung schrieb 1156: »Unsere Priester feiern ihre Privatmessen niemals mit nur einem Zuhörer«20, das heißt, es mussten wenigstens zwei Messdiener oder möglichst noch mehr dabei sein, was bei der damaligen großen Zahl der Konversbrüder kein Problem war. Dadurch wurde der Gemeinschaftscharakter auch dieser Messen gewahrt, die nicht als »privat« im heutigen Sinn galten, denn dieses Wort hatte ursprünglich eine andere Bedeutung. Auch von den Werktagen wurde bei uns als von »privatis diebus« gesprochen. Das lateinische Verb »privare« bedeutet nämlich »berauben«, und folglich waren »private« Messen oder Tage solche, die jeder Feierlichkeit »beraubt« bzw. entblößt waren.
In der Frühzeit der Zisterzienser lebten die Chormönche und Laienbrüder in zwei voneinander getrennten Bereichen je für sich. Bei uns waren beide Gruppen bereits etwas enger miteinander verzahnt. Nördlich vom Kreuzgang lag ein zweites Gebäudegeviert, in dessen Westflügel im Erdgeschoss sich das Skriptorium (der Aufenthaltsraum) und der Waschraum, im Obergeschoss der Schlafsaal der Brüder befanden (im Ostflügel lagen, symmetrisch in der gleichen Anordnung, die Räume der Novizen). Das Refektorium (den Speisesaal) hatten wir gemeinsam, während in den alten Zisterzienserklöstern die Brüder auch über ein eigenes Refektorium verfügten. Bei uns bekamen die Brüder zum Teil etwas kräftigeres Essen, weil sie schwerer körperlich arbeiten mussten.
Das Verhältnis von Chormönchen und Brüdern habe ich als ziemlich harmonisch erlebt. Das lag nicht zuletzt an der Rollenverteilung. Die Chormönche standen zwar im Chor vorne und leiteten, soweit sie Priester waren, die Liturgie. Dagegen waren die meisten Konversbrüder ausgebildete Handwerker und standen den Werkstätten vor. Zur praktischen Arbeit wurden die Chormönche den Konversbrüdern als Hilfsarbeiter zugeteilt und stellten sich in der Regel unpraktischer an als die versierten Brüder. Nur der Arbeitsvorsteher durfte sprechen, um kurz seine Anweisungen zu geben; die Chormönche mussten ihnen gehorchen und konnten nur durch Zeichen signalisieren, wenn sie etwas nicht richtig begriffen hatten.
Außerdem hatten die Konversbrüder finanziell und wirtschaftlich das Heft in der Hand. In manchen Klöstern erhielt der für die Ökonomie und Bauarbeiten maßgebliche Konversbruder sogar den Spitznamen »der braune Abt«, so zum Beispiel in den ersten Jahrzehnten Mariannhills der außerordentlich fähige – und seinem Abt loyale – Bruder Nivard, ein damals in ganz Südafrika angesehener Architekt und Ingenieur.21
Wenn unser Abt ausnahmsweise einmal verreisen musste – was er nur ungern und selten tat, aber gelegentlich war eine Äbteversammlung oder Verhandlung mit irgendwelchen Instanzen unvermeidlich – so begab er sich in die Buchhaltung zu Bruder Konrad, ließ sich von dem sagen und aushändigen, wie viel Geld er ungefähr brauchte, und lieferte nach seiner Rückkehr dem Bruder gewissenhaft seine Abrechnung und das Restgeld wieder ab. Oder es konnte geschehen, dass der Bruder, der einen Chormönch am Nachmittag zum Ausmisten des Kälberstalls angewiesen hatte, am selben Abend diesem Chormönch ein Zeichen gab, er wolle beichten, und mit diesem im Beichtstuhl im Kreuzgang verschwand. Dann kniete der Boss vom Nachmittag vor dem, den er befehligt hatte, und dieser übte sein Amt aus. Dieses ständige Hin und Her der Rollen schuf, soweit ich das erlebte, ein harmonisches Gleichgewicht.
Der Abt wurde von allen Mönchen auf Lebenszeit gewählt. Seine Amtszeichen waren ein Ring mit einem einfachen Stein (Abt Otto hatte einen polierten Kieselstein im Ring) sowie ein Brustkreuz an einer violetten Kordel, das nur aus Holz sein durfte; die Kordel fiel auf dem Rücken herunter und endete in einer Quaste. Bei sehr feierlichen Hochämtern und Amtshandlungen wie der der Entgegennahme der Profess eines Mönchs trug er einen Stab, der ebenfalls nur aus Holz war. Die ursprünglich nicht übliche, erst seit dem Spätmittelalter gebräuchliche Mitra wurde zu meiner Zeit kaum mehr verwendet.
Konversbruder Nivard Streicher (1854–1927), der »braune Abt« von Mariannhill
Abt Franz hatte eine Leidenschaft für das Holzspalten
Der Abt verfügte über ein Amtszimmer mit gepolsterten Doppeltüren, damit die Gespräche, die man darin führte, akustisch nicht störten. Wo man ihm über den Weg lief oder wenn man sein Zimmer betrat, macht man vor ihm eine tiefe Verbeugung, bei der man mit den Handflächen die Knie berührte. In seinem Zimmer kniete man sich unverzüglich auf den Boden und bat mit dem Wort »Benedicite« (»Sprecht den Segen«) um Sprecherlaubnis. Seine Antwort lautete: »Dominus« (»Der Herr [segne]«). Dann konnte man sein Anliegen vortragen. Zu meiner Zeit wurde man von den Äbten unverzüglich aufgefordert, aufzustehen oder sogar, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Wie die Stimmung gerade war, ließ sich daran ablesen, ob man sich kniend, stehend oder sitzend äußern konnte. Unser Abt hatte neben seinem Amtszimmer eine Kammer mit einem eigenen Bett. Das benützte er, wenn er länger aufgeblieben war und im Schlafsaal nicht mehr stören wollte, denn dort hatte auch er seinen normalen Schlafplatz.
Soweit es ihre besonderen Amtspflichten und Arbeiten zuließen, teilten unsere Äbte ganz das Leben der Mönche und nahmen so gut wie keine Privilegien in Anspruch, ja hatten den Ehrgeiz, ihren Mönchen ein Muster an »Regularität« zu sein. Abt Andreas hatte in Folge einer Kriegsverletzung eine verkrüppelte Hand. Wenn größere gemeinsame Arbeiten anstanden – etwa das Putzen von Zentnern von Bohnen – kam er mit einem Buch in den Arbeitsraum und las uns daraus vor. Abt Otto übernahm sämtliche Hilfsarbeiten vom Kloputzen bis zum Wäschesortieren und legte Wert darauf, während dieser Zeit dem zuständigen Konversbruder wortlos zu gehorchen.
Rugel musste in seinen Erinnerungen aus Oelenberg einräumen: »Es spricht viel für sich, dass alle geistlichen Oberen, die ich in meinem Kloster kennen gelernt habe, ausnahmslos alle klösterlichen Übungen und Lebensgewohnheiten mit dem letzten Novizen mitgemacht haben, Prioren und Äbte haben mit uns gearbeitet, gegessen und geschlafen. Sie haben dieselbe frugale Kost gehabt wie wir und sie haben wie wir anderen die Füße geküsst und ihre Mahlzeiten auf dem Boden genommen (das waren bestimmte Bußübungen nach Verfehlungen oder Missgeschicken, B.S.). Und da ihnen letzteres und manches andere natürlich niemand auflegen konnte, so haben sie es sich eben selbst aufgelegt. Da sie alles aus eigener Erfahrung kannten, so konnte man sich auch auf ihr Urteil verlassen. Es konnte einem gar nicht passieren, dass einem etwas aufgelegt wurde, was sie nicht selbst getan hätten, oder was die eigenen Kräfte überstieg. Das schaffte an sich schon zwischen Oberen und Untergebenen eine Atmosphäre stärksten Vertrauens. Und warum sollte ein Novize nicht schweigen, wenn der Prior das auch tat? Und warum sollte ein Anfänger nicht arm sein wollen, wenn sein Abt es genauso war, wie er selbst? Wenn etwas nicht recht gehen wollte, so konnte man es seinen Oberen abgucken, oder sie bitten, es einem zu erklären. Es ist mir im Kloster erspart geblieben, in die Hände von sturen Eiferern zu geraten. Meine Oberen blieben in allem verstehende und gütige Menschen und oft hat einem sogar ihr feiner und echt menschlicher Humor das Schwerste ertragen helfen. Ich kam einmal zu meinem Abt Franziskus Strunk und sagte ihm, dass ich viel unter ›gemütlichen‹ Depressionen zu leiden habe. Da sagte er schmunzelnd: ›Ei der Kuckuck, solche Depressionen möchte ich auch haben! Die meinen sind ekelhaft ungemütlich!‹ Und weg war meine Melancholie. Wenn ich heute auf meine Klosterzeit zurückblicke, dann muss ich sagen, dass ich in dieser langen Zeit nicht ein einziges Mal von meinem Oberen eine Behandlung erfahren habe, die ich nach meiner heutigen Auffassung als ein Unrecht oder gar als einen persönlichen Schimpf hätte betrachten können. Im Gegenteil. Ich muss feststellen, dass unsere Oberen, selbst nicht ganz unbedenklichen Verfehlungen gegenüber, zu allen Zeiten eine dem Fehlenden völlig entwaffnende und tief beschämende Milde und väterliche Güte an den Tag gelegt haben.«22