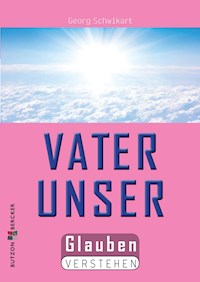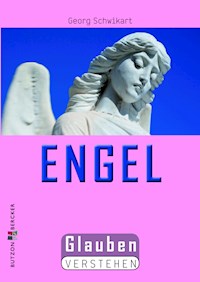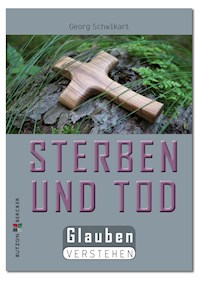Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nichts darlegen, nichts beweisen. Dieses Buch sammelt Momente des Alltags von einem, der erfahren hat: Gott sucht die Begegnung. Georg Schwikart fragt und staunt, bejaht und widerspricht, registriert Ansichten und Absichten seiner Mitmenschen und von sich selbst … und dazu braucht es nur wenige Worte, die er gleichsam unterwegs wie kleine Kostbarkeiten ausstreut: Betrachtungen, Gebete, Aphorismen, Erzähltes. Wer sie liest, darf einsammeln, von vorn oder von hinten kommend oder auf Umwegen durch das Buch wandernd, und dabei sensibler werdend für die vielgestaltige Wirklichkeit und für die Stimme eines jeden Augenblicks; jeder ist durchdrungen von der Gegenwart Gottes. Wie Hunde etwas von den Krümeln haben, die vom Tisch ihrer Herren fallen (Matthäus 15,27), so sind auch uns immer wieder kurze Annäherungen an das Unsagbare geschenkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Schwikart
Gotteskrümel
Georg Schwikart
Gotteskrümel
Annäherungenan das Unsagbare
Für die kritische Durchsicht des Manuskriptes danke ich Herbert Stangl und Kurt Hägerbäumer.
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2023
© 2023 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: www.wunderlichundweigand.de
Umschlagfoto: © lavsketch/shutterstock.com
Innengestaltung: Crossmediabureau
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05858-6
978-3-429-05252-2 (PDF)
978-3-429-06601-7 (ePub)
Inhalt
Eine Einleitung
Eine Einleitung
Es ist wahr: Du bist ein Gott, der sich verbirgt.
(Jesaja 45,15)
Zeit der Krisen: Corona, Krieg, Klimakatastrophen. Sexualisierte Gewalt als gesellschaftliches Problem. Unsere Demokratie muss sich behaupten. Anderswo verhungern Menschen oder fristen ein Dasein im Elend. Ist es angesichts all dieser Nöte nicht ein unnötiger Luxus, sich mit Gott zu beschäftigen?
Die Gottesfrage habe ich mir nicht ausgesucht. Sie begleitet mich, ob ich will oder nicht. Buchstäblich Tag und Nacht. Offensichtlich oder verborgen. Gott selbst verbirgt sich ja, zeigt sich jedoch ab und zu. Lässt von sich hören. Wirkt. Ist Ahnung. Gegenwart. Spürbar! Und wieder verschwunden.
Möge, wer diese Erfahrungen mit mir teilt, in meinen Notizen Anregungen finden, mit dem verborgenen Gott in Kontakt zu bleiben. Bei aller Fremdheit wagen wir doch das vertraute Du!
Sankt Augustin, am Ewigkeitssonntag / Christkönigsfest 2022
Georg Schwikart
Jesus kanzelt sie kühl ab: „Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen.“ Doch so schnell gibt diese tapfere Frau nicht auf; sie fleht um Hilfe für ihre besessene Tochter: „Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.“ (Matthäus 15,26–27)
Das ist meine Bitte, Gott: Lass auch mir ein paar Krümel über. Von dir.
Der liebe Gott ist gar nicht so lieb. Gott war nie allein der liebe Gott, sondern ebenso gewalttätig, eifersüchtig, nachtragend, unberechenbar. Auch barmherzig, ja. Gott ist ganz anders. Das macht es nicht leicht, mit ihm, mit ihr umzugehen. Alles, was ich Glauben nenne, mein Beten und Denken und Feiern, sind Annäherungen, nicht mehr. Von Gott könnte ich angemessen nur schweigen, doch das ist kaum auszuhalten. Vom Unsagbaren etwas zu sagen ist eigentlich sinnlos. Eigentlich aber auch sehr menschlich. Ich kann nicht anders.
Ich glaube an Gott als einer, der isst und verdaut, der zärtlich sein kann und brutal, sich intelligent und strohdumm anstellt. Ich bin mal gierig, mal bescheiden. Ich glaube als jemand, der die Macht von Sucht und Trieb kennt, der sich zusammenreißen und fasten kann. Ich bin gemein, großzügig, nachtragend, ein Träumer. Das Meiste vergesse ich. Was Liebe möglich macht, das ahne ich wohl, unterliege allerdings oft der Gleichgültigkeit. Mein Herz ist weich, hart, eng, weit, kalt, heiß … immerhin, es pulsiert. Ein Egoist bin ich, egozentrisch gar, depressiv, wohlgelaunt und voller Sehnsucht nach Leben. Ein Pessimist bin ich, ein Optimist, heiliger Sünder und sündiger Heiliger. Jeden Tag werde ich müde. Die Erschöpfung nimmt zu. Ich glaube an Gott als ein Mensch. Wie soll das funktionieren?
Josefine wurde erwartet! Von allen willkommen geheißen: ihren Eltern und Großeltern, den Tanten und Onkeln, der Verwandtschaft, der Patin, dem Paten, den Freunden der Eltern. Für Freitag war die Geburt ausgezählt. Am Morgen schlug ihr Herz nicht mehr. Am Samstag wurde Josefine still geboren. Ihr Sterbedatum liegt also vor ihrem Geburtsdatum. – Man muss nicht religiös sein, um zu protestieren: So soll es nicht sein! Dass eines von tausend Kindern in den letzten Wochen vor der Geburt stirbt, mag eine statistische Tatsache sein, aber sie lässt sich mit unserer Vorstellung von Wahrheit nicht in Einklang bringen: dass wir leben sollen!
Bei der Beerdigung ist es dann meine Aufgabe, Trost zu spenden; ich finde einen Ansatz dazu in Psalm 139,16: „Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet: die Tage, die schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war.“ Keiner von Josefines Tagen geht verloren. Nur, wir hätten sie so gern mit ihr geteilt.
Was hat Gott damit zu tun? Man könnte verrückt werden! Schon im nächsten Psalmvers heißt es sehr verständlich: „Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken!“
Am ersten Fastensonntag ist der Mythos vom Sündenfall der Predigttext. Ich spreche frei und beginne mit Josefine, die so erwartet wurde. Dann komme ich auf den Krieg, der so viele Menschenleben fordert. Laut Bibel sind wir selbst schuld; die Schlange hat gelogen, doppelt sogar: Wer von den verbotenen Früchten isst, wird nicht klug und muss doch sterben. Adam und Eva haben sich verführen lassen und sind nicht einmal bereit, die Verantwortung für ihre Schwäche zu übernehmen: „Die Frau war’s!“ – „Die Schlange war’s!“ Die Gemeinde horcht auffallend aufmerksam zu, es herrscht Spannung in der Kirche. Wir alle merken endlich mal wieder: Da geht es um mich.
„Denn er hat seinen Engeln befohlen über dich, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Felix Mendelssohn Bartholdy hat diesen Vers aus Psalm 91 (11–12) herzergreifend vertont, etwas fürs Gemüt. Das Versprechen bleibt indes Illusion, ja es wirkt wie Hohn, wenn – um im Bild zu bleiben – dein Fuß vom Felsbrocken zerquetscht wird.
Die Freundin reicht zum Frühstück belgische Waffeln, leicht angewärmt, mit Mascarpone und Marillenkonfitüre – ein Traum! Und kauend frage ich mich: Darf ich das genießen, wo doch Krieg ist in der Ukraine?
„Mach doch bitte, dass der Coronatest negativ ausfällt“, bete ich still – und schäme mich im gleichen Augenblick für solche Naivität. Aber, so will ich mich rechtfertigen, ich will doch am nächsten Tag nach Rom, ich freue mich so darauf, es ist schon alles bezahlt … was es nur noch schlimmer macht. Andere haben ganz anderes verloren, manche sogar ihr Leben, viele ihr Grundvertrauen, es werde schon gutgehen. Nein, das tut es nicht. Nicht immer.
Sitze ich im dunklen Loch, scheint mich die strahlende Sonne zu verhöhnen. Kalt lächelnd ignoriert sie meine Schwermut und verbreitet gute Laune. Ich misstraue ihr zutiefst. Und doch, wie gern würde ich ihrer Einladung ins Licht folgen.
Ein Psychologe erzählte mir einmal von einer depressiven Frau, die einen Suizidversuch hinter sich hatte. Er wollte mit ihr einen Spaziergang durch die leuchtende Mittagssonne machen. Seine Klientin empörte sich: „Wissen Sie denn nicht, dass die Sonne nur so strahlt, um mich zu quälen?“ – Ich musste lachen, als ich das hörte, aber es war ein bitteres Lachen. Die Frau tat mir leid: Wer alles auf sich persönlich bezieht, muss untergehen. Aber etwas von diesem verqueren Denken rumort auch in mir.
Heute habe ich eine Zigarre geraucht – nur um zu sehen, wie die Zeit vergeht.
Im kleinen Benediktinerkloster St. Romuald knie ich mit Kummer beladen vor dem ausgesetzten Herrn. Um innere Ruhe zu finden, richte ich meinen Blick auf die Monstranz. Es braucht eine Zeit, bis ich deuten kann, was ich da sehe: Durch die Hostie geht ein Riss! Von oben bis unten. Sie ist gebrochen. Mir kommen die Tränen. Es ist alles gesagt. Ich fühle mich verstanden. Welch ein Symbol für das Drama unserer Existenz.
Im Zimmer 16 des Krankenhauses übe ich mich in Demut. Als Patient wird über mich bestimmt. Die vier Männer, die hier schicksalhaft zusammenliegen, werden ihre Krankheiten überleben. Obwohl beim Bettnachbarn anscheinend die Diagnose das Komplizierteste ist: Magen-Darm oder doch Niere oder gar das Herz? Wie kann ihm geholfen werden, wenn die Ursache der Schmerzen unklar ist?
Zwar dankbar für ein alles in allem funktionierendes Gesundheitssystem, schwant mir, wie verletzlich wir alle sind. Wie endlich. Gesundheit ist ein Wunder, das zu wenig Achtung erhält. Das Alter sorgt für ihren Verlust, so will es der Schöpfungsplan. Ich bin nicht gefragt worden. Ich muss mich fügen.
„Ich bin immer allein. Ich bin immer verbunden.“ Der Therapeut schaut mich eindringlich an. Der erste Satz entspricht meinem Empfinden. Den zweiten muss ich mir zusprechen lassen. „Er gehört mit dazu, bedenken Sie das!“ Mein Kopf gibt ihm recht, mein Herz kann nicht Schritt halten.
Weil es so viel Leiden gibt, können manche nicht an Gott glauben. Ich verstehe sie. Was ist mit jenen, die trotzdem Vertrauen wagen? Wir leben doch in der gleichen Wirklichkeit. Wir deuten sie aber unterschiedlich.
Sie klopft nicht an, tritt einfach ein: „Hier bin ich mal wieder“, grinst sie herausfordernd. Ich liebe sie nicht, aber wir kennen uns schon so lange, gehören irgendwie zueinander. Also muss ich sie aushalten. Es gibt durchaus Tage, an denen ich mich in ihrer Anwesenheit suhle. Aber unterm Strich kann ich gern auf sie verzichten: die Melancholie.
„Am Ende der Geschichte fragt niemand mehr, warum unser Wir verlorenging, wohin das Vertrauen entwich, was aus der einstigen Nähe wurde, ja nicht einmal, ob wir uns überhaupt je geliebt haben.
Am Ende der Geschichte bleibt im besten Falle Dankbarkeit für gemeinsame Zeit. Unsere Erinnerungen werden sich allerdings nicht übereinbringen lassen, doch das stört uns nicht mehr.
Eigentlich gibt es keine Probleme. Was hindert uns also am unbefangenen Umgang miteinander? Vielleicht, dass ich noch unterwegs zum Ende der Geschichte bin und du schon da bist?“
Ihre Reaktion: „So ist es.“
Mich fröstelt.
Die Bilder von der zerstörten Klinik, die hochschwangere Frau auf einer Trage. Zerbombte Häuser, wie Gerippe. Alte Leute, humpelnd auf der Flucht. Vom Mann, der sich vor den herannahenden Panzer kniet. Die russische Redakteurin, die während der Hauptnachrichten ein handgeschriebenes Plakat in die Kamera hält: „Ihr werdet belogen!“ – Ich muss in diesen Wochen viel weinen vor dem Fernseher. In Sicherheit. Viele hundert Kilometer entfernt. Was macht Gott, noch mehr sehend als ich, ganz nah dran? Weint Gott auch?
Gott, schau auf unsere zerrissene Welt.
Sieh, was Menschen einander antun.
Wie durch Krieg Unheil über uns kommt.
Wir leiden mit jedem Opfer,
denn alles Lebendige ist miteinander verbunden.
Wir sehnen uns nach Frieden,
einem Frieden,
den die Welt sich selbst nicht geben kann.
Lass uns dem Unrecht und der Gewalt
entschlossen entgegentreten.
Segne alle Bemühungen,
die Waffen schweigen zu lassen.
Schenke den Mächtigen Einsicht und Weisheit.
Steh den Opfern bei und
rühre unsere Herzen an,
dass auch wir ihnen beistehen.
Ohne dich sind wir verloren.
Dir allein vertrauen wir uns an.
Du bist unser Friede.
Die Öffentlichkeitsbeauftragte bittet mich um ein Friedensgebet für die Homepage meiner Gemeinde. Dringend. Ich google ein wenig, nichts gefällt mir. „Mach