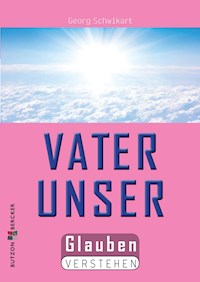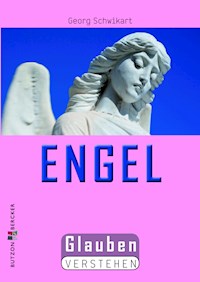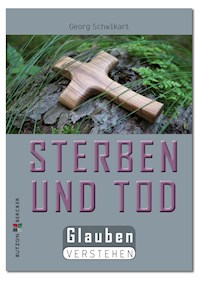Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Religiöse Pluralität: Oft als "Patchwork-Religion" verteufelt, ist dieses Buch ein Lob auf die spirituellen Möglichkeiten unserer Gegenwart. Wie nie zuvor stehen Inhalte verschiedener Religionen und Konfessionen zur Verfügung, auch immer mehr Christen wollen mehr als nur die eine Wahrheit. Der Theologe Georg Schwikart zeigt, was diese Situation für uns ist: die Chance zu einem tieferen, weil bewussteren Glauben, und einem authentischen spirituellen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Schwikart
Prüft alles,behaltet das Gute
Selbst entscheiden,was man glaubt
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand
Umschlagmotiv: © fotochab/fotolia.com – © Miloje/shutterstock.com
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-80176-1
ISBN (Buch) 978-3-451-32809-1
Für Theresia und Lukas
Inhalt
Prüft alles und behaltet das Gute
Einladung zur Expedition
Das Pantheon-Syndrom – oder: Synkretismus ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts
Die Kirchen meiner Kindheit
Wo Gott sonst noch wohnt
Das Pantheon: ein Ort für jeden Gott – bis heute
Da glaubt sich was zusammen!
Was ist Synkretismus?
Abgrenzung und Beeinflussung
Eine Religion im Wandel
Die Angst vor der Beliebigkeit
Zweifeln heißt nicht nicht glauben – oder: Warum Fragen erlaubt sein muss
Was ist Wahrheit?
Der Zweifel – ein schweres Erbe
»Wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm«
Wer bin ich?
Wissenschaftlicher Zweifel – Motor für die Zukunft
»Wozu sind wir auf Erden?«
Das Credo der Moderne – oder: Kann man heute noch von Gott sprechen?
Abhandengekommener Glaube
Gott als Selbstbeschränkung
Kritik an Gott hat Tradition
Atheisten und die Sehnsucht nach Gemeinschaft
Höher als die Vernunft
Kleines Lexikon der Religionen – oder: Wie Menschen über Gott reden und denken
Sinn-stiftend – Religionen und ihr »Sitz im Leben«
Viele Götter
Ein Gott
Das Göttliche
Gott begegnen und erfahren
Mythos – Wahrheit oder Unsinn?
Die andere Wahrheit
Die Welt, in der wir leben – oder: Heute ist nicht gestern
Noah und die »Sündflut«
König Gilgamesch
Orpheus, Euridike und Co
American Dream und die Spinne in der Yuccapalme
Warum Gott keinen Bart hat – oder: Was ist Theologie?
Verschiedene Theologien – ein Gott
Allmächtiger Gott?
Weder Frau noch Mann
Ganz anders
Gott, der Alleine
Gott erfahren – aber wie?
Wo und wie ist Gott anwesend?
Von Zeichen und ihrer Wirkung
Rituale – überholtes Getue oder Kraftspender der ganz anderen Art?
Firmung, Konfirmation, Jugendweihe
Die bunte Welt der Riten
Messe und Gottesdienst
Mythos und Ritual – Huhn oder Ei?
Wegweiser und Hilfe für Lebensübergänge
Alltag und Fest
Rituale haben das »Mehr«
Stolperfallen – oder: Von und zu Gott reden
Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen
»Ich bete jetzt – braucht noch jemand was?«
Engelwelten
Gedanken über das Jenseits
Bei Mama schmeckt’s am besten – oder: Was es beim Blick über den Tellerrand alles zu entdecken gibt
Warum Purismus arm macht
Was die Kirche von der Küche lernen kann
»Christlich« ist kein Qualitätsmerkmal
»Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg«
Neue Antworten auf alte Fragen finden – oder: Was Menschen heute wirklich brauchen
Theologie – gibt’s die auch in alltagstauglich?
Warum es bei schwierigen Fragen auch einen schwierigen Gott braucht
Innerhalb der Kirche kein Heil?
Glauben kann man nicht messen
Wer ist der »Hirte« in meinem Leben?
Selbstgestrickt
Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, nicht untergehen lassen – oder: Kirche heute
Kirche heute – der »heilige Rest« und die vielen Frustrierten
Kein Ja und Amen
Die Suchenden
Den Menschen nicht vorschreiben, was sie zu glauben haben
Nicht ohne den anderen glauben
Im Supermarkt der Religionen
Interreligiöser Dialog
Aus dem Vollen schöpfen – oder: Warum Interreligiosität ein Mehr und nicht weniger ist
Der Faszinierende
Das Gemeinsame finden, statt das Trennende hervorzuheben
»Wahrheit durch Beziehung«
Anachronismus Ökumene
»Gott ist größer als unser Herz«
Der litauische Klappaltar
Zitatnachweis
Prüft alles und behaltet das Gute
Heinz, der Malermeister, erzählte mir auf der Straße in seinem rheinischen Singsang, er wäre unlängst plötzlich schwer erkrankt und habe sich einer Notoperation unterziehen müssen. Im Krankenhaus dann (und das sagt er mit großen Augen, die meine Reaktion abschätzen wollen) betete er: »Zu Jesus, zu Mohammed, zu Buddha – dat war mir janz ejal.« Er ist gesund geworden. Und ich beruhigte ihn: »Tu, was dir guttut.«
Heinz ist nicht allein mit seiner Haltung. Immer größer wird die Zahl derer, die die Grenzen des Christentums überschreiten. Sie wählen nicht nur aus, was sie aus ihrer hergebrachten Religion beibehalten und was sie über Bord werfen wollen. Sie schauen sich auch um, was andere anzubieten haben, und integrieren einzelne Elemente daraus in ihre Religiosität.
Die Kirchen – als institutionalisierte Religion – finden das gar nicht gut. Ich hörte im vergangenen Jahr eine Predigt, in der genau dieses Verhalten kritisiert wurde: »Wie kann man als Christ eine Buddhafigur im Regal stehen haben, in die indianische Schwitzhütte gehen oder an Kursen über islamische Mystik teilnehmen?« Als echte Frage wäre das interessant. Dann könnte man nämlich sehen, ob es eine Antwort darauf gibt. Möglicherweise können diejenigen, die ihren Glauben durch Versatzstücke aus anderen Kulturen bereichern, gar nicht ausdrücken, warum sie das tun. Doch wahrscheinlich ist die Formulierung »Wie kann man …« gar keine Frage, sondern reine Rhetorik, also ein Vorwurf im Sinn von: Wie kann man nur, was man nicht darf! Wir stellen allerdings fest: Man kann als Gläubiger jeder Religion offensichtlich Dinge miteinander kombinieren, die für die Theologie unvereinbar erscheinen. Und so läuft die Rüge von der Kanzel ins Leere. Glaube lässt sich nicht mehr von oben verordnen.
Die Welt ist ein Markt der Möglichkeiten geworden, auch im Bereich des Glaubens. Das Christentum eignet sich für viele heute nicht mehr als allein seligmachend; sie stricken sich eine Patchwork-Religion zusammen. Das Fachwort dafür lautet: Synkretismus. Das klingt irgendwie ganz schlimm, wie eine Krankheit. Aber so schlimm ist es gar nicht. Das Christentum selbst ist durch seine Bereitschaft, sich ursprünglich Fremdes anzueignen, zur Weltreligion avanciert. Nur scheint immer irgendwann der Zeitpunkt erreicht zu sein, da man von offizieller Seite her annimmt, nun sei es aber genug, die Lehre vollkommen, der Ritus perfekt und überhaupt keine Frage mehr offen. Ab dann heißt es bewahren und das Überlieferte verteidigen gegen die Einflüsse der Zeit, die aber bekanntlich nicht stillstehen will.
Doch die Gläubigen glauben, was sie wollen. Mit dem Wegfall der Zuchtmittel (Ketzer werden nicht mehr verbrannt) und im Zuge der allgemeinen Globalisierung entdecken immer mehr Menschen, dass es eigentlich schade wäre, den ungeheuren Reichtum der religiösen Erfahrung der Menschheitsgeschichte ungenutzt zu lassen.
Fakt ist: Diese Entwicklung nur zu kritisieren ist banal. Sie ruft nicht nach Bekämpfung, sondern nach Auseinandersetzung. Die Religion ist in der Tat ein weites Feld wie die Liebe auch. Wenn wir uns aber vorurteilsfrei dem Phänomen des Synkretismus widmen, werden wir dabei auch die ungeahnten Chancen entdecken, die mit der neuen Offenheit einhergehen. Die Entwicklung wird weitergehen, ob wir wollen oder nicht. Und sie wird die Kirche verändern. Gestalten wir diese Veränderung doch mit! Die Glaubenden wollen selbst entscheiden, was sie glauben.
Ich nähere mich diesem Phänomen im Folgenden an, mit meinen eigenen Gedanken, Fragen und Erfahrungen und denen anderer Autorinnen und Autoren. Natürlich kann man die Sache auch anders sehen, aber meiner Ansicht nach ist die Hauptsache doch, dass wir Christen in einen aufrichtigen Dialog eintreten: untereinander, in der eigenen Konfession, mit den anderen Kirchen und Religionen und auch mit denjenigen, die nicht glauben. Alle haben etwas zu sagen.
Über meinem Schreibtisch hängt ein Kruzifix, das ich als junger Mensch in Assisi erworben habe: ein starkes Symbol für meinen Glauben – aber nicht das einzige. Der Apostel Paulus rät selbst: »Prüft alles und behaltet das Gute!« (1 Thessalonicher 5, 21). Diese Fähigkeit hat das Christentum durch die Zeiten gebracht und wird es auch weiterhin tragen. Christ sein heißt: unterwegs sein. Machen wir uns auf!
Sankt Augustin, am Neujahrsfest 2015
Georg Schwikart
Für konstruktive Kritik am Manuskript danke ich aufrichtig Ursula Schairer, Stefan Zimmer und Marlene Fritsch.
Einladung zur Expedition
Wer selbst entscheiden will, was er glaubt, muss erst einmal wissen, was es alles zu glauben gibt. Es ist wie im Gasthaus nach dem Studium der Speisekarte: Man muss sich entscheiden. Möglicherweise lässt sich ein Gericht abändern oder mit einem anderen kombinieren. Aber alles kann man nicht bestellen. Im Reich der Religion kann man auch nicht alles glauben. Manche Vorstellungen lassen sich kaum angleichen oder widersprechen sich sogar. Vieles ist sich aber auch zum Verwechseln ähnlich.
In diesem Buch lade ich die Leserinnen und Leser zu einer Reise in die Welt der Religion ein. Es wird eine Expedition! Wie wir von fernen Ländern bestimmte Bilder im Kopf haben, bevor wir jemals dort waren, so sind wir auch von Vorstellungen über die Religion an sich und über die einzelnen Religionen geprägt, bevor wir uns näher damit beschäftigt haben.
Religionen sind sehr unübersichtliche Erscheinungen. Zahlreiche Faktoren bestimmen das Erscheinungsbild dessen, was wir Glauben nennen. Da geht es beispielsweise um Psychologie, um Wahrheit, um Glück, um Regeln und Zeremonien, um das Verständnis von Sprache und Symbolen, um ein gutes Leben auf der Erde, um den Zugang zum Himmel und um Gott, der sich »offenbart«, also zu erkennen gibt.
Einige Glaubensvorstellungen mögen wir als völlig unverständlich und absurd ablehnen. Andere erscheinen uns plausibel und nachvollziehbar – wahrscheinlich jene, an die wir uns einfach gewöhnt haben. Bedenken wir: Alles, was geglaubt wird, ist unter spezifischen Bedingungen entstanden, das heißt: in einer bestimmten Zeit, unter bestimmten politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Glaubensinhalte haben immer zu einer bestimmen Zeit Antworten auf drängende, meist existenzielle Fragen gegeben. Es kann aber sein, dass wir heute diese Fragen nicht mehr stellen und daher mit den Antworten auch nichts mehr anfangen können.
Zur Grundausstattung unserer »Reise« benötigen wir daher zunächst Offenheit für das Neue und Fremde, allerdings auch für das Alte, das wir zu kennen meinen. Forschungsreisen sind keine Spaziergänge in lauer Sommernacht. Wir werden bestimmt auch auf wenig Angenehmes stoßen, auf Anstrengendes, Langweiliges. Die Auseinandersetzung mit dem Glauben macht Mühe – mitunter die Mühe auszuhalten, dass wir etwas nicht verstehen. Doch so etwas wie beispielsweise die Dreifaltigkeit Gottes kann man nicht verstehen, wie man die Funktionsweise eines Hubschraubers begreift. Es gibt Dinge, da bleibt nur das Aushalten, auch das Aushalten mehrerer Entwürfe, die uns je auf ihre Weise Gott und das Leben erklären wollen. Diese Vielfalt muss uns nicht gleichgültig lassen, doch warum sollte es nicht gelingen, sie gleich gültig sein zu lassen?
Ich höre bereits die Warnung, hier drohe »religiöser Indifferentismus«. Einige Menschen geben vor, genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Sie wissen zum Beispiel, welche Frage eine unbedingte Entscheidung verlangt, etwa die nach dem einzig wahren Glauben. Papst Gregor XVI. verurteilte den Indifferentismus als »jene verkehrte, allenthalben durch die Täuschung der Bösewichte verbreitete Meinung, man könne mit jedem beliebigen Glaubensbekenntnis das ewige Seelenheil erwerben, wenn man den Lebenswandel an der Norm des Rechten und sittlich Guten ausrichte«. Der Alte Fritz, König Friedrich der Große von Preußen, hingegen konnte großzügig bescheiden, jeder solle »nach seiner Façon« selig werden.
Mit Leidenschaft haben sich die Religionen aller Couleur in ihrer Geschichte mit dem rechten Glauben auseinandergesetzt, was aber immer auch bedeutete: Man grenzte sich vom »falschen« Glauben ab. Das Stichwort lautet: Irrlehre. Jene, die solchen anhingen, wurden ermahnt, zwangsmissioniert, ausgeschlossen, vertrieben, getötet. Ehrlicherweise müssen wir für das Christentum feststellen, dass mindestens drei Viertel aller Christen heute nicht (mehr) das glauben, was die Theologen streng genommen für dogmatisch richtig halten. Doch bereits innerhalb der Theologie wuchern die wildesten Entwürfe durcheinander. Die Bibel kann nur bedingt als Korrektiv fungieren, denn welche Autorität sie besitzt, ist an sich schon ein heißes Thema.
Wen aber interessiert noch Theologie? Längst findet der Auszug der Gläubigen aus den kirchlichen Strukturen statt. Es sind nicht Einzelne, die in der Kirche heimatlos geworden sind, das ist mittlerweile vielmehr der Normalzustand. Traditionsabbruch heißt das Schlagwort, das uns klarmachen soll: Es wird in Zukunft immer schwerer werden, innerhalb des Christentums zu glauben.
Ich wurde 1964 geboren. Damals gab es noch eine Volkskirche, das heißt: Kirche war eine lebensgestaltende Kraft. Diese Kirche konnte ich lieben, auch an ihr leiden. Ich konnte mit ihr streiten und daran arbeiten, sie zu verändern. Heute finden Menschen kaum noch diesen Zugang. Sie betrachten nicht die großartige Idee von Kirche, sondern ihre ernüchternde Wirklichkeit, und wenn sie keinen Mehrwert verspricht, wenden sie sich ab.
Das bedaure ich. Ich möchte alle Enttäuschten einladen, sich innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft – frei nach Kant – ihres eigenen Glaubens zu bedienen. Wie in der Medizin: Was hilft, hat recht.
Eigentlich seltsam, dass sich im Christentum eine Enge entwickeln konnte, wo doch Jesus selbst eine bemerkenswerte Weite an den Tag legte. Als der Hauptmann von Kafarnaum Jesus bittet, seinen Diener zu heilen, ist der Messias überrascht: Da wagt es ein Römer, ein Besatzer, ein hoher Militär und dazu noch ein »Heide«, dem kleinen jüdischen Rabbi eine Bitte vorzutragen. »Als Jesus das hörte, staunte er und sprach zu denen, die ihm folgten: Amen, ich sage euch: Bei niemand in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Ich sage euch: Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch liegen. Die Söhne des Reiches aber werden hinausgestoßen in die Finsternis draußen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein« (Matthäus 8,10 –12). Der Diener wurde übrigens gesund. Aber niemand sollte sich zu sicher fühlen, auf dem richtigen Glaubensweg zu sein. Auf einmal lassen sich Leute von Osten und Westen am Tisch nieder – und wir dachten doch, die Plätze seien für uns reserviert!
Brechen wir daher auf! Ich möchte zur Debatte anregen, erklären, provozieren, meine Ansicht darlegen in dem Bewusstsein, dass es nur meine persönliche Perspektive auf das große Mysterium des Glaubens ist. Ich bin jedoch überzeugt, dass sich die Christen in der Vergangenheit zu sehr damit beschäftigt haben, den Glauben definieren zu wollen. Es kann sein, dass es am Ende gar nicht um die Orthodoxie, also die wahre Lehre geht, sondern um die Orthopraxie, also das richtige Tun. Es kann auch sein, der Herr spricht »An jenem Tage« so, wie der Dichter Joachim Dachsel:
An jenem Tage,
der kein Tag mehr ist – vielleicht wird er sagen:
Was tretet ihr an
mit euren Körbchen voller Verdienste,
die klein sind wie Haselnüsse
und meistens hohl?
Was wollt ihr
mit euren Taschen voller Tugenden,
zu denen ihr gekommen seid
aus Mangel an Mut,
weil euch Gelegenheit fehlte,
oder
durch fast perfekte Dressur?
Hab ich euch davon nicht befreit?
Wissen will ich:
Habt ihr die anderen
angesteckt mit Leben
so wie ich euch?
Das Pantheon-Syndrom – oder:Synkretismus ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts
Die Kirchen meiner Kindheit
Die Kirche meiner Kindheit war schlicht. Einerseits das Gotteshaus selbst: ein zwischen 1958 und 1960 erbauter, ziemlich quadratischer, an den mittelalterlichen Kirchturm angefügter Backsteinbau, der eine kleinere Vorgängerkirche aus dem 19. Jahrhundert ersetzte. Im seinerzeit noch weiß gehaltenen Inneren dominierte ein großzügiger, erhöhter Altarraum. In der schmalen Apsis prangte ein Kruzifix mit einem Jesus in lebensechten Proportionen. Der Herr schien schon erlöst zu sein, als wäre er bereits auferstanden, denn kein Schmerz quälte sein sanftes Antlitz. Übrigens trug er nur einen schmalen roten Lendenschurz, den die Leute dort auch gern als »Badehose« bezeichneten.
Andererseits war damals auch mein Begriff von Kirche als Glaubensgemeinschaft schlicht: katholisch sein als Normalfall. Eine Pfarrgemeinde, die mit den Gottesdiensten und Festen den Lauf des Jahres gestaltete; eine Lehre, die mir öffentlich erklärte, doch auch subkutan einimpfte, wie Gott ist und was er will, was wir Menschen zu glauben, zu tun und zu lassen haben. Ein perfektes System, das keine Frage offen ließ.
Kirche – damals verstand ich sie nicht als außergewöhnliches Ereignis, sondern als selbstverständlichen Teil meiner Lebenswirklichkeit. Kirche und Glaube waren zwei Begriffe, von denen der eine nicht ohne den anderen gedacht und gebraucht werden konnte. Sie waren für mich Synonyme: zwei Wörter, die deckungsgleich sind. Mit einer solchen religiösen Sozialisation gehört man heutzutage einer aussterbenden Art an.
Mit vierzehn begegnete ich dann dem Protestantismus, der sich in meinem Heimatort in einer ambitionierten Sichtbetonkirche aus den Siebzigern darbot. Sie war faszinierend anders. »Bunker« nennt man dort das trutzige Bauwerk, eine Art zeitgenössischer Fortsetzung der Reformationshymne: »Ein feste Burg ist unser Gott«. Allein, dass in diesen kühlen, grauen Mauern vor der Revision der Lutherbibel von 1984 noch eine seltsam altertümliche Sprache in Schriftlesung und Liturgie Verwendung fand, irritierte mich als Jugendlicher. Aber die Sitzkissen waren grün und die Lampenschirme (wenn ich mich recht erinnere) orange, ein Variationsreichtum an Farben also, der mir den Pluralismus der Evangelischen versinnbildlichte.
Wie mir erging es Millionen anderer in unserem Land, die in Nachkriegskirchen in das Christentum hineinwuchsen. Viele alte Gotteshäuser waren zerstört worden und mussten in kürzester Zeit durch neue ersetzt werden. Zudem wuchsen die Gemeinden in diesen Jahrzehnten noch, man brauchte Platz für die Gottesdienstteilnehmer. Doch nicht allein den klammen Finanzen sind die Resultate geschuldet: Viele Kirchen, katholische wie evangelische, gleichen eher Schwimmbädern oder Fabrikhallen. Manche lassen noch eine sakrale Funktion erahnen, andere betonen offensiv den pragmatischen Charakter ihrer Gestaltung – Versammlungsräume eben. Diese Kirchen wirken mitunter so, als wären sie sich unsicher, wofür sie stehen, als würden sie sich verschämt anpassen, um nicht zu sehr aufzufallen. Wenn, wie ich oben sagte, Glaube und Kirche übereinstimmen, dann drücken diese Bauten aus, wie langweilig und trostlos es dort zugehen muss.
Wo Gott sonst noch wohnt
Natürlich, die Vorstadt- und Dorfkirchen früherer Zeiten sind auch nicht gerade architektonische Meisterleistungen, und ohnehin kann kein einzelner Kirchenbau alle Aspekte des reichen Schatzes christlicher Kirchen- und Glaubensgeschichte transportieren. Umso mehr beeindrucken jene Sakralbauten, die seit Jahrhunderten einfach durch ihre Präsenz eine bestimmte Seite des christlichen Glaubens bezeugen. Aus den römischen Markthallen ging die Form der Basilika hervor, Kirchen in der Bauweise der Romanik stehen für Festigkeit in unsicheren Zeiten, die gotische Variante strebt zum Himmel und lässt das Licht durchbrechen. Der Barock wagt es zu spielen.
Auch wer keinerlei Fachwissen über Kirchengeschichte und die Historie des Kirchenbaus hat, spürt doch schon beim Betreten einer Kirche ihre Aura, ihre Botschaft. Im wuchtigen Kölner Dom fühlt der Mensch sich klein. Macht das Gott größer? In der Dresdner Frauenkirche betritt man das Wohnzimmer des Allmächtigen (wenn man sich Gott als vornehmen Adeligen vorstellt). Die Wallfahrtskirche von Le Corbusier in Ronchamp vermittelt Geborgenheit, das in dunkelblaues Licht getauchte Achteck der Kaiser-Wilhelm-Ge- dächtniskirche in Berlin sogar das Angebot von Transzendenz. Der Petersdom in Rom schließlich präsentiert sich als Inbegriff von Macht und Herrlichkeit – des Herrn oder der katholischen Kirche?
Dabei ist Gott uns an jedem Ort auf dieser Welt nah. Er wohnt, wo man ihn einlässt, wie Martin Buber sagt: am Meer oder in den Bergen, in der Wohnung im vierten Stock der Neuen Heimat wie auch im zugigen Bauernhaus eines sterbenden Dorfes; am Esstisch, im Bett, auf dem Klo. Es liegt an uns, den angebotenen Kontakt aufzunehmen. Dafür kann eine Kirche hilfreich sein. Ein Raum, der nicht ablenkt, sondern hinführt zu Gott. Deswegen sind offene Kirchen so wichtig, sie laden ein, still zu werden und im Trubel des Daseins auf Gott zu lauschen. Wenn allerdings in den Kirchen Gottesdienst stattfindet, dann ist Gotteserfahrung nicht immer leicht. Zu viele Worte. Zu wenig Schweigen in seiner Gegenwart.
Das Pantheon: ein Ort für jeden Gott – bis heute
Eine Kirche, in der indes sehr selten geschwiegen wird und die heute eher einem Rummelplatz gleicht, symbolisiert die Situation der Religion unserer Tage vortrefflich: das Pantheon in Rom. Der römische Feldherr Agrippa besiegte im Jahr 27 v. Chr. die Perser und ließ aus Dank einen Tempel »für alle Götter« bauen; der griechische Ausdruck dafür ist Pantheon. Nach einigen Zerstörungen wurde um das Jahr 120 n. Chr. auf den Grundmauern dieses Gebäudes von Kaiser Hadrian ein neuer Tempel errichtet, das Pantheon, wie wir es heute kennen. Es gilt als das besterhaltene Zeugnis antiker Baukunst.
Die gelungenen Proportionen sind eine architektonische Meisterleistung: Der Durchmesser der Kuppel entspricht ihrer Innenhöhe: etwa 43 Meter. Der runde Bau steht für die Unendlichkeit der darin verehrten Götter. Das fensterlose Gebäude empfängt Licht nur durch ein Loch in der Kuppel. Erschauernd blickt der Mensch auf: Neun Meter Durchmesser soll diese Öffnung haben? Man glaubt es kaum.
Alle Götter genossen also Verehrung im Pantheon und die Menschen im antiken Rom kannten eine ganze Menge davon. Die Römer waren überzeugt, dass alle Bereiche des Lebens unter göttlichem Einfluss stünden.
Was ihren Götterhimmel angeht, so waren sie nicht besonders wählerisch; viele Götter sind den entsprechenden griechischen Gottheiten angeglichen worden, dazu kamen später noch einige orientalische wie Isis, Epona und Baal. Wenn die Römer fremdes Territorium unterworfen hatten, praktizierten sie in den eroberten Tempeln das Ritual der evocatio, der Herausrufung: Die römischen Priester wandten sich an die fremden Götter und forderten sie auf: »Lauft zu uns über, dann verehren wir euch weiter!«
Und so lässt sich schon hier erkennen, wie einfach es zumindest für die Römer oft war, die Vorzüge und Traditionen anderer Religionen in die eigene zu übernehmen: Der höchste Gott war Jupiter, der dem griechischen Zeus ähnlich ist. Juno, seine Gattin, ist wie die griechische Hera Beschützerin der Frauen, der Ehe und der Familie. Wie ihr griechisches Vorbild Athene ist Minerva die Göttin der Kunst und der Wissenschaft. Der griechischen Göttin Artemis entspricht die römische Diana (Göttin der Jagd), der Aphrodite die Venus (Göttin der Liebe). Der griechische Hermes, der Götterbote und Gott des Handels, wurde von griechischen Kaufleuten nach Rom eingeführt und heißt hier Merkur; der römische Meergott Neptun entspricht dem griechischen Poseidon. Ceres, griechisch Demeter, ist die Göttin der Fruchtbarkeit, Bacchus, griechisch Dionysos, der Gott des Weines.
Religion bedeutete für die Römer vor allem die genaue Einhaltung von Vorschriften. Der Wille der Götter wurde aus Vorzeichen gedeutet; so lasen die Auguren aus dem Flug der Vögel günstige oder ungünstige Möglichkeiten ab; ein Brauch, den die Römer von den Etruskern übernommen hatten. Kultische Handlungen waren vor allem Opfer (Speisen, Schlachttiere) und Gebete.
Viele Rituale wurden vom Familienvater (Pater Familias) zelebriert; es gab aber auch ein staatliches Priestertum. Dazu gehörten die Vestalinnen, die das heilige Feuer im Tempel der Vesta hüteten; die kärglichen Überreste dieses Tempels sind auf dem Forum Romanum zu besichtigen. Der höchste römische Priester trug den Titel Pontifex Maximus, der auf die Kaiser und schließlich auf die Päpste überging. Auch Kaiser konnten in den Götterstatus erhoben, »vergöttlicht« werden.
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts wandelte man nun das Pantheon in eine Kirche um und weihte sie der »Heiligen Maria zu den Märtyrern«. Halten wir fest: Ohne christliche Besitzname wäre das Pantheon wohl zerstört worden wie andere »heidnische« Tempel.
Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Pantheon immer wieder geplündert und beschädigt, einzelne Teile wurden demontiert und anderweitig verwendet. Man beraubte es seines wertvollen Schmucks: die vergoldeten bronzenen Dachziegel wurden eingeschmolzen und nach Konstantinopel gebracht; den Bronzebeschlag der Vorhalle (geschätzte 25 Tonnen) ließ Papst Urban VIII. für Kanonen und für den Bronzebaldachin über dem Hochaltar von St. Peter verwenden. Nur die großen bronzenen Eingangstüren sind noch im Original erhalten.
Dieser besondere Tempel färbt auf seine Umgebung ab, vor allem auf die Piazza della Rotonda, den Platz vor dem Pantheon. Hier wird die Nacht zum Tag, das Leben zum Fest. Wer je das Glück hatte, an dieser Stätte einen Septembernachmittag im Kreis lieber Menschen verbringen zu dürfen, dem brennen sich diese Stunden ein Leben lang ein. Mögen die Cafés hier in der Altstadt auch stillschweigend einen erheblichen Sehenswürdigkeitenzuschlag auf die Preise erheben – wie herrlich ist es doch, an solch einem geschichtsträchtigen Ort zu verweilen!
Hinter dem Pantheon handeln einige Läden – mit der gebotenen Zurückhaltung, aber deswegen nicht weniger geschäftstüchtig – mit speziellem Bedarf für Nonnen und Priester. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt auch hier: Soutanen, Messgewänder, Bischofsstäbe, Kelche, Behälter für Weihwasser, Käppchen für Kardinäle, Bauchstricke für Mönche, Heiligenfiguren oder wärmende Leibhemdchen für betagte Ordensfrauen. Der Fachhandel hat alles am Lager. Religion hat eben eine Innen- und eine Außenseite, sie kennt das Heilige und das Profane, wobei die einen beide Bereiche streng trennen und die anderen meinen, auch das Profane sei heilig, wie das Heilige letztlich profan sei.
Was sagt uns nun das Pantheon? Schon vor dem Christentum hatten die Menschen eine Religion, die ihr Leben beeinflusste. Die Christen haben es verstanden, diese in ihr System zu adaptieren – sowohl die Gebäude wie auch viele Riten und Vorstellungen. Was man damals geglaubt hat, ist nicht einfach verschwunden, sondern wurde in den christlichen Glauben aufgenommen. Flehte man erst zu den Göttern, so wandte man sich später an die Heiligen.
Schon vor zweitausend Jahren betete man in diesem kolossalen Rundbau, nur die Religion hat sich inzwischen geändert. Dabei scheint sich der Kreis wieder zu schließen: Die Tausenden von Touristen aus aller Welt, die heute tagtäglich ins Pantheon kommen und sich von seiner außergewöhnlichen Atmosphäre ansprechen lassen, bringen ihre unterschiedlichsten Religionen und Weltanschauungen mit und selbst die Atheisten unter ihnen zollen dieser Ikone der Architektur Respekt.
Das Pantheon erscheint von den Hügeln oder Aussichtsterrassen der Stadt aus schlicht wie eine Muschel am Strand. Wer aber hineingeht, der staunt. Nicht Kerzen oder Elektrizität spenden das Licht, sondern allein die Sonne. Kein Dach versperrt den Zugang zum Himmel – der Weg nach oben ist frei. Gottlob wird dieses Loch nie gestopft.
Diese vorchristliche Sakralstätte transportiert eine Botschaft, die Menschen aller Kulturen begreifen: Das Entscheidende ist – die Lücke, die Auslassung, die Leerstelle im Dach, die den Blick himmelwärts zieht. Das will ja Religion: unseren Blick für die Weite öffnen.
Das Pantheon ist offen für alle. Und so schön rund. Und rundherum brummt das Leben.
Da glaubt sich was zusammen!
Was ist Synkretismus?
Die griechische Silbe »syn-« (auch in ihren Variationen »sys-«, »syl-« und »sym-«) bedeutet »zusammen« oder »mit«, bezeichnet also eine Verbindung. Einige griechische Begriffe, in denen sich diese Silbe findet, sind in unseren aktiven Wortschatz eingegangen, zum Beispiel die Sympathie, die Synthese, das System, das Symbol, die Symmetrie oder die Symphonie. Außerdem kennen wir Fachwörter wie die Synchronisation, die Synapse, das Symposion oder die Synode. All diese Vokabeln haben einen wertneutralen Klang – nur beim Wort Synkretismus zucken diejenigen zusammen, die wissen, was sich dahinter verbirgt.
Genutzt wird es, um im Bereich einer Religion das Phänomen zu bezeichnen, Elemente aus anderen Religionen aufzunehmen und einzugliedern. Dieses Verfahren kann man ohne Bewertung beobachten. So erforscht die zeitgenössische Religionswissenschaft synkretistische Erscheinungen wie »Einfluss (einer Religion auf eine andere); Vereinigung (zweier Religionen); Eingliederung (fremder Gottheiten in eine Religion); Gleichsetzung (verschiedener Götter); Verschmelzung (verschiedener Gottheiten)«, wie der Religionswissenschaftler Ulrich Berner bemerkt. Er gibt zu bedenken, Synkretismus habe auch mit der Auseinandersetzung einer Religion mit modernen weltanschaulichen Systemen, die sich nicht als Religion verstehen, zu tun. Die ganze Dynamik religionsgeschichtlicher Prozesse umfasse zudem die Auswirkungen von Wissenschaft oder Wirtschaft auf die Religion.
Hermann Usener, ein Philologe und Religionswissenschaftler aus Bonn, bezeichnete 1898 Synkretismus noch als »Religionsmischerei«. Dieses Urteil setzte die Vorstellung voraus, es gäbe eine »reine Religion«, die an Qualität einbüße, also verwässert oder verfälscht würde, wenn sie aus »fremden« Religionen etwas übernähme.
Ein Austausch von Göttern war in der Antike ein probates Verfahren. Die Götter und Göttinnen der Römer waren, wie bereits dargelegt, kaum mehr als Kopien der griechischen Vorbilder und sie korrespondierten mit den noch älteren ägyptischen Gottheiten.
Ein betont synkretistisches Produkt ist die Bahá’i-Reli- gion. Ihr Gründer Mirza Husain Ali Nuri erklärte 1863 in Bagdad (damals Osmanisches Reich, heute Irak), er sei nach Adam, Mose, Krischna, Buddha, Zarathustra, Christus und Mohammed der letzte und wichtigste Prophet. Er nannte sich fortan Bahá’u’lláh, »die Herrlichkeit Gottes«. Er gab Königen und anderen Staatsoberhäuptern bekannt, er sei gesandt, die Welt am Ende der Zeiten zu erlösen und Gottes Willen für ein neues Zeitalter zu verkünden.
Bahá’u’lláh (1817–1892) war zunächst selbst Anhänger eines persischen Religionsgründers, der sich als »Bab« verstand, als »Pforte der Erkenntnis«. Nach dessen Tod übernahm Bahá’u’lláh die kleine Anhängerschaft und weitete sie rasch aus. Vom Schah aus Persien verbannt, emigrierte er zunächst nach Bagdad, wo er sich 1863 zum »Verheißenen aller Religionen, dessen Kommen der Bab vorausgesagt habe«, erklärte.
Die heute 5 bis 8 Millionen Anhänger dieser Religion, die Bahá’i, glauben an einen Gott, der sich in allen Religionen offenbart, besonders jedoch durch den eigenen Stifter Bahá’u’lláh, der als Heilsbringer verehrt wird. Ihre ethische Grundhaltung beruht auf der Verkündigung von der Einheit der Menschheit in Frieden und Gerechtigkeit: »Der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und Seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen« (Bahá’u’lláh). Als Weg zum großen Ziel werden eine Welteinheitssprache und -währung, ebenso eine Weltgesetzgebung durch eine Weltregierung proklamiert. Von Anfang an verfolgte man in vielen Ländern die Bahá’i und verbannte sie aus dem Land. Noch heute ist diese Religion im Iran verboten. Das administrative Zentrum der Bahá’i liegt im israelischen Haifa.
Die monotheistischen Religionen, die nur den einen Gott verehren, betrachten den Synkretismus kritisch als eine Bedrängnis für den rechten Glauben. Die hebräische Bibel beschwört immer wieder die Gefahren herauf, die erwachsen, wenn man sich fremden Völkern – etwa Babylon – öffne; das schade dem Jahwe-Glauben und führe ins Unglück. Auch der Islam lehnt Synkretismus schroff ab. In beiden Religionen pflegt man das mehrmalige tägliche Bekenntnis, dass es wirklich nur einen Gott gibt. Offenbar bedarf es dieser nachdrücklichen Einschärfung, denn aller Erfahrung nach wird genau das wiederholt eingeimpft, was in Vergessenheit zu geraten droht. Den Christen werfen beide Religionen demnach auch bis heute vor, die Dreifaltigkeitslehre sei mit einem wahren Ein-Gott-Glauben unvereinbar.
Eigenartig: Würden wir die Vorstellung, dass es nur einen einzigen Gott gibt, wirklich ernst nehmen, dann könnte man den Synkretismus begrüßen, da doch überall ein und derselbe Gott bezeugt und verehrt wird, nur eben auf verschiedene Art und Weise.
Abgrenzung und Beeinflussung
Wenn man die Entwicklung eines Menschen, eines Volkes oder eines Landes betrachtet, spricht man von dessen Geschichte. Was in dieser Zeit geschieht, kann oft erst im Nachhinein recht verstanden, aufgeschrieben und interpretiert werden.
In Bezug auf Glaubensgemeinschaften und insbesondere für das Christentum gibt es noch zwei weitere Begriffe, die hierbei eine Rolle spielen: Das Wort »Heilsgeschichte« bezeichnet die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er handelt innerhalb der »profanen« Geschichte für das Heil der Menschen, von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt. Die »Kirchengeschichte« dagegen betrachtet die Entwicklung der Institution durch ihre Verstrickungen in die Geschehnisse der jeweiligen Zeit.
Die ersten Jahrhunderte des Christentums waren geprägt vom Ringen um den rechten Glauben und vom Überleben als eigenständige Religion. Die beiden »Apostelfürsten« Petrus und Paulus waren die Ersten, die den neuen Glauben in eine fremde Umgebung transferierten, denn das Christentum entstand in Landstrichen, die bereits religiös geprägt waren. Dem Apostel Petrus wurde nach neutestamentlichem Zeugnis von Jesus eine besondere Verantwortung für die Leitung der Kirche übertragen. Ob diese Beauftragung allerdings nur für ihn persönlich galt oder ob damit ein Amt geschaffen worden war, das auch seine Nachfolger gegenüber den übrigen Christen bevorzugte, das sollte später zu einem gravierenden Streitpunkt werden. Zur Aufgabe des Petrus gehörte es, innerhalb der »Mutterreligion« der ersten Christen (also des Judentums, denn in dem Land, in dem Jesus lebte und seine Botschaft verkündete, waren die allermeisten Menschen jüdischen Glaubens) den Glauben an Jesus als den Messias zu verteidigen. Wir haben ihm aber auch einen entscheidenden Schritt zur Öffnung des Christentums zu verdanken. Als traditionell sozialisierter Jude hielt er sich streng an die jüdischen Speisegebote. Doch dann hatte er eine Vision, während er auf einem Hausdach wartete, dass das Essen fertig wurde: »Er sah den Himmel offen und ein Behältnis wie ein großes Leinentuch herabkommen, das an seinen vier Enden auf die Erde herabgelassen wurde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief ihm zu: Steh auf, Petrus, schlachte und iss! Petrus erwiderte: Niemals, Herr! Noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal: Was Gott für rein erklärt hat, sollst du nicht unrein nennen! Das geschah dreimal. Dann wurde das Behältnis sogleich wieder in den Himmel emporgehoben« (Apostelgeschichte 10,11–16).