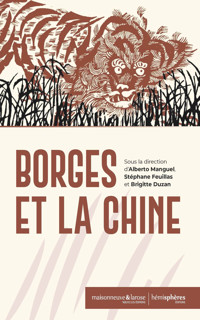Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anne Chengs Standardwerk zur viertausendjährigen Geschichte der chinesischen Philosophie von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert liegt nun endlich auch in deutscher Übersetzung vor. In ihrer meisterhaften Gesamtdarstellung verfolgt die vielfach ausgezeichnete Autorin die Entwicklung des chinesischen Denkens in seiner Kontinuität wie in allen Verwandlungen und Brüchen und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Nachschlagewerk. Als die »Histoire de la pensée chinoise« 1997 auf Französisch erschien, setzte sie sogleich Maßstäbe für eine schlüssige und zugleich umsichtige Darstellung der in der westlichen Philosophie oft nur bruchstückhaft bekannten, geschweige denn rezipierten chinesischen Philosophiegeschichte. Das Buch setzt ein mit der archaischen Kultur der Shāng und Zhōu im 2. Jahrtausend v. Chr. und behandelt in sechs Teilen die antiken Grundlagen des chinesischen Denkens (Konfuzius, Mòzǐ), die Zeit der Streitenden Reiche (Zhuāngzǐ, Menzius, Lăozǐ, Xúnzǐ, Legisten und kosmologisches Denken), die geistige Erneuerung während der HànDynastie, die buddhistische Umwälzung und anschließende Integration des Buddhismus in China, die Philosophie in der Zeit der Sòng und der MíngDynastien und schließlich die Entstehung des modernen Denkens. Auch wenn Cheng sich an den bekannten Schulen und Traditionslinien orientiert, berücksichtigt sie stets die Problematik, dass diese Schulen sich ihrem Selbstverständnis nach oft keiner Tradition zuordneten und Philosophiegeschichtsschreibung meist im Nachhinein konstruiert ist. Es gelingt der Autorin, unter enger Bezugnahme auf die jüngste sinologische Forschung den verschiedensten systematischen Aspekten des Philosophierens im traditionellen China gerecht zu werden – bei aller Eigenartigkeit, die diese Denkweisen in ihren Argumentationsstrukturen auszeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Cheng
GRUNDRISS
GeschichtedeschinesischenDenkens
Aus dem Französischenübersetzt vonUlrich Forderer
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (ePub): 978-3-7873-4204-4
eISBN (PDF): 978-3-7873-4203-7
© Editions du Seuil, 1997, Histoire de la pensée chinoise
Umschlagabbildung: Ausschnitt aus dem Gemälde »Garten der Kultur«von Hán Huǎng (723–787), Sammlung des Kaiserpalasts in Peking
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2022. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 URG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbH.
www.meiner.de
Für Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Für Clara und JuliaIn Erinnerung an Yiningund Wang Yun
Wer auf Zehenspitzen steht, wackelt,
Wer Riesenschritte macht, kann nicht gehen,
Wer sich ins Licht rückt, leuchtet nicht,
Wer immer Recht haben will, ist ohne Ruhm,
Wer sich selber lobt, ist ohne Verdienst,
Wer sich selber rühmt, hat keine Dauer.
(Lăozĭ 24)
Inhalt
Vorwort zur deutschen Übersetzung
Vorbemerkungen des Übersetzers
Schlüsselbegriffe|Umschrift|Hinweise zur Aussprache|Typographie|Namen|Abkürzungen|Interne Verweise|Zur Übersetzung der Textauszüge|Danksagung
Hinweis
Chronologie
Einleitung
China
Geschichte
Tradition
Denken oder Philosophie?
Denken und Wirklichkeit auf gleicher Ebene
Wissen und Tat: das Dào
Einheit und Kontinuität: der Hauch
Wandlung
Beziehung und Mittigkeit
ERSTER TEIL
Die antiken Grundlagen des chinesischen Denkens(2. Jahrtausend – 5. Jahrhundert v. Chr.)
1Die archaische Kultur der Shāng und der Zhōu
Wahrsagerische Rationalität
Ahnenkult
Ritualisierung des religiösen Bewusstseins
Vom ›Herrscher oben‹ zum ›Himmel‹
Ordnung und Ritus
2Konfuzius setzt auf den Menschen
Die konfuzianische Wende
Die Person Konfuzius
Mit fünfzehn beschloss ich zu lernen
Lernen heißt lernen, menschlich zu sein
Der Sinn fürs Menschliche (rén)
»Alle Menschen zwischen den vier Meeren sind Brüder«
Rituelle Geisteshaltung
Die heilige Aufgabe des Edlen
Der Fürst als Edler
Wie regieren?
Die Namen berichtigen
Der konfuzianische Weg
Konfuzius und die Herausbildung der kanonischen Texte
3Mòzǐ greift die konfuzianische Lehre an
Der Pazifist Mòzǐ, ein Handwerker?
Anfänge der Argumentation im Mòzǐ
Kriterium der Nützlichkeit versus Tradition des Rituals
Universelle Liebe versus Sinn fürs Menschliche
Gemeinnutz
»Sich seinen Vorgesetzten fügen«
Mòzǐs Himmel
Mohisten versus Konfuzianer
ZWEITER TEIL
Freier Gedankenaustausch zur Zeit der Streitenden Reiche(4.–3. Jahrhundert v. Chr.)
4Zhuāngzǐ lauscht aufs Dào
Das Buch und der Mensch Zhuāngzǐ
Relativität der Sprache
Die Paradoxa des Huì Shī
Der Riesenvogel und der Frosch
Es ist so, es ist nicht so
Wie können wir wissen?
Das begriffliche Denken vergessen
Wie ein Fisch im Dào
Die Hand und der Geist
Das Spontane als Spiegel
Traum und Wirklichkeit
Mensch oder Himmel
Der wahre Mensch
Die Grundenergie bewahren
Die höchste Loslösung
5Diskurs und Logik zur Zeit der Streitenden Reiche
Hintergründe des Diskurses
Die Logiker
Instrumentale Sprachauffassung
Die Theorie der ›Massennomina‹
Nominalistische Auffassung
Weißes Pferd ist kein Pferd
Über die Bezeichnung der Dinge
6Menzius: Konfuzius’ geistiger Erbe
Der Edle und der Fürst
Das Buch Mèngzǐ, ein polemisches Werk
Die Überzeugungskraft des ›Menschlichen‹
Begründung der Moral aus der Natur
Moralische Lebenskraft
Moralische Physiologie
Herz/Geist
Jeder Mensch kann ein Heiliger werden
Wesensnatur und Bestimmung
Und das Böse?
Menschlichkeit als Verantwortung
Mittigkeit und Authentizität
7Das Dào des Nichthandelns im Lăozǐ
Legende
Text
Nichthandeln
Die Metapher des Wassers
Paradoxa
Das Amoralische des Natürlichen
Der politische Wert des Nichthandelns
Zurück zum Natürlichen
Zurück zum Ursprung
Dào
Vom Dào zu den Myriaden Wesen
Negativer Weg oder Mystik?
8Xúnzǐ, Konfuzius’ realistischer Erbe
Porträt eines Konfuzianers am Ende eines Zeitalters
Mensch und Himmel
»Das Wesen des Menschen ist schlecht«
Wesensnatur und Kultur
Riten
Name und Wirklichkeit
Ein Panorama der Gedanken zur Zeit der Streitenden Reiche
9Legisten
Legistische Anthropologie
Gesetz
Machtstellung
Techniken
Das totalitaristische Dào des Hán Fēizĭ
10Das kosmologische Denken
Gedanken über die Natur
Am Anfang war das Qì
Yīn und Yáng
Die fünf Phasen
Kosmologischer Raum und kosmologische Zeit
Der Lichtpalast
11Das Buch der Wandlungen
Ursprung aus der Wahrsagerei
Die Kanonisierung des Buchs der Wandlungen
»Ein Yīn, ein Yáng: So ist das Dào«
Die Wandlungen als Figuren-Kombinatorik
Deutung der Wandlungen
Der »winzige Anfang«
Vor und nach der Gestaltwerdung
Günstige Gelegenheit
DRITTER TEIL
Ausgestaltung des Erbes(3. Jahrhundert v. Chr. – 4. Jahrhundert n. Chr.)
12Das holistische Weltbild der Zeit der Hàn-Dynastie
Die Denkrichtung Huánglăo
Huáinánzĭ und die kosmischen Resonanzen
Korrelative Kosmologie versus wissenschaftliches Denken
Der Kult der Einheit
Dŏng Zhòngshū (etwa 195–115 v. Chr.)
Der Klassikerstreit
Yáng Xióng (53 v. Chr.–18 n. Chr.)
Wáng Chōng (27–etwa 100 n. Chr.)
Die Zeit der Östlichen Hàn (25–220 n. Chr.)
13Die geistige Erneuerung des 3. und 4. Jahrhunderts
»Zweckfreie Plaudereien« und »Studien des Geheimnisvollen«
Wáng Bì (226–249)
Zwischen Undifferenziertheit und Sichtbarwerdung
Diskurs, Bild, Sinn
Zwischen Undifferenziertheit und strukturierendem Prinzip
Guō Xiàng (etwa 252–312)
Taoistische Tradition
VIERTER TEIL
Die große buddhistische Umwälzung(1.–10. Jahrhundert)
14Die Anfänge des Buddhismus in China (1.–4. Jahrhundert)
Die indischen Ursprünge des Buddhismus
Die vier Siegel des Dharmas
Geschichtliche Entwicklung des Buddhismus in Indien
Der Buddhismus im China der Hàn-Zeit
Buddhismus des Nordens und Buddhismus des Südens
Dhyāna und Prajñā
Intellektueller Austausch im Buddhismus des Südens
Der Buddhismus unter den nichtchinesischen Dynastien des Nordens
Einige wichtige Mönche des 4. Jahrhunderts: Dáo’ān, Huìyuăn, Dàoshēng
15Das Denken in China an der Wegscheide(5.–6. Jahrhundert)
Kumārajīva und die Schule Mādhyamika
Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten, Konfuzianern und Taoisten in den südlichen Dynastien
Kontroverse über Leib und Geist
Der Buddhismus im Norden im 5. und 6. Jahrhundert
Xuánzàng und die Yogācāra-Schule
16Die Blütezeit der Táng-Dynastie(7.–9. Jahrhundert)
Sinisierung des Buddhismus
Tiāntái
Die Huáyán-Schule
Die Schule der Reinen Erde
Tantrischer Buddhismus
Volkstümliche Äußerungen des Buddhismus
Chán
Der Geist des Chán
Die Methoden des Chán
Hányù (768–824) und die »Rückkehr zur Antike«
Lĭ Áo (etwa 772–836) und die »Rückkehr zur Wesensnatur«
FÜNFTER TEIL
Das chinesische Denken nach der Integration des Buddhismus(10.–16. Jahrhundert)
17Die konfuzianische Renaissance zu Beginn der Sòng-Zeit(10.–11. Jahrhundert)
Die großen Männer der Tat in der Zeit der Nördlichen Sòng-Dynastie (960–1127)
Die konfuzianische Renaissance
Rückkehr zum Buch der Wandlungen und zur Kosmologie
Shào Yōng (1012–1077)
Beschaffenheit und Funktion
Figuren und Zahlen
Kenntnis des Prinzips und »umgekehrte Betrachtung«
Zhōu Dūnyí (1017–1073)
»Ohne First und doch Höchster First«
»Heilig ist nichts anderes als authentisch«
Die Frage des Bösen
Ist Heiligkeit erlernbar?
Einheit und Vielfalt
Zhāng Zài (1020–1078)
»Alles hängt in ein und demselben Dào zusammen«
Qì: Leere und Fülle
Einheit der Energie, Einheit der Wesensnatur
Streben nach Heiligkeit
18Das Denken zur Zeit der Nördlichen Sòng-Dynastie(11. Jahrhundert)Zwischen Kultur und Prinzip
Die Brüder Sū und die Brüder Chéng
Sū Shì und das Dào der Kultur
Die Brüder Chéng und das »Studium des Dào«
Das liĭ als Prinzip
Das Prinzip zwischen Einheit und Vielfalt
»Wissen erweitern« und »die Dinge untersuchen«
»Das Prinzip sehen«
Ansichten zum Buch der Wandlungen
Prinzip und Energie
Prinzip und Sinn für Menschlichkeit
Streben nach Heiligkeit
19Die große Zusammenschau in der Zeit der Südlichen Sòng-Dynastie(12. Jahrhundert)
Zhū Xī (1130–1200) und Lù Xiàngshān (1139–1193)
Vom »Studium des Weges« zu seiner »rechtmäßigen Überlieferung«
Höchster First: Einheit von Prinzip und Energie
»Höchster First« oder »Ohne-First«?
Geist als Einheit von himmlischem Prinzip und menschlichen Begierden
»Dào-Geist« und »Menschen-Geist«
Die Einheit des Geistes nach Lù Xiàngshān
Beherrschung des Geistes
»Untersuchung der Dinge und Erweiterung der Erkenntnis«
Stufenweises Voranschreiten und plötzliche Erleuchtung, Erkenntnis und Tat
20Neubesinnung auf den Geist zur Zeit der Míng-Dynastie(14.–16. Jahrhundert)
Das Vermächtnis der Sòng-Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert
Wáng Yángmíng (1472–1529)
»Es gibt kein Prinzip außerhalb des Geists«
Die Frage des Bösen und das »angeborene moralische Wissen«
»Wissen und Tat sind eins«
Denker des Qì im 16. Jahrhundert
»Die drei Lehren sind gleich«
Auflehnung gegen den offiziellen Konfuzianismus und kritischer Geist
Liú Zōngzhōu (1578–1645)
Leben und Sterben der privaten Akademien gegen Ende der Míng-Dynastie
Erneuerungsgesellschaft und Jesuiten
SECHSTER TEIL
Heranbildung des modernen Denkens(17.–20. Jahrhundert)
21Kritischer Geist und empirische Ansätze zur Qīng-Zeit(17.–18. Jahrhundert)
Huáng Zōngxī (1610–1695)
Gù Yánwŭ (1613–1682)
Wáng Fūzhī (1619–1692)
Einheit von Mensch und Welt in der Lebensenergie
Einheit des himmlischen Prinzips und der menschlichen Begierden
Denken über Kräfte, kraftvolles Denken
Der Sinn der Geschichte
Yán Yuán (1635–1704)
Die großen staatlichen Buchausgaben im 18. Jahrhundert
Textkritik der Klassiker und Rückkehr zu den »Hàn-Studien«
Dài Zhèn (1724–1777)
Zu den Quellen von Menzius
Von der Energie zum Unterscheidungsprinzip
Gegen Pharisäer und Pedanten
Kritischer Geist zu Beginn des 19. Jahrhunderts
22Das chinesische Denken in der Auseinandersetzung mit dem Westen(Ende 18. – Anfang 20. Jahrhundert)
Rückkehr zu den »neuen Texten« zur Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
»Moderne Texte« und Reformismus
»Moderne Texte« und Legismus
Erste offene Konflikte mit den ausländischen Mächten
Kāng Yŏuwéi (1858–1927) und der Höhepunkt des Neutextreformismus
Liáng Qĭchāo (1873–1929) und Tán Sìtóng (1865–1898)
Der Reformgeist zwischen Universalismus und Nationalismus
Die »Nach-1898-Zeit«: die klassische Tradition zwischen Reform und Revolution
Zhāng Bĭnglín (1869–1935)
Liú Shīpéi (1884–1919)
Epilog
Bibliographie
Register der chinesischen Begriffe
Register der Eigennamen
Register der Werke
Vorwort zur deutschen Übersetzung
Diese deutsche Übersetzung hat eine lange Geschichte – die Geschichte einer bald zwanzigjährigen Freundschaft. Zu Beginn der 2000er Jahre, kurz nach dem Erscheinen der ersten Auflage meiner Histoire de la pensée chinoise im Verlag Editions du Seuil, wurde ich von einem Brief von Ulrich Forderer überrascht, in dem er schrieb, dass er »zu seinem eigenen Vergnügen« begonnen habe, mein Buch zu übersetzen. Ich schlug ihm vor, uns in einem Pariser Café zu treffen. Dort sah ich ihn dann zum ersten Mal mit seinem vor Geist sprühenden schelmischen Blick. Bei dieser ersten Begegnung vergingen die Stunden beim anregenden Gedankenaustausch wie im Flug und sie war der Beginn einer Freundschaft, die sich in zahlreichen Diskussionen bei meinen Seminaren zu antiken und klassischen chinesischen Texten im Nationalen Institut für orientalische Sprachen und Kulturen (INALCO) vertiefte, die Ulrich regelmäßig besuchte und durch seine geistreichen, den Nagel immer auf den Kopf treffenden Fragen bereicherte. Hinter seinen zerzausten Haaren lernte ich einen ewig jungen, dem äußeren Erscheinungsbild gegenüber gleichgültigen Geist von umfassender humanistischer Bildung und unersättlichem Wissensdrang schätzen. Dank seiner Ausbildung als Übersetzer und seiner soliden Kenntnisse des modernen und alten Chinesischen sowie der chinesischen und westlichen Philosophie hätte ich mir keinen besseren Übersetzer für meine Geschichte des chinesischen Denkens wünschen können.
Dem Verlag Meiner, der seit mehr als hundert Jahren ein fester Begriff in der Philosophie ist, ist es zu verdanken, dass dieses Projekt Wirklichkeit werden konnte. Auch hier hätte ich mir nichts Besseres erträumen können. Ich danke ihm und insbesondere Marcel Simon-Gadhof für die kompetente und sorgfältige Betreuung der deutschen Ausgabe.
Die Umstände der Übersetzung und Herausgabe sind erwähnenswert: Seit 2013 arbeitet Ulrich in China in der germanistischen Abteilung der Universität Lanzhou und wegen der erschwerten Reisemöglichkeiten durch die Covid-19-Pandemie verlief unsere Zusammenarbeit ganz über das Internet. Er schickte mir Kapitel für Kapitel mit seinen immer stichhaltigen Fragen und Bemerkungen und ich muss gestehen, dass die Lektüre meines Buchs auf Deutsch mich ziemlich beeindruckte, wenn nicht gar einschüchterte, denn es kam mir manchmal ein bisschen vor, als läse ich Hegel oder Heidegger …
Von all den Übersetzungen meines Buchs in zahlreiche europäische und asiatische Sprachen ist die deutsche wohl die, bei der ich am engsten mit dem Übersetzer zusammengearbeitet habe, dessen Kompetenz und Genauigkeitsanspruch mich dazu veranlasste, meinen Text zu überarbeiten und zu verbessern. Ulrich hat sich nämlich nicht darauf beschränkt, aus dem Französischen zu übersetzen, sondern scheute nicht die Mühe, bei allen zitierten Textauszügen auf die chinesischen Ursprungstexte zurückzugreifen, die er an vielen Stellen genauer und treuer wiedergibt, als ich es tat. Ich kann daher ohne Übertreibung sagen, dass die deutsche Ausgabe verlässlicher als die französische ist.
Auch wenn die französische Ausgabe bei Neuauflagen mehrmals überarbeitet und erweitert wurde, so war es dennoch unmöglich, bei den bibliografischen Angaben mit der exponentiellen Zunahme der sinologischen Veröffentlichungen in europäischen Sprachen in den letzten zwanzig Jahren Schritt zu halten. Wir haben uns dennoch in dieser deutschen Ausgabe bemüht, wenigstens einige der wichtigsten Neuerscheinungen deutscher Sinologen zu erwähnen, von denen zurzeit viele in englischsprachigen Universitäten arbeiten und wesentliche Beiträge zur philologischen und philosophischen Erhellung der chinesischen Quellen leisten. Ich empfinde daher sowohl Stolz als auch Demut, meine Geschichte des chinesischen Denkens, die ursprünglich für die französische Leserschaft konzipiert war, der deutschsprachigen unterbreiten zu dürfen, und möchte dies auch als Ausdruck meiner Ehrerweisung gegenüber der deutschen Sinologie verstanden wissen, die ebenso wie die französische seit der Epoche der Aufklärung das Verständnis Chinas durch ihren besonderen europäischen Blickwinkel bereichert.
Paris, September 2021
Anne Cheng
Vorbemerkungen des Übersetzers
Die deutsche Ausgabe der Histoire de la pensée chinoise von Anne Cheng ist das Ergebnis langjähriger Arbeit, durch welche dem philosophisch und kulturell interessierten deutschen Leser nun endlich dieser meisterhafte und dringend benötigte Überblick über die Hauptlinien der chinesischen Ideengeschichte vorgestellt werden kann.
Schlüsselbegriffe
Der Zugang zum chinesischen Denken erfordert es, sich mit einigen Begriffen vertraut zu machen, die seine geistigen Werkzeuge sind und ihm ihr besonderes Gepräge verleihen. Wir haben uns daher bemüht, diese möglichst einheitlich zu übersetzen (und oft in Klammern an die chinesischen Bezeichnungen zu erinnern), damit der Leser langsam intuitiv ihre Bedeutungen erfasst, für die es keine Eins-zu-eins-Entsprechung in westlichen Sprachen gibt. Zu diesen Begriffen gehören insbesondere:
道dào: im französischen Text la Voie, Dào, im Deutschen meist unübersetzt Dào.
誠chéng: im französischen Text authentique, autenticité, im Deutschen »authentisch«.
德dé: Im französischen Text oft mit »vertu« (von lateinisch virtus) in Anführungszeichen übersetzt, um zu verdeutlichen, dass es oft nicht Tugenden im moralischen oder moralisierenden Sinn bezeichnet, sondern das Charisma eines Herrschers oder die natürliche Wirksamkeit des Dào. Im französischen Text finden sich auch die Übersetzungen puissance, puissance morale, puissance invisible oder charisme. Im Deutschen mit »Tugend«, »Charisma«, »moralischer Kraft«, »unsichtbarer Kraft«, »Macht« übersetzt.
君子jūnzǐ: im französischen Text l’homme de bien, im Deutschen der »Edle«. Der Gegensatz dazu ist der 小人, l’homme de peu, der »gemeine Mensch«.
理liǐ: im französischen Text »principe«, im Deutschen: »Prinzip« (zur Umschrift siehe unten).
禮, lǐ: im französischen Text »rites«, im Deutschen »Riten«.
命mìng: im französischen Text destin, mandat, im Deutschen »Bestimmung«, »Schicksal«, »Erlass«.
氣, qì: im französischen Text énergie, énergie vitale, souffle, im Deutschen »Energie«, »Lebensenergie«, »Hauch«.
仁rén: grundlegender Begriff der Moral, im Französischen le sens de l’humain, im Deutschen »der Sinn fürs Menschliche«.
聖人shèngrén, im Französischen »saint«, im Deutschen der »Heilige«, wobei zu beachten ist, dass dies nicht mit dem christlichen Begriff gleichzusetzen ist.
體tĭ / 用yòng: Es handelt sich um eine häufig verwendete Dichotomie; im französischen Text meist constitution (manchmal auch substance) – fonction, mise en œuvre, im Deutschen meist Beschaffenheit – Funktion, Wirksamwerden, Umsetzung u. ä.
天地tiāndì: im französischen Text Ciel-Terre, im Deutschen »Himmel-und-Erde«. Durch diese Schreibweise soll gezeigt werden, dass Himmel und Erde als Einheit gesehen werden, als Erfahrungshorizont des vormodernen Menschen.
心xīn: im Französischen coeur, coeur-esprit, esprit, im Deutschen Herz, HerzGeist, Geist.
性, xìng: im Französischen nature, im Deutschen »Wesensnatur«.
有yŏu / 無wú: Dieses Begriffspaar, wird von Anne Cheng nicht wie gebräuchlich mit »Sein« und »Nichts« übersetzt, da dieser Gegensatz bei den chinesischen Denkern nicht so radikal aufgefasst wird. Sie übersetzt meist mit l’il-y-a und l’il-n’y-pas, im Deutschen verwenden wir entsprechend »das Vorhandene« – »das Nichtvorhande«: »das, was da ist«, »das, was nicht da ist«. Bei Wàng Bì wird 無wú im Französischen mit l’indifférencié oder le non manifesté wiedergegeben, im Deutschen »das Undifferenzierte«, »das Nicht-Kundgewordene«.
自然zìrán: im Französischen naturel, spontané, de soi ainsi, im Deutschen das »Natürliche«, das »Spontane«, »von selbst so«.
萬物wànwù: im Deutschen »die Myriaden Wesen«.
Umschrift
Wie in der französischen Ausgabe werden die unvereinfachten Schriftzeichen verwendet. Zur Umschrift wird das heute übliche sogenannte Pinyin-System verwendet.
Die einzige Ausnahme vom Pinyin-System betrifft zwei homophone Begriffe, die beide philosophisch äußerst wichtig sind: »Riten« und »Prinzip«, beide lĭ ausgesprochen. In der deutschen Übersetzung werden sie, um Verwechslung zu vermeiden, folgendermaßen unterschieden: Riten: lĭ, Prinzip: liĭ.
Anders als in der französischen Ausgabe werden für die sinologische Leserschaft die Akzente zur Bezeichnung der Silbenintonationen mitangegeben. Im Chinesischen trägt jede Silbe eine von vier Intonationen, das heißt melodische Muster, die sinnunterscheidende (phonemische) Funktion haben.
Hinweise zur Aussprache
In der offiziellen Umschrift der chinesischen Sprache, dem sogenannten Pinyin, vertreten einige Buchstaben andere Laute als im Deutschen. Dies betrifft insbesondere folgende Laute:
zh
ch
j
DCH (d plus »ch« wie in »ich«)
q
TCH (qì, Energie, wird TCHI ausgesprochen)
z
DS
c
TS
x
CH (wie in »ich«) (xìng, Wesensnatur, wird CHING ausgesprochen)
Beispiel: Die Philosophen Zhū Xī und Xúnzǐ werden DSCHU CHI und CHÜN-DS ausgesprochen.
Im Internet kann der interessierte Leser Webseiten (Suchbegriff »Pinyin«) mit Hörbeispielen für alle im Chinesischen existierenden Silben finden, die ihm ein besseres Bild als diese annäherungsweise und unvollständige Beschreibung vermitteln.
In den Registern am Ende dieses Buchs wird bei einigen Namen und Begriffen, deren Pinyin-Umschrift für den Deutschen sehr irreführend ist, in Klammern die ungefähre deutsche Aussprache in freier Form angeben.
Typographie
Fremdsprachige Ausdrücke (chinesisch, Sanskrit usw.) sind kursiv gedruckt. Kursiv sind auch Buchtitel gedruckt, sodass der Zhuāngzĭ das dem Autor Zhuāngzĭ zugeschriebene Werk bezeichnet.
Namen
Im Chinesischen steht der Familienname vor dem persönlichen Eigennamen. So ist also bei dem Philosophen Wáng Yángmíng Wáng der Familiennamen und Yángmíng persönlicher Name. Im alten China haben viele Menschen mehrere Namen. Hier werden nur die gebräuchlichsten angegeben.
Abkürzungen
SBBY:Sìbù bèiyào, Shànghăi, Zhōnghuá shūjú, 1936
SBCK:Sìbù cóngkān, Shànghăi, Shāngwù yìnshūguăn, 1919–1936 (Nachträge 1934–1936)
ZZJC:Zhūzĭ jíchéng, Hongkong, Zhōnghuá shūjú, 1978. Diese Ausgabe wurde von der Autorin wenn immer möglich für die Texte der Zeit der ›Streitenden Reiche‹ und der Hàn-Dynastie verwendet.
Interne Verweise
Verweise auf Fußnoten gelten oft nicht diesen selbst, sondern den Textauszügen aus chinesischen Quellen, auf die sie sich beziehen.
Zur Übersetzung der Textauszüge
Das Werk enthält zahlreiche Textauszüge chinesischer Denker. Der Leser sollte sich beim Lesen dieser Auszüge allgemein der besonderen Schwierigkeit der Übersetzung alter chinesischer Texte bewusst sein, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass sich die klassische chinesische Schriftsprache durch einen teils ausgesprochen lakonischen und vieldeutigen Stil auszeichnet. Hinzu kommt das Alter der Texte, die Schwierigkeiten der Sprache, meine Unzulänglichkeiten und die Tatsache, dass die Auszüge aus ihrem jeweiligen Werkkontext herausgelöst sind. Sollten sich Fehldeutungen eingeschlichen haben, bitten wir fachkundige Leser um kritische Hinweise. Allen Lesern sei stets empfohlen, sich nicht an den Wortlaut zu klammern, sondern die im vierten Kapitel zitierten Worte Zhuangzis zu beherzigen:
Der Daseinsgrund der Reuse ist der Fisch. Ist der Fisch erst gefangen, vergisst man die Reuse. Der Daseinsgrund der Falle ist der Hase. Ist der Hase erst gefangen, vergisst man die Falle. Der Daseinsgrund der Worte ist der Sinn. Ist der Sinn erfasst, vergisst man die Worte.
Danksagung
Danken möchte ich vor allem der Autorin Anne Cheng. Die lange Arbeit an der Übersetzung hat mir durch zahlreiche Gespräche die Tore zur chinesischen Philosophie (und dadurch angeregt auch zur Philosophie überhaupt!) geöffnet und uns Freunde werden lassen.
Mein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus Cáo Yuānzhé (曹渊喆), der mich durch gemeinsame Konfuziuslektüre ins klassische Chinesisch einführte und anschließend unzählige Stunden darauf verwendet hat, mir bei all meinen Fragen mit seinem sprachlichen und philosophischen Wissen beiseitezustehen. Er hat wesentlich zum besseren Verständnis der Textauszüge beigetragen. Ebenso haben mir Wáng Tíng (王婷) und der sanskritkundige Lĭ Níngjūn (李宁军), ohne die Stunden zu zählen, selbstlos mit ihrem sprachlichen und inhaltlichen Verständnis der Texte geholfen.
Mein Dank gilt auch Yáng Xuӗ (杨雪), mit der ich weite Teile des Manuskripts durchgegangen bin und die mir zahlreiche wertvolle Hinweise gab, und Yán Yàn (闫艳), Yuán Zǐchuān (原子川) und Cén Shān (岑珊) für die Erstellung der Register und die Durchsicht der Transkriptionen.
Weiterhin danke ich Marcel Simon-Gadhof vom Meiner Verlag für seine kompetente Lektorierung und freundliche Betreuung des Projekts.
Last but not least möchte ich Dōng Yī (冬一) danken, aus deren chinesischer Übersetzung der Histoire de la pensée chinoise1 ich die Originale der chinesischen Textauszüge (in vereinfachter Schrift) für meine Übersetzungsarbeit übernommen habe. Da diese auch für Sinologen und Studierende der alten chinesischen Sprache nützlich sein könnten, können sie auf Anfrage dank der freundlichen Einwilligung von Dōng Yī und der Henan University Press als Worddatei zur Verfügung gestellt werden ([email protected]). Viele Texte sind außerdem auch auf der Webseite ctext.org (in alter Schrift) und in anderen Internetressourcen zu finden.
Lanzhou, Januar 2022
Ulrich Forderer
1Cheng Ailan, Zhongguo sixiangshi, Henan University Press, 2017, ISBN: 978-7-5649-3024-7, 中国思想史, 程艾蓝著, 冬一, 戎恒颖译, 河南大学出版社)
Hinweis
Dieses Buch richtet sich an eine wissbegierige, aber nicht notwendigerweise fachkundige Leserschaft, darunter insbesondere Studierende, mit deren Schwierigkeiten die Autorin durch ihre jahrelange Erfahrung mit Kursen zur Geschichte des chinesischen Denkens vertraut ist. Ziel ist es nicht, dem Leser ein vollständiges Wissen zu vermitteln, was auch ganz unmöglich wäre, sondern ihn in die Lage zu versetzen, selbst Ansätze und Anhaltspunkte zu finden, sich frei in einem lebendigen Raum zu bewegen, kurz gesagt, selbst auf Wassern zu rudern, die wie ein Ozean erscheinen mögen.2
Es wäre sicherlich vermessen, zu meinen, ein für alle Mal alles endgültig zum Thema sagen zu können. Die Vergangenheit des chinesischen Denkens ist wie alle Geschichte immer wieder im Lichte der Gegenwart neu zu betrachten. Vorstellungen, die allgemein anerkannt zu sein scheinen, sehen sich regelmäßig durch neue Entdeckungen oder Forschungen in Frage gestellt. Zu Gesichtspunkten oder Forschungsansätzen, in denen wir nicht fachkundig sind, wurde auf zahlreiche anerkannte Werke verwiesen. Die bibliografischen Hinweise zur Sekundärliteratur (die auf europäische Sprachen beschränkt sind, chinesische und japanische Sekundärliteratur wird nicht angeführt) sind sehr zahlreich, um wettzumachen, was Spezialisten als Manko erscheinen muss, und um dem interessierten Leser zu ermöglichen, seine Nachforschungen zu vertiefen.
Da China eine Buchkultur ist, gibt es von vielen der zitierten Primärtexte zahlreiche Ausgaben. Die Verweise beziehen sich aus praktischen Gründen, insbesondere für Studierende, so weit wie möglich auf moderne, leichter verfügbare, punktierte Ausgaben. Für die dynastischen Geschichtswerke, angefangen beim Shĭjì (Historische Aufzeichnungen) von Sīmă Qiān, beziehen wir uns auf die Pekinger Ausgabe Zhōnghuá shūjú.
N. B.: Bei den internen Verweisen werden nicht die Seitenzahlen, sondern die Abschnitte in den Kapiteln oder die Endnoten angeben, wobei sich die Verweise auf eine Fußnote oft auf die entsprechende Stelle im Text beziehen.
2Um Leser, die ihre kulturelle Bildung erweitern wollen, ohne aber den Wunsch oder die Muße zu haben, ein ganzes Studium darauf zu verwenden, nicht zu entmutigen, haben wir uns entschieden, mehr Gewicht auf die Hauptströmungen des chinesischen Denkens zu legen und andere Gesichtspunkte, die zwar wichtig, aber eher spezialisiert sind und den Rahmen dieses Buchs sprengen würden, beiseitezulassen. Informationen, die fachkundigere Leser interessieren könnten, finden sich in den Endnoten.
Chronologie
Dynastien
Ideengeschichtliche Anhaltspunkte
2. Jahrtausend – 18. Jahrhundert v. Chr.
Dynastie Xià
18. Jhd. – 11. Jhd. v. Chr.
Wahrsageinschriften
Dynastie Shāng
11. Jhd. – 256 v. Chr.
Feudales Königtum
Dynastie Zhōu
Westliche Zhōu (11. Jahrhundert – 771 v. Chr.)
Hauptstadt Hào (heutiges Xī’ān)
Östliche Zhōu (770–256 v. Chr.)
Hauptstadt Luò (heutiges Luòyáng))
Frühlinge und Herbste (722–481 v. Chr.)
Konfuzius
Streitende Reiche (403–256 v. Chr.)
Mòzĭ, Zhuāngzĭ, Menzius, Logiker usw.
221–207 v. Chr. Dynastie Qín
Legisten, kosmologisches Denken
(Erster Kaiser)
206 v. Chr. – 220 n. Chr.
Sīmă Qiān, Huáng-Lăo Huáinánzĭ, Dŏng Zhòngshū, Yáng Xióng, Liú Xiàng, Wáng Chōng, usw.
Hàn-Dynastie
Westliche Hàn (206 v. Chr. – 9 n. Chr.)
Dynastie Xīn von Wáng Măng (9–23)
Liú Xīn
Östliche Hàn (25–220)
Zhèng Xuán, Wáng Fú
220–265 Dynastie Wèi
Wáng Bì, taoistische Tradition, Eindringen des Buddhismus, Guō Xiàng
(Drei Königreiche)
265–316 Westliche Jìn
Erste Periode des Buddhismus in China (Dào’ān)
317–589 Südliche und Nördliche DynastienNorden: Tuòbá Wèi, Östliche und Westliche Wèi, Nördliche Qí, Nördliche ZhōuSüden: Östliche Jìn, Liú Sòng, Qí, Liáng, Chén
Ab 402: Periode der Übernahme des indischen Buddhismus als solchem:Im Norden: Kumārajīva, Sēngzhào (Mādhyamika)Im Süden: Huìyuăn, Dàoshēng
581–618 Dynastie Suí
Xuánzàng (Yogācāra)
618–907 Dynastie Táng
Periode der Sinisierung des Buddhismus:
Tiāntái- und Huáyán-Schule, Schule des Reinen Landes, Chán
Konfuzianische Renaissance: Hán Yù, Lĭ Áo
907–960 Fünf Dynastien
(Zeit der Zersplitterung)
960–1279 Dynastie Sòng
Nördliche Sòng (960–1127)
Liáo (mongolische Khitan, 916–1125)
Fàn Zhòngyān, Ōuyáng Xiū, Wáng Ānshí, Shào Yōng, Zhōu Dūnyí, Zhāng Zài, Sū Shì, Chéng Hào, Chéng Yí
Südliche Sòng (1127–1279)
Zhū Xī, Lù Xiàngshān
Jīn (mandschurische Dschürdschen, 1115–1234
1264–1368 Dynastie Yuán (Mongolen)
Liú Yīn, Xŭ Héng, Wú Chéng
1368–1644 Dynastie Míng
Chén Báishā, Wáng Yángmíng, Wáng Tíngxiàng, Luó Qīnshùn, Lĭ Zhì, Liú Zōngzhōu. Gesellschaft für Erneuerung, jesuitische Missionare (Matteo Ricci)
1644–1912 Dynastie Qīng (Mandschuren)
Ende 17. Jhd.: Huáng Zōngxī, Gù Yánwŭ
Wáng Fūzhī, Yán Yuán
18. Jhd.: Dài Zhèn
19. Jhd.: Liú Fénglù, Wèi Yuán, Gōng Zizhēn, Yán Fù, Kāng Youwéi
Liáng Qĭchāo, Tán Sìtóng, Zhāng Bĭnglín, Liú Shīpéi
1912 Republik China, seit 1949 in Taiwan
Bewegung des 4. Mai 1919
1949 Volksrepublik
Einleitung
China
Was dringt heute aus China zu uns? Ein wirrer Lärm, in dem sich Wirtschaftswunderdinge, erschreckende politische Nachrichten und mehr oder weniger fundierte Kulturinterpretationen vermengen. China: ein großes Stück Menschheit und Zivilisation, das der westlichen Welt noch immer weitgehend unbekannt ist und doch seit je Neugier, Träume und Gelüste hervorruft – von christlichen Missionaren des 17. Jahrhunderts über Philosophen der Aufklärung bis zu maoistischen Eiferern und Geschäftsleuten von heute. Simon Leys hat dies sehr schön beschrieben:
Aus der Sicht des Westens stellt China nicht mehr und nicht weniger als den Gegenpol der menschlichen Erfahrung dar. Alle anderen großen Zivilisationen sind entweder untergegangen (Ägypten, Mesopotamien, präkolumbisches Amerika) oder zu sehr vom Überlebenskampf in extremer Lage in Anspruch genommen (primitive Kulturen) oder uns zu nahe (islamische Kulturen, Indien), um uns einen solchen totalen Kontrast, eine so vollständige Andersartigkeit, eine so radikale und erhellende Eigenständigkeit wie China bieten zu können. Erst wenn wir uns mit China auseinandersetzen, können wir unsere eigene Identität genauer ermessen und zu erfassen beginnen, was von unserem Erbe universell menschlich und was nur indoeuropäische Idiosynkrasie ist. China ist dieses ganz Andere, ohne welches sich der Westen nicht wirklich der Konturen und Grenzen seines kulturellen Ich bewusstwerden kann.1
Heute, wo alle möglichen Ängste und Verlockungen des Irrationalen wieder auftauchen und uns zwischen Furcht vor der ›gelben Gefahr‹ und Schwärmerei für ›östliche Weisheit‹ schwanken lassen, erscheint es mehr als je zuvor nötig, Fundamente für ein authentisches Wissen zu legen, das auf Achtung des Anderen und wissenschaftlicher Redlichkeit statt auf verformten, meist für unausgesprochene Zwecke eingespannten Abbildern der Wirklichkeit gründet. Es bietet sich hier, in unserer Epoche auseinandersplitternder Identitäten und Gewissheiten, die seltene Chance, eine Bestandsaufnahme der unendlich reichhaltigen Möglichkeiten des menschlichen Denkens und Sehnens vorzunehmen. Auch die chinesische Kultur gelangt heute, nach einem Jahrhundert ständiger Unruhe, an einen Wendepunkt ihrer viertausendjährigen, kontinuierlichen Geschichte, und auch sie hat jetzt oder nie die Chance, eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, um klar in die Zukunft zu blicken und sich zu fragen, ob sie sich noch aus ihrer eigenen Tradition nähren kann und was sie uns, die wir im modernen Westen leben, Wesentliches mitzuteilen hat.
Wir treten an das chinesische Gedankengut zwangsläufig mit unseren eigenen geistigen Gewohnheiten heran. Aber ist es deshalb dazu verdammt, für uns etwas Exotisches, ganz Außenstehendes zu bleiben? Wenn wir wirklich wünschen, es kennenzulernen, ist es wichtig – wenn auch sehr schwierig –, seine Eigenständigkeit zu achten: es zwar auszufragen, aber dann auch zu schweigen zu wissen, um auf die Antworten zu hören, ja sogar zu lauschen zu beginnen, bevor wir es mit unseren Fragen bombardieren. Wir werden daher die chinesischen Autoren nicht unter methodischen Erörterungen begraben und schon gar nicht an ihrer Stelle reden, sondern ihnen so oft wie möglich das Wort erteilen und den Textauszügen breiten Raum lassen. Fangen wir damit an, unser Ohr daran zu gewöhnen, den Eigenklang herauszuhören und wiederkehrende Leitgedanken und innovative Themen zu unterscheiden.
Wir ließen uns daher in diesem Buch von einem sowohl kritischen als auch (im etymologischen Sinn des Worts) sympathischen Geist leiten, von einem Standpunkt des Innen und des Außen. Es geht uns in erster Linie darum, Aufnahmebereitschaft zu erwecken. Wir wollen keine enzyklopädische Sammlung feststehender Wahrheiten liefern, sondern Interesse wecken und natürlich auch etwas bieten, um die geweckte Neugierde zu befriedigen, das heißt, dem Leser gewisse Schlüssel in die Hand geben, ob diese nun viel oder wenig taugen mögen, die ihm aber so lange nützlich sein können, bis er so weit ist, sich seine eigenen zu schmieden. Es liegt uns fern, ein endgültiges Wissensmonument errichten zu wollen. Wir möchten lediglich unseren von zwei Kulturen geschulten Blick und unser Vergnügen, großen Geistern zu begegnen, mit dem Leser teilen.
Geschichte
Eine Ideengeschichte zu schreiben, ist ein schwieriges, zwischen chronologischer Eingleisigkeit und gedanklichem Tiefgang schwankendes Unterfangen. Kann der Nutzen eines solchen Unterfangens innerhalb einer bestimmten, über gemeinsame Sprache und Bezüge verfügenden Kultur in Zweifel gezogen werden, so erscheint es berechtigter, wenn es darum geht, Laien eine vollständig andere Kultur näherzubringen, deren Ausdrucksweisen und Denkrahmen keinerlei Festpunkte zu bieten scheinen. Jacques Gernet schrieb: »Am schwierigsten ist es klar zu sein, wenn es darum geht, eine uns wirklich fremde und in einer immensen Tradition verankerte Kultur zu beschreiben. Die Gefahr irrtümlicher Gleichsetzungen ist groß …«2
Auch wenn die chinesische Geistesgeschichte beim westlichen Betrachter den Eindruck von Wiederholung hervorruft – die Themen des 11., ja sogar des 18. Jahrhunderts greifen immer und immer wieder auf antike Begriffe zurück –, so bestätigt diese, weniger lineare als spiralförmige Entwicklung nicht das allzu verbreitete Bild einer zeitlosen, unveränderlichen Weisheit und macht keineswegs die diachrone Betrachtung überflüssig, für die auch die chinesischen Denker selbst ein helles Bewusstsein hatten, da es ihnen darum ging, auf die besonderen Fragen ihrer jeweiligen Epochen zu antworten. Die Betrachtung der chinesischen Tradition in ihrer langen Entwicklung zeigt uns deren Vielfalt und Lebenskraft und ermöglicht es, sowohl das sich Ändernde als auch das Bleibende zu sehen. Die historische Dimension sorgt darüber hinaus auch für die nötige Distanz, derer ein kritischer Geist stets bedarf, und bewahrt vor der stets lauernden Gefahr der Verallgemeinerung und voreiliger Schlussfolgerungen. In einer so langen Tradition entwickelte Begriffe nehmen nicht unbedingt in jeder Epoche dieselbe Bedeutung an, denn sie werden in stets neuen Problemfeldern und Zusammenhängen verwendet.
Die Bedeutung der Geschichte beruht auch auf dem Stellenwert, der Gesellschaft und Politik in China immer beigemessen wurde, auch wenn das Individuelle in Zeiten der Wirren ebenfalls eine beachtliche Rolle spielte. Es muss hier an die besondere Stellung des Intellektuellen erinnert werden, der vor allem als Beamten-Gelehrter in der Kaiserzeit selten seine Rolle des ›Fürstenberaters‹ aus dem Auge verlor. Das Geschick des chinesischen Denkens ist untrennbar mit dem der Dynastien verbunden – von Konfuzius an, der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung den Begriff des ›himmlischen Mandats‹ entwickelte, bis hin zum Verfall der kanonischen Tradition zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der direkt mit dem Untergang des Kaisertums in Zusammenhang steht.
Schon im frühesten Altertum, ab Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, zeigt die chinesische Zivilisation in ihren allerersten schriftlichen Zeugnissen besondere Züge, die ihre Wurzeln im Ahnenkult und in der besonderen Rolle der Wahrsagerei bei der Ausbildung von Schrift und Rationalität haben.
Konfuzius setzt kühn auf den Menschen und erarbeitet eine Ethik, die das Bewusstsein der Menschen in China bleibend beeinflussen sollte. In der entscheidenden Epoche der Streitenden Reiche (4.–3. Jahrhundert v. Chr.) erlebt China einen großartigen Ideenaustausch zwischen zahlreichen Gedankenrichtungen und ein subtiler Gedankenausdruck bildet sich heraus. In dieser Zeit zeichnet sich alles Spätere ab: Ausgangspunkte, Lösungsansätze, Fragestellungen, Orientierungen.
Mit der Einigung des Reichs durch den Ersten Qín-Kaiser im Jahr 221 v. Chr. kommt der Pluralismus der Streitenden Reiche zum Stocken. Das sprudelnde geistige Leben der Vorkaiserzeit erfährt zur Zeit der Hàn-Dynastie (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) eine erste Stabilisierung: Es bilden sich die Institutionen und politische Gepflogenheiten heraus, die das chinesische Kaisertum während seines zweitausendjährigen Bestehens in den Hauptzügen bestimmen werden, und es zeichnet sich eine kulturelle Identität ab, die auf einer Reihe gemeinsamer Begriffe und schon in bestimmte Formen gebrachte Denkweisen fußt.
Die Pax sinica scheint zu triumphieren, doch dann eröffnet sich mit dem Sturz der Hàn-Dynastie im 3. Jahrhundert und der Aufsplitterung des politischen Raums eine neue Epoche. Die ganze Weltsicht der Hàn-Zeit stürzt ein, die Denkrichtungen der Streitenden Reiche leben wieder auf und China wird mit einem ›Außen‹ konfrontiert: Der Buddhismus dringt aus Indien ein und fasst in China Fuß. Die Denkweise des Buddhismus, dem chinesischen Denken zunächst völlig fremd, passt sich einerseits der Gesellschaft und den Gebräuchen an und formt anderseits alle kulturellen Errungenschaften tiefgreifend um, sodass es schließlich zur Blütezeit der Táng-Dynastie kommen kann.
Angesichts des gewaltigen buddhistischen Einflusses unternehmen die Denker der Sòng-Zeit ab Ende des ersten Jahrtausends ebenso gewaltige Anstrengungen, ihre Gelehrtentradition völlig neu zu überdenken. In der Míng-Zeit im 15.–17. Jahrhundert wird diese Erneuerung dann als zu stark der Buchgelehrsamkeit verhaftet aufgefasst und man wendet sich wieder stärker der Innenschau zu, was anschließend, beschleunigt durch die Errichtung der Mandschu-Dynastie der Qīng, als Gegenreaktion eine Neubesinnung auf praktische Werte hervorruft.
Als das chinesische Denken die Assimilierung des Buddhismus abgeschlossen hat, wird es mit der ihm noch fremderen Tradition des Christentums und der europäischen Wissenschaften konfrontiert, zunächst durch Missionare, dann durch im Laufe des 19. Jahrhunderts ständig zunehmende Kontakte und schließlich durch die Angriffe der westlichen Mächte. An der Wende zum 20. Jahrhundert ist China zwischen der erdrückenden Last seines Erbes und der dringenden Notwendigkeit, Antworten auf die neue Herausforderung des als Inbegriff der Modernität aufgefassten Westens zu finden, hin- und hergerissen. Unsere Betrachtung endet mit der symbolträchtigen, alles Hergebrachte über den Haufen werfenden Bewegung des 4. Mai 1919: Als erste Bewegung solchen Ausmaßes kehrt sie der zweitausendjährigen Tradition entschlossen den Rücken und läutet eine neue Ära ein, deren Widersprüche und Konflikte noch nicht gelöst sind.
Tradition
Im Zentrum unseres Buchs, dem die zeitliche Abfolge Rahmen und allgemeine Anhaltspunkte gibt, stehen die wichtigsten Anliegen der chinesischen Denker, das, was im Herzen der Diskussionen steht und strittig ist, und auch das, was unausgesprochen bleibt, weil es als selbstverständlich und keiner Erläuterung bedürfend aufgefasst wird. Im Gegensatz zu dem in der Nachfolge des griechischen Logos stehenden philosophischen Denken, das stets das Bedürfnis verspürt, seine Grundlagen und Behauptungen zu begründen, kann das chinesische Denken, das von einem implizit akzeptierten gemeinsamen Substrat ausgeht, nicht als eine Aufeinanderfolge theoretischer Systeme dargestellt werden. Sagte nicht schon Konfuzius, der doch als erster in eigenem Namen sprechender chinesischer Denker gilt: »Ich übermittele und schaffe nichts Neues«3.
Es erscheint daher sinnvoller, den Schwerpunkt auf die Entwicklung der Begriffe zu legen, welche meist durch die Tradition weitergeleitet werden und nicht einem bestimmten Autor zuzuschreiben sind.4 Da das chinesische Denken von einer Reihe vorgegebener Voraussetzungen ausgeht, besteht die eigentliche Arbeit des Historikers darin, die Streitpunkte und Debatten zu erfassen, die mehr anhäufend als dialektisch die Entwicklung der Tradition voranbringen. Chang Hao spricht heute von »internen Dialogen«, die »eine spezifische Form von intellektuellen Diskussionen darstellen, die in der ganzen chinesischen Tradition über Jahrhunderte fortgesetzt wurden. Diese Tradition hat sich, wie auch Traditionen anderer Hochkulturen, entwickelt, indem sie einen Grundstock von Fragen und Gedanken aufhäufte, der die Welt der Intellektuellen von Generation zu Generation in Spannung hielt.«5 Es ist, als würde aus diesen ›internen Dialogen‹ im Laufe der Zeit ein Wandteppich gewoben, und wir wollen in unserem Buch zeigen, wie sich schließlich deutliche Motive auf dem Gewebe abzeichnen. Es handelt sich daher nicht nur darum, dem Zeitfaden zu folgen, sondern auch einen gestalteten Raum zu zeichnen, in dem wir uns zurechtfinden können.6
Denken oder Philosophie?
All das oben Gesagte scheint es uns zu verbieten, das chinesische Denken als Philosophie zu bezeichnen – ein Begriff, den die Erben des Logos, andere Anwärter eifersüchtig abweisend, für sich allein in Anspruch nehmen: Das chinesische Denken befände sich somit in einem »präphilosophischen Stadium« oder wird auf den Bereich der »Weisheit« verwiesen. Wir seien genötigt, anzuerkennen, dass die »Philosophie griechisch redet«7, und was nütze es da, der »Kunst, Begriffe zu schaffen«, ihr keines Beistands bedürfendes Monopol streitig machen zu wollen? »Der Orient«, so erfahren wir, »kennt keine Begriffe, denn er begnügt sich damit, neben eine ganz abstrakte Leere ohne jede Vermittlung ein ganz triviales Sein zu setzen«.8 Solche Urteile sind Ausdruck eines intellektuellen Hochmuts, welcher, zusammen mit der Vormachtstellung des Westens, verständlich macht, warum das Etikett ›Philosophie‹ heute vielerorts so heiß begehrt ist und jede Kultur es um ihrer Würde willen für sich in Anspruch nehmen möchte. Wie Joël Thoraval gezeigt hat, hat sich auch China diesen Wunsch nach Anerkennung nicht versagt und nimmt die Kategorie ›Philosophie‹ für sich in Anspruch, die sie mit einer Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Japanischen entlehnten Wortneuschöpfung bezeichnet (zhéxué哲學, japanisch tetsugaku).9
Angesichts der Heterogenität der Texte der chinesischen Denker (neben Abhandlungen, die ein Thema oder einen Begriff zusammenhängend behandeln, gibt es eine reiche Literatur von Kommentaren hauptsächlich zu den Klassikern sowie – bunt gemischt – Gedichte, Briefe, Vorworte und aus bestimmten Anlässen verfasste Texte) kommt man allerdings nicht umhin festzustellen, dass es schwierig ist, einen wirklich ›philosophischen‹ Korpus von ›religiösen‹, ›literarischen‹ oder ›wissenschaftlichen‹ Texten zu trennen (haben sich aber nicht auch die Stoiker in poetischer Form und Briefen ausgedrückt?). Man kann aber auch nicht bestreiten, dass sich in dieser blühenden Literatur eine gewisse Anzahl von Texten mit fruchtbaren Intuitionen findet, die das Denken über Jahrtausende belebten und deren Auffassungen über die Welt und den Menschen wohlgestalteten Zusammenhang und beständige Bemühung um bessere Formulierung zeigen. Es entwickelte sich schon zur vorkaiserlichen Zeit eine Ausdrucksweise, die zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zu einem hervorragenden, wunderbar zugeschliffenen Werkzeug ausgefeilt wurde und die bestens geeignet ist, in alle Spalten der Wirklichkeit einzudringen und sich subtilem Denken anzupassen.
Wenn also die Ausdrucksweise keineswegs, wie so oft behauptet, dem Vagen huldigt, sondern im Gegenteil nach immer präziserer Formulierung strebt, so ist die Form der Texte jedoch selten geradlinig, einem logischen Faden folgend und autonom in dem Sinne, dass der Text selbst die Schlüssel zu seinem Verständnis liefern würde. Meist bilden die Texte ein Gewebe im eigentlichen Sinn des Wortes (unser Wort ›Text‹ leitet sich aus dem lateinischen Wort für ›weben‹ ab), das beim Leser die Vertrautheit mit den wiederkehrenden Motiven voraussetzt. Sie erwecken den Eindruck, ständig nur traditionelle Äußerungen zu wiederholen, wie ein Weberschiffchen, das unermüdlich auf denselben Kettenfäden hin- und hergleitet. Auf was wir achten müssen, ist das Motiv, das sich dabei langsam abzeichnet, denn es ist das Sinntragende.
Selten wird der Gegenstand der Debatten klar genannt, was nicht bedeutet, dass es keine Debatte gegeben hätte. In den Texten der Zeit der Streitenden Reiche werden echte Ideenkämpfe ausgetragen, allerdings auf eine recht kuriose Weise, vor allem wenn wir sie mit der offenen Auseinandersetzung der griechischen Tradition vergleichen, die sich in der Redekunst der Agora und der Gerichte und in kontradiktorischen, mit Sophistik und Logik gespeisten Debatten entfaltet hat. Man sollte es sich bei der Betrachtung des Schachbretts der geistigen Auseinandersetzungen im alten China zur Regel machen, immer zu verstehen zu versuchen, auf welchen Begriff und auf welche Debatte das Gesagte Bezug nimmt und auf Grundlage welcher Denkweise eine andere verstanden werden kann. Die chinesischen Texte erhellen sich, wenn wir wissen, wem sie antworten. Sie bilden daher keine geschlossenen Systeme, da sich ihr Sinn aus dem Netz ihrer Bezüge ergibt. Statt sich in Begriffen zu konstruieren, entwickeln sich die Gedanken in diesem großen Wechselspiel der Verweise, was eben Tradition, und zwar lebendige Tradition darstellt.
Das Fehlen einer theoretischen Untermauerung in der Art der Griechen oder Scholastiker erklärt sicherlich die chinesische Tendenz zum Synkretismus. Es gibt hier keine absolute und ewige Wahrheit, sondern Dosierungen. Daraus folgt insbesondere, dass Widersprüche nicht als unlösbar, sondern eher als Alternativen aufgefasst werden. Statt Urteile, die sich ausschließen, haben wir eher Gegensätze, die sich ergänzen, bei denen es ein Mehr und ein Weniger geben kann: Man schreitet in unmerklichen Übergängen vom Yīn zum Yáng, vom Undifferenzierten zum Differenzierten.
Zusammenfassend gesagt, das chinesische Denken geht nicht so sehr linienförmig oder dialektisch als vielmehr spiralförmig vor. Es erfasst sein Thema nicht ein für alle Mal durch eine Reihe von Definitionen, sondern indem es immer engere Kreise um es zieht. Das ist nicht Zeichen eines zögernden oder ungenauen Denkens, sondern vielmehr des Willens, einen Sinn zu vertiefen, anstatt einen Begriff oder einen Denkgegenstand zu erhellen. Vertiefen bedeutet, den Sinn einer (aus dem beharrlichen Studium der klassischen Schriften entnommenen) Lektion, einer (von einem Meister erteilten) Belehrung, einer (selbst erlebten) Erfahrung immer tiefer in sich, in seine Existenz einsinken zu lassen. Dem entspricht die Verwendung der Texte in der chinesischen Ausbildung, wo sie nicht einfach gelesen, sondern eingeübt wurden: zunächst auswendig gelernt und dann durch Studium der Kommentare, durch Diskussion, Reflexion und sinnende Betrachtung vertieft. Als Zeugnisse der lebendigen Worte von Meistern richten sie sich nicht nur an den Verstand, sondern an den ganzen Menschen. Wichtig ist nicht, sie zu bekritteln, sondern sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie einzuüben und sie letztendlich zu leben. Denn das eigentliche Ziel ist nicht die intellektuelle Freude an Gedanken. Es geht nicht um geistige Abenteuerlust, nicht darum, immer besser zu begründen, sondern darum, in ständiger Anspannung nach Heiligkeit zu streben, unser Menschenwesen in immer größerer Harmonie mit der Welt zu leben.
Denken und Wirklichkeit auf gleicher Ebene
Die Sprache der Texte des alten China ist also weniger deskriptiv oder analytisch als instrumental. Wenn das chinesische Denken niemals das Bedürfnis verspürt, die Fragestellung, das Thema oder den Gegenstand explizit zu nennen, dann deswegen, weil es ihm nicht darum geht, irgendeine theoretische Wahrheit zu finden. Vielleicht hängt dies mit der chinesischen Schrift zusammen, die von den europäischen phonetischen Alphabeten grundlegend verschiedenen ist. Dieser Schrift – deren Ursprünge in der Wahrsagerei liegen – werden, wie sichtbaren Zeichen überhaupt, magische Kräfte zugeschrieben.
Statt sich auf begriffliche Konzeptionen zu stützen, gehen die chinesischen Denker von den Zeichen selbst aus. Diese sind keine Verkettung von in sich sinnleeren phonetischen Elementen, sondern jedes von ihnen bildet eine sinntragende Einheit und wird als ein ›Ding unter den Dingen‹ wahrgenommen. Wenn ein chinesischer Autor zum Beispiel vom ›Wesen‹ (des Menschen) spricht, so denkt er an das Schriftzeichen 性, das sich aus den Bestandteilen 生, was Geburt oder Leben, und 忄, was Herz bzw. Geist bedeutet, zusammensetzt, wodurch seine Überlegungen in eine vitalistische Richtung gelenkt werden. Das chinesische Denken kann sich durch die besondere Natur der Schrift der Vorstellung hingeben, es reihe sich ins Reale ein, statt sich ihm zu überlagern.10 Die Nähe oder Verschmelzung mit den Dingen entspringt einerseits sicherlich dieser besonderen Form der schriftlichen Darstellungsweise, und sie bedingt anderseits auch eine bestimmte Form des Denkens, die – statt seine Objekte in kritischer Distanz aufzubauen – dazu neigt, in das Reale eingetaucht zu bleiben, um dessen Harmonie besser zu fühlen und zu bewahren.
Neben der Schrift müssen auch die grammatischen Besonderheiten des Altchinesischen beachtet werden. Die antike griechische und lateinische Philosophie ist ohne Verneinungspräfixe, abstrahierende Suffixe usw. unvorstellbar. Es ist bekannt, dass die mittelalterliche Scholastik zu einem großen Teil Überlegungen zu den grammatischen Kategorien des Lateinischen entstammt: Unterscheidung zwischen Substantiv und Adjektiv, zwischen Passiv und Aktiv (Subjekt/Objekt), das Verb ›sein‹ usw. Das Chinesische ist dahingegen keine flektierende Sprache, bei der die Rolle eines jeden Satzelements durch Geschlecht, Singular- und Pluralkennzeichen, Deklination, Konjugation usw. bestimmt wäre, sondern die Bezüge werden nur durch die Stellung der Wörter (bzw. Schriftzeichen, da jedes Schriftzeichen eine Sinneinheit darstellt) in der Satzfolge ausgedrückt. Es gibt daher keine Grundstruktur des Typs Subjekt – Prädikat, die etwas über etwas aussagt und damit implizit die Frage aufwirft, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Eine der auffälligsten Besonderheiten des Altchinesischen im Vergleich zu den indoeuropäischen Sprachen ist das Fehlen des Verbs ›sein‹ als Prädikat. Die Identität wird einfach durch ein Nebeneinanderstellen ausgedrückt. Jean Beaufret drückte es so aus: »Die Quelle ist überall als Unbestimmtes da, sei es im Chinesischen, Arabischen oder Indischen … aber die Griechen hatten das seltsame Privileg, diese Quelle Sein zu nennen«.11
Es ist daher nicht verwunderlich, dass das chinesische Denken nicht in die Fachgebiete der Epistemologie und Logik mündete, welche auf der Überzeugung aufbauen, dass das Reale Gegenstand einer theoretischen Beschreibung sein kann, indem seine Strukturen in Parallele zu denen des menschlichen Verstands gesetzt werden. Der analytische Ansatz beginnt mit einer kritischen Distanz, die sowohl das Subjekt als auch das Objekt schafft. Das chinesische Denken ist dahingegen völlig im Wirklichen eingetaucht: Es gibt hier keine Vernunft außerhalb der Welt.
Wissen und Tat: das Dào
In diesem, mit der Realität auf gleicher Ebene stehenden Denken gelten die Überlegungen weniger dem Wissen als solchem als vielmehr seinem Bezug zur Tat. Es gibt dabei zwei Hauptrichtungen: Die eine setzt die Tat als Horizont des Wissens (und ist daher stets bemüht, nur nach für die Tat relevantem Wissen zu suchen), die andere streitet dem Bezug zwischen Wissen und Tat jede Gültigkeit ab (und damit jeder Begründung von Tat durch Wissen und jedem tatorientierten Wissen). Der ersten Richtung, bestens vertreten durch die konfuzianische Tradition, geht es hauptsächlich um den tatsächlichen Übergang vom Wissen zur Tat, was in den chinesischen Begriffen als Übergang vom Latenten zu seiner sichtbaren Manifestation verstanden wird. Ihre Hauptalternative hingegen, die taoistische Tradition, bevorzugt und pflegt das, was diesseits des Sichtbaren, vor dem Sichtbaren liegt. Die Achse Wissen – Tat hat somit zwei Seiten: die des politischen Anliegens (als Gestaltung der Welt entsprechend der Sicht des Menschen) und die der künstlerischen Sicht (als Beteiligung des Menschen am Gebären der Welt). Es ist daher kaum verwunderlich, dass wir diese Gesichtspunkte oft in ein und derselben Person vereint vorfinden, die sich mit größter Selbstverständlichkeit gleichzeitig als Dichter-Maler-Kalligraph und als Berater eines Fürsten oder Staatsmanns betätigt.
Wissen im konfuzianischen Geist – aufgefasst als das, was noch nicht Tat ist, aber werden soll – bedeutet weniger ein ›Wissen, was‹ (das heißt Kenntnis von Aussagen, deren Inhalt im Idealfall die Wahrheit sein sollte) als vielmehr ein ›Wissen, wie‹: zu wissen, wie Unterscheidungen anzustellen sind, damit wir unser Leben richtig lenken und den gesellschaftlichen und kosmischen Raum richtig gestalten. Es handelt sich um ein Wissen, das nicht intellektuell Aussagen beurteilt, sondern die Gegebenheit der Sachen und Sachverhalte einzubeziehen strebt. Zumindest bis zum radikalen Wandel durch den Buddhismus sind die Texte der chinesischen Denker in dem Sinn instrumental, dass sie stets und zuerst auf die Tat ausgerichtet sind. Konfuzius war der erste, der sagte, dass er Angst davor habe, seine Rede könne seine Taten übersteigen. Die Tat ist nicht nur das Anwenden des Gesagten, sie ist sein Maß, und das Gesagte hat nur Sinn, wenn es direkt auf die Tat wirkt.
Diese Auffassung des Verhältnisses zwischen Wissen und Tat sowie, allgemeiner gesprochen, der stete Zweifel an der Rede als Selbstzweck erklären, warum sich das antike chinesische Denken nicht so sehr mit dem Phänomen des Wissens (dem Gegenstand der Epistemologie) auseinandergesetzt hat als vielmehr mit dem Verhältnis zwischen Rede und Tatsächlichkeit (in chinesischen Begriffen ausgedrückt: zwischen ›Name‹ und ›Realität‹). Daher rührt auch der Gedanke, dass die Art, wie ein Ding benannt wird, selbst Einfluss auf die konkrete Realität hat. Wahrheit ist zunächst etwas Ethisches, da die Hauptsorge der richtigen Verwendung der Rede gilt und nicht dem, was die Wahrheit von Einstellungen, Gedanken, Aussagen oder Begriffen ausmacht.12 Es handelt sich dabei jedoch nicht so sehr um ein auf das ›Praktische‹, ›Pragmatische‹ reduziertes Denken, sondern es ist angebrachter, von einem Denken zu sprechen, das von vornherein in Situation und Bewegung ist wie die Parallelperspektive in der Malerei, die keinen idealen Fixpunkt setzt, sondern sich mit dem Blick durch den Bildraum bewegt.
Die verschiedenen Denkrichtungen des alten China wollen keine abgeschlossenen Systeme anbieten, die innewohnende vitale Möglichkeiten ersticken könnten, sondern ein Dào (道, in westlichen Sprachen bisher üblicherweise ›Tao‹ geschrieben). Dieses Wort, das oft fälschlich als Alleinbesitz der Taoisten angesehen wird, ist in Wirklichkeit ein häufig verwendeter Begriff der antiken Literatur, welcher ›Straße‹ und im weiteren Sinn ›Methode‹, ›Vorgehensweise‹ bedeutet. Unser Wort ›Weg‹ gibt diese engere und weitere Bedeutung wieder. Da jedoch die Übergänge zwischen den Wortarten im alten Chinesisch fließend sind, kann dào als Verb auch ›gehen‹, ›voranschreiten‹ sowie – interessanterweise – auch ›sprechen‹, ›etwas sagen‹ heißen. Jede Denkrichtung hat ihr Dào, was bedeutet, dass sie in Form von Aussagen eine Lehre anbietet, deren Gültigkeit nicht theoretischer Art ist, sondern eine Lebensweise darstellt. Das Dào strukturiert die Erfahrungen und ist somit Synthese einer Perspektive, ohne welche die Wahrheit des expliziten Inhalts eines Textes nicht eingeschätzt werden kann.
Es geht dabei weniger darum, das Ziel zu erreichen, als vielmehr darum, gehen zu können. »Was wir Dào nennen«, sagte Zhuāngzǐ im 4. Jahrhundert v. Chr., »ist das, was wir benutzen, um gehen zu können«.13 Oder an anderer Stelle: »Hafte deinen Geist nicht an ein ausschließliches Ziel, sonst wirst du gehbehindert im Dào«. Der WEG ist niemals vorgezeichnet, sondern zeichnet sich ab, während man ihn begeht. Man kann daher unmöglich über ihn sprechen, wenn man nicht einen Fuß vor den anderen setzt. Das chinesische Denken ist kein Denken des Seins, sondern des Prozesses, welcher sich im Laufe seiner Entwicklung festigt, bestätigt, vervollkommnet. Unter Zuhilfenahme einer echt chinesischen Dichotomie können wir sagen: Die Beschaffenheit (tǐ體) einer jeden Realität nimmt in ihrer Funktionsweise (yòng用) Gestalt an.
Einheit und Kontinuität: der Hauch
Das chinesische Denken wurzelt im Grundvertrauen des Menschen in die Welt, in der er lebt, und in der Überzeugung, dass der Mensch in der Lage ist, das Ganze der Realität mit seinem Wissen und seiner Tat zu umarmen – das Ganze als das Eine, auf das sich die unendliche Vielfalt seiner Teile bezieht. Die Welt als organische Ordnung wird nicht außerhalb des Menschen gedacht, und der Mensch, der auf natürliche Weise in die Welt gehört, denkt sich nicht außerhalb der Welt. So gilt es, die Harmonie, die im natürlichen Lauf der Dinge herrscht, im Leben und in den Beziehungen der Menschen zu wahren. Die Welt wird nicht aus der Perspektive eines fernen Sterns für analysierbar oder nichtig befunden, sondern als Ganzes aus ihrem eigenen Inneren heraus wahrgenommen: Das ist der Sinn des berühmten Bilds vom Yīn und Yáng – der Weg eines Punktes, der vom zunächst beginnenden und dann reifen Yīn ins Yáng umschlägt und so einen Kreis, Inbegriff des Globalen, beschreibt.
Die vom chinesischen Denken im Laufe seiner ganzen Entwicklung erstrebte Einheit ist die Einheit des Hauchs (qì氣). Das Qì ist die Lebensenergie oder der Lebensstrom, der das ganze Universum belebt. Jegliche Wirklichkeit, sei sie physikalisch oder geistig, ist nichts als Lebensenergie. Das Denken ist nicht über oder neben, sondern im Leben, es ist der Fluss des Lebens selbst. Der Geist arbeitet nicht losgelöst vom Körper: Es gibt eine Physiologie der Gefühle, des Geistes und der Gedankenwelt, so wie es eine Spiritualität des Körpers als Verfeinerung und Sublimierung der physikalischen Materie gibt.
Der Hauch ist sowohl Geist als auch Materie. Er sorgt auf allen Ebenen für die organische Kohärenz der Welt des Lebendigen. Er zirkuliert als Lebensstrom ständig zwischen seiner unbestimmten Quelle und der unendlichen Vielfalt seiner sichtbaren Manifestationen. Der Mensch wird nicht nur durch ihn in allen seinen Aspekten belebt, sondern er schöpft aus ihm auch seine Wertkriterien, sowohl die moralischen als auch die künstlerischen. Das Qì ist Quelle der moralischen Energie. Es ist keineswegs ein abstrakter Begriff, sondern wird zutiefst im Wesen und im Leib verspürt. Es ist zwar ganz konkret, jedoch nicht immer sicht- oder greifbar: Es kann das Temperament einer Person, die Stimmung eines Orts, die Ausdruckskraft eines Gedichts oder die Fracht der Gefühle eines Kunstwerks sein. Seit Cáo Pī, der im 3. Jahrhundert n. Chr. die Meinung vertrat, dass »in der Literatur der Hauch das Wichtigste ist«, und Xiè Hè, der zweihundert Jahre später sagte, dass »es in der Malerei darum geht, die harmonischen Qì in lebendige Bewegung zu bringen«, steht das Qì im Mittelpunkt nicht nur des ethischen, sondern auch des ästhetischen Denkens. Es wird daher gesagt, dass die chinesische Kultur eine Kultur des Hauchs sei.
Wandlung
In einer Denkweise, die das generative Modell (dessen Urform möglicherweise im Ahnenkult zu finden ist) gegenüber dem kausalen bevorzugt, ist die relevante Scheidelinie nicht die zwischen Transzendenz und Immanenz, sondern zwischen Virtuellem und Manifestem. Da diese als zwei Aspekte ein und derselben, stets hin- und herpendelnden Wirklichkeit aufgefasst werden, führen sie nicht zu ›disjunktiven Begriffen‹ wie Sein/Nichts, Geist/Körper, Gott/Welt, Subjekt/Objekt, Realität/Anschein, Gut/Böse usw. Da die Chinesen ein Gefühl für die dem Dualismus innewohnende Gefahr hatten, das Kreisen des Lebenshauchs in einem ausweglosen Zweikampf erstarren zu lassen, bevorzugten sie die Polarität von Yīn und Yáng, die den Wechselstrom des Lebens und das korrelative Wesen aller organischen Realität – Koexistenz, Kohärenz, Korrelation, Komplementarität … – wahrt. Daraus ergibt sich eine Sicht der Welt nicht als Menge von diskreten und unabhängigen Einheiten, die jede für sich eine Essenz darstellen, sondern als ein kontinuierliches Netz von Beziehungen zwischen dem Ganzen und den Teilen, ohne dass Ersteres Letztere transzendiert.
Wird die Welt als Kontinuum aufgefasst, wird man eher zum Begriff eines zyklischen Rhythmus (sowohl beim natürlichen Lauf der Dinge als auch in den menschlichen Angelegenheiten) neigen als zum Gedanken eines absoluten Beginns oder einer Schöpfung ex nihilo. Auch wenn die chinesischen Texte gelegentlich auf kosmogonische Vorstellungen eines Ursprungs oder einer Genese der Welt Bezug nehmen, so wird die Welt doch überwiegend als etwas dargestellt, das sich wandelnd »von selbst so ist«. Die Überlegungen zu den Grundlagen des Universums befassen sich kaum mit den Elementen, aus denen sie aufgebaut ist, und noch weniger mit der Frage der Existenz eines Schöpfergottes: Was als ursprünglich angesehen wird, ist der Wandel. Dieser ist die Triebfeder der universellen Dynamik, das heißt des Lebenshauchs.
Der Hauch ist eins, aber nicht als kompakte, statische, starre Einheit – ganz im Gegenteil ist er lebendig und kreist ständig. Er ist seinem Wesen nach Wandel. Hier handelt es sich um eine eigenständige chinesische Intuition. Wenn Konfuzius ohne Umschweife mit der Unterscheidung der verschiedenen Lebensalter das Gesetz der Zeit bejaht, so handelt es sich um eine Zeitlichkeit, die nicht erlitten, sondern im Gegenteil in allen Stufen ihrer Wandlung voll gelebt und akzeptiert wird und in eine Art von ›Freiheit‹ mündet – Freiheit nicht im Sinne einer Entscheidungsfreiheit, sondern einer völligen Übereinstimmung mit der Weltordnung. Eine der Kernintuitionen des Lăozǐ (besser bekannt als Tao Te King) ist, dass sich alle Dinge in ihrer Rückkehr erfüllen, welche schlechthin die »Bewegung des Dào«, das heißt des Lebens, ist. Rückkehr zur ursprünglichen Leere: Dies darf nicht als Vernichtung aufgefasst werden, sondern ist synonym mit lebendig und konstant. Lebendig deswegen, weil die Leere nicht ein Ort ist, in dem die Dinge resorbiert werden, sondern das, woraus der Hauch immer wieder neu quillt. Konstant deswegen, weil die Leere die Wandlung ermöglicht und gleichzeitig das ist, was sich nicht wandelt. In der Auslegungstradition des berühmten Buchs der Wandlungen (Yìjīng, in europäischen Sprachen oft I-king geschrieben) treffen sich Konfuzianer und Taoisten insofern, als sie beide das intuitive Verständnis des Lebenshauchs als Wandel teilen, wobei die Konfuzianer die Wandlung als »Leben, das ohne Unterlass Leben gebiert« verstehen, wohingegen für die Taoisten die Leere als Inbegriff der Virtualität paradoxerweise Wurzel des Lebens ist, während alles, was seine ›Fülle‹ erreicht hat, sich verhärtet und vergeht.14
Beziehung und Mittigkeit
Die Kontinuität zwischen den Teilen und dem Ganzen fließt auch in die Betrachtungen der chinesischen Denker über Beziehungen überhaupt ein. Die Beziehung ist hier nicht einfach eine Verbindung zwischen bis dahin deutlich getrennten Einheiten, sondern sie bildet die Wesen in ihrem Sein und Werden. Konfuzius beginnt damit, unsere Menschlichkeit in der Beziehung zu sehen, die uns eint, weil wir zusammenleben. Die Gegensatzpaare, die die chinesische Sicht der Welt und der Gesellschaft strukturieren (Yīn/Yáng, Himmel/Erde, Leere/Fülle, Vater/Sohn, Herrscher/Minister usw.), führen nicht zu einer dualistischen Denkweise im oben erwähnten disjunktiven Sinn, sondern zu einer ternären, da sie das Zirkulieren des Hauchs zwischen den beiden Begriffen miteinbeziehen. Die kreisende, spiralige Bewegung des Hauchs weist auf ein Zentrum hin, das zwar niemals lokalisierbar oder im Voraus feststehend, aber nichtsdestoweniger real und konstant ist.
Das Paar Himmel/Erde ist nicht einfach die Addition zweier Begriffe, sondern es schafft, indem es die Wechselwirkung ihres Bezugs, ihr wechselbezügliches Werden impliziert, einen dritten Begriff, nämlich den der organischen, lebendigen, schöpferischen Beziehung, durch die das Paar gebildet wird. Der dritte Begriff ist in der kosmologischen Spekulation nichts anderes als der Mensch selbst, der durch seine aktive Beteiligung das kosmische Werk ›vollendet‹. Am Menschen und dem, was ihn mit dem Universum verbindet, setzen die Überlegungen der chinesischen Denker zur ›Mitte‹ (中) als dem ›dazwischen Geborenen‹ und zur Bedeutung dieser Mitte für das moralische Verhalten an.
Die Übersetzung des Begriffs zhōng bzw. zhòng (中) als »Mitte« ist problematisch und führt leicht zu Missverständnissen. Das Wort ist sowohl Substantiv (zhōng) als auch Verb (zhòng) und bezeichnet nicht nur die räumliche Mittigkeit, sondern auch eine dynamische und wirkende Kraft. Als Substantiv ist es der richtige Weg, der die Angemessenheit von Ort und Zeitpunkt beinhaltet. Als Verb ist es die Bewegung des Pfeils, der das Ziel in der Mitte durchbohrt (was das Schriftzeichen bildlich darstellt: 中). So wie der Bogenschütze dank der Treffsicherheit seiner natürlichen, völlig mit dem Dào im Einklang stehenden Bewegung ins Schwarze trifft, so ist zhòng ungestörte Wirksamkeit der Riten. Das hat nichts zu tun mit der Sorge, die ›richtige Mitte‹ zwischen zwei Extremen zu wahren oder sich mit feigen Kompromissen, die sich mit einem ›Mittelmaß‹ begnügen, abzugeben. Das Allerparadoxeste ist, dass die Mitte von chinesischen Denkern als »Firstbalken (jí 極)« bezeichnet wurde, der ganz oben das ganze Gebäude zusammenhält und aus dem sich alles ableitet.15 Im Großen Plan des antiken Buchs der Dokumente erscheint die Mitte schon als höchste Anforderung:
Nicht schräg, nicht voreingenommen: groß ist der Königsweg.
Nicht voreingenommen, nicht schräg: eben ist der Königsweg.
Kein Zurückschreiten, kein Abweichen: rechtschaffen und gerade ist der Königsweg.
Alles in ihm mündet in der äußersten Anforderung, alles in ihm kehrt zu ihr zurück.16
Die MITTE ist somit kein abstandsgleicher Punkt zwischen zwei Gegebenheiten, sondern eher der Pol, der uns nach oben zieht, der in jeder Lebenssituation eine Spannung schafft und aufrechterhält, durch die wir immer mehr nach dem Besten von dem streben, was zwischen uns aus unseren Beziehungen erwächst. Dies ist in den Augen der chinesischen Denker von entscheidender Bedeutung: Ohne diese Spannung, diese ständig im Wandel aufrechterhaltene Anforderung, kann die Lebensordnung, welche das Dào ist, sich nicht schaffen und nicht fortdauern. Die Mitte ist in der Tat nichts anderes als das Gesetz des Dào. In der Leere der Taoisten ist das Zentrum erkennbar, wo sich die Lebenskräfte für einen harmonischen und dauerhaften Wandel schaffen und erneuern.
»Besser ist es, in der Mitte zu bleiben«17, sagt Lăozǐ. Statt der Versuchung zu erliegen, die Zweige – die sichtbaren und schön anzusehenden Teile – zu pflegen, ist es besser, die Wurzel des Baums zu hegen, welche, indem sie Nahrung aus der Tiefe der Erde schöpft und – komme was da wolle – gen Himmel strebt, das perfekte Bild der chinesischen Weisheit, ihres Gefühls für das Ausgeglichene und ihres Vertrauens in den Menschen und in die Welt darstellt. Das chinesische Denken muss wohl mit seinen Wurzeln und nicht mit seinen Zweigen in den geistigen Austausch mit seinen Gesprächspartnern – früher den Buddhisten, heute dem Westen – treten. Das ist der Preis seiner Erneuerung.
1Simon Leys, L’Humeur, l’Honneur, l’Horreur. Essais sur la culture et la politique chinoises, Paris, Robert Laffont, 1991, S. 60–61.
2L’Intelligence de la Chine. Le social et le mental, Paris, Gallimard, 1994, S. 303.
3Gespräche VII, 1. Siehe Übersetzung von Anne Cheng, Paris, Édition du Seuil, 1981. So wie man einen chinesischen Autor nicht außerhalb der Tradition verstehen kann, die ihn trägt, so zeigt auch die Verwendung des Worts 家 jiā, »Familie« oder »Sippe«, als Bezeichnung von Denkrichtungen, dass geistige Traditionen wie Familientraditionen weitergegeben werden. Eine Lehre wird in Enzyklopädien, Gliederungen oder Katalogen nicht nach einem Autor, sondern nach einem von Generation zu Generation weitergegebenen Textkorpus definiert.
4