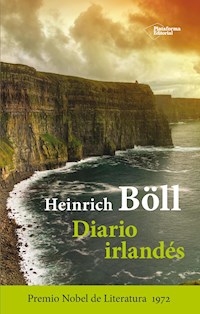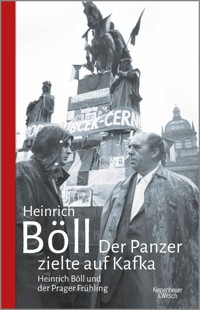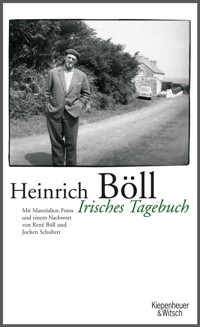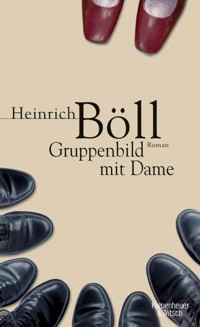
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Erzähler, dessen Beobachtungsgabe kaum zu übertreffen ist und dessen Sensibilität und Phantasie keine Grenzen kennt, schöpft aus dem Vollen.« Marcel Reich-Ranicki Leni Pfeiffer, geborene Gruyten, Jahrgang 1922, lernt während des Krieges den sowjetischen Kriegsgefangenen Boris kennen und lieben, besorgt ihm einen deutschen Pass und muß erfahren, daß er in einem Lager der Amerikaner umkommt. Inzwischen ist sie achtundvierzig, und ihr gemeinsamer Sohn sitzt im Gefängnis, weil er auf seine Weise ein an der Mutter begangenes Unrecht korrigieren wollte ... Ein ironisch als »Verf.« eingeführter Autor rekonstruiert aus hinterlassenen Zeugnissen, aus Gesprächen und Erinnerungen das Leben dieser Frau. Heinrich Böll ist mit diesem inzwischen zum Klassiker gewordenen Roman ein gestalten- und episodenreiches Panorama der deutschen Vor- und Nachkriegsgeschichte gelungen. Informieren Sie sich auch über das größte editorische Unternehmen in der Geschichte des Verlags Kiepenheuer & Witsch: Heinrich Böll, Werke 1 - 27 Kölner Ausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Inhalt
» Informationen zum Autor
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Inhalt
Kapitel 1
7
Kapitel 2
29
Kapitel 3
74
Kapitel 4
128
Kapitel 5
175
Kapitel 6
200
Kapitel 7
242
Kapitel 8
288
Kapitel 9
380
Kapitel 10
433
Kapitel 11
457
Kapitel 12
471
Kapitel 13
479
Kapitel 14
485
[Menü]
|5|Für Leni, Lev und Boris
[Menü]
|7|1
Weibliche Trägerin der Handlung in der ersten Abteilung ist eine Frau von achtundvierzig Jahren, Deutsche; sie ist 1,71 groß, wiegt 68,8 kg (in Hauskleidung), liegt also nur etwa 300–400 Gramm unter dem Idealgewicht; sie hat zwischen Dunkelblau und Schwarz changierende Augen, leicht ergrautes, sehr dichtes blondes Haar, das lose herabhängt; glatt, helmartig umgibt es ihren Kopf. Die Frau heißt Leni Pfeiffer, ist eine geborene Gruyten, sie hat zweiunddreißig Jahre lang, mit Unterbrechungen versteht sich, jenem merkwürdigen Prozeß unterlegen, den man den Arbeitsprozeß nennt: fünf Jahre lang als ungelernte Hilfskraft im Büro ihres Vaters, siebenundzwanzig Jahre als ungelernte Gärtnereiarbeiterin. Da sie ein erhebliches immobiles Vermögen, ein solides Mietshaus in der Neustadt, das heute gut und gerne vierhunderttausend Mark wert wäre, unter inflationistischen Umständen leichtfertig weggegeben hat, ist sie ziemlich mittellos, seitdem sie ihre Arbeit, unbegründet und ohne krank oder alt genug zu sein, aufgegeben hat. Da sie im Jahre 1941 einmal drei Tage lang mit einem Berufsunteroffizier der Deutschen Wehrmacht verheiratet war, bezieht sie eine Kriegerwitwenrente, deren Aufbesserung durch eine Sozialrente noch aussteht. Man kann wohl sagen, daß es Leni im Augenblick – nicht nur in finanzieller Hinsicht – ziemlich dreckig geht, besonders seitdem ihr geliebter Sohn im Gefängnis sitzt.
Würde Leni ihr Haar kürzer schneiden, es noch ein wenig grauer färben, sie sähe wie eine gut erhaltene Vierzigerin aus; so wie sie ihr Haar jetzt trägt, ist die Differenz zwischen der jugendlichen Haartracht und ihrem nicht mehr |8|ganz so jugendlichen Gesicht zu groß, und man schätzt sie auf Ende Vierzig; das ist ihr wahres Alter, und doch begibt sie sich einer Chance, die sie wahrnehmen sollte, sie wirkt wie eine verblühte Blondine, die – was keineswegs zutrifft – einen losen Lebenswandel führt oder sucht. Leni ist eine der ganz seltenen Frauen ihres Alters, die es sich leisten könnte, einen Minirock zu tragen: ihre Beine und Schenkel zeigen weder Äderung noch Erschlaffung. Doch Leni hält sich an eine Rocklänge, die ungefähr im Jahre 1942 Mode war, das liegt zum größten Teil daran, daß sie immer noch ihre alten Röcke trägt, Jacken und Blusen bevorzugt, weil ihr angesichts ihrer Brust (mit einer gewissen Berechtigung) Pullover zu aufdringlich erscheinen. Was ihre Mäntel und Schuhe betrifft, so lebt sie immer noch von den sehr guten und sehr gut erhaltenen Beständen, die sie in ihrer Jugend, als ihre Eltern vorübergehend wohlhabend waren, erwerben konnte. Kräftig genoppter Tweed, grau-rosa, grün-blau, schwarz-weiß, himmelblau (uni), und falls sie eine Kopfbedeckung für angebracht hält, bedient sie sich eines Kopftuchs; ihre Schuhe sind solche, wie man sie – wenn man entsprechend bei Kasse war – in den Jahren 1935–39 als »Unverwüstliche« kaufen konnte.
Da Leni im Augenblick ohne ständigen männlichen Schutz oder Rat in der Welt steht, unterliegt sie, was ihre Haartracht betrifft, einer Dauertäuschung; an der ist ihr Spiegel schuld, ein alter Spiegel aus dem Jahr 1894, der zu Lenis Unglück zwei Weltkriege überdauert hat. Leni betritt nie einen Frisiersalon, nie einen reich bespiegelten Supermarkt, sie tätigt ihre Einkäufe in einem Einzelhandelsgeschäft, das soeben davorsteht, dem Strukturwandel zu erliegen; so ist sie einzig und allein auf diesen Spiegel angewiesen, von dem schon ihre Großmutter Gerta Barkel geb. Holm sagte, er schmeichle nun doch zu arg; Leni benutzt den Spiegel sehr oft. Lenis Haartracht ist einer |9|der Anlässe für Lenis Kummer, und Leni ahnt den Zusammenhang nicht. Was sie mit voller Wucht zu spüren bekommt, ist die sich stetig steigernde Abfälligkeit ihrer Umwelt, im Haus und in der Nachbarschaft. Leni hat in den vergangenen Monaten viel Männerbesuch gehabt: Abgesandte von Kreditinstituten, die ihr, da sie auf Briefe nicht reagierte, letzte und allerletzte Mahnungen überbrachten; Gerichtsvollzieher, Anwaltsboten; schließlich die Sendboten von Gerichtsvollziehern, die Gepfändetes abholten; und da Leni außerdem drei möblierte Zimmer, die gelegentlich die Mieter wechseln, vermietet, kamen natürlich auch jüngere männliche Zimmersuchende. Manche dieser männlichen Besucher sind zudringlich geworden – ohne Erfolg selbstverständlich; jeder weiß, wie gerade die erfolglos Zudringlichen mit den Erfolgen ihrer Zudringlichkeit prahlen, so wird jeder ahnen, wie rasch Lenis Ruf ruiniert war.
Der Verf. hat keineswegs Einblick in Lenis gesamtes Leibes-, Seelen- und Liebesleben, doch ist alles, aber auch alles getan worden, um über Leni das zu bekommen, was man sachliche Information nennt (die Auskunftspersonen werden an entsprechender Stelle sogar namhaft gemacht werden!), und was hier berichtet wird, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als zutreffend bezeichnet werden. Leni ist schweigsam und verschwiegen – und da hier nun einmal zwei nichtkörperliche Eigenschaften aufgezählt werden, seien zwei weitere hinzugefügt: Leni ist nicht verbittert, und sie ist reuelos, sie bereut nicht einmal, daß sie den Tod ihres ersten Mannes nie betrauert hat. Lenis Reuelosigkeit ist so total, daß jegliches »mehr« oder »weniger«, auf ihre Reuefähigkeit bezogen, unangebracht wäre; sie weiß wahrscheinlich einfach nicht, was Reue ist; in diesem – und in anderen Punkten – muß ihre religiöse Erziehung mißglückt sein |10|oder als mißglückt bezeichnet werden, wahrscheinlich zu Lenis Vorteil.
Was aus den Aussagen der Auskunftspersonen eindeutig hervorgeht: Leni versteht die Welt nicht mehr, sie zweifelt daran, ob sie sie je verstanden hat; sie begreift die Feindschaft der Umwelt nicht, begreift nicht, warum die Leute so böse auf sie und mit ihr sind; sie hat nichts Böses getan, auch ihnen nicht; neuerdings, wenn sie notgedrungen zu den notwendigsten Einkäufen ihre Wohnung verläßt, wird offen über sie gelacht, Ausdrücke wie »mieses Stück« oder »ausgediente Matratze« gehören noch zu den harmloseren. Es tauchen sogar Beschimpfungen wieder auf, deren Anlaß fast dreißig Jahre zurückliegt: Kommunistenhure, Russenliebchen. Leni reagiert auf Anpöbeleien nicht. Daß »Schlampe« hinter ihr hergemunkelt wird, gehört für sie zum Alltag. Man hält sie für unempfindlich oder gar empfindungslos; beides trifft nicht zu, nach zuverlässigen Zeugenaussagen (Zeugin: Marja van Doorn) sitzt sie stundenlang in ihrer Wohnung und weint, ihre Bindehautsäcke und ihre Tränendrüsenkanäle sind erheblich in Tätigkeit. Sogar die Kinder in der Nachbarschaft, mit denen sie bisher auf freundschaftlichem Fuß stand, werden gegen sie aufgehetzt und rufen ihr Worte nach, die weder sie noch Leni so recht verstehen. Dabei kann hier nach ausführlichen und ausgiebigen, aber auch die letzte und allerletzte Quelle über Leni erschöpfenden Zeugenaussagen festgestellt werden, daß Leni in ihrem bisherigen Leben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im ganzen wahrscheinlich zwei dutzendmal einem Mann beigewohnt hat: zweimal dem ihr später angetrauten Alois Pfeiffer (einmal vor, einmal während der Ehe, die insgesamt drei Tage gedauert hat) und die restlichen Male einem zweiten Mann, den sie sogar geheiratet hätte, wenn die Zeitumstände es erlaubt hätten. Wenige Minuten, nachdem es Leni erlaubt wird, |11|unmittelbar in die Handlung einzutreten (das wird noch eine Weile dauern), wird sie zum ersten Mal das getan haben, was man einen Fehltritt nennen könnte: sie wird einen türkischen Arbeiter erhört haben, der sie kniefällig in einer ihr unverständlichen Sprache um ihre Gunst bitten wird, und sie wird ihn – das als Vorgabe – nur deshalb erhören, weil sie es nicht erträgt, daß irgend jemand vor ihr kniet (daß sie selbst unfähig ist zu knien, gehört zu den vorauszusetzenden Eigenschaften). Es sollte vielleicht noch hinzugefügt werden, daß Leni Vollwaise ist, einige peinliche angeheiratete Verwandte hat, andere, weniger peinliche, nicht angeheiratete, sondern direkte, auf dem Land und einen Sohn, der fünfundzwanzig Jahre alt ist, ihren Mädchennamen trägt und zur Zeit in einem Gefängnis einsitzt. Ein körperliches Merkmal mag noch wichtig, auch für die Beurteilung männlicher Zudringlichkeit von Bedeutung sein. Leni hat die fast unverwüstliche Brust einer Frau, die zärtlich geliebt worden ist und auf deren Brust Gedichte geschrieben worden sind. Die Umwelt möchte Leni am liebsten ab- oder wegschaffen; es wird sogar hinter ihr hergerufen: »Ab mit dir« oder »Weg mit dir«, und es ist nachgewiesen, daß man hin und wieder nach Vergasung verlangt, der Wunsch danach ist verbürgt, ob die Möglichkeit dazu bestünde, ist dem Verf. unbekannt; hinzufügen kann er nur noch, daß der Wunsch heftig geäußert wird.
Zu Lenis Lebensgewohnheiten müssen noch ein paar Einzelheiten geliefert werden; sie ißt gern, aber mäßig; ihre Hauptmahlzeit ist das Frühstück, zu dem sie unbedingt zwei knackfrische Brötchen, ein frisches, weichgekochtes Ei, ein wenig Butter, einen oder zwei Eßlöffel Marmelade (genauer gesagt: Pflaumenmus von der Sorte, die anderswo unter Powidl bekannt ist) braucht, starken Kaffee, den sie mit heißer Milch mischt, sehr wenig Zukker; an der Mahlzeit, die Mittagessen heißt, ist sie wenig |12|interessiert: Suppe und ein kleiner Nachtisch genügen ihr; abends dann ißt sie kalt, ein wenig Brot, zwei – drei Scheiben, ein wenig Salat, Wurst und Fleisch, wenn ihre Mittel es erlauben. Den größten Wert legt Leni auf die frischen Brötchen, die sie sich nicht bringen läßt, sondern eigenhändig aussucht, nicht, indem sie sie betastet, nur, indem sie deren Farbe begutachtet; nichts – an Speisen jedenfalls nichts – ist ihr so verhaßt wie laffe Brötchen. Der Brötchen wegen und weil das Frühstück ihr tägliches Feiertagsmahl ist, begibt sie sich sogar morgens unter Menschen, nimmt Beschimpfungen, mieses Gerede, Anpöbeleien in Kauf.
Zum Punkt Rauchen ist zu sagen: Leni raucht seit ihrem siebzehnten Lebensjahr, normalerweise acht Zigaretten, keinesfalls mehr, meistens weniger; während des Krieges verzichtete sie vorübergehend aufs Rauchen, um jemandem, den sie liebte (nicht ihrem Mann!), die Zigaretten zuzustecken. Leni gehört zu den Menschen, die hin und wieder ein Gläschen Wein mögen, nie mehr als eine halbe Flasche trinken und je nach Wetterlage sich einen Schnaps, je nach Stimmungs- und Finanzlage einen Sherry genehmigen. Sonstige Mitteilungen: Leni hat den Führerschein seit 1939 (mit Sondergenehmigung erhalten, die näheren Umstände werden noch erklärt), aber schon seit 1943 kein Auto mehr zur Verfügung. Sie fuhr gern Auto, fast leidenschaftlich.
Leni wohnt immer noch in dem Haus, in dem sie geboren ist. Das Stadtviertel ist aufgrund nicht zu eruierender Zufälle von Bomben verschont worden, jedenfalls ziemlich verschont worden; es wurde nur zu 35 % zerstört, war also vom Schicksal begünstigt. Kürzlich ist Leni etwas widerfahren, das sie sogar gesprächig gemacht hat, sie hat es bei nächster Gelegenheit ihrer besten Freundin, ihrer Hauptvertrauten, die auch die Hauptzeugin des Verf. ist, brühwarm erzählt, mit erregter Stimme: morgens, als sie |13|beim Brötchenholen die Straße überquerte, hat ihr rechter Fuß eine kleine Unebenheit auf dem Straßenpflaster wiedererkannt, die er – der rechte Fuß – vor vierzig Jahren, als Leni dort mit anderen Mädchen Hüpfen spielte, zum letztenmal erfaßt hatte; es handelt sich um eine winzige Bruchstelle an einem Basaltpflasterstein, der schon, als die Straße angelegt wurde, etwa im Jahre 1894, vom Pflasterer abgeschlagen worden sein muß. Lenis Fuß gab die Mitteilung sofort an ihren Hirnstamm weiter, jener vermittelte diesen Eindruck an sämtliche Sensibilitätsorgane und Gefühlszentren, und da Leni eine ungeheuer sinnliche Person ist, der sich alles, aber auch alles sofort ins Erotische umsetzt, erlebte sie vor Entzücken, Wehmut, Erinnerung, totaler Erregtheit jenen Vorgang, der – womit dort allerdings etwas anderes gemeint ist – in theologischen Lexika als »absolute Seinserfüllung« bezeichnet werden könnte; der von plumpen Erotologen und sexotheologischen Dogmatikern, auf eine peinliche Weise reduziert, mit Orgasmus bezeichnet wird.
Bevor der Eindruck entsteht, Leni sei vereinsamt, müssen alle jene aufgezählt werden, die ihre Freunde sind, von denen die meisten mit ihr durch dünn, zwei mit ihr durch dick und dünn gegangen sind. Lenis Einsamkeit beruht lediglich auf ihrer Schweigsamkeit und Verschwiegenheit; man könnte sie sogar als wortkarg bezeichnen; tatsächlich »geht« sie nur sehr selten »aus sich heraus«, nicht einmal ihren ältesten Freundinnen Margret Schlömer, geb. Zeist, und Lotte Hoyser, geb. Berntgen, gegenüber, die noch zu Leni hielten, als es am allerdicksten kam. Margret ist so alt wie Leni, verwitwet wie Leni, doch könnte dieser Ausdruck Mißverständnisse hervorrufen. Margret hats ziemlich mit Männern getrieben, aus Gründen, die noch benannt werden, nie aus Berechnung, gelegentlich allerdings – wenn es ihr allzu dreckig ging – |14|gegen Honorar, und doch könnte man Margret am besten charakterisieren, wenn man feststellt, daß ihre einzige berechnete erotische Beziehung zu dem Mann bestand, den sie als Achtzehnjährige geheiratet hat; damals auch machte sie die einzige nachweisbare hurenhafte Bemerkung, indem sie zu Leni sagte (es war im Jahr 1940): »Ich hab mir nen reichen Knopp geangelt, der unbedingt mit mir vor den Traualtar will.« Margret liegt zur Zeit im Krankenhaus, in einer Isolierstation, sie ist auf schlimme Weise wahrscheinlich unheilbar geschlechtskrank; sie bezeichnet sich selbst als »total hinüber« – ihr gesamter endokriner Haushalt ist gestört; man kann nur durch eine Glasplatte geschützt mit ihr sprechen, und sie ist dankbar für jede mitgebrachte Schachtel Zigaretten und jede kleine Portion Schnaps, und wäre es auch nur der kleinste im Handel erhältliche und mit dem billigsten Schnaps nachgefüllte Flachmann. Margrets endokriner Haushalt ist so durcheinander, daß sie »sich nicht wundern würde, wenn plötzlich statt Tränen Urin aus meinen Augen käme«. Sie ist für jede Art von Betäubungsmitteln dankbar, würde auch Opium, Morphium, Haschisch annehmen.
Das Krankenhaus liegt vor der Stadt, im Grünen, ist bungalowartig angelegt. Um Zutritt zu Margret zu erlangen, mußte der Verf. zu verschiedenen verwerflichen Mitteln greifen: Bestechung, Hochstapelei in Tateinheit mit Amtsanmaßung (er gab sich als Dozent für Prostitutionssoziologie und -psychologie aus!).
Es muß hier als Vorschuß auf die Auskünfte über Margret hinzugefügt werden, daß sie »an sich« eine weit weniger sinnliche Person ist als Leni; Margrets Verderben war nicht ihr eigenes Begehren nach Liebesfreuden, ihr Verderben war die Tatsache, daß von ihr so viel Freuden begehrt wurden, die sie zu spenden von Natur begabt war; es wird darüber noch berichtet werden müssen. Jedenfalls: Leni leidet, Margret leidet.
|15|»An sich« nicht leidend, nur leidend, weil Leni leidet, an der sie nun wirklich sehr hängt, ist eine eingangs schon erwähnte weibliche Person namens Marja van Doorn, siebzig Jahre alt, ehemals Hausgehilfin bei Lenis Eltern, den Gruytens; sie lebt nun zurückgezogen auf dem Land, wo eine Invalidenrente, ein Gemüsegarten, einige Obstbäume, ein Dutzend Hühner und der Anteil an je einem halben Schwein und Kalb, an deren Mästung sie sich beteiligt, ihr einen halbwegs angenehmen Lebensabend sichern. Marja ist mit Leni nur durch dünn gegangen, Bedenken hatte sie nur, als es »gar zu dick kam«, keine – wie ausdrücklich festgestellt werden muß – moralischen, überraschenderweise – nationale Bedenken. Marja ist eine Frau, die wahrscheinlich noch vor fünfzehn oder zwanzig Jahren »das Herz auf dem rechten Fleck« gehabt hat; inzwischen ist dieses überschätzte Organ ihr anderswo hingerutscht, falls es überhaupt noch da ist; bestimmt nicht »in die Hose«, feige ist sie nie gewesen; entsetzt ist sie darüber, wie man es mit ihrer Leni treibt, die sie nun tatsächlich gut kennt, gewiß besser als der Mann, dessen Namen Leni trägt, sie gekannt hat. Immerhin hat Marja van Doorn von 1920 bis 1960 im Hause Gruyten gelebt, sie hat Lenis Geburt erlebt, an allen ihren Abenteuern, an ihrem gesamten Schicksal teilgenommen; sie ist drauf und dran, wieder zu Leni zurückzuziehen, legt aber vorläufig noch ihre gesamte (und recht erhebliche) Energie in den Plan, Leni zu sich aufs Land zu holen. Sie ist entsetzt über das, was Leni widerfährt und ihr angedroht wird, ist sogar bereit, gewisse historische Greuel, die sie bisher nicht gerade für unmöglich gehalten, in ihrer Quantität aber angezweifelt hat, zu glauben.
Eine Sonderstellung unter den Auskunftspersonen nimmt der Musikkritiker Dr. Herweg Schirtenstein ein; er wohnt seit vierzig Jahren im hinteren Teil einer Wohnung|16|, die vor achtzig Jahren einmal als feudal gegolten hätte, nach dem Ersten Weltkrieg aber schon an Rang verlor, geteilt wurde; seine Wohnung im Parterre eines Hauses, das mit seinem hofwärts gelegenen Teil an den hofwärts gelegenen Teil von Lenis Wohnung grenzt, hat es ihm möglich gemacht, Lenis Übungen und Fortschritte und später partielle Meisterschaft auf dem Klavier über Jahrzehnte hin sorgfältig zu verfolgen, ohne daß er je erfahren hätte, daß es Leni ist, die da spielt; er kennt zwar Leni von Ansehen, begegnet ihr seit vierzig Jahren gelegentlich auf der Straße (es ist sogar durchaus wahrscheinlich, daß er Leni, als sie noch Hüpfen spielte, zuschaute, denn er ist leidenschaftlich an Kinderspielen interessiert, hat über das Thema »Musik im Kinderspiel« promoviert), da er nicht unempfänglich für weibliche Reize ist, hat er gewiß Lenis gesamte Erscheinung im Laufe der Jahre aufmerksam verfolgt, gewiß hin und wieder anerkennend mit dem Kopf genickt, möglicherweise sogar begehrliche Gedanken gehegt, und doch muß gesagt werden, daß er Leni – vergleicht man sie mit allen Frauen, mit denen Schirtenstein bisher intim geworden ist – als »eine Spur zu vulgär« nicht ernsthaft erwogen hätte. Ahnte er, daß es Leni ist, die da nach recht hilflosen Übungsjahren gelernt hat, allerdings nur zwei Klavierstücke von Schubert meisterhaft zu beherrschen, und so, daß Schirtenstein nicht einmal durch jahrzehntelange Wiederholung gelangweilt wurde, vielleicht würde er sein Urteil über Leni ändern, er, vor dem sogar eine Monique Haas nicht nur zitterte, sogar Respekt hatte. Auf Schirtenstein, der unwillentlich später mit Leni auf eine nicht gerade telepathische, lediglich telesensuelle Art in erotische Beziehung treten wird, muß noch zurückgekommen werden. Es muß gerechterweise gesagt werden, daß Schirtenstein mit Leni auch durch dick gegangen wäre, nur: er bekam keine Chance. |17|Über Lenis Eltern viel, über Lenis inneres Leben wenig, über Lenis äußeres Leben fast alles wußte eine fünfundachtzigjährige Auskunftsperson zu berichten: der seit zwanzig Jahren pensionierte Hauptbuchhalter Otto Hoyser, der in einem komfortablen Altersheim lebt, das die Vorzüge eines Luxushotels mit denen eines Luxussanatoriums verbindet. Er besucht Leni fast regelmäßig oder wird von Leni besucht.
Eine prägnante Zeugin ist seine Schwiegertochter Lotte Hoyser, geb. Berntgen; weniger zuverlässig deren Söhne Werner und Kurt, inzwischen fünfunddreißig bzw. dreißig Jahre alt. Lotte Hoyser ist so prägnant wie bitter, ihre Bitterkeit hat sich allerdings nie gegen Leni gewandt; Lotte ist siebenundfünfzig, Kriegerwitwe wie Leni, Büroangestellte.
Lotte Hoyser, scharfzüngig, bezeichnet ihren Schwiegervater Otto (siehe oben) und ihren jüngsten Sohn Kurt, ohne jede Einschränkung und ohne Blutsbande zu berücksichtigen, als Gangster, denen sie fast die gesamte Schuld an Lenis derzeitiger Misere gibt; erst kürzlich hat sie »gewisse Dinge erfahren, die Leni zu sagen ich nicht übers Herz bringe, weil ich selbst sie mir noch nicht ganz zu Herzen gebracht habe. Es ist einfach nicht zu fassen.« Lotte bewohnt eine Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung im Stadtzentrum, für die sie etwa ein Drittel ihres Einkommens als Miete bezahlt. Sie erwägt, in Lenis Wohnung zurückzuziehen, aus Sympathie, aber auch, wie sie (aus vorläufig mysteriösen Gründen) drohend hinzufügte, »um zu sehen, ob sie tatsächlich auch mich exmittieren würden. Ich fürchte: sie würden.« Lotte ist Angestellte einer Gewerkschaft »ohne Überzeugung« (wie sie ungefragt hinzufügte), »nur, weil ich ja nun mal am Fressen bleiben und leben möchte«.
|18|Weitere Auskunftspersonen, nicht unbedingt die unwichtigsten, sind: der promovierte Slawist Dr. Scholsdorff, der aufgrund einer komplizierten Verstrickung oder Verflechtung in Lenis Lebenslauf geraten ist; die Verflechtung wird, mag sie auch noch so kompliziert sein, erklärt werden. Scholsdorff ist aufgrund sehr vielschichtiger Umstände, die ebenfalls an geeigneter Stelle erklärt werden, in den höheren Finanzdienst geraten; er will diese Karriere bald durch vorzeitige Pensionierung beenden.
Ein weiterer promovierter Slawist, Dr. Henges, spielt eine untergeordnete Rolle; als Auskunftsperson ist er ohnehin fragwürdig, obwohl er sich seiner eigenen Fragwürdigkeit bewußt ist und jene sogar betont, ja fast genießt. Er bezeichnet sich selbst als »total verkommen«, eine Bezeichnung, die der Verf., gerade weil sie von Henges selbst stammt, nicht übernehmen möchte. Ohne darum gebeten worden zu sein, hat Henges zugegeben, im Dienste eines kürzlich ermordeten Diplomaten gräflicher Herkunft in der Sowjetunion bei der »Anwerbung« von Arbeitskräften für die deutsche Kriegsrüstungsindustrie »mein Russisch, mein herrliches Russisch verraten zu haben«. Henges lebt »unter nicht unerfreulichen finanziellen Umständen« (H. über H.) in der Nähe von Bonn auf dem Lande, wo er als Übersetzer für verschiedene ostpolitische Zeitschriften und Büros arbeitet.
Es würde zu weit führen, hier schon alle Auskunftspersonen detailliert aufzuzählen. Sie werden an geeigneter Stelle vorgestellt und in ihrem Ambiente geschildert werden. Als Auskunftsperson nicht für Leni selbst, nur für eine wichtige Figur in Lenis Leben, eine katholische Nonne, sei hier nur noch ein ehemaliger Buchantiquar erwähnt, der sich durch die Initialen B. H. T. ausreichend legitimiert glaubt.
|19|Eine schwache, immerhin aber noch lebende Auskunftsperson, die nur dann als befangen abgelehnt werden muß, wenn es um sie selbst geht, ist Lenis Schwager Heinrich Pfeiffer, vierundvierzig, verheiratet mit einer gewissen Hetti, geb. Irms, zwei Söhne, achtzehn und vierzehn, Wilhelm und Karl.
Es werden an entsprechender Stelle, mit der ihrer Wichtigkeit entsprechenden Ausführlichkeit noch vorgestellt werden: drei hochgestellte Persönlichkeiten männlichen Geschlechts, der eine Kommunalpolitiker, der andere aus dem Bereich der Großindustrie, der dritte ein Rüstungsbeamter in höchster Stellung, zwei invalide Arbeiterinnen, zwei oder drei Sowjetmenschen, die Besitzerin einer Kette von Blumenläden, ein alter Gartenmeister, ein nicht ganz so alter ehemaliger Gärtnereibesitzer, der (eigene Aussage!) »sich ganz der Verwaltung seiner Liegenschaften widmet«, und einige andere. Wichtige Auskunftspersonen werden mit exakter Angabe ihrer Körpergröße und ihres Gewichts vorgestellt.
Lenis Wohnungseinrichtung, soweit sie ihr nach vielen Pfändungen verblieben ist, ist eine Mischung aus 1885 und 1920/25: durch Erbschaften ihrer Eltern in den Jahren 1920 und 1922 sind ein paar Jugendstilstücke, eine Kommode, ein Bücherschrank, zwei Stühle in Lenis Wohnung geraten, deren antiquarische Kostbarkeit den Gerichtsvollziehern bisher entgangen ist; sie wurden als »Gerümpel« für pfändungsunwürdig bezeichnet. Hinweggepfändet und durch Vollstreckungsbeamte aus dem Haus geholt wurden achtzehn Originalgemälde zeitgenössischer, lokaler Maler aus den Jahren 1918–1935, überwiegend religiösen Gegenstands, deren Wert, weil sie Originale waren, vom Gerichtsvollzieher überschätzt wurde, deren Verlust Leni nicht im geringsten schmerzlich |20|berührt hat. Lenis Wandschmuck besteht aus exakten Farbfotos mit Abbildungen der Organe des menschlichen Körpers; ihr Schwager Heinrich Pfeiffer besorgt sie ihr; er ist Büroangestellter beim Gesundheitsamt, hat u. a. die Verwaltung des Lehr- und Informationsmaterials, und »obwohl es mit meinem Gewissen nicht so ganz vereinbar ist« (H. Pfeiffer), bringt er Leni jene Tafeln mit, die abgenutzt sind und ausrangiert werden; um buchungstechnisch korrekt vorzugehen, erwirbt Pfeiffer die ausrangierten Tafeln und zahlt eine kleine Gebühr für sie; da er auch die Neuanschaffung der entsprechenden Tafeln »unter sich« hat, gelingt es Leni hin und wieder, durch ihn auch eine neue Tafel zu erwerben, die sie direkt von der Herstellungsfirma bezieht und natürlich aus ihrer eigenen (schmal bestückten) Tasche bezahlt. Die abgenutzten Tafeln bessert sie eigenhändig aus: sie reinigt sie sorgfältig, mit Seifenlauge oder Benzin, zieht mit einem schwarzen Graphitstift die Linien nach, und mit Hilfe eines billigen Aquarellkastens, der noch aus den Kindheitstagen ihres Sohnes im Hause verblieben ist, koloriert sie die Tafeln. Ihre Lieblingstafel ist die wissenschaftlich exakte Vergrößerung eines menschlichen Auges, das über ihrem Klavier hängt (um das schon mehrfach gepfändete Klavier auszulösen, es vor dem Abtransport durch Vollstrekkungsbeamte zu bewahren, hat Leni sich durch Betteleien bei alten Bekannten ihrer verstorbenen Eltern, Mietvorschüsse bei ihren Untermietern, durch Anpumpen ihres Schwagers Heinrich, meistens durch Besuche bei dem alten Hoyser, dessen scheinbar familiäre Zärtlichkeiten Leni nicht ganz geheuer sind, erniedrigt; nach Aussage der drei zuverlässigen Zeugen [Margret, Marja, Lotte] hat sie sogar geäußert, sie wäre bereit, um des Klaviers willen »auf die Straße zu gehen« – eine für Leni ungeheuer kühne Äußerung). Auch minder betrachtete Organe wie die menschlichen Gedärme schmücken Lenis Wände, und |21|nicht einmal die menschlichen Geschlechtsorgane mit exakter Beschreibung ihrer sämtlichen Funktionen fehlen als vergrößerter tabulierter Wandschmuck, und sie hingen schon bei Leni, lange bevor die Pornotheologie sie populär machte. Es hat seinerzeit harte Auseinandersetzungen zwischen Leni und Marja über diese Tafeln gegeben, die Marja als unsittlich bezeichnete, aber Leni ist hart und hartnäckig geblieben.
Da irgendwann ohnehin Lenis Beziehung zur Metaphysik angesprochen werden muß, sei hier gleich am Anfang erklärt: die Metaphysik macht Leni nicht die geringsten Schwierigkeiten. Sie steht mit der Jungfrau Maria auf vertrautem Fuß, empfängt sie auf dem Fernsehschirm fast täglich, jedesmal wieder überrascht, daß auch die Jungfrau eine Blondine ist, gar nicht mehr so jung, wie man sie gern hätte; diese Begegnungen finden unter Stillschweigen statt, meistens spät, wenn alle Nachbarn schlafen und die üblichen Fernsehprogramme – auch das holländische – ihr Sendeschlußzeichen gesetzt haben. Leni und die Jungfrau Maria lächeln sich einfach an. Nicht mehr, nicht weniger. Leni würde keineswegs erstaunt oder gar erschrocken sein, wenn ihr eines Tages der Sohn der Jungfrau Maria auf dem Fernsehschirm nach Sendeschluß vorgestellt würde. Ob sie gar darauf wartet, ist dem Berichterstatter unbekannt. Überraschen würde es ihn nach allem, was er inzwischen erfahren hat, nicht. Leni kennt zwei Gebete, die sie hin und wieder murmelt: das Vaterunser und das Ave-Maria. Außerdem noch ein paar Fetzen Rosenkranz. Sie hat kein Gebetbuch, geht nicht zur Kirche, glaubt daran, daß es im Weltraum »beseelte Wesen« (Leni) gibt.
Bevor mehr oder weniger lückenhaft über Lenis Bildungsweg berichtet wird, noch ein Blick in ihren Bücherschrank|22|; die Hauptmasse der dort glanzlos verstaubenden Werke besteht aus einer Bibliothek, die ihr Vater einmal pauschal gekauft hat. Sie entspricht den Originalölgemälden, ist bisher der Pfändung entgangen; es gibt da auch einige komplette Jahrgänge einer kirchlich (katholisch) orientierten, alten illustrierten Monatszeitschrift, die Leni hin und wieder durchblättert; diese Zeitschrift – eine antiquarische Rarität – verdankt ihr Überleben lediglich der Unwissenheit des Gerichtsvollziehers, der sich durch ihre Unansehnlichkeit täuschen läßt. Nicht der Aufmerksamkeit des Gerichtsvollziehers entgangen sind leider die Jahrgänge 1916–1940 der Zeitschrift »Hochland«, sowie die Gedichte von William Butler Yeats, die aus dem Besitz von Lenis Mutter stammten. Aufmerksamere Beobachter wie Marja van Doorn, die sich staubwischenderweise lange damit beschäftigen mußte, oder Lotte Hoyser, die lange Zeit während des Krieges Lenis zweithöchste Vertraute war, entdecken in diesem Jugendstilbücherschrank allerdings sieben bis acht überraschende Titel: Gedichte von Brecht, Hölderlin und Trakl, zwei Prosabände von Kafka und Kleist, zwei Bände von Tolstoi (»Auferstehung« und »Anna Karenina«) – und alle diese sieben oder acht Bände sind auf die honorigste, für die Autoren schmeichelhafteste Weise zerlesen, so sehr, daß sie mit den verschiedensten Klebemitteln und Klebestreifen immer wieder und wenig fachkundig zusammengeflickt worden sind, teilweise einfach durch Gummiband lose zusammengehalten werden. Angebote, ihr Neuausgaben der Werke jener Autoren zu schenken (Weihnachten, Geburtstag, Namenstag etc.), lehnt Leni mit einer fast beleidigenden Entschiedenheit ab. Der Verf. erlaubt sich hier eine über seine Kompetenz hinausgehende Bemerkung: er ist fest davon überzeugt, daß Leni einige der Prosabände von Beckett ebenfalls dort stehen hätte, wären sie zu der Zeit, da Lenis literarischer |23|Ratgeber noch Einfluß auf sie hatte, schon erschienen oder jenem bekannt gewesen.
Zu Lenis Leidenschaften gehören nun nicht nur die acht täglichen Zigaretten, eine intensive, wenn auch durch Mäßigung bestimmte, Eßlust, das Spielen zweier Klavierstücke von Schubert, das entzückte Betrachten der Abbildungen menschlicher Organe – Därme eingeschlossen; nicht nur die zärtlichen Gedanken, die sie ihrem zur Zeit inhaftierten Sohn Lev widmet. Sie tanzt auch gern, ist immer eine leidenschaftliche Tänzerin gewesen (was ihr einmal zum Verhängnis wurde, weil sie dadurch in den unauslöschlichen Besitz des unsympathischen Namens Pfeiffer geriet). Wo soll nun eine achtundvierzigjährige alleinstehende Frau, die von der Umwelt zur Vergasung freigegeben worden ist, tanzen gehen? Soll sie in die Lokale für jugendliche Tanzlustige gehen, wo sie gewiß als Sex-Oma mißverstanden, mißbraucht würde? Auch die Teilnahme an Pfarrveranstaltungen, auf denen getanzt wird, ist ihr verwehrt, da sie seit ihrem vierzehnten Lebensjahr unkirchlich dahinlebt. Würde sie andere Jugendfreundinnen außer Margret – der das Tanzen wahrscheinlich bis an ihr Lebensende verwehrt bleiben wird – ausfindig machen, wahrscheinlich würde sie in irgendwelche Strip- oder Partnertauschparties geraten, ohne selbst einen Partner zu haben, und würde zum viertenmal in ihrem Leben erröten. Leni ist bis dato dreimal in ihrem Leben errötet. Was macht Leni also? Sie tanzt allein, manchmal nur leicht bekleidet, in ihrem Wohnschlafzimmer, in ihrem Badezimmer sogar manchmal nackt und vor dem schmeichlerischen Spiegel. Sie wird hin und wieder dabei beobachtet, sogar überrascht – und das fördert keineswegs ihren Ruf. Einmal hat sie mit einem der möblierten Herrn getanzt, einem Gerichtsassessor, dem frühzeitig kahl gewordenen Erich Köppler; Leni wäre |24|dabei fast errötet, wären die handgreiflichen Zudringlichkeiten dieses Herrn nicht gar zu plump gewesen; jedenfalls mußte sie ihm kündigen, da er – nicht unintelligent und keineswegs instinktlos – Lenis enorme Sinnlichkeit erkannt hatte und seit dem »riskierten Tänzchen« (Leni), das sich, als er seine Miete bezahlte und Leni beim Abhören von Tanzmusik ertappte, einfach so ergab, jeden Abend vor ihrer Zimmertür winselte. Leni wollte ihn nicht erhören, weil sie ihn nicht mochte, und seitdem gehört Köppler, der sich ein Zimmer in der Nachbarschaft besorgte, zu den übelsten Denunzianten, der hin und wieder im vertraulichen Gespräch mit der Besitzerin des Einzelhandelsgeschäfts, das kurz davor ist, dem Strukturwandel zu erliegen, intime Details seiner fiktiven Liebschaft mit Leni zum besten gibt, die jene Besitzerin – eine Person von eiskalter Hübschheit, deren Mann tagsüber abwesend ist (er arbeitet in einer Autofabrik), derart in Erregung versetzt, daß sie den kahlköpfigen Gerichtsassessor, der inzwischen Rat geworden ist, ins Hinterzimmer zerrt, wo sie sich ausgiebig an ihm vergeht. Diese Person, Käte Perscht mit Namen, achtundzwanzig Jahre alt, ist es denn auch, die mit bösester Zunge über Leni spricht, sie moralisch verleumdet, obwohl sie selbst durch Vermittlung ihres Mannes, wenn überwiegend männliche Messebesucher die Stadt überschwemmen, in einem Nachtclub sich gegen gute Bezahlung zum »Messestrip« verdingt und von einem öligen Ansager vor ihrem Auftritt verkünden läßt, sie sei bereit, die Erregungen, die ihre Darstellungen hervorrufen, konsequent zu befriedigen.
Neuerdings hat Leni hin und wieder Gelegenheit zu einem Tanz. Aufgrund gewisser Erfahrungen vermietet sie nur noch an Ehepaare und ausländische Arbeiter Zimmer, so hat sie an ein nettes junges Paar, das wir der Einfachheit halber Hans und Grete nennen wollen, zwei Zimmer – und das angesichts ihrer Finanzlage! – zu einem |25|Vorzugspreis vermietet, und eben jener Hans und jene Grete haben beim gemeinsamen Abhören von Tanzmusik mit Leni deren äußere wie innere rhythmische Zukkungen richtig gedeutet, und so kommt Leni gelegentlich zu einem »Tänzchen in Ehren«. Hans und Grete versuchen sogar manchmal vorsichtig, Leni ihre Situation zu analysieren, raten ihr, ihre Kleidung zu modernisieren, ihre Haartracht zu ändern, raten ihr, sich einen Liebhaber zu suchen. »Nur ein bißchen aufgemöbelt, Leni, ein schickes rosa Kleid und schicke Strümpfe auf deine phantastischen Beine – und du würdest bald merken, wie attraktiv du noch bist.« Doch Leni schüttelt dann den Kopf, sie ist zu verletzt, sie betritt den Lebensmittelladen nicht mehr, läßt ihre Einkäufe von Grete besorgen, und Hans hat ihr den allmorgendlichen Gang zum Bäckerladen abgenommen und holt ihr rasch, bevor er zur Arbeit geht (er ist Techniker bei der Straßenbauverwaltung, Grete arbeitet als Kosmetikerin und hat Leni – bisher ohne Erfolg – ihre Dienste kostenlos angeboten), ihre zwei unabdingbaren knackfrischen Brötchen, die für Leni wichtiger sind als für andere Leute irgendwelche Sakramente.
Lenis Wandschmuck besteht natürlich nicht ausschließlich aus biologischen Lehrtafeln, sie hat auch Fotos an den Wänden; Fotos von Verstorbenen; ihre Mutter, die 1943 im Alter von einundvierzig Jahren starb und kurz vor ihrem Tod aufgenommen ist, eine leidend wirkende Frau mit dünnem grauem Haar und großen Augen, die, in eine Decke eingehüllt, auf einer Bank am Rhein bei Hersel sitzt, in der Nähe einer Schiffsanlegestelle, auf der man eben jenen Ortsnamen lesen kann, im Hintergrund Klostermauern sieht; Lenis Mutter, das kann man erkennen, fröstelt; auffallend ist die Mattigkeit ihrer Augen, die überraschende Festigkeit ihres Mundes in einem nicht |26|gerade sehr vital wirkenden Gesicht; man sieht ihr an, daß sie nicht mehr leben möchte; würde man aufgefordert, ihr Alter zu schätzen, geriete man in Verlegenheit und wüßte nicht zu sagen, ob es sich um eine durch ein geheimes Leiden übermäßig gealterte Frau von etwa dreißig handelt oder um eine zartgliedrige Sechzigjährige, die sich eine gewisse Jugendlichkeit erhalten hat. Lenis Mutter lächelt auf diesem Foto, nicht gerade mühsam, aber angestrengt.
Lenis Vater, ebenfalls kurz vor seinem Tod im Jahr 1949 als Neunundvierzigjähriger mit einer simplen Box fotografiert, lächelt ebenfalls, nicht einmal andeutungsweise angestrengt; man sieht ihn in einem oft und sorgfältig geflickten Maurerarbeitsanzug vor einem zertrümmerten Haus, in der linken Hand ein Brecheisen, von der Art, die Eingeweihten als »Klaue« bekannt ist, in der rechten Hand einen Hammer, der Eingeweihten als »Fäustel« bekannt ist; vor ihm, links und rechts neben ihm, hinter ihm, liegen Eisenträger verschiedener Größen, denen möglicherweise sein Lächeln gilt, wie das Lächeln eines Anglers seiner Tagesbeute. Tatsächlich handelt es sich – wie ausführlich erklärt werden wird – um seine Tagesbeute, er arbeitete damals für jenen schon erwähnten ehemaligen Gärtnereibesitzer, der früh die »Schrotthausse« roch (Aussage Lotte H.). Lenis Vater ist auf dem Foto barhaupt zu sehen, er hat sehr dichtes, nur leicht ergrautes Haar, und es fällt sehr schwer, diesen hochgewachsenen, schlanken Mann, dem sein Werkzeug so selbstverständlich in den Händen liegt, mit irgendeinem verbindlichen Sozial-Epitheton zu versehen. Wirkt er proletarisch? Oder wie ein Herr? Wirkt er wie jemand, der eine ihm ungeläufige Arbeit tut, oder ist diese offensichtlich harte Arbeit ihm vertraut? Der Verf. neigt zu der Meinung, daß beides zutrifft und beides in beiden Fällen. Lotte H.s Kommentar zu diesem Foto bestärkt ihn, sie bezeichnet |27|ihn auf diesem Foto als »Herr Prolet«. Nicht einmal andeutungsweise sieht Lenis Vater aus, als sei ihm die Lebenslust vergangen. Er sieht weder jünger noch älter aus, als er ist, ist ganz der »gut erhaltene Endvierziger«, der in einer Heiratsanzeige sich anheischig machen könnte, »eine fröhliche Lebensgefährtin, möglichst nicht über vierzig, glücklich zu machen«.
Die vier weiteren Fotos zeigen vier männliche Jugendliche, alle so um die zwanzig, drei davon tot, einer (Lenis Sohn) noch lebend. Zwei dieser jungen Männer zeigen auf den Fotos gewisse, nur ihre Kleidung betreffende Mängel: obwohl es sich um Kopfbilder handelt, sieht man bei beiden so viel von der Brust, daß man deutlich die Uniform der Deutschen Wehrmacht erkennt, auf dieser Uniform Hoheitsadler und Hakenkreuz, jene Symbolkomposition, die Eingeweihten als »Pleitegeier« bekannt ist. Es handelt sich um Lenis Bruder Heinrich Gruyten und ihren Vetter Erhard Schweigert, die man – wie den dritten Toten – zu den Opfern des Zweiten Weltkrieges zählen muß. Heinrich und Erhard sehen beide »irgendwie deutsch aus« (Der Verf.), »irgendwie« (Der Verf.) gleichen sie beide sämtlichen auftreibbaren Bildern deutscher Bildungsjünglinge; vielleicht ist es deutlicher, wenn hier Lotte H. zitiert wird, für die beide »Bamberger Reiter« sind, eine, wie sich später herausstellen wird, keineswegs nur schmeichelhafte Charakterisierung. Sachlich festzustellen ist, daß E. blond, H. braunhaarig ist; daß beide ebenfalls lächeln, E. »innig und gänzlich unreflektiert vor sich hin« (Der Verf.), lieb auch und ausgesprochen nett. H.s Lächeln ist nicht so ganz innig, in den Mundwinkeln ist bei ihm schon eine Spur von jenem Nihilismus zu sehen, der gewöhnlich als Zynismus mißverstanden wird und für das Jahr 1939, in dem die beiden Fotos aufgenommen worden sind, als ziemlich früh, ja fast progressiv gedeutet werden kann.
|28|Das dritte Verstorbenenfoto zeigt einen Sowjetmenschen namens Boris Lvović Koltowski; er lächelt nicht; das Foto ist die fast schon graphisch wirkende Vergrößerung eines Paßbildes, das im Jahre 1941 in Moskau privat aufgenommen worden ist. Es zeigt B. als einen ernsten, blassen Menschen, dessen auffallend hoher Haaransatz im ersten Augenblick auf verfrühte Kahlköpfigkeit schließen lassen könnte, sich aber, da das Haar dicht, blond, lockig ist, als ein persönliches Merkmal von Boris K. erweist. Seine Augen sind dunkel und ziemlich groß, durch eine Nickelbrille der Roten Armee auf eine Weise gespiegelt, die als graphische Raffinesse mißverstanden werden könnte. Man sieht sofort, daß dieser Mensch, obwohl ernst und mager und mit überraschend hoher Stirn, jung war, als das Foto gemacht wurde. Er trägt Zivil, Hemd offen, Schillerkragen, keine Jacke, was auf sommerliche Temperaturen zur Zeit der Aufnahme schließen läßt.
Das sechste Foto zeigt einen Lebenden, Lenis Sohn. Obwohl er zur Zeit der Aufnahme gleichaltrig mit E., H. und B. war, wirkt er doch wie der Jüngste; das mag darauf zurückzuführen sein, daß das Fotomaterial zur Zeit der Aufnahme besser war als in den Jahren 1939 und 1941; es läßt sich leider nicht verleugnen: der junge Lev lächelt nicht nur, er lacht auf diesem Foto aus dem Jahr 1965; keiner würde zögern, ihn als »fröhlichen Jungen« zu bezeichnen; die Ähnlichkeit zwischen ihm, Lenis Vater und seinem Vater Boris ist unverkennbar. Er hat »Gruyten-Haar« und »Barkel-Augen« (Lenis Mutter war eine geborene Barkel. Der Verf.), wodurch er eine zusätzliche Ähnlichkeit mit Erhard bekommt. Sein Lachen, seine Augen lassen ohne weiteres den Schluß zu, daß er zwei Eigenschaften seiner Mutter ganz gewiß nicht besitzt: er ist weder schweigsam noch verschwiegen.
|29|Es muß hier noch ein Kleidungsstück erwähnt werden, an dem Leni hängt wie außerdem nur an den Fotos, den Abbildungen menschlicher Organe, dem Klavier und den frischen Brötchen: ihr Bademantel, den sie hartnäckig fälschlicherweise als Morgenrock bezeichnet. Es ist ein Gebilde aus »Frottee von Friedensqualität« (Lotte H.), ehemals, wie am Rücken und an den Kanten der Taschen erkennbar ist, weinrot, inzwischen – nach dreißig Jahren! – zur Farbe einer ziemlich dünnen Himbeersoße verblichen. Er ist an vielen Stellen mit orangefarbener Baumwolle gestopft, sachkundig, wie man feststellen muß. Leni trennt sich selten von diesem Kleidungsstück, das sie kaum noch auszieht, sie soll gesagt haben, sie möchte, »wenn es soweit ist, darin begraben werden« (Hans und Grete Helzen, die für alle Wohnungsinterna als Auskunftspersonen fungieren).
Die gegenwärtige Belegung von Lenis Wohnung sollte vielleicht noch kurz erwähnt werden: zwei Zimmer hat sie an Hans und Grete Helzen vermietet; zwei an ein portugiesisches Ehepaar mit drei Kindern, die Familie Pinto, bestehend aus den Eltern Joaquim und Ana-Maria sowie deren Kindern Etelvina, Manuela und José; eins an drei türkische Arbeiter, die Kaya Tunç, Ali Kiliç und Mehmet Şahin heißen und nicht mehr ganz so jung sind.
[Menü]
2
Nun ist Leni natürlich nicht immer achtundvierzig Jahre alt gewesen, und es muß notwendigerweise zurückgeblickt werden.
Auf Jugendfotos würde man Leni ohne weiteres als hübsches und frisches Mädchen bezeichnen; sogar in der Uniform einer Naziorganisation für Mädchen – als Dreizehn-|30|, Vierzehn-, Fünfzehnjährige – sieht Leni nett aus. Kein männlicher Betrachter wäre in seinem Urteil über ihre körperlichen Reize niedriger gegangen als »verdammt noch mal, die ist nicht übel«. Der menschliche Paarungsdrang geht ja von Liebe auf den ersten Blick über den spontanen Wunsch, einer Person des anderen oder eigenen Geschlechts, einfach mal, ohne auf Dauerbindung aus zu sein, beizuwohnen; er geht bis zur tiefsten, aufwühlenden Leidenschaft, die ruhelose Seelen und Körper schafft, alle seine Spielarten, die so gesetzlos wie ungesetzmäßig auftreten, jede von ihnen, von der oberflächlichsten bis zur tiefsten, hätte von Leni geweckt werden können und ist von ihr geweckt worden. Als sie siebzehn war, machte sie den entscheidenden Sprung von hübsch zu schön, der dunkeläugigen Blondinen leichter fällt als helläugigen. In diesem Stadium wäre kein Mann in seinem Urteil niedriger gegangen als »bemerkenswert«.
Es müssen noch ein paar Bemerkungen zu Lenis Bildungsweg gemacht werden. Mit sechzehn trat sie ins Büro ihres Vaters ein, der den Sprung vom hübschen Mädchen zur Schönheit wohl bemerkte und sie, vor allem ihrer Wirkung auf Männer wegen (wir befinden uns im Jahr 1938), zu wichtigen geschäftlichen Besprechungen hinzuzog, an denen Leni mit Notizblock und Bleistift auf den Knien teilnahm und hin und wieder Stichworte niederschrieb. Stenografie konnte sie nicht, hätte sie auch nie gelernt. Abstraktes und Abstraktionen lagen ihr zwar nicht gänzlich fern, doch die »Hackschrift«, wie sie Stenografie nannte, mochte sie nicht lernen. Ihr Bildungsweg hat auch aus Leiden bestanden, mehr Leiden der Lehrer als ihre eigenen. Sie absolvierte, nachdem sie zweimal nicht gerade sitzengeblieben, sondern »freiwillig zurückversetzt« worden war, die Volksschule mit der vierten Klasse und einem leidlichen, reichlich interpolierten |31|Zeugnis. Einer der noch lebenden Zeugen aus dem Kollegium der Volksschule, der fünfundsechzigjährige pensionierte Rektor Schlocks, der auf seinem ländlichen Alterssitz aufgestöbert werden konnte, wußte zu berichten, daß Leni zeitweise sogar für die Abwimmelung in die Hilfsschule angestanden hat; daß aber zwei Umstände sie davor bewahrten: die Wohlhabenheit ihres Vaters, die – wie Schlocks nachdrücklich betont – nie direkt, nur indirekt eine Rolle spielte, und zweitens die Tatsache, daß Leni zwei Jahre hintereinander als Elf- und Zwölfjährige den Titel »das deutscheste Mädel der Schule« gewann, der von einer rassekundigen Kommission, die von Schule zu Schule ging, verliehen wurde. Einmal stand Leni sogar in der Auswahl für das »deutscheste Mädel der Stadt«, sie wurde aber auf den zweiten Platz verwiesen von der Tochter eines protestantischen Pfarrers, deren Augen heller waren als Lenis Augen, die damals schon nicht mehr so ganz hellblau waren. Konnte man etwa das »deutscheste Mädel der Schule« auf die Hilfsschule schicken? Mit zwölf kam Leni auf eine von Nonnen geleitete höhere Schule, von der man sie bereits mit vierzehn als gescheitert herunternehmen mußte; sie war innerhalb von zwei Jahren einmal saftig sitzengeblieben, einmal versetzt worden, weil ihre Eltern das feierliche Versprechen abgaben, von dieser Versetzung nie Gebrauch zu machen. Das Versprechen wurde gehalten.
Bevor Mißverständnisse entstehen, muß hier als sachliche Information eine Erklärung der mißlichen Bildungsumstände gegeben werden, denen Leni unterlag bzw. unterworfen wurde. Es gibt in diesem Zusammenhang keine Schuldfrage, es gab nicht einmal – weder auf der Volksschule noch auf dem Lyzeum, das Leni besuchte – erhebliche Ärgernisse, lediglich Mißverständnisse. Leni war durchaus bildungsfähig, sogar bildungshungrig oder |32|-durstig, und alle Beteiligten waren bemüht, ihren Hunger bzw. Durst zu stillen. Nur die ihr gebotenen Speisen und Getränke entsprachen nicht ihrer Intelligenz, nicht ihrer Veranlagung, nicht ihrer Auffassungsgabe. In den meisten, man kann fast sagen, in allen Fällen entbehrte der dargebotene Stoff jener sinnlichen Dimension, ohne die Leni nichts zu begreifen imstande war. Schreiben z. B. bereitete ihr nie die geringsten Schwierigkeiten, obwohl bei diesem hochabstrakten Vorgang das Gegenteil zu erwarten gewesen wäre, doch Schreiben war für Leni mit optischen, haptischen, sogar mit Geruchswahrnehmungen verbunden (man bedenke die Gerüche verschiedener Tinten, Bleistifte, Papiersorten), und so gelangen ihr selbst komplizierte Schreibübungen und grammatikalische Finessen; ihre Handschrift – von der sie leider wenig Gebrauch macht – war und ist kräftig, sympathisch und – wie der pensionierte Rektor Schlocks (Auskunftsperson für alle grundsätzlichen pädagogischen Details) glaubwürdig versicherte – geradezu geeignet, »erotische bzw. sexuelle Erregung hervorzurufen«. Besonders Pech hatte Leni mit zwei nah verwandten Fächern: Religion und Rechnen bzw. Mathematik. Wäre auch nur einer ihrer Lehrer oder Lehrerinnen auf die Idee gekommen, schon der kleinen, der sechsjährigen Leni klarzumachen, daß der Sternenhimmel, den Leni so liebte, mathematische und physikalische Annäherungsmöglichkeiten bietet, sie hätte sich nicht gegen das kleine und nicht gegen das große Einmaleins gesträubt, das ihr so widerwärtig war wie anderen Leuten Spinnen. Die Nüsse, Äpfel, Kühe, Erbsen auf dem Papier, mit denen man auf eine platte Weise einen Rechenrealismus zu erreichen sucht, blieben ihr fremd; es war keine Rechnerin in ihr verborgen, gewiß aber eine naturwissenschaftliche Begabung, und hätte sie außer den Mendelschen Blüten, die rot, weiß, rosa immer wieder in Schulbüchern und auf Tafeln auftauchten, etwas kompliziertere |33|genetische Vorgänge geboten bekommen, sie wäre – wie man so hübsch sagt – gewiß mit Feuereifer in eine solche Materie »eingestiegen«. Angesichts der Magerkeit des Biologieunterrichts blieben ihr viele Freuden versagt, die sie nun im Alter, komplizierte organische Vorgänge mit einem billigen Aquarellkasten nachzeichnend, erst findet. Wie die van Doorn glaubwürdig versichert, ist ihr ein Detail aus Lenis vorschulischer Existenz unvergeßlich und bis heute so wenig »geheuer« wie Lenis Genitalientafeln. Schon als Kind hat Leni sich leidenschaftlich für ihre exkrementale Unterworfenheit interessiert und – leider! – vergebens Auskunft darüber verlangt, mit der Frage: »Verflucht, was ist das für ein Zeug, das aus mir herauskommt?« Weder ihre Mutter noch die van Doorn gaben ihr diese Auskunft!
Erst dem zweiten der beiden Männer, denen sie in ihrem bisherigen Leben beiwohnte, ausgerechnet einem Ausländer, dazu noch einem Sowjetmenschen, blieb es vorbehalten zu entdecken, daß Leni zu erstaunlichen Sensibilitäts- und Intelligenzleistungen fähig war. Ihm auch erzählte sie, was sie – zwischen Ende 43 und Mitte 45 war sie viel weniger schweigsam als heute – später Margret wiedererzählte: daß die erste und volle »Seinserfüllung« ihr widerfahren war, als sie, sechzehnjährig, soeben aus dem Internat entlassen, mit dem Fahrrad an einem Juniabend unterwegs, auf dem Rücken im Heidekraut liegend, »ausgestreckt und ganz hingegeben« (Leni zu Margret), mit dem Blick zum eben erglühenden Sternenhimmel, in den noch Abendrot hineinleuchtete, jenen Punkt von Glückseligkeit erreichte, der heutzutage viel zu oft angestrebt wird; Leni – so erzählte sie Boris, wie sie Margret erzählt hat – hatte an diesem Sommerabend des Jahres 1938, als sie dahingestreckt und »geöffnet« auf dem warmen Heidekraut lag, ganz und gar den Eindruck, »genommen« zu werden und auch »gegeben« zu haben, |34|und – so erläuterte sie später Margret – sie wäre nicht im geringsten erstaunt gewesen, wenn sie schwanger geworden wäre. So ist ihr denn auch die Jungfrauengeburt keineswegs unbegreiflich.
Leni verließ das Lyzeum mit einem peinlichen Zeugnis, auf dem sie in Religion und Mathematik mangelhaft bekam. Sie kam für zweieinhalb Jahre auf ein Pensionat, wo sie in Haushaltskunde, Deutsch, Religion, ein wenig in Geschichte (bis zur Reformation), auch in Musik (Klavier) unterrichtet wurde.
Hier müssen, bevor einer verstorbenen Nonne ein Denkmal gesetzt wird, die für Lenis Bildung so entscheidend wurde wie der noch ausgiebig zu erwähnende Sowjetmensch, drei noch lebende Nonnen als Zeuginnen erwähnt werden, die, obwohl ihre Begegnungen mit Leni vierunddreißig bzw. zweiunddreißig Jahre zurückliegen, sich ihrer noch lebhaft entsannen und die alle drei, vom Verf. mit Bleistift und Notizblock an drei verschiedenen Orten aufgesucht, sobald Leni erwähnt wurde, in den Ruf ausbrachen: »Ach ja, die Gruyten!« Dem Verf. erscheint dieser gleichlautende Ausruf bedeutsam, da er beweist, wie eindrucksvoll Leni gewesen sein muß.
Da nicht nur der Ausruf »Ach ja, die Gruyten!«, auch gewisse körperliche Eigenschaften den drei Nonnen gemeinsam sind, können einige Details aus Gründen der Zeilenersparnis synchronisiert werden. Alle drei haben das, was man eine pergamentene Haut nennt: zart über magere Wangenknochen gespannt, gelblich, ein wenig zerknittert; alle drei boten dem Berichterstatter Tee an (oder ließen anbieten). Nicht aus Undankbarkeit, lediglich um der Sachlichkeit willen muß gesagt werden, daß der Tee bei allen dreien nicht sehr stark war; alle drei boten trockenen Kuchen an (oder ließen anbieten); alle drei |35|begannen zu husten, als der Verf. zu rauchen anfing (unhöflicherweise ohne gefragt zu haben, da er ein Nein nicht riskieren wollte); alle drei empfingen ihn in fast identischen Sprechzimmern, die mit religiösen Drucken, einem Kruzifix, je einem Porträt des regierenden Papstes und regionalen Kardinals geschmückt waren; alle drei Tische in den drei verschiedenen Sprechzimmern waren mit Plüschdecken bedeckt, alle Stühle waren unbequem; alle drei Nonnen sind zwischen siebzig und zweiundsiebzig Jahre alt.
Die erste, Schwester Columbanus, war Direktorin des Lyzeums, das Leni mit so geringem Erfolg zwei Jahre lang besucht hat. Eine ätherische Person mit matten, sehr klugen Augen, die fast die ganze Dauer des Interviews kopfschüttelnd dasaß, kopfschüttelnd, weil sie sich Vorwürfe machte, das, was in Leni steckte, nicht zutage gefördert zu haben. Immer wieder sagte sie: »Es steckte was in ihr, was Starkes sogar, aber wir haben es nicht zutage gefördert.« Schwester Columbanus – promovierte Mathematikerin, die heute noch (mit der Lupe!) Fachliteratur liest – war ganz der Typ aus einer früh emanzipierten Epoche weiblichen Bildungsdranges, der leider im Nonnenhabit so wenig erkannt und noch weniger gewürdigt wird. Höflich nach Details ihres Lebenslaufs gefragt, erzählte sie, daß sie schon 1918 in Sackleinen herumgelaufen sei und mehr verspottet, verachtet, verhöhnt worden sei als heutzutage mancher Gammler. Als sie vom Verf. Einzelheiten aus Lenis Lebenslauf erfuhr, leuchteten ihre ermatteten Augen ein wenig auf, sie sagte, seufzend, doch mit einem Anflug von Begeisterung: »Extrem, ja extrem – so mußte ihr Leben verlaufen.« Eine Bemerkung, die den Verf. stutzig machte. Beschämt blickte er beim Abschied auf die vier provozierend vulgär in Asche gebetteten Zigarettenkippen in einem weinlaubförmigen Keramikaschenbecher, der wahrscheinlich selten benutzt wird, in |36|dem lediglich hin und wieder eine Prälatenzigarre erkalten mag.
Die zweite Nonne, Schwester Prudentia, war Lenis Deutschlehrerin gewesen; sie war eine Spur weniger vornehm als Schwester Columbanus, eine Spur rotwangiger, womit nicht gesagt ist, sie sei rotwangig, nur: daß ihre frühere Rotwangigkeit noch durchschien, während Schwester Columbanus’ Gesichtshaut eindeutig eine schon in der Jugend getragene Dauerblässe ausstrahlte. Schwester Prudentia (ihr Ausruf, als sie Lenis Namen hörte, siehe oben!) steuerte ein paar überraschende Details bei. »Ich hab ja«, sagte sie, »alles getan, um sie auf der Schule zu halten, aber es war nicht zu machen, obwohl ich ihr doch in Deutsch eine Zwei gegeben habe und auch geben konnte; sie hat nämlich da einen ganz großartigen Aufsatz über ›Die Marquise von O. ..‹ geschrieben, wissen Sie, eine Lektüre, die nicht erlaubt war, sogar sehr ungern gesehen, weil sie doch einen heiklen Inhalt hat, sozusagen – aber ich fand und finde, vierzehnjährige Mädchen sollten sie getrost lesen und sich ihre Gedanken drüber machen –, und da hat die Gruyten was ganz Großartiges geschrieben: sie hat nämlich eine flammende Verteidigung des Grafen F... geschrieben, eine Einfühlungsfähigkeit in die – na sagen wir, männliche Geschlechtlichkeit, die mich überrascht hat – großartig, und es war fast eine Eins –, aber da war das Mangelhaft, eigentlich eine interpolierte Sechs, in Religion, weil man dem Mädchen doch eine Sechs in Religion nicht antun wollte, und ein saftiges, sachlich ganz sicher berechtigtes Mangelhaft in Mathematik, das Schwester Columbanus ihr mit zwei weinenden Augen, aber weil sie doch gerecht sein mußte, geben mußte – und weg war die Gruyten ... ging ab, mußte abgehen.«
Von den Schwestern und Lehrerinnen des Pensionats, auf dem Leni von ihrem vierzehnten bis fast siebzehnten Jahr |37|ihre Bildung fortsetzte, war nur noch die dritte der hier präsentierten Nonnen, Schwester Cecilia, aufzutreiben. Sie war es, die Leni zweiundeinhalb Jahre lang privat Klavierunterricht erteilte; Lenis Musikalität sofort ahnend, entsetzt aber, geradezu verzweifelt über ihre Unfähigkeit, Noten zu lesen, gar in der gelesenen Note den ausgedrückten Ton zu erkennen, verbrachte sie die ersten sechs Monate damit, Leni Schallplatten vorzuspielen – und sie einfach das Vorgespielte nachspielen zu lassen, ein, wie Schwester Cecilia sagte, zweifelhaftes, aber gelungenes Experiment, das sogar – so Schwester Cecilia – bewies, »daß Leni in der Lage war, nicht nur Melodien und Rhythmen, sogar Strukturen zu erkennen«. Wie aber – unzählige Seufzer der Schwester! – Leni das unumgängliche Notenlesen beibringen? Sie kam auf die – fast schon geniale Idee – es auf dem Umweg über die Geographie zu versuchen. Zwar war der Geographieunterricht ziemlich mager – er bestand hauptsächlich im Aufsagen, Aufzeichnen und immer wieder Abbeten aller Nebenflüsse des Rheins unter gleichzeitigem Abbeten der durch diese Flüsse begrenzten Mittelgebirge oder Landschaften –, und doch: Karten zu lesen, hatte Leni gelernt: diese so sehr gewundene schwarze Linie zwischen Hunsrück und Eifel, die Mosel, wurde von Leni doch durchaus nicht nur als schwarze gewundene Linie, sondern als Zeichen für einen wirklich vorhandenen Fluß erkannt. Also. Das Experiment gelang: Leni lernte Noten lesen, mühsam, widerstrebend, oft vor Wut weinend, aber sie lernte es – und da Schwester Cecilia von Lenis Vater ein gutes Sonderhonorar bekam, das in die Kassen des Ordens floß, fühlte sie sich verpflichtet, Leni »auch etwas beizubringen«. Es gelang ihr, und: »Was ich an ihr bewunderte: sie erkannte sofort, daß Schubert ihre Grenze war – Versuche, darüber hinauszugehen, mißlangen so kläglich, daß sogar ich ihr riet, innerhalb ihrer Grenzen zu bleiben, obwohl ihr Vater |38|darauf gedrungen hatte, sie müsse Mozart, Beethoven und so spielen.«
Zur Haut von Schwester Cecilia noch eine Bemerkung: es waren noch milchige Stellen zu erkennen, weichweiß, nicht ganz so trocken; der Verf. gesteht freimütig, daß er in sich den möglicherweise frivolen Wunsch verspürte, mehr von der Haut dieser äußerst liebenswürdigen zölibaren Greisin zu sehen, mag ihm auch dieser Wunsch den Verdacht der Gerontophilie einbringen. Leider wurde Schwester Cecilia, nach einer für Leni wichtigen Mitschwester gefragt, ausgesprochen eisig, fast abweisend.
Es kann hier nur angedeutet werden, was möglicherweise im Laufe des Berichts bewiesen wird: daß Leni ein verkanntes Genie der Sinnlichkeit ist. Leider lief sie lange Zeit unter einer Kategorie, die so bequem ist, daß sie gern verwendet wird: dumme Pute. Der alte Hoyser gab sogar zu, Leni heute noch in diese Kategorie einzustufen.
Nun sollte man meinen, Leni, die Zeit ihres Lebens eine großartige Esserin war, sei eine vorzügliche Kochschülerin gewesen und Haushaltskunde habe ihr Lieblingsfach sein müssen; keineswegs: der Kochunterricht, obwohl am Herd und Küchentisch, unter Anwendung von riechbaren, faßbaren, schmeckbaren, sichtbaren Materialien gelehrt, kam ihr (wenn der Verf. einige Bemerkungen von Schwester Cecilia richtig deutet) abstrakter vor als die Mathematik, so unsinnlich wie der Religionsunterricht. Es ist schwer festzustellen, ob an Leni eine ausgezeichnete Köchin verlorengegangen ist, noch schwerer festzustellen, ob die schon metaphysische Angst von Nonnen vor Gewürzen Leni das zubereitete Essen im Kochunterricht als zu »laff« erscheinen ließ. Daß sie keine gute Köchin ist, ist leider unbestreitbar; einzig Suppen gelingen ihr hin und wieder, auch Nachspeisen, außerdem ist sie – was keineswegs selbstverständlich ist – eine |39|gute Kaffeeköchin, und sie war eine liebevolle Babyköchin (bezeugt durch M. v. D.), aber ein regelrechtes Menü würde sie nie zustande bringen. Wie das Schicksal einer Sauce von einer so gesetzlosen wie ungesetzmäßigen raschen Handbewegung abhängen kann, mit der jemand irgendeine Zutat hineingibt, so scheiterte (oder besser gesagt mißlang glücklicherweise) Lenis religiöse Erziehung vollständig. Wenn es um Brot oder Wein ging, um Umarmungen, Handauflegen, wenn Irdisch-Materielles im Spiel war, hatte sie keine Schwierigkeiten. Bis auf den heutigen Tag macht es ihr nicht die geringsten Schwierigkeiten, daran zu glauben, daß jemand, indem man ihn mit Speichel bestreicht, geheilt werden kann. Aber wer bestrich schon jemand mit Speichel? Sie heilte nicht nur den Sowjetmenschen und ihren Sohn mit Speichel, durch bloßes Handauflegen versetzte sie den Sowjetmenschen in Glückseligkeit und beruhigte sie ihren Sohn (Lotte und Margret). Wer aber legte schon jemand die Hand auf? Was war das für ein Brot, das man ihr gab, als sie die Erste Heilige Kommunion empfing (die letzte kirchliche Handlung, an der sie teilnahm), und wo, wo verflucht noch einmal blieb der Wein? Warum gab man ihn ihr nicht? Gefallene Frauen und so weiter, die ziemlich vielen Frauen, mit denen der Sohn der Jungfrau da umging, das alles gefiel ihr außerordentlich und hätte sie ebenso in Verzückung versetzen können wie der Anblick des Sternenhimmels.
Man kann sich denken, daß Leni, die zeitlebens ihre frischen Brötchen am Morgen so liebte, sich um derentwillen sogar dem Spott der Nachbarschaft aussetzte, mit heftigem Begehren dieser Erstkommunionsfeier entgegensah. Man muß wissen, daß Leni auf dem Lyzeum vom Empfang der Erstkommunion ausgeschlossen worden war, weil ihr während des Vorbereitungsunterrichts mehrmals die Geduld riß und sie den Religionslehrer, einen |40|damals schon älteren weißhaarigen, sehr asketischen Menschen, der leider seit zwanzig Jahren verstorben ist, regelrecht attackierte und nach der Unterrichtsstunde mehrmals mit kindlicher Heftigkeit fragte: »Bitte, bitte, geben Sie mir doch dieses Brot des Lebens! Warum muß ich so lange warten?« Dieser Religionslehrer, von dem der Name Erich Brings und einige Publikationen überliefert sind, fand Lenis spontane Sinnlichkeitsäußerung »kriminell«. Er war entsetzt über diese Willensäußerung, die für ihn unter den Namen »sinnliche Begierden« fiel. Er lehnte Lenis Ansinnen natürlich schroff ab, stellte sie zwei Jahre zurück wegen »erwiesener Unreife und Unfähigkeit, Sakramente zu begreifen«. Für diesen Vorfall gibt es zwei Zeugen: den alten Hoyser, der sich gut daran erinnert und zu berichten weiß, es sei »damals mit knapper Not ein Skandal vermieden worden«, und man habe sich lediglich wegen der innenpolitisch heiklen Situation der Nonnen (1934!), von der Leni nichts ahnte, entschlossen, die »Sache nicht an die große Glocke zu hängen«. Der zweite Zeuge ist der alte Herr selbst, dessen Steckenpferd die Partikellehre war, eine Lehre, die darin besteht, monate-, wenn nötig jahrelang unter Berücksichtigung aller kasuistisch erdenklichen Umstände sich darüber auszulassen, was mit den Partikeln der Hostie geschehen mag oder geschehen könnte oder hätte geschehen können, müssen, sollen. Jener Herr also, der als Partikelspezialist immer noch einen gewissen Ruf genießt, publizierte später in einer theologisch-literarischen Zeitschrift periodisch »Skizzen aus meinem Leben«, gab unter anderem das Erlebnis mit Leni, die er scham- und phantasielos mit »eine gewisse L. G., damals zwölf Jahre alt« abkürzt, preis. Er schildert Lenis »flammende Augen«, ihren »sinnlichen Mund«, herablassend bemerkt er ihre dialektgefärbte Aussprache, bezeichnet ihr Elternhaus als »typisch neureich, vulgär« und schließt mit dem |41|Satz: »Einer derartig proletarisch-materialistisch geäußerten Begierde nach dem Hochheiligsten mußte ich natürlich die Spendung desselben verweigern.« Da Lenis Eltern zwar nicht ungeheuer religiös, auch nicht sonderlich kirchlich waren und doch landschafts- und milieubedingt es als einen Mangel, ja sogar als Schande betrachteten, »daß Leni noch nicht mitgegangen« war, ließen sie Leni dann mit vierzehneinhalb, als sie schon im Pensionat war, »mitgehen«, wie man das auszudrücken pflegt, und da es Leni zu jener Zeit schon – nach glaubwürdigen Auskünften von Marja van Doorn – nach Art der Frauen erging, mißglückte die kirchliche Feier vollständig, die säkulare ebenfalls. Leni hatte dieses Stück Brot so heftig begehrt, ihr gesamtes Sensorium war bereit, tatsächlich in Verzückung zu verfallen – »Und nun« (so schilderte sie es der damals entsetzten Marja van Doorn) »bekam ich dieses blasse, zarte, trockene, nach nichts schmeckende Ding auf die Zunge gelegt – ich war drauf und dran, es wieder auszuspucken!« Marja bekreuzigte sich mehrere Male und fand es überraschend, daß handgreiflich gebotene Sinnlichkeit: Kerzen, Weihrauch, Orgel- und Chormusik, Leni nicht hatten über diese Enttäuschung hinweghelfen können. Nicht einmal das übliche Festessen mit Spargel, Schinken, Vanilleeis mit Sahne konnte Leni über diese Enttäuschung hinweghelfen. Daß Leni selbst eine »Partikularistin« ist, beweist sie täglich, indem sie sämtliche Brötchenkrümel vom Teller aufliest und in den Mund steckt (Hans und Grete).
Es sollen in diesem Bericht Obszönitäten möglichst vermieden werden, doch muß hier wohl der Vollständigkeit halber erklärt werden, was der Religionslehrer im Pensionat, der Leni nur auf Druck der Direktorin zur Erstkommunion zuließ, ein jüngerer, ebenfalls asketischer Mensch namens Horn, den jungen Mädchen, bevor sie – |42|die Jüngste von ihnen sechzehn, die Älteste einundzwanzig – das Pensionat verließen, an sexueller Aufklärung bot. Mit sanfter Stimme bediente er sich einer ausschließlich kulinarischen Symbolik, verglich, ohne exakte biologische Details auch nur anzudeuten, das Ergebnis des Beiwohnens, das er »notwendigen Fortpflanzungsvorgang« nannte, mit »Erdbeeren mit Schlagsahne«, verlor sich in improvisierten Vergleichen, die erlaubtes und unerlaubtes Küssen beschreiben sollten, wobei »Schnekken« eine von den Mädchen nicht zu eruierende Rolle spielten. Festgestellt werden muß, daß Leni, während die sanfte Stimme in unbeschreiblicher, ausschließlich kulinarischer Symbolik unbeschreibliche Details übers Küssen und Beiwohnen von sich gab, zum ersten Mal in ihrem Leben errötete (Margret), und da sie selbst reueunfähig ist – eine Tatsache, die ihr das Beichten als bloße Routinetat, indem sie irgend etwas ableierte, erleichterte –, müssen bei ihr irgendwelche Empfindungszentren durch diesen Aufklärungsversuch getroffen worden sein, die bisher noch nicht entdeckt sind. Wenn hier versucht wird, Lenis direkte, proletarische, fast geniale Sinnlichkeit einigermaßen glaubwürdig zu präsentieren, so muß hinzugefügt werden: schamlos war sie nicht, und so muß ihr erstes Erröten als Sensation vermerkt werden. Als sensationell, als qualvoll und schmerzlich jedenfalls empfand Leni diesen Vorgang des heftigen Errötens, der sich außerhalb ihrer Kontrolle vollzog. Daß eine ungeheure erotische und sexuelle Erwartung in ihr schlummerte, braucht hier nicht mehr betont zu werden, und daß ihr von einem Religionslehrer auf diese Weise etwas erklärt wurde, das ihr gleichzeitig wie die Kommunion als Sakrament angepriesen wurde, steigerte ihre Empörung und ihre Verwirrung über den ihr bis dato unbekannten Vorgang des Errötens. Sie verließ einfach, vor Wut stammelnd, mit knallrotem Kopf den Religionsunterricht; das |43|trug ihr eine weitere Fünf, in Religion, auf dem Abgangszeugnis ein. Was ihr außerdem im Religionsunterricht eingeprägt worden war, immer wieder und immer wieder, ohne Begeisterung in ihr zu erwecken: die drei Berge des Abendlandes: Golgatha, Akropolis, Capitol – wobei ihr Golgatha nicht unsympathisch war, ein Berg, von dem sie aus dem Bibelunterricht wußte, daß er nur ein Hügel und keineswegs im Abendland gelegen war. Bedenkt man die Tatsache, daß Leni immerhin das Vaterunser und das Ave-Maria behalten hat und sich dieser Gebete sogar noch bedient; daß sie ein paar Rosenkranzfragmente beherrscht, der Umgang mit der Jungfrau Maria ihr selbstverständlich ist – so wäre hier doch vielleicht die Bemerkung am Platze, daß man Lenis religiöse Begabung so verkannt hat wie ihre Sinnlichkeit, daß in ihr, an ihr vielleicht eine große Mystikerin zu entdecken und zu entwickeln gewesen wäre.
Nun muß endlich angefangen werden, den Entwurf zu einem Denkmal wenigstens zu skizzieren, das einer Frauensperson gesetzt werden muß, die leider als Zeugin nicht mehr aufgesucht oder auf- und ausgerufen werden kann; sie starb Ende 42 unter bisher ungeklärten Umständen, nicht durch direkte Gewalt, aber durch drohende direkte Gewalt und durch Vernachlässigung, die ihre Umwelt ihr widerfahren ließ. Dieser B. H. T. und Leni waren wahrscheinlich die einzigen Personen, die jene Frauensperson geliebt hat; ihr bürgerlicher Name konnte auch nach sorgfältigen Nachforschungen nicht herausgefunden werden, weder ihr Herkunftsort noch das Milieu, aus dem sie stammte; bekannt ist lediglich – und dafür gibt es Zeugen genug, Leni, Margret, Marja und eben jener ehemalige Antiquariatslehrling, der sich mit den Initialen B. H. T. ausreichend legitimiert weiß – ihr Klostername: Schwester Rahel. Außerdem ihr Spitzname: |44|