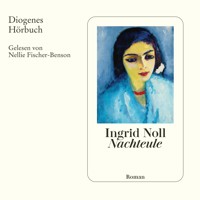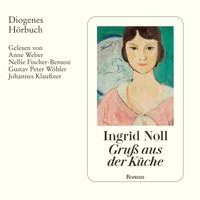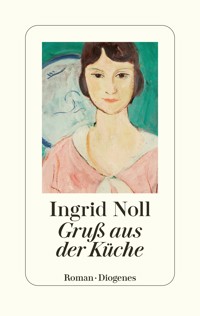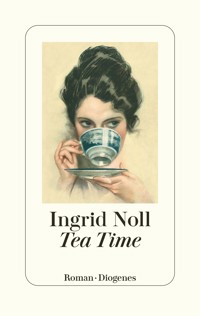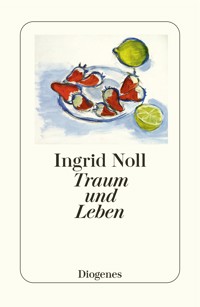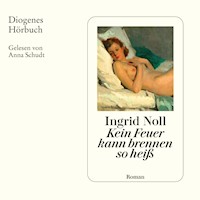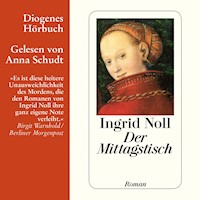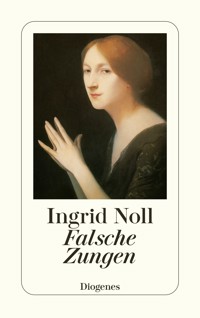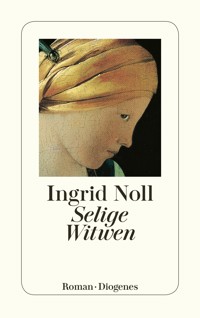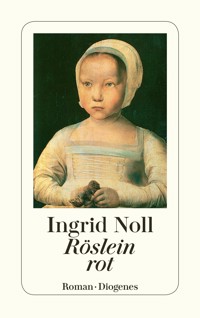10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rosemarie Hirte
- Sprache: Deutsch
Der kinderlose Witwer Wolfram macht seiner ehemaligen Kollegin Karla ein Angebot: Wenn sie ihn pflegt bis zu seinem Tod, vermacht er ihr sein halbes Erbe, bringt sie ihn wunschgemäß um, sein ganzes, eine Weinheimer Villa inklusive ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ingrid Noll
Hab und Gier
Roman
Die Erstausgabe erschien 2014 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Bernardino Licinio, ›Portrait of a Lady‹,
1522 (Ausschnitt)
Öl auf Leinwand, 83,5x71,5cm.
Inv.N. 51.802
Copyright © 2015 The Museum of Fine Arts,
Budapest/Scala, Florenz
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06885 6 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60416 0
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Das Gabelfrühstück [7]
Sensationslüstern [18]
In der Höhle des Wolfs [32]
Schmutzige Wäsche [42]
Das dritte Testament [52]
Der Hexenschuss [62]
Die Bernsteinkette [72]
Der Heiratsantrag [82]
Unter dem Dach [93]
Der Fleischwolf [103]
Nachtgespenster [113]
Die Fälscherwerkstatt [125]
Das neue Testament [135]
Die Qualle [144]
Die Grablegung [154]
Mimikry [165]
Sherlock Holmes [175]
Der Mörder ist immer der Gärtner [184]
Fremde Kinder [193]
Der Erbschein [202]
Judas [213]
Der Feuerlöscher [222]
Hab den Sandmann umgebracht [232]
Happy End
[7] 1
Das Gabelfrühstück
Vor etwa zwanzig Jahren erhielt ich gelegentlich eine Einladung zum Sonntagsbrunch, doch dann kamen Mittagstermine aus der Mode. Die Gastgeber wurden es leid, weil einige der Besucher bis zum Abend blieben und man mehr als eine Mahlzeit auftischen musste. Daher war ich völlig überrascht, als ich kürzlich die handgeschriebene Karte eines ehemaligen Kollegen im Briefkasten fand: Wolfram Kempner, von dem ich schon lange nichts mehr gehört hatte – und der nun offenbar auch aus der Bibliothek ausgeschieden war –, bat an einem bevorstehenden Feiertag zu einem Gabelfrühstück. Ganz der alte Bücherwurm!, dachte ich. Wer außer ihm kannte heute schon noch dieses altmodische, seltsame Wort für einen Imbiss!
Noch zwei Wochen hatte ich Zeit, um eventuell abzusagen, meine Gefühle schwankten zwischen Neugier und Unlust. Vorsichtshalber wollte ich mir vor einer Zusage eine gewisse Grabinschrift noch einmal anschauen. Gedankenverloren wanderte ich über den Weinheimer Friedhof. Ich war einige Monate nicht mehr dort gewesen, obwohl sich die Gräber meiner Verwandten hier befanden. Frühling lag in der Luft, es war ein milder Tag, Vögel zwitscherten munter, frisch aufgeworfene Erde glänzte in der Sonne, die [8] Blumengebinde erfroren nicht mehr über Nacht, sondern hielten sich fast so gut wie in der Vase. Am Tag zuvor hatte es geregnet, auf den glitschigen Nebenwegen musste ich mich in Acht nehmen, um nicht auszurutschen. Erstaunt bemerkte ich, dass sich die kleinen Putten aus wetterfestem Steinguss wundersam vermehrt hatten. Manche Gräber wiesen bis zu acht Engel auf, einige eine Madonna. Die meisten Himmelsboten waren relativ neu und blendend weiß, die paar älteren aus Keramik wiesen Sprünge auf, setzten Moos an, ergrauten, passten sich dem Erdreich an und wurden irgendwann zu Staub. Immer wieder wunderte ich mich, dass die Verstorbenen persönlich angesprochen wurden: Ruhe sanft! Wir werden dich nie vergessen! Du fehlst mir! Selbst die Schleife auf einem verwelkten Kranz war bedruckt: Ewig Deine Sieglinde. Ob man davon ausging, dass die Verstorbenen die Botschaften mit Genugtuung zur Kenntnis nahmen? Auch in Todesanzeigen hatte ich schon ähnliche Anreden gefunden und mir ausgemalt, wie man sich im Jenseits gegenseitig die Zeitung vorlas. Während ich mich noch bei dieser Vorstellung amüsierte, entdeckte ich sie wieder, diese eigenartige und nicht eben freundliche Inschrift auf einer grauen Granitplatte: Bleib, wo du bist!
War es ein Versehen, sollte es eigentlich heißen: Bleib, wie du bist!, und der Spruch sollte der Toten die allmähliche Verwesung untersagen? Ich studierte erneut Vor- und Nachnamen – kein Zweifel: Hier ruhte wirklich die Ehefrau jenes Kollegen, der mir vor wenigen Tagen die bewusste Karte geschickt hatte. Bernadette Kempner war vor einem halben Jahr gestorben, so dass die Einladung zum Gabelfrühstück nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Bestattung [9] stehen konnte. Man konnte nicht von einem allzu frühen Ableben sprechen, denn sie war, wie ich mich auf dem Grabstein vergewisserte, mit 73 gestorben, war also etwa sechs Jahre älter als ihr Mann. Nur sehr selten hatte Wolfram seine Frau erwähnt, überhaupt war er ein stiller, zurückhaltender Mitarbeiter unserer Stadtbücherei gewesen, der lieber im Hintergrund Büroarbeiten erledigte, als sich im Publikumsverkehr zu engagieren. Zwar war er der einzige Mann unseres Teams gewesen, sozusagen der Hahn im Korb, hatte aber nie den Gockel gespielt, galt eher als Neutrum oder – um im Bild zu bleiben – als Kapaun. Ich hatte ihn auch deshalb etwas aus den Augen verloren, weil ich vorzeitig die Rente beantragt hatte und vor drei Jahren mit sechzig aus der Bibliothek ausgeschieden war. Den Kampf mit unbekannten audiovisuellen Medien und immer neuer Software hatte ich längst aufgegeben. Ein einziges Mal schüttete ich ihm mein Herz aus, wie viel angenehmer und menschlicher es doch früher zugegangen war, als es noch in erster Linie um die Ausleihe und Verwaltung von Büchern ging. Er nickte zwar teilnahmsvoll, schien sich aber im Gegensatz zu mir mit der modernen Technik überhaupt nicht schwerzutun, denn er war ein ebenso leidenschaftlicher Bastler wie Bücherwurm. Immerhin meinte er, dass er meinen mutigen Entschluss bewundere. Er müsse leider noch bis zu seinem 65. Lebensjahr durchhalten, wenn nichts Unerwartetes geschehe.
Waren es finanzielle Gründe? Oder fiel ihm zu Hause die Decke auf den Kopf? Da er den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Besuchern eher vermieden hatte, war mangelnder Kontakt als Grund eher unwahrscheinlich. Es mussten private Umstände sein, die ihn zum Ausharren zwangen. [10] Vielleicht würde ja seine Rente allzu knapp ausfallen, oder sein Häuschen war noch nicht abbezahlt.
Konnte es sein, dass die verblichene Bernadette es nicht gern gesehen hätte, dass Besuch ins Haus kam, und Wolfram jetzt etwas nachholen wollte? Soweit ich informiert war, hatte noch keine aus unserem ehemaligen Team sein Haus betreten. Kaum wieder daheim, rief ich Judith an, eine viel jüngere Kollegin, mit der ich mich nach wie vor gern im Rhein-Neckar-Zentrum zum Shoppen traf.
»Warst du in letzter Zeit auf dem Friedhof?«, begann ich und erzählte von meiner Entdeckung. Judith wusste aus der Zeitung, dass Wolframs Frau unlängst verstorben war, meinte aber, sie kenne fröhlichere Spazierwege als zwischen Gräberreihen. Über die seltsame Inschrift musste sie kichern, dann geriet sie allerdings ins Grübeln. Zum Gabelfrühstück war sie nicht eingeladen und fand im Übrigen diese Ausdrucksweise reichlich schräg.
»Hast du seine Frau mal kennengelernt? Hat er irgendwann eine Andeutung über seine Ehe gemacht?«, forschte ich weiter, aber der verschlossene und scheue Wolfram war mit ihr nie ins Gespräch gekommen.
»Ich hab mal so einen Spruch in einem alten Kinderbuch gelesen: Bleib, wo dubist, und rühr dich nicht! Dein Feind ist nah und sieht dich nicht!«, sagte Judith. »Könnte es sein, dass der seltsame Grabspruch etwas mit Erinnerungen zu tun hat?«
Wir überlegten hin und her und kamen zu keinem Schluss.
»Warum nur hat er ausgerechnet mich eingeladen?«, beharrte ich.
Ich hörte Judith leise lachen. »Wahrscheinlich sucht er eine neue Frau«, sagte sie.
[11] Das war ja wohl nicht ihr Ernst. Ich bin geschieden und habe bekanntermaßen keine gute Meinung von den Männern. Außerdem bin ich weder der Typ Hausmütterchen noch besonders sexy, was in meinem Alter ja auch ohnedies kein Thema mehr ist. Für einen Witwer, der Wärme, Trost und Hilfe sucht, bin ich die falsche Adresse. Nach der lange zurückliegenden Trennung von meinem Mann hat sich keiner mehr für mich interessiert, wohl, weil ich selbst es nicht anders wollte. Am gleichen Abend schrieb ich eine Zusage für die freundliche Einladung, zum Anrufen war ich zu feige.
Natürlich wollte ich mich nicht sonderlich schick machen, ein Gabelfrühstück war keine Opernpremiere. Außerdem sollte sich Wolfram bloß nicht einbilden, ich messe seiner Einladung eine besondere Bedeutung bei. Sollte ich einen Blumenstrauß mitbringen? Ich entschied mich für ein Glas mit Ingwermarmelade, die ich nicht mochte und schon lange im Schrank stehen hatte. Eine Weile blätterte ich auch in einem Taschenbuch mit launigen Grabsprüchen, stellte es aber wieder ins Regal zurück – Bleib, wo du bist! gehörte nicht zu dieser Kategorie.
Eigentlich bin ich ein pünktlicher Mensch, aber zum Gabelfrühstück musste ich mit dem Bus fahren, da ich mir im Ruhestand kein Auto mehr leisten konnte. Ich erschien absichtlich zwanzig Minuten zu spät, der Gastgeber sollte nicht auf die Idee kommen, ich sei scharf auf ihn. Was mochte es wohl zu essen geben? Ein Kapaun war Wolfram insofern nicht, als er ein besonders mickriges Exemplar von Mann war, weder kräftig noch wohlgenährt. Ich hatte keine Ahnung, ob er mehr als ein weiches Ei kochen konnte. Doch wenn [12] man wollte, konnte man auch mit Sekt und Kaviar, Austern und Krebsschwänzen Ehre einlegen – doch war das diesem unscheinbaren Männlein zuzutrauen?
Das Haus in der Biberstraße war riesengroß, ziemlich düster und lugte nur knapp hinter von Efeu umschlungenen Tannen hervor. Wolfram erwartete mich auf der Schwelle. Ich erschrak, als ich ihn sah. Er musste schwerkrank sein, so abgemagert und blass schaute er aus der Wäsche beziehungsweise dem dunklen Rollkragenpullover. Auf seinem Kopf wuchs kaum ein Haar mehr. Wir begrüßten uns vorsichtig, wussten wohl beide nicht genau, ob Distanz oder Herzlichkeit angebracht war. Dann setzten wir uns an den gedeckten Tisch, Tee und Kaffee standen auf einem Stövchen bereit. Zum Frühstück gab es ein Ei im Glas, außerdem Croissants, Rosinenbrötchen, Honig, fertig gekauften Fleischsalat und italienischen Schinken. Alles war tadellos, wenn auch nicht besonders originell. Wir stellten die üblichen Fragen nach dem gegenseitigen Befinden und früheren Kolleginnen, doch nach ein wenig Small Talk ging es ans Eingemachte.
»Es geht mir zusehends schlechter«, begann er. »Der Tumor ist inoperabel und sprach kaum auf die Chemo an. Überall habe ich Metastasen, inzwischen bin ich austherapiert. Deswegen ist es an der Zeit, noch ein paar wichtige Dinge zu regeln. Verehrte Karla, ich wende mich nicht ohne Hintergedanken an dich, denn du bist die einzige mir bekannte Frau, die nicht an ihren Vorurteilen festhält…«
Verblüfft über diese Formulierung blickte ich von meinem halbausgelöffelten Ei auf. Er erwähnte eine Diskussion in unserer Bibliothek, bei der es um einen Exhibitionisten [13] ging. Unsere Chefin und alle Kolleginnen hätten sehr hart über den Mann geurteilt, während ich als Einzige über dessen beschädigte Psyche nachgedacht hätte.
»Deswegen wusste ich, dass du mich nicht gleich verdammen würdest«, sagte er.
Was mochte jetzt kommen? Ich bekam fast ein wenig Angst, aber im Notfall war ich die Stärkere.
»Ihr habt mich sicher schon immer für einen verkorksten Typen gehalten, was irgendwie auch stimmt«, begann er zögernd. »Ich bin das Gegenteil eines Machos, in jungen Jahren wollte ich mich gern führen lassen und flog auf starke, etwas ältere Frauen. Bernadette war eine sehr beherrschende Person. So kam es, dass ich mich in der ersten Zeit unserer Ehe überaus wohl fühlte.«
Welche Vorurteile mochte er wohl meinen? »War Bernadette etwa eine Domina, und du warst ihr Sklave?«
Er schüttelte den Kopf. »So kann man das nicht sagen, sie hatte eher etwas von einer allmächtigen Mutter, sie wünschte sich eine große Familie, aber es wollten sich keine Kinder einstellen. Nach vielen Kuren und Hormonbehandlungen ihrerseits nahm mich ein Urologe unter die Lupe. Das Ergebnis war niederschmetternd – es lag ausschließlich an mir. Von da an war es mit dem häuslichen Frieden vorbei. Wenn ich es hin und wieder versuchte, bis in ihr Schlafzimmer vorzudringen, brüllte sie in einer Lautstärke, dass man es drei Straßen weiter hören konnte: Bleib, wo du bist, und rühr dich nicht!«
»Ach so«, murmelte ich, denn nun ging mir eine Stalllaterne auf. »Doch warum habt ihr euch nicht scheiden lassen?«
[14] »Wir haben immer wieder über eine Trennung gesprochen, auch über eine Adoption. Heute könnten uns die Reproduktionsmediziner bestimmt helfen, doch damals gab es kaum Möglichkeiten. Bernadette hielt sich schließlich für zu alt, um es noch einmal mit einem anderen Mann zu versuchen. Wahrscheinlich fand sie auch mehr und mehr Gefallen daran, mich zu quälen. Ich wiederum hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich an ihrem Unglück schuld war, und nahm die Bestrafung hin. Wir wurden gewissermaßen zu einem Sadomaso-Paar, ganz ohne Peitschen oder Eisenketten…« Er machte eine Atempause und fuhr fort: »…obwohl das vielleicht besser gewesen wäre.«
Leicht verlegen trank ich einen Schluck von meinem kalt gewordenen Kaffee. Was wollte Wolfram denn nun von mir? Sollte ich den kranken Mann ein bisschen foltern, um seine Sehnsucht nach Bestrafung zu stillen? Weil mir kein passender Kommentar einfiel, probierte ich den Fleischsalat, obwohl ich ihn eigentlich nicht leiden kann – auch um endlich mal die besagte Gabel zu gebrauchen. Mein Gegenüber hatte bisher nur Tee getrunken und nichts Essbares angerührt. Am liebsten hätte ich mich verabschiedet, aber er hatte ja offensichtlich noch ein Anliegen.
Vorerst jammerte er jedoch weiter: »Vor etwa dreizehn Jahren bot man mir eine Stelle als Ressortleiter der Bremer Stadtbibliothek an. Ich hatte mich hinter Bernadettes Rücken beworben und freute mich sehr über die Zusage. Es galt, das Medienangebot nach Schwerpunkten zu strukturieren, was mir mehr lag als die rein bürokratischen Arbeiten, die ich bisher erledigt hatte. Aber Bernadette befahl mir wieder einmal: Bleib, wo du bist! Und ich musste absagen.«
[15] »Warum nur?«, fragte ich. »Ein Umzug in eine Großstadt ist doch für jede Frau eine erfreuliche Herausforderung – oder etwa nicht?«
»Bernadette war eine reiche Erbin, auch dieses Haus gehörte ihr. Sie ist darin aufgewachsen und wollte darin sterben, niemals hätte sie es vermietet oder gar verkauft. Schließlich wollte sie es ja mit einer Kinderschar bevölkern, aber das habe ich ihr vermasselt. Bernadette und ich haben uns gegenseitig das Leben versaut.«
Allmählich geriet ich in Zorn, nicht nur auf die egozentrische Bernadette, sondern fast noch mehr auf diesen laschen Mann, der sich nicht emanzipieren mochte. Sekundenlang spürte ich den Impuls, ihm wegen seiner unerträglich devoten Haltung das Honigglas an den Kopf zu werfen.
»Das lässt sich nun auch nicht mehr ändern«, sagte ich ärgerlich und stand auf. »Warum erzählst du mir das alles? Ich kann dir nicht helfen.«
Er bat mich, noch zu bleiben, denn er sei nicht fertig mit seiner Beichte. Dieses Wort ließ mich aufhorchen.
»Woran ist deine Frau eigentlich gestorben?«, fragte ich argwöhnisch.
»Es ist, als könntest du Gedanken lesen! Ihr Lebensende liegt mir schwer auf der Seele. Vor etwa zwei Jahren haben wir uns beide routinemäßig untersuchen lassen. Bei mir wurde ein bösartiger Primärtumor festgestellt, der bereits Metastasen gestreut hatte. Bernadette war bis auf einen zu hohen Blutdruck kerngesund.
Eines Abends hatten wir einen heftigen Streit, es ging wie so oft um Bernadettes Nichte. Dieses scheinheilige Geschöpf hat es immer wieder verstanden, meiner naiven Frau [16] viel Geld abzuknöpfen. Am Morgen nach unserer Auseinandersetzung hörte ich ein schwaches Klopfen aus ihrem Schlafzimmer. Nun will sie wohl wieder mal die Kranke spielen und sich den Tee ans Bett bringen lassen, dachte ich verärgert, aber ich lasse mich nicht unentwegt herumkommandieren. Erst später begriff ich, dass sie einen Schlaganfall gehabt hatte, nicht um Hilfe rufen konnte und mit ihrem Rückenkratzer gegen die Kommode schlug.«
»Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an«, sagte ich. »Waren die Retter nicht schnell genug zur Stelle?«
»Natürlich hätte ich sofort den Notruf wählen müssen, aber ich ahnte ja nicht, dass es um Tod und Leben ging. Da ich einen Termin in der Onkologie hatte, zog ich bloß den Regenmantel über und verließ das Haus. Erst Stunden später kam ich zurück, da war sie bereits kalt. Seitdem leide ich unter schwersten Gewissensbissen und weiß nicht, wie ich mit meiner Schuld umgehen soll.«
Ich reagierte ziemlich entsetzt. »Wurde der Arzt nicht misstrauisch?«, fragte ich.
Wolfram schüttelte den Kopf, denn wie sollte man ihm nachweisen, dass er bei ihrem Anfall noch zu Hause gewesen war?
Warum hatte er ausgerechnet mich zu seiner Beichtschwester erkoren? Und was nun? Erwartete er etwa, dass ich ihm eine Buße auferlegte?
»Die unterlassene Hilfeleistung musst du vor deinem eigenen Gewissen verantworten«, sagte ich. »Ich bin kein Pfarrer, Richter oder gar Henker und werde mich jetzt auf die Socken machen…«
Er hielt mich am Ärmel fest. »Bleib bitte noch ein paar [17] Minuten, Karla! Ich habe dich nicht eingeladen, damit du mir die Absolution erteilst«, sagte er. »Leider habe ich weder Freunde noch Verwandte, die ich um Hilfe bitten könnte. Meine Wahl fiel auf dich, weil ich mir sicher bin, dass du weder berechnend bist noch die Situation ausnutzt. Jede andere Frau würde einen nicht unvermögenden, aber sterbenskranken Witwer mit List und Tücke umgarnen, um ihn möglichst bald zu beerben. Ich habe in einem vorläufigen Testament verfügt, dass dieses große Haus versteigert wird und der Erlös an ein Heidelberger Hospiz geht. Ein Viertel des Geldes soll jedoch an dich ausgezahlt werden, wenn du mir eine kleine Gefälligkeit erweist. Ich verlange nur, dass du Kosten und Pflege für meine letzte Ruhestätte übernimmst und ich direkt neben meiner Frau begraben werde. Die Inschrift auf meinem Grab soll lauten: Dein Feind ist nah.«
»Wenn’s weiter nichts ist«, sagte ich erleichtert. »Geht in Ordnung!«
Wir lächelten uns an, gaben uns die Hand, und der Pakt war geschlossen. Ich sah völlig ein, dass erst beide nebeneinanderliegenden Granitplatten das Motto dieser Ehe aufzeigten: Bleib, wo dubist! – Dein Feind ist nah!
Als ich endlich auf der Straße stand, hatte ich das Gefühl, von einer älteren Frau am Fenster des Nachbarhauses beobachtet zu werden.
[18] 2
Sensationslüstern
Erst im Alter wird mir so richtig bewusst, wie einsam ich die meiste Zeit meines Lebens war. Eine eigene Familie hatte ich nicht, meine Schulfreundinnen wohnten nicht am Ort, mein Bruder war nach Kanada ausgewandert. Ich hatte kaum Besuch und wurde wohl aus diesem Grund auch selten eingeladen. Nach Möglichkeit mied ich sogar Betriebsfeiern, obwohl ich mit meinen Kollegen leidlich auskam. Deshalb war es Glück im Unglück, dass sich durch ein gemeinsam erlebtes Abenteuer eine engere Beziehung zu einer viel jüngeren Bibliothekarin ergab.
Judith war damals neu in unserer Bibliothek, und sie hatte noch wenig Berufserfahrung. Als ich die Einladung zur Wiedereröffnung einer großen Buchhandlung erhielt, fragte ich Judith aus einer Laune heraus, ob sie nicht mitkommen wolle. An einem Samstagnachmittag fuhren wir also nach Mannheim und plauderten mit dem Juniorchef und dessen Vater, den ich noch aus meiner Studienzeit kannte. Bei einem Glas Wein erfuhren wir alles über sein neues, innovatives Konzept und ließen uns durch die verschiedenen Abteilungen führen. Kurz vor acht verabschiedete uns der stolze Inhaber und nahm natürlich an, dass wir uns spätestens bei Ladenschluss auf den Heimweg machten. Doch ich wollte erst noch in der Sachbuchabteilung nachschauen, was sie für Reisebücher hatten.
[19] Schon immer fand ich es wunderbar, in Buchhandlungen herumzustöbern, den Klappentext neuer Klassikerausgaben und frischer Bestseller zu lesen. Hierdurch angeregt, träumte ich von luxuriösen, aber leider nicht erschwinglichen Anschaffungen für unsere Stadtbibliothek. Während Judith und ich es uns im obersten Stockwerk in den Knautschsesseln bequem machten, wurden die Besucher der Buchhandlung per Lautsprecher aufgefordert, das Haus zu verlassen. Es war bestimmt nur eine Vorwarnung, dachte ich und griff schon nach dem nächsten Band, ohne auf die Uhr zu schauen. Doch keine zehn Minuten später sprang Judith erschrocken auf und meinte, wir müssten jetzt schleunigst aufbrechen, sonst würden wir am Ende noch eingeschlossen. Um uns herum war weder Personal noch Kundschaft zu sehen, auch die Kasse war nicht mehr besetzt. Wir eilten zum gläsernen Lift, um zum Ausgang zu kommen, drückten auf E, fuhren los und bekamen einen heillosen Schreck, als auf einmal alle Lichter ausgingen. Im selben Moment blieben wir zwischen der zweiten und ersten Etage stecken.
»Hätten wir doch besser die Rolltreppe genommen!«, sagte ich mit einem mulmigen Gefühl und hatte ein schlechtes Gewissen. Schließlich war ich es, die wie ein pflichtvergessenes Schulkind getrödelt hatte. Judith machte mir keine Vorwürfe, ja gab keinen Pieps von sich. Plötzlich tat es einen Ruck, und der Aufzug sackte einige Zentimeter ab, um erneut stehen zu bleiben und sich nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Die Tür blieb fest geschlossen. Zum Glück war es in der Kabine nicht völlig dunkel, durch die Glasscheiben drang immerhin noch ein blasser Lichtschimmer. Ich suchte und fand den Notfallknopf und hoffte, dass der [20] Hausmeister noch in seinem Büro war und uns in Kürze befreien würde. Judith hatte ihr Handy im Auto gelassen, ich besaß damals noch kein Mobiltelefon. Immerhin hatte ich mal gelesen, wie schnell die Feuerwehr in solchen Fällen an Ort und Stelle war. Geduldig harrten wir aus, doch die Zeit verstrich, und es tat sich nichts.
Unser gemeinsames Verlies war etwa zwei Quadratmeter groß. Ich überlegte etwas besorgt, wie lange die Atemluft für uns beide ausreichen würde. Immer wieder drückte ich ohne den geringsten Erfolg auf den verdammten Knopf. Judith war am Boden zusammengesackt, zitterte am ganzen Leib und sagte kein Wort.
Meinen damaligen Zustand würde ich als diffuse Beklemmung bezeichnen, sie hingegen bekam eine hysterische Panikattacke und begann zu kreischen, dass es mir in den Ohren gellte. Ich setzte mich neben sie und begann beruhigend auf sie einzureden. Glücklicherweise wurde sie nach zehn Minuten heiser und schluchzte nur noch leise, doch dann zitterte sie plötzlich am ganzen Leib und rang nach Luft. Vergeblich versuchte ich, beruhigend auf sie einzuwirken. Mit dem Kopf in meinem Schoß lag sie da und schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Hast du das schon mal gehabt?«, fragte ich. »Wie kann man dir helfen?«
Sie zuckte nur am ganzen Körper und japste weiter. »Erzähl mir eine Geschichte«, brachte sie schließlich hervor. »Ablenkung hilft. Aber vielleicht muss ich trotzdem sterben.«
»Quatsch«, sagte ich und fing sofort an zu reden – erzählte aber nicht wie Scheherezade ein Märchen nach dem anderen, sondern einfach meine eigene Geschichte. Ich sprach von [21] meiner behüteten Kindheit an der badischen Bergstraße, vom unglücklichen Ende meiner kurzen Ehe, meinem jetzigen zurückgezogenen Leben und den kleinen Freuden des Alltags. Ja, ich sprudelte auf einmal alles heraus, was ich bisher keinem Menschen anvertraut hatte. Es war fast so, als läge ich auf der Couch eines Psychoanalytikers. Judith atmete allmählich ruhiger, aber sobald ich stockte, flüsterte sie: »Weiter!«
Nach etwa zwei Stunden ging es ihr tatsächlich besser. Stockend berichtete sie jetzt selbst von einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit, als sie im Keller der Grundschule versehentlich stundenlang eingeschlossen war. Sie gab zu, dass sie eigentlich dringend auf die Toilette müsse, und wir regelten das mit einer Plastiktüte, die ich zum Glück in meiner Handtasche fand. Danach entspannte sie sich etwas, und wir vertrieben uns die Zeit mit Klatsch und Tratsch und der ausführlichen Analyse unserer Kollegen, wobei wir uns besonders lange mit Wolfram Kempner aufhielten, dem einzigen Mann in unserem Team.
Wir mussten nicht bis Montagmorgen auf Rettung warten, alles in allem waren wir wohl nur fünf Stunden lang eingesperrt. Andere Menschen hatten weit Schrecklicheres in Fahrstühlen erlebt, aber natürlich empfanden wir die vergleichsweise kurze Zeit als eine halbe Ewigkeit. Von da an waren wir gute Freundinnen. Das Beste dabei war, dass mich Judith mit ihrem Elan immer wieder ansteckte und unser Altersunterschied kaum ins Gewicht fiel.
Judith war ein sensationslüsternes Weib, auch wenn sie es nicht zugab. Sie sei wissbegierig und an vielen Dingen [22] interessiert, behauptete sie. Ich hatte es fast erwartet, dass sie schon wenige Stunden nach dem Gabelfrühstück bei mir anrief.
»Und, hat er dir einen Antrag gemacht?«, fragte sie.
»Du hattest den richtigen Riecher«, antwortete ich. »Und weil wir nicht mehr die Jüngsten sind, findet die Hochzeit schon in vier Wochen statt. Leider wirst du nicht den Brautstrauß auffangen, denn wir fliegen nach Las Vegas und lassen uns in der Graceland Wedding Chapel trauen!«
»Verarschen kann ich mich selbst«, meinte Judith. »Was wollte der Typ von dir?«
»Ich erzähle es dir nur unter der Bedingung, dass du die Klappe hältst. Kein Wort zu den Kolleginnen!«
Das sei doch Ehrensache, behauptete sie. Da ich es ohnedies nicht aushielt, schilderte ich ihr jedes Detail unseres Déjeuners à deux samt allem, was an Essbarem auf den Tisch kam. Meinen Deal mit dem kranken Gastgeber zögerte ich noch hinaus. Judith seufzte zwar »Yummy!«, als sie vom Ei im Glas hörte, ließ sich aber nicht von ihrer eigentlichen Frage ablenken. Allzu lange konnte ich sie nicht auf die Folter spannen, also berichtete ich von unserem denkwürdigen Vertrag.
»Ist es eine noble Immobilie?«, fragte Judith. »Springt ordentlich etwas heraus für die lebenslange Grabpflege?«
»Wird schon einiges wert sein. Das Haus liegt in der Biberstraße, ganz nah bei der Hauptschule, ein imposantes Gebäude aus der Gründerzeit. Ursprünglich wohl für zwei bis drei Parteien gedacht, Wolfram bewohnt es aber allein. Ich habe nur den Flur und das Wohnzimmer gesehen, ziemlich dunkel und scheußlich eingerichtet, doch immerhin jedes freie Fleckchen mit Büchern zugemauert.«
[23] »Ein altes Haus ist doch ein Traum! Du warst wohl bloß vor Aufregung halb blind. Weißt du was, ich komme dich abholen, und wir fahren mal unauffällig an deiner Villa vorbei!«
»Untersteh dich! Hast du nichts Besseres zu tun? Erstens gehört mir das Haus nicht, und zweitens stehen jede Menge Bäume davor. Und herumschleichen will ich auf keinen Fall, stell dir vor, Wolfram steht am Fenster! Peinlicher geht’s nicht! Also bleib, wo du bist, und rühr dich nicht!«
Judith war unbelehrbar und stand schon eine Viertelstunde später bei mir auf der Matte. Der Himmel sei bewölkt – wenn wir unter aufgespannten Regenschirmen an Wolframs Haus vorbeiflanierten, werde er uns nicht erkennen. Ich ließ mich beschwatzen, beharrte allerdings darauf, den Wagen außer Sichtweite zu parken. Schon eine halbe Stunde später schlenderten wir die Biberstraße entlang. Da ja Feiertag war, herrschte nur wenig Verkehr, man sah keine Schulkinder und kaum Fußgänger.
»Ich hoffe, du hast einen Fotoapparat mitgenommen«, sagte Judith. Doch ich besaß gar keinen.
»Es ist die Nummer neunzehn«, flüsterte ich. Ihr Forscherdrang hatte mich angesteckt. Durch verwildertes Gestrüpp, hohe Tannen und buschige Koniferen im Vorgarten schielten wir unauffällig auf Wolframs Haus, einen schmutzig gelben Klinkerbau mit schmalen, hohen Sprossenfenstern, grauem Schieferdach und Gauben im Dachgeschoss. Die fast blinden Fenster wurden von rötlichen Sandsteinen umrahmt. An der Frontseite lasen wir die eingelassene Jahreszahl 1897, über der Haustür stand SALVE. Der hölzerne Zaun auf einem niedrigen Mäuerchen wurde fast von wucherndem Efeu erdrückt.
[24] »Ein Kleinod der Tristesse!«, meinte Judith. »Die Bäume müssen weg, und dann sollte man den Schuppen gründlich putzen. Im Parterre eine Arztpraxis, oben ein schöner Wohnbereich, die Mansarden ein piekfeines Studio. Was meinst du?«
»Oder drei großzügige Wohnungen«, sagte ich. »Bestimmt muss man viel Geld reinstecken. Hier ist jahrzehntelang nicht mehr renoviert worden. Keine Ahnung, ob solche Häuser unter Denkmalschutz stehen. Doch mir kann egal sein, was damit passiert – für mich ist nur der Verkaufspreis interessant. Je höher der Erlös, desto fetter mein Anteil.«
Stehen bleiben wollten wir nicht, also zockelten wir weiter, drehten am Ende der Straße um und liefen auf der gegenüberliegenden Seite wieder zurück. Plötzlich war mir, als ob sich die verblichenen Gardinen im oberen Stock leicht bewegten, und ich wäre am liebsten im Asphalt versunken. Etwas hastig liefen wir an unserem Zielobjekt vorbei und setzten uns schließlich wieder in Judiths Wagen.
»Und was machst du mit der ganzen Kohle?«, fragte Judith mit leuchtenden Augen.
Ich hatte keine Ahnung und zuckte mit den Schultern.
»Bis jetzt ist noch gar nicht sicher, ob alles stimmt, was Wolfram mir aufgetischt hat. Vielleicht lebt er länger als erwartet, und sein Testament habe ich auch nicht gesehen. Also sollten wir den Wolf erst mal erlegen, bevor wir ihm das Fell abziehen!«
Erst später fiel mir auf, dass ich Judith bereits verbal an Wolframs Fell beteiligt hatte. Warum auch nicht eine gemeinsame Weltreise machen oder ein Lesecafé eröffnen? Nach [25] unserem Ausflug hatte ich sie gebeten, im Internet nach Maklerangeboten Ausschau zu halten. Sicherlich ließ sich ein vergleichbares Objekt finden, um den Wert exakter abzuschätzen. Ich selbst besaß keinen Rechner. Ich musste mich in meinen letzten Dienstjahren mit dieser teuflischen Erfindung so herumplagen, dass ich froh war, ihn als Rentnerin los zu sein.
Als ich wieder allein war, sang ich ununterbrochen: »Wenn ich einmal reich wär, o je widi widi widi widi widi widi bum…« Vergeblich wartete ich auf Judiths Anruf, bis ich schließlich spät am Abend selbst zum Hörer griff.
»Bist du im Internet fündig geworden?«, fragte ich, immer noch ziemlich aufgekratzt.
Judith gab ein gedehntes pfff von sichund reagierte etwas unwillig: Sie sei noch nicht dazu gekommen, sie habe Besuch.
»Wer?«, wollte ich wissen und erkannte im selben Moment, dass meine Frage unerwünscht war.
»Cord!«, gab sie nur kurz zurück.
Ihre Männergeschichten hatten mir noch nie behagt. Sicher, sie war eine hübsche junge Frau mit Verstand und Witz, und ich gönnte ihr alle Chancen der Welt, aber ihre zahllosen Affären mit windigen Männern gefielen mir nicht. Solide Bewerber erschienen ihr immer zu langweilig. Manchmal hatte sie offenbar mehrere Fische gleichzeitig an der Angel, dann wieder erschien ein völlig Neuer, um sie abzuholen. Mit einem halbkriminellen Typen namens Cord hatte sie vor Jahren eine etwas längere Beziehung, er war der Einzige, der sogar bei ihr gewohnt hatte. Aber diese Liaison hatte sie meines Wissens schon lange beendet.
Da mir die Villa keine Ruhe ließ, kramte ich die [26] Zeitungen der vergangenen Woche aus dem Papierkorb und überflog die Immobilienanzeigen. Immerhin wurde ein Haus in der Hübschstraße – ganz in Wolframs Nähe – für sechshunderttausend Euro angeboten. Doch ohne Anhaltspunkte wie Grundstückgröße, Ausstattung und Gesamtzustand half mir das auch nicht weiter. Die Gegend wurde als Toplage angepriesen, aber natürlich stellten die Makler alles in ein günstiges Licht.
Mir fiel eine Fernsehsendung ein, in der man bis zu einer Million Euro gewinnen konnte. Der Moderator pflegte seine Kandidaten zu fragen, was sie mit dem erhofften Geld anfangen wollten. Da gab es einige, die sehr konkrete Wünsche hatten, einen Konzertflügel zum Beispiel oder eine Reise nach Australien. Andere gaben vor, den Großteil spenden oder verschenken zu wollen, oder mussten dringend ihr Bafög oder andere Schulden zurückzahlen. Nie hätte ich mich für dieses öffentliche Quiz beworben, obwohl ich viele Fragen mit Leichtigkeit beantworten könnte: Literatur, deutsches Liedgut, Märchen, klassische Musik, Geographie und Geschichte sind meine Spezialgebiete, aber ich würde mich unsterblich blamieren, wenn es um Hitlisten, Physik, die neuesten Filme, Popmusik, Promiklatsch und Königshochzeiten ginge. Deswegen habe ich mir bisher auch keine Gedanken gemacht, was ich mit einem unverhofften Geldsegen anfangen könnte. Lotto spiele ich nicht. Große Sprünge kann ich zwar nicht machen, aber ich komme mit meiner Rente so einigermaßen aus.
Nicht zu verachten wäre eine Eigentumswohnung mit Balkon oder Wintergarten und einer modernen Küche, Opernkarten für die allerfeinsten Häuser, eine Reise nach Indien [27] oder ein Besuch bei meinem Bruder in Kanada. Mein uraltes Auto habe ich verkaufen müssen, ein kleiner Flitzer wäre toll. Stopp, sagte ich mir plötzlich, vielleicht ist der Holzwurm im Gebälk, und der olle Kasten bringt nur zweihunderttausend Euro. Ein Viertel der Gesamtsumme steht mir zwar zu, aber ich muss auch noch die Grabpflege und den Stein samt Inschrift bezahlen. Womöglich bleibt unterm Strich nur wenig übrig.
Bereits im Bett, grübelte ich immer noch über das Gabelfrühstück und Wolframs seltsame Ehe. Bis jetzt kam der Schmerzensmann allein in seinem großen Haus zurecht, über kurz oder lang würde er aber Hilfe brauchen. Hatte er wenigstens eine Putzfrau? Wer würde für ihn einkaufen, kochen, ihn zum Arzt begleiten, ihn schließlich sogar pflegen? Ob er dergleichen Samariterdienste von mir erwartete? Eigentlich hatten wir so nicht gewettet, aber ich konnte ihm trotzdem ein wenig Unterstützung anbieten, bis er schließlich im Krankenhaus oder Hospiz landete. Was hatte er kurioserweise zu mir gesagt? Ich sei die einzige Frau, die seine Situation niemals ausnützen würde! Woher wollte er das wissen? War ich wirklich so edel und unbestechlich, wie er sich einbildete? Erst gegen Morgen schlief ich ein und wachte wie gerädert auf. Seit diesem sonderbaren Gabelfrühstück war es um meinen Frieden als Rentnerin geschehen, und ich murmelte wie das Gretchen im Faust: »Meine Ruh’ ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmermehr.«
Gegen elf machte ich mir eine Tasse Kaffee und hätte mich am liebsten gleich wieder hingelegt. Ich zwang mich jedoch, [28] ein paar Hausarbeiten zu erledigen und die Blumen zu gießen.
Judith rief in ihrer Mittagspause an. »Ich hab was gefunden«, sagte sie stolz. »Ein ähnliches Haus kostet neunhunderttausend, allerdings nicht in Weinheim, sondern in Bensheim! Was sagst du nun?«
»Nicht schlecht!«, sagte ich. »Ein Viertel davon wären fast zweihundertfünfzigtausend Euro, davon könnte ich mir bestimmt eine schicke Eigentumswohnung kaufen. Eine runde Million für mich allein wäre allerdings noch netter!«
»Ich muss aufhören«, sagte Judith. »Träum weiter!«
Das tat ich dann den Rest des Tages. Irgendwann wurde mir allerdings klar, dass ich noch einmal mit Wolfram sprechen musste. Sollte ich ihn anrufen? Es gab drei ehemalige Schulfreundinnen, mit denen ich manchmal stundenlang telefonierte. Bei Wolfram kam mir ein Telefonat unpassend vor. Ein ernsthaftes Gespräch hielt ich nur für möglich, wenn wir uns direkt gegenübersaßen und mit gedämpfter Stimme ungestört reden konnten: Schließlich ging es um seinen baldigen Tod. Sollte ich ihn meinerseits zu einem Imbiss einladen? Lieber nicht, denn ich wollte ja sein Haus näher in Augenschein nehmen. Vielleicht könnte ich das Bad aufsuchen, die Tassen in die Küche tragen und dadurch dem Grundriss auf die Spur kommen. Ich beschloss, ihn zu überrumpeln und in den nächsten Tagen einfach mal zu klingeln. Dann musste er sich auch nicht umständlich auf einen Besuch vorbereiten und würde am Ende wieder Fleischsalat kaufen.
Ziemlich erschöpft legte ich mich mit der Zeitung aufs [29] Sofa, mochte aber keine längeren Artikel lesen. Unentschlossen blätterte ich herum, fand keine interessanten Immobilienangebote und studierte schließlich die Todesanzeigen, Inserate von Bestattungsunternehmen und Friedhofsgärtnern. Ein Steinmetz bot günstige Grabsteine an, die Lasergravur für eine Inschrift kostete bloß 80Euro. Ich riss mir die Seite heraus, rollte mich zur Wand und hielt zur falschen Zeit ein Schläfchen: ein untrügliches Zeichen, dass ich alt wurde. Ich hatte noch sehr gut die Klagen meiner Mutter im Kopf, weil mein Vater in seinen letzten Jahren oft am helllichten Tag mit der Brille auf der Nase und der Zeitung in Händen im Ohrensessel einnickte.