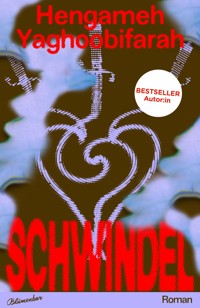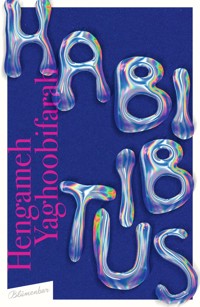
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer unsere Gegenwart verstehen will, muss die Texte von Hengameh Yaghoobifarah lesen Mit einem Vorwort von Fatma Aydemir. Rechter Terror, Rassismus unter Linken, Rape Culture, fades Essen und schlechtes Netz: Seit 2016 legt Hengameh Yaghoobifarah in der taz-Kolumne »Habibitus« schonungslos den Finger in die Wunden »deutscher Leitkultur«. Yaghoobifarah offenbart, warum Crocs stylisch, Kinderlosigkeit verheißungsvoll und Dumplings das Rezept für Weltfrieden sein können. Mit Witz, Haltung und untrüglichem Gespür für die relevantesten Themen unserer Zeit stellt Hengameh Yaghoobifarah vermeintliche Gewissheiten infrage und entlarvt, was in Deutschland alles schiefläuft – egal ob es um Körper, Kapitalismus oder Kartoffeln geht. Dieser Band bündelt die prägnantesten Beiträge einer Stimme, die aus der öffentlichen Debatte nicht mehr wegzudenken ist. »In diesem Land witzig zu sein, ist gar nicht so einfach, besonders wenn es auf Kosten der satten, bürgerlichen, weißen Dominanzkultur geht. Hengamehs Texte sind charmant, politisch stabil und zum Schreien komisch.« Fatma Aydemir
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Den politischen und zeithistorischen Kontext der Habibitus-Kolumnen bilden der NSU-Prozess, der Einzug der AfD in den Bundestag, die rechtsextremen Anschläge in Halle und Hanau, der Mord an Walter Lübcke, die Entstehung eines NSU 2.0. Diese Ereignisse und überhaupt die Allgegenwärtigkeit rechter Gewalt werden auch inhaltlich in einigen der Kolumnen verhandelt. In den meisten Texten jedoch bleiben sie der unausgesprochene Hintergrund, das Grauen, das zwischen den Zeilen wabert. Jeder Witz sitzt, weil hinter ihm stets der Schrecken aufblitzt. Jedes Lachen befreit, weil mit ihm auch ein kleines bisschen Angst bewältigt wird. Diese Texte eröffnen Räume, in denen wir leicht sein können, ohne die Schwere auszublenden oder zu verleugnen. Unermüdlich zeigt uns Hengameh, wie es gehen kann: Leben, lieben, lachen trotz Deutschland.«Fatma Aydemir im Vorwort
Über Hengameh Yaghoobifarah
Hengameh Yaghoobifarah lebt und arbeitet in Berlin und ist seit 2014 Redaktionsmitglied beim Missy Magazine. Zwischen 2016 und 2022 erschien die Kolumne »Habibitus« in der taz. Gemeinsam mit Fatma Aydemir hat Hengameh Yaghoobifarah 2019 den viel beachteten Essayband »Eure Heimat ist unser Albtraum« herausgegeben. 2021 erschien der erfolgreiche Debütroman »Ministerium der Träume«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Hengameh Yaghoobifarah
Habibitus
Mit einem Vorwort von Fatma Aydemir
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Leben, lieben, lachen trotz Deutschland — Vorwort von Fatma Aydemir
Deutsche Vita
Es ist Deutschland hier
Freche Almans & The City
Gib mir meinen Pokal, du Otto!
Alman Magic
Deutsche, schafft euch ab!
Welche Kartoffel bist du?
Kartoffelgerichte
Feiertag, Meiertag
Nicht ohne mein Hayvan
Deutsche Bahn Unhinged
POV: Du kommst aus einem Entwicklungsland
Way 2 Sexy
Horror aus der Flasche
Haram im Hamam
Adi-Positivity
Skin-Care in 10 Schritten
Können Heten nicht mal campen?
Fake Bitch, Fake Beauty
Fette Arroganz
Das Habibitus-Dating-Portal
Hugbefehl
Nach der Fat-Tax die Fatccine
Der Hot-Maus-Summer-Stress
Body Positivity reicht nicht aus
Die Veränderung
Das Recht auf Hässlichkeit
Das F‑Wort
Willkommen in der Hölle, Ladys
Wer ist hier die Hexe?
So haram wie Schwein
Horst und die Boys
Scheinheilige und Huren
Wow, nicht alle Väter sind Hunde
Das große deutsche Sprachgejammer
Ich will Bubatz statt Babys
Herbstgefühle
Zutritt nur für Arier
Schnick-Schnack-Schelle
Antifa, aber mit mehr Fashion
Döner for none
Lauter als jede Kirchenglocke
Deutsche Kontinuitäten
Deutsche Fantasy
Deutschland im Herbst
Liebe ist politisch
Patriotische Glückseligkeit
Rassismus ohne Rassist_innen
Männlich, middle-aged & mittelmäßig
Ein Land probt »den Schock«
Trauer ist kein Wettbewerb
Mal ’ne coole Deutschlandkarte
Der Terror der Rat-Licker
Deutsches Traditionsbewusstsein
Jeden Tag Herbst in Deutschland
Der Kampf gegen Nazis muss global sein
Sterne
Mein Horoskop ist wichtiger als Deutschland
Der Arschlochfilter
Der feministische Astro-Guide
Sternzeichen bleiben im Haus
Die Sternzeichen als Haftbefehl-Songs
Der Habibitus-Geburtsstein-Guide
Sternchen
Deine Mudda ist born this way
Trans, homo und fascho? Na logo!
Stars und Sternchen
Querer Pessimismus
Hauptsache, Heten haben Spaß — gemeinsam mit Bahar Sheikh geschrieben
Der Heten-Filter
Weiterkämpfen und Erinnern
Die Projektionsflächen
Gender ist eine Horrorshow
Das Revolutionäre Potenzial der Liebe
Durchzug, Durchdrehen, Durchfall
Die Mär vom Kinderschutz
Der Große Maustausch
Es bleibt nur Selbstverteidigung
Die Lage ist critical
»Bio« ist für mich Abfall
Ist Unterdrückungsneid auch Diskriminierung?
Anti gegen Anti
Ab heute bin ich wieder antideutsch
Anstandtifa nicht verfügbar
Bock auf Zoff
Hey Maus, lass mal ehrlich sein
Die lässigste Legende der Welt
Das White Guilt Stipendium
Punkte, bei denen ich falschlag
Zwischen Kritik und Schadenfreude
Widersprüche machen einsam
Voll im Arsch
Fusion Revisited
Die Islamisierung des Hinterns
Kampf der Kackkulturen
Real Talk
Eine Kirche namens Eurozentrismus
Alle gegen Greta
Solidarität – oder soll man’s lassen?
Dicke, weiße Krokodilstränen
Nicht komplett im Arsch
Deutschland, deine Komiker
All cops are berufsunfähig
Mehr als nur entweder oder
No Future bis zum Kommunismus
Zum Verrücktwerden
We love Eigenverantwortung
Leitungswasser predigen, Champagner saufen
Die Stop-Being-Poor-Mentalität
Savoir-vivre
Muschirosapink
Sachlichkeit ist für Lauchs
Männer und Mode
Bitte nicht noch mehr Verwandte
Leider eher peinlich
Fade wie Furzen
Das C‑Wort – ein Bekenntnis
Schweinehufe als Utopie
Irritierend und trotzdem da
Wer kann die Reichen verdauen?
Wir können alle Blumen sein
No pressure, just pleasure
Das Comeback des Annika-Schuhs
Ichstagram
One World Dumplings
Sturm auf Sylt
Die Entscheidungsschlacht
Trotz Deutschland leben, lieben, lachen
Fuck around and find out — Nachwort
Anhang
Impressum
Leben, lieben, lachen trotz Deutschland
Vorwort von Fatma Aydemir
In diesem Land witzig zu sein, ist gar nicht so einfach. Klar, im Mainstream als witzig zu gelten geht easy, sehr easy sogar, angesichts der Trauerveranstaltung, die sich deutscher Humor nennt1. Doch wer sich entscheidet, öffentlich Witze zu machen, und zwar nicht auf Kosten von Migrant_innen, Schwarzen, Frauen, Queers oder Juden, sondern schön auf den Nacken der satten, bürgerlichen, weißen Dominanzkultur, macht sich – gelinde gesagt – nicht besonders beliebt. Zumal in einer Gesellschaft, in der diese Form des Witzigseins zwar nicht verfassungswidrig ist, aber ihr mit so viel Misstrauen und Verachtung begegnet wird, als ob sie das wäre – da gleicht es quasi einem Akt des Widerstands, Menschen auf diese Weise zum Lachen bringen zu wollen. Weil: Es ist Deutschland hier, hier gibt’s nichts zu lachen.
Und genau das ist paradoxerweise zum Schreien komisch. Vor allem dann, wenn Hengameh Yaghoobifarah von diesem Deutschland erzählt. Das ist nicht unbedingt immer politisch korrekt. Auch die berühmt-berüchtigte Gürtellinie wird in Hengamehs Texten eher zu einer Frage der Perspektive. Aber einen Ehrenkodex gibt es, der da lautet: Es wird nicht nach unten getreten, siempre antifascista. Ansonsten gilt: anything goes. So sind die Deutschen etwa nur am Jammern, wissen nicht, was Gewürze sind, und laufen freiwillig mit Kotresten am Hintern durchs Leben. Für Heten sollte es einen Filter geben, um sie aus der Realität ausblenden zu können. Wenn Horst Seehofer angestrengt lächelt, dann nur, weil der Fototermin ihn seit einer Viertelstunde daran hindert, aufs Klo zu gehen. Und sollte die Polizei abgeschafft werden, müssten die Ex‑Beamten am besten direkt zur … Na ja, Sie wissen schon.
Was genau an all dem witzig sein soll? Wenn Sie sich diese Frage stellen, kann ich Ihnen leider gar nicht behilflich sein. Das ist eben die Sache mit Witzen, wenn man anfängt sie zu erklären, hat man schon verloren. Entweder der Witz zündet oder er tut es nicht. Ich würde behaupten, es gibt eine bestimmte Kernleser_innenschaft, bei der Hengamehs Witze mit höherer Wahrscheinlichkeit zünden: links, undogmatisch, popkulturell sozialisiert. Die Mehrheit der Deutschen aber wird beim Lesen von Hengamehs Texten wahlweise stoisch mit den Schultern zucken, ein bisschen sauer werden, passiv-aggressiv mit einer Abo-Kündigung drohen, oder einen leicht über den Zaun schießenden Drohbrief schreiben.
Ich weiß das, weil ich die Ehre hatte, als Redakteurin Hengamehs Kolumne von Anfang an zu betreuen. Erst im Drei-, dann im Zweiwochenrhythmus erschien ab 2016 bei der Tageszeitung taz die Kolumne mit dem süßen Titel »Habibitus« – eine Wortneuschöpfung aus dem Habitus-Begriff des Soziologen Pierre Bourdieu und dem arabischen Wort habibi, zu Deutsch »Liebling«. Das Liebevolle an den scharfzüngigen Texten erschließt sich zunächst einmal nur jenen Leser_innen, die sich als Verbündete in deren Humor verstehen. Diesen Bund identitär zu deuten, greift allerdings zu kurz. Es gibt sie nämlich durchaus, die weißen deutschen Leser_innen, die sich köstlich über Hengamehs Spott zu amüsieren wissen, weil sie die in den Kolumnen beschriebenen Deutschen nicht als abzählbare Gruppe von real existierenden Personen verstehen, mit denen sie sich eins zu eins identifizieren müssen, sondern mehr als Werkzeug. Die Deutschen in den Habibitus-Kolumnen sind eine Art Personifizierung der postnationalsozialistischen Gesellschaft: selbstgerecht, geschichtsvergessen, immer schön offen nach rechts. Wer sich hier also abgewertet und mitgemeint fühlt, wird es möglicherweise auch sein.
Aber es dreht sich ja glücklicherweise nicht alles um die Deutschen. Mode ist ein wiederkehrendes Thema in Hengamehs Schreiben, Skin Care und Astrologie bieten jeweils Stilmittel, um das Thema Selbstoptimierung in der kapitalistischen Gesellschaft auf originelle Weise auseinanderzunehmen. Im Grunde alles Trendthemen aus der Netzkultur der letzten Dekade, die auch den Sprachwitz und die Anspielungen in Hengamehs Texten maßgeblich beeinflussen. Insofern eröffnen die Kolumnen für Social-Media-Nutzer_innen der eigenen Blase mehr Deutungsräume als für Außenstehende. Zwar bemüht sich Hengameh im Rahmen der Möglichkeiten eines 3000‑Zeichen-kurzen Textes, die eigenen Sprachbilder und Begrifflichkeiten möglichst vielen Leser_innen verständlich zu machen. Aber der Geduldsfaden ist der Textlänge entsprechend ziemlich dünn. Wer nicht versteht, ist raus. Vermutlich wurzelt manch aufgebrachter Leser_innenkommentar auch genau in diesem Umstand, der nicht selten zur ersten Ausgrenzungserfahrung eines ansonsten recht privilegierten, bürgerlichen Tageszeitungsleser_innentums zu mutieren vermag. Sei’s drum.
Viel aufregender ist ein anderer Aspekt von Hengamehs Texten, und da komme ich auf den Bund der Eingeweihten zurück, die sich nicht einfach über ihre Identitäten oder ihr Verhältnis zu Deutschland zusammenfassen lassen: Queerness. Für mich persönlich war Hengamehs Kolumne von Beginn an eine Möglichkeit zu begreifen, was Queerness alles ausmachen kann. Und zwar nicht, weil Hengameh queer ist, sondern weil Hengameh queer schreibt. In den nervtötenden Feuilletondebatten der letzten Jahre wurde aus rechtsnationaler, konservativer bis hin zu linker Perspektive stets eine von Identitätspolitik ausgehende Gefahr für die freie Meinungsäußerung proklamiert. Nervtötend, nicht weil Kritik daran grundsätzlich illegitim wäre, sondern weil es sich die Kritiker_innen aus allen Lagern allzu leicht machen. »Wer nicht queer ist, darf nicht mitreden« lautet häufig die beleidigte und sehr verkürzte Vorannahme, aus der dann keine besonders geistreichen Analysen folgen können. Manchmal wird Hengameh in diesen Kritiken namentlich genannt, viel häufiger jedoch sicherlich mitgemeint als populäre und meinungsstarke Person ohne Hemmungen, das Verhältnis zwischen Identitätszuschreibungen und Macht immer wieder neu zu betrachten, zuzuspitzen und rücksichtslos auf die Schippe zu nehmen – nur eben nicht aus der gewohnten normativen Perspektive. Was Kritiker_innen dabei meist entgeht, ist, dass Queerness kein Reisepass ist, auf dem Hengameh sich während der Zerstörungstrips in Gefilde der cis-heteronormativen Lächerlichkeit ausruht. Queerness ist eine Praxis, der sich Hengameh bedient und die Hengameh aktiv mitprägt, indem keine Beziehung, keine Autorität und keine Ordnung als unumstößlich oder alternativlos begriffen wird, am allerwenigsten das Phantasma der Zweigeschlechtlichkeit oder die Art und Weise, wie wir mit- und übereinander sprechen. Queer ist bei Hengameh eben nicht bloß Diskriminierungsmerkmal, sondern vielmehr eine Art und Weise auf die Welt zu blicken und sich eine bessere zu erträumen. Es ist ein Ausbruch aus dem Gefängnis namens Norm. Und diesen Ausbruch immer wieder durch das extrem enge Gerüst der Textgattung Kolumne zu wagen und zu meistern, das ist eine Leistung. Um nicht zu sagen: eine Gabe.
Hengameh Yaghoobifarah hat diese Gabe und ist dabei auch noch zum Umwerfen charmant, politisch stabil, lustig. So lustig, dass bereits eine ganze Reihe von Mitbürger_innen infrage stellten, ob es denn überhaupt legal ist, so funny zu sein. 150 Strafanzeigen gingen allein wegen einer einzigen Kolumne bei der Berliner Staatsanwaltschaft ein, nämlich im Sommer 2020, als gerade die ganze Welt gegen Polizeigewalt demonstrierte. In besagtem Text sinniert Hengameh darüber, welchen Jobs Ex‑Beamte nachgehen könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht – an sich ein absurdes Szenario, gehört der Schutz von Eigentumsverhältnissen doch seit jeher zum Kerngeschäft der Institution Polizei. Jedenfalls landen die fiktiven Ex‑Beamten am Ende des ganz offensichtlich satirischen Textes auf der Müllhalde. Ein Affront, den die Freunde des Freundes und Helfers allzu persönlich nahmen. Unabhängige Journalist_innen ergriffen Partei für das Exekutivorgan des Staates, taz-Leser_innen brachten Blumensträuße auf Polizeiwachen. Selbst der Innenminister erwog eine Anzeige, sah in Hengamehs Polizeikritik nicht etwa eine freie Meinungsäußerung, sondern Volksverhetzung, und ließ seinen Gedanken dazu bei einem Exklusivgespräch mit der »Bild«-Zeitung freien Lauf, deren tagelange Hetzkampagne selbstverständlich unter die Pressefreiheit fiel. Wie gesagt: In diesem Land witzig zu sein, ist nicht einfach. Sich zum Clown zu machen hingegen schon.
Was ist es also, worüber wir, die anderen, lachen? Vielleicht liegt die Antwort in der Psychoanalyse, laut der Angst und Lachen ja recht nah beieinander liegen. Den politischen und zeithistorischen Kontext der Habibitus-Kolumnen bilden der NSU-Prozess, der Einzug der AfD in den Bundestag, die rechtsextremen Anschläge in Halle und Hanau, der Mord an Walter Lübcke, die Entstehung eines NSU 2.0. Diese Ereignisse und überhaupt die Allgegenwärtigkeit rechter Gewalt werden auch inhaltlich in einigen der Kolumnen verhandelt. In den meisten Texten jedoch bleiben sie der unausgesprochene Hintergrund, das Grauen, das zwischen den Zeilen wabert. Jeder Witz sitzt, weil hinter ihm stets der Schrecken aufblitzt. Jedes Lachen befreit, weil mit ihm auch ein kleines bisschen Angst bewältigt wird. Diese Texte eröffnen Räume, in denen wir leicht sein können, ohne die Schwere auszublenden oder zu verleugnen. Unermüdlich zeigt uns Hengameh, wie es gehen kann: Leben, lieben, lachen trotz Deutschland.
Deutsche Vita
Es ist Deutschland hier
Vorsicht, Attention, Achtung, Danger Zone: Was den Deutschen neben mediterranfarbenen Wohnzimmergarnituren und dem Ausblenden ihrer politischen Verantwortung besonders gut gefällt, sind ihre Regeln. Deshalb bleiben Zeigefinger nahezu permanent erhoben wie eine Radioantenne – oder eben, saisonal passend, wie hässliche Flaggen an Autofenstern. Ganz gönnerhaft schreibt Thomas Straubhaar in seiner Welt-Kolumne2 bereits im aussagekräftigen Titel: »Der Islam gehört zu uns, wenn er unseren Regeln folgt.« So weit, so wtf.
Die Vorstellung, dass Muslim_innen nur über den Migrations- oder Fluchtweg nach Europa kommen und der Islam somit etwas Undeutsches sei, ist eine Urban Legend. Muslimisch sein und weißsein schließen sich nicht aus. (Wenn Sie mich fragen: Die nervigsten Muslim_innen sind die weißen Deutschen unter ihnen. Die Streber_innenhaftigkeit, die Pedanterie, der Hang zum Autoritären, und das alles mit Religiosität unterlegt … what’s not to love?)
Klar, vor 800 Jahren war der Anteil an muslimischen Personen hier sehr viel geringer. Dafür waren Europäer_innen damals damit beschäftigt, an der Pest zu sterben und, business as usual, antisemitisch zu sein. Letzteres hat sich nicht geändert, das mit der massiven Unhygiene ist etwas besser geworden. Veränderung kann eben auch schön sein. Deutsche akzeptieren das allerdings nicht gern, womit ich mir den Hype um das Mittelalter nur erklären kann.
Welchen deutschen Regeln sollten Muslim_innen also folgen? Wo hakt es mit der Integration? Würde es helfen, dreimal täglich Schweinefleisch zu essen? Kein Bier vor vier, danach aber Kristallweizen, als gäbe es keinen Morgen? Alle Männer, die an der EM nicht interessiert sind, pauschal als »schwul« bezeichnen und mit »schwul« eine Beleidigung implizieren? So wie der Bambi-Integrationspreisträger Bushido die AfD wählen? Mit Schuhen ins Haus gehen? Mit schwachen Augenbrauen aus dem Haus gehen und so tun, als wäre die Welt in Ordnung?
Tägliche Anschläge auf Geflüchtetenheime ignorieren und sich dann über den plötzlichen Anstieg rechter Gewalt wundern? Keine Festnetzanrufe nach 20 Uhr? Sonntagsruhe respektieren? Konsequent mit zu niedrigem Lichtschutzfaktor in die Sonne und von Mayo zu Ketchup mutieren? Passive Aggressivität statt ehrlicher Realitätsschellen? Nur noch mit Salz, Pfeffer und, wenn es mal exotischer sein soll, Kräutern der Provence würzen? Oder das Grundgesetz beachten, an das sich nicht einmal alle zugelassenen politischen Parteien halten?
Es sind keine breaking news, dass soziale Konventionen von Land zu Land unterschiedlich sind. Was aber auch keine so steile These ist, ist, dass Menschen von einander und ihren Differenzen lernen können. Von deutscher Pünktlichkeit zum Beispiel hätten sich meine Eltern ruhig mal eine Scheibe abschneiden können, als sie mich bei Minusgraden eine halbe Stunde lang vor der Schule warten ließen.
Dafür möchte ich allen Menschen eine Gießkanne neben das Klo stellen. Ist nicht böse gemeint, aber es ist purer Selbsthass, freiwillig mit Kotresten am Hintern durch das Leben zu gehen. Anstatt sich über die Islamisierung des Abendlandes zu echauffieren, können diese Almanis endlich mal anfangen, sich über die Chance auf ein schöneres Leben zu freuen.
Juni 2016
Freche Almans & The City
In der Servicewüste Deutschland mangelt es an einigen Dingen. Ich spreche nicht von gut gewürztem Essen oder ästhetischer Funktionskleidung, sondern von der kollektiven Möglichkeit, Aggressionen abzubauen. Vielleicht sollte es mehr Fight Clubs geben. Nach dem Feierabend oder nur so zwischendurch mit einem Handtuch und bequemer Kleidung ein Etablissement wie einen Sportverein betreten, in dem sich alle einvernehmlich die Fresse polieren und danach mit einem Glühen auf den Wangen nach Hause fahren.
Hauptsache, die Leute – und damit meine ich besonders Durchschnittsalmans wie Dörte und Wolfgang – können Luft rauslassen und tiefenentspannt in ihren Alltag, das Wohnzimmer mit Eckgarnitur im Reihenhaus, zurückkehren. Denn das Bedürfnis aufzumucken ist definitiv da, und es zeigt sich vor allem an einem Ort: der Schlange zum Service. Die Schlange verwandelt sich in einen metaphysischen Raum mit verschwommenen Regeln. Aus dem diplomatischen Dieter und der gewaltfrei kommunizierenden Gisela werden wahre Hayvans, wie man sie sonst nur von All-you-can-eat-Buffets und vom Einstiegsbereich öffentlicher Verkehrsmittel kennt.
Keine Lüge ist ihnen zu schade, um möglichst früh dranzukommen. Kein Kommentar über andere Menschen zu unangebracht, um mit Fremden zu bonden und ein Wir zu konstruieren, das gemeinsam gegen ein Feindbild wettert. Mal ist es die Person, deren Geschlecht nicht eindeutig zugeordnet werden kann – aber ganz ehrlich, wann kann man das schon wirklich? –, mal die Person, die ihre Tasche zu langsam packt, mal die Person, die nicht fließend Deutsch spricht und deshalb Dinge nachfragen muss. Würden sie wenigstens intervenieren, wenn sich jemand diskriminierend verhält: okay. Aber nein: Die Schlange verwandelt sich in einen mit harten Gefühlen aufgeladenen Käfig, in dem alles – vor allem sich Einmischen – kann und nichts – besonders kein Respekt – muss.
Gestern ging ich mit Kopfhörern auf den Ohren in den Drogeriemarkt. An harten Tagen wie diesen hilft mir die musikalische Beschallung dabei, stressige Orte wie Geschäfte auszuhalten. An der Kasse spürte ich schon, wie die Uschi hinter mir ungeduldig wie ein gedoptes Pferd vor einem Rennen hin und her trabte. Und das, obwohl ich meine Kopfhörer trug und mich mental ganz woanders befinden wollte. Als ich die Kassiererin bat, einen Satz zu wiederholen, weil ich ihn nicht verstanden hatte, hörte ich das Pferd schon wie dieses eklige Wasser, das manchmal aus Ketchupflaschen kommt, losspritzen: »Sind wir hier etwa im Baumarkt, dass man Kopfhörer für den Lärmschutz braucht?«
Ich atmete durch und riss mich zusammen. Mein Energielevel war niedrig, sonst hätte ich mich zu ihr umgedreht und gesagt, dass Pissnelken wie sie der Grund dafür sind, warum ich meine Kopfhörer am liebsten nie abnehmen würde. Oder ich hätte eine Freundin von meiner Mutter zitiert, die mal sagte: »Wenn du nichts zu sagen hast, aber deine Zunge in Bewegung halten musst, dann kau Kaugummi.«
November 2016
Gib mir meinen Pokal, du Otto!
Es gibt Gewinner_innen und es gibt Verlierer_innen. Und dann gibt es jene, die faktisch gewonnen haben, aber den Erfolg trotzdem nicht genießen können. Letzteres gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag bei den Oscar-Preisverleihungen vor einem Millionenpublikum zu sehen.
Die Verkündung des Gewinnerfilms in der Kategorie »Best Picture« sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern vor allem für eine peinliche Schlüsselszene: Die Moderationsottos lesen von der verkehrten Karte ab und küren fälschlicherweise »La La Land« als Gewinner. Die komplette Crew kommt auf die Bühne, die ersten weißen Typen bedanken sich bei ihrer Sippe. Als der dritte weiße Typ noch schnell das Mikro ergreift und Familienmitgliedernamen droppt, ist (auch ihm) längst klar, dass er gerade nicht richtig steht. Schließlich beendet er seine Rede mit passiv-aggressivem Verlierergesicht und dem Satz: »Übrigens, wir haben verloren.« Erst dann folgt die Korrektur: Der eigentliche Gewinner ist »Moonlight«, ein queerer Schwarzer Film.
Nun gehöre ich nicht zu der Sorte Mensch, die die Preisverleihung nachts live verfolgt. Den Gossip lese ich am Morgen drauf online nach. Neben der starken Rede von der Schauspielerin Viola Davis, Gewinnerin des Awards als beste Nebendarstellerin, blieb nur dieser Fauxpas hängen. Fauxpas klingt, als wäre es eine zufällige Verwechslung gewesen. Ein Missgeschick, das bei jeder Kategorie hätte passieren können. Das ist es aber nicht. Worum es wirklich geht, ist, dass rassifizierte Menschen selten einfach nur gewinnen dürfen.
Wie oft mussten wir uns dafür entschuldigen, als Beste abgeschnitten zu haben? Und immer erklären, dass ein Sieg ja nichts zu bedeuten hätte und wir doch eigentlich alle Gewinner_innen seien? Viele von uns sind total schlecht darin, Komplimente von weißen Menschen anzunehmen. Ich fühle mich immer gezwungen, etwas ähnlich Nettes zu spiegeln. Selbst, wenn es nicht zutrifft.
Es fällt uns extrem schwer, vor weißen Menschen im Rampenlicht zu stehen. Entweder begeben wir rassifizierten Personen uns von selbst in den Schatten weißer Menschen oder weiße Menschen funken dazwischen: Bei den Olympischen Spielen wird der Erfolg Schwarzer Athlet_innen 2016 immer noch anhand biologistischer, rassentheoretischer Logik erklärt. Ihr Gewinn darf nie einfach so stehen bleiben. Warum weiße Menschen rassifizierten nie ihren hart erkämpften Ruhm lassen? Weil sie glauben, ihnen gehöre die Welt. Weil es geschichtlich schon immer so dargestellt wurde, als wäre Gewinnen ein weißes Hobby. Wir anderen wiederum sind es gewohnt, möglichst auf den uns zugeschriebenen Plätzen zu bleiben. Die sind meistens nicht mit am großen Tisch.
Gleichzeitig müssen wir uns, um überhaupt mit weißen Menschen mithalten zu können, dreimal so stark anstrengen wie sie. Wenn wir auch noch cis Frauen oder trans Personen sind, vielleicht sogar fünfmal. Dabei sollten wir unbedingt lernen, die Anerkennung zu genießen. Dass wir gut verlieren können, wissen wir eh. Dass wir noch besser gewinnen können, nun auch.
März 2017
Alman Magic
Man gibt es ja nicht gerne zu, aber Weißsein verliert – abgesehen von den ollen Privilegien – ganz schön an Attraktivität, während alle anderen Leute sich im Zuge des Empowerments zelebrieren können. Nun werden Eigenschaften, die üblicherweise rassifiziert wurden, sogar schon von mittelmäßigen weißen Frauen wie dem Kardashian-Nachwuchs Kylie Jenner angeeignet: buschige Brauen und dicke Haare statt des üblichen Drei-Strähnen-Looks, richtig Junk In The Trunk statt dem Handy in der Arschtasche der Jeans als einzige Rundung, Braids statt Bauernzopf. Kurzum Black Girl Magic statt Merlins billigem Hokuspokus. Und es geht über Beauty-Trends hinaus.
Früher in Deutschland als eklig geltende Küche wie etwa die koreanische gilt jetzt als Szene-Essen. Außergewöhnliche Namen machen viel mehr her als Jochen und Otto, die mittlerweile als Beschimpfungen fungieren. Kein Grund zu feiern für Kartoffeln? Nicht ganz. Deutsche haben nämlich ihre eigenen Superpowers. Sie brauchen weder gut gewürztes Essen noch aneignungswürdige Ästhetik in Mode, Musik und Make‑up.
Ihre geheime Magie besteht darin, wie von Zauberhand die Gefühle von allen im Raum Anwesenden zu kontrollieren. Funktioniert meistens nur in eine Richtung, und zwar nach unten, aber das allein ist schon bemerkenswert. Ist euch das mal aufgefallen? Kartoffeln sind leicht und oft schlecht gelaunt.
Dafür gibt es viele Gründe: das deprimierende Wetter, das fade Essen, das miese Fernsehprogramm, die bemerkenswert hohe Quote, sich Wertgegenstände klauen zu lassen oder sie zu verlegen, zersplitterte Smartphone-Displays, enttäuschende Fußballergebnisse, geschlossene Läden, limitierende GEMA-Regelungen, überall Hundescheiße auf der Straße, you name it. In Deutschland leben heißt unter belastenden Umständen leben.
Kein Wunder, dass allen die Mundwinkel bis in den Keller hängen. Kartoffeln sind ja auch nicht für ihre Herzlichkeit und Besonnenheit bekannt. Wer es trotzdem schafft, sich diesen Wermutstropfen zu entziehen, dem machen Kartoffeln dann mit ihren Zauberkräften einen Strich durch die Rechnung. Wenn sie irgendwo oder irgendwas verloren haben beispielsweise, ziehen sie so lange eine Fresse und meckern darüber, dass andere nach einer Zeit das Gefühl haben, es sei ihr eigener Geldbeutel, der in der Mittagspause geklaut wurde.
Oder sie seien dran schuld und müssten ihnen nun vielleicht ihren eigenen geben, auf jeden Fall aber einen Kaffee oder ein Bier ausgeben, damit sich ihre Laune ein bisschen hebt und etwas Ruhe einkehrt. Wie es sich wohl anfühlt, wenn dir das Auto gestohlen, ein lauwarmes Bier serviert, an der Kasse der falsche Betrag abgerechnet, die Kieselsteine in der Einfahrt durcheinandergebracht werden oder wie es sein muss, das Abitur nicht bestanden zu haben, kann ich mir mittlerweile originalgetreu vorstellen, weil es Kartoffeln in meinem Umfeld bereits erlebt und mir das Gefühl übertragen haben. Wenn das keine außergewöhnliche Alman-Magie ist, was ist es dann?
März 2017
Deutsche, schafft euch ab!
2010 veröffentlichte Thilo Sarrazin seine rassistische Thesensammlung »Deutschland schafft sich ab« und befeuerte damit eine sich ausbreitende Hetzstimmung gegen Muslim_innen. Dass Sarrazin ein rechter Lauch ist, der gerne viel Scheiße labert, wenn der Tag lang genug ist, wissen wir bereits. Dass er mit seinem Buchtitel ein falsches Versprechen gegeben hat, auch, denn ich schaue es dem Fenster und sehe Deutschland immer noch.
Und die Deutschen bringen eine deutsche Aktion nach der anderen. Neulich warf Thomas Wir-sind-nicht-Burka de Maizière die Möglichkeit in den Raum, in bestimmten Bundesländern einen muslimischen Feiertag einzuführen. Dass dieser Vorschlag völlig unverbindlich ist? Egal. Die leere Symbolik dahinter? Geschenkt. Aber die dadurch ausgelöste Panik bei Kartoffeln? Unbezahlbar.
In Online-Umfragen darüber, ob es zusätzlich zu den bestehenden christlichen Feiertagen einen muslimischen für alle Leute geben sollte, stimmte die Mehrheit dagegen. Kartoffeln würden lieber auf einen freien Tag verzichten, als Muslim_innen einmal was zu gönnen. Warum machen sie so?
Der deutsche Hass auf Muslim_innen und die Paranoia vor einer – was auch immer das sein soll – Islamisierung der deutschen (wortwörtlich) Dreckskultur hält Kartoffeln davon ab, ein schöneres Leben zu führen. Lieber eine Schweinefleisch-Lobby gründen, als halal-Fleisch in ihrer Kantine akzeptieren. Lieber Bremsspuren in der Unterhose und ein erhöhtes Risiko für Geschlechtskrankheiten verteidigen, als ein islamisches Klo im Kölner Bürgerhaus zulassen. Lieber einen Tag mehr arbeiten als ein muslimischer Feiertag im Kalender. Ihr antimuslimischer Rassismus schadet Muslim_innen und Kanax, aber er geht auch auf ihren eigenen Nacken. Ihre Missgunst ist so riesig, dass sie sich das eigene Leben verderben. Engherzig, trotzig, bitter und kleinlich – das ist deutsche Kultur. Es fällt ihnen leichter, zu verlieren, als eine Win-Win-Situation auszuhalten.
In ihren liebsten griechischen Restaurants oder Döner-Buden modifizieren die Köch_innen ihre originalen Gewürzpaletten auf den deutschen Geschmack hin, damit es den Kartoffeln schmeckt. Aber wehe, jemand wagt es, deutsche Gewohnheiten und Traditionen in Frage zu stellen.
Wer strategisch klug vorgeht, nimmt alles Profitable mit, was geht – da spielt es keine Rolle, ob auch andere den Vorteil genießen, man ist halt auf sein eigenes Leben fokussiert und will das Beste rausholen. Aber Kartoffeln sind nicht strategisch klug, sie sind ignorant, geschichtsverdrossen und besserwisserisch. Weder aus den Fehlern anderer noch aus ihren eigenen können und wollen sie lernen. Würden AfD-Wähler_innen zuhören, wüssten sie, dass die AfD einen Großteil von ihnen unter den Bus schmeißen würde, wäre sie an der Macht.
Sarrazin hat auf 464 Seiten Verantwortliche für die Abschaffung Deutschlands gesucht, aber die größte Problemkindergruppe vergessen: die Deutschen selbst. Sie schaffen sich selber ab. Ich hoffe, sie beeilen sich.
Oktober 2017
Welche Kartoffel bist du?
Keine Lust mehr darauf, als Kartoffel dauernd in eine Schublade gesteckt zu werden? Du hast die Faxen dicke, ständig für Pauschalisierungen herzuhalten? Du wünschst dir mehr Differenzierung, wenn über deine Demografie gesprochen wird? Dann bist du hier richtig. Mache jetzt den Habibitus-Psychotest und finde heraus, welche Form der Kartoffel du bist!
1. Wenn jemand weiße Deutsche als Kartoffeln bezeichnet, dann. . .
*…ich!
#…fühle ich mich angegriffen.
%…ist das Rassismus gegen Deutsche.
+…lache ich und sage »I bims 1 Alman!«
2. Wie gehst du mit Kritik an Deutschland um?
#Es gibt viel Gutes hier: den Harz, Pünktlichkeit, Kant. . .
+Super, nur nicht in Anwesenheit meiner Eltern.
*Nationalstaaten gehören abgeschafft.
%Niemand muss hier leben ;)
3. Was macht deutsche Leitkultur für dich aus?
+Du meinst Leidkultur?
%Oktoberfest, Obergrenze und Omas Sonntagsbraten.
#Wir sind nicht Burka, wir sind Goethe!
*ein Herrschaftsinstrument und Assimilationsimperativ.
4. Wie gehst du mit Geflüchteten um?
%Sie fassten unsere Frauen an, jetzt fasse ich ihr Existenzrecht an, so einfach ist das.
#Ich hieß sie mit Seife am Bahnhof willkommen.
+Mit meinem »Refugees Welcome«-Turnbeutel setze ich ein klares Zeichen gegen Rassismus.
*So wie mit anderen Menschen auch.
5. Was ist dir wichtig?
#Wenn ich jemandem 20 Cent leihe, dann schuldet mir die Person 20 Cent.
%Meine Ängste sollen ernst genommen werden. Wir mussten zu lange schweigen!
*Liberté, Egalité, No‑AfDé (und Beyoncé).
+Kapitalismus überwinden, der Rest kommt von allein.
Die Auflösung:
* Süßkartoffelpommes
Du bist nicht wie die anderen Kartoffeln – das sagen auch andere. Wertkonservatismus und völkisches Gelaber sind bei dir out, man findet dich in jedem hippen Burgerladen. Dir liegt etwas daran, die Gegenwart progressiver zu gestalten. Weiter so!
+ Kumpir
Du findest die anderen Kartoffeln ganz schlimm. Bei deinen Abgrenzungsversuchen verpasst du aber die Critical Kartoffelness. Ungerechtigkeit lässt sich nicht bekämpfen, indem du die Unterdrückten imitierst. Bleib bei dir selbst, ohne die Empathie zu verlieren.
# Kartoffelsalat mit Mayo und Speck
Du bist eine klassische Form der Kartoffel und das bist du gerne. Wer mit dir nicht kann, soll halt was anderes essen. Extrawürste gibt es bei dir nicht. Außer, man bringt sie selber mit, dann tolerierst du sie.
% Kroketten mit brauner Soße
Eigentlich siehst du ganz sympathisch aus mit deiner knusprigen Kruste. Wer aber zu schnell anbeißt, wird sich an dem heißen Inneren verbrennen. Du bist ein undefinierbares Gemisch aus Kartoffelbrei (Labilität) und Laktose (Bauchschmerzen) mit traditionsbewusstem Topping.
November 2017
Kartoffelgerichte
Die ersten Enttäuschungen über die deutsche Essenskultur traten bei mir früh ein. Als ich fünf war, gab es im Kindergarten ein trostloses Ensemble zum Mittagessen: Durchsichtiger Glibber lag wie ein Gummifilm auf dem braunen Fleisch neben dem Gemüse. Zu Hause iranifizierte ich viele der Gerichte, wenn meine Mutter mich fragte, was es zum Mittagessen gab. Hühnerfrikassee mit Reis hieß bei mir Morgh‑o Polo und Spinatgerichte labelte ich als Ghorme Sabzi (zugegebenermaßen ein ganz schöner Euphemismus). Anstatt eines Danks für diese Transferleistung erhielt ich von meiner Mutter einen Nackenklatscher fürs Lügen. Sie wusste genau, dass in der deutschen Küche für diese Art des Gaumenschmauses kein Platz vorhanden war.
In meiner Phantasie hingegen schon. Doch selbst ich war nicht in der Lage, Worte für dieses unappetitliche Gericht vor mir zu finden. (Heute weiß ich: Es heißt Aspik.) »Was ist das?«, fragte ich in bemüht gefasstem Ton meine Erzieherin. »Iss, dann wirst du schon sehen«, brummte sie. Ich überwand mich dazu, einen Löffel zu probieren. Dann ging plötzlich alles ganz schnell, und ehe ich mich versah, übergab ich mich direkt auf meinen Teller. »Ich musste kotzen«, teilte ich meiner Erzieherin mit, die mich wütend anblinzelte.
Einige Jahre später verwechselte ich auf einer Klassenfahrt beim Abendbrot Sauerkraut mit angebratenen Zwiebeln. Die glasig-glänzenden Fäden hielt ich für mein Lieblingsgemüse und haute mir hungrig eine Portion auf den Teller. Der erste Bissen war ein Schock. Kochen Almans so schlecht, dass sich der Geschmack von köstlichen, süßlich-scharfen Zwiebeln um 180 Grad zu dieser säuerlichen Katastrophe wenden kann? »Die Zwiebeln schmecken echt komisch«, bemerkte ich am Tisch und eine Mitschülerin lachte mich aus. »Das ist Sauerkraut!«
Das ist also dieses Deutschland, in dem das Essen entweder nach nichts oder nach zu viel Knoblauch schmeckt, weil die Köch_innen unbedingt beweisen wollen, dass sie ein krasses Gewürz-Game haben. Was sie jedoch meistern: Kartoffelgerichte aller Art. (No pun intended.)
Angesichts der hohen Chance, ein verkacktes Essen serviert zu bekommen, bin ich im Nachhinein nicht mehr so traurig darüber, dass ich oft im Zimmer meiner Gastgeberinnen aus der Schule bleiben musste, während diese mit ihren Familien aßen. Meine Verwandten konnten diesen deutschen Brauch kaum fassen, aber ich nahm es mit Gelassenheit. Meistens gab es ohnehin Schweinefleisch, das wäre einfach nur ein awkward Tischgespräch gewesen.
Umso überraschender finde ich es, wenn Almans staunend und doch so in Flammen von der Gastfreundschaft schwärmen, wenn sie aus ihrem Nahost-Urlaub zurückkehren. Ich kann da meistens nur mit den Augen rollen und denken: Du Hayvan, wenn du Gastfreundschaft so geil findest, warum probierst du das Konzept nicht mal selber aus?
März 2018
Feiertag, Meiertag
Wir erinnern uns: Letztes Jahr deutete die allgemeine Stimmung gegen einen neuen Feiertag. Zumindest, wenn es ein muslimischer sein sollte. Dann lieber einen Tag mehr arbeiten, als Muslim_innen ein Mal etwas zu gönnen. Stattdessen hat der niedersächsische Landtag jetzt den 31. Oktober, den Reformationstag, zum zusätzlichen Feiertag erklärt. Nach Schleswig-Holstein und Hamburg machen damit jetzt drei westdeutsche Bundesländer am Luthertag frei.
Wenn es nach mir ginge, müssten Feiertage gar keinen religiösen Anlass haben – denn wenn es einen muslimischen Feiertag in Deutschland gäbe, bräuchte es schließlich auch einen jüdischen, vielleicht einen buddhistischen, einen für das chinesische, das kurdische, afghanische und iranische Neujahr sowie Beyoncés Geburtstag und zwei Tage für Atheist_innen.
Dabei gäbe es genug andere Anlässe für Feiertage. Der 8. März beispielsweise. Da die meisten cis Männer an dem Tag keine Lohnarbeit tätigen müssten, könnten sie jegliche Sorgearbeit übernehmen und alle anderen könnten sich den schönen Dingen des Lebens widmen. Oder der 20. Januar, traditionell bekannt als »Punch A Nazi Day«. Ob betrunken mit Bollerwagen oder nüchtern auf dem City-Roller, alle Leute gehen auf die Straße, um Nazis zu klatschen (oder in manchen Fällen: um sich als Nazi klatschen zu lassen).
Für diejenigen, denen das zu krass sein sollte, gäbe es noch den 5. Juni: Zu Ehren des Menschen, der Gaulands Kleidung beim Baden gezockt hat, werden alle Bademöglichkeiten in Europa nach den Klamotten rechter Politiker_innen im Allgemeinen und AfD-Mitgliedern im Speziellen, aber auch jenen anderer völkischer Umweltverschmutzer_innen durchkämmt und diese dann geklaut. Wer keine Badekleidung findet, darf auch anderes Eigentum nehmen. Alles besser als der Reformationstag.
Hardcore-Fans von Luther können ihn eigentlich nur feiern, indem sie, von der Arbeitswut geritten, das Neue Testament nehmen und damit antisemitische und sexistische Straftaten begehen. Wie sonst zelebriert man einen Mann, der Frauen als Unkraut bezeichnet, das zu nichts außer Hausarbeit gut ist, und der brennende Synagogen sehen will? Warum überhaupt ein Feiertag für einen Typen, der die Integrationstests für Geflüchtete nicht bestehen würde, weil er weniger Respekt für Frauen, Queers und Jüdinnen_Juden hat, als Bild & Co. es über Muslim_innen behaupten?
Juni 2018
Nicht ohne mein Hayvan
Kurz vor Weihnachten, ich muss 18 gewesen sein, habe ich mit zwei Genoss_innen auf dem Wochenmarkt trotz eisiger Kälte mit einer Thermoskanne und einem Stapel Flyer einen winzigen Stand aufgebaut. Unser Anliegen: Kleinstadtzecken gegen Mord an Tieren. GuMo, wie wäre es an Heiligabend mit einem Tofubraten statt Gans?
Knapp zehn Jahre später und ich ernähre mich immer noch überwiegend vegan oder zumindest vegetarisch, mitunter aus politischen Gründen, doch ich würde es niemals in meine Bio schreiben. Was juckt mein Ernährungsstil fremde Menschen, als dicke Person wird mir sowieso ständig zugeschrieben, was ich nicht alles fresse. Außerdem will ich auf keinen Fall mit der Vegan-Szene in Verbindung gebracht werden. Die meisten leben entweder vegan für ihre Fitness (Diät) oder für die Tiere (und neigen zu antisemitischen und rassistischen Vergleichen).
Deutsche und Tierschutz – nenn mir ein ikonischeres Duo. Almans sind netter zu ihren Hunden als zu ihren Kindern, sagt mein Onkel. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, doch Almans haben definitiv mehr Empathie für Hunde als für rassifizierte Menschen. Da wundert es auch kaum, dass die AfD sich nun vor den Landtagswahlen in Sachsen als »Die Tierschutzpartei in Deutschland« inszeniert, nur um sich gegen das jüdische und muslimische Ritual des Schächtens in Stellung zu bringen. Vielleicht betrachten Almans Rex & Co. als ihresgleichen, weil sie oft selber Hunde sind. Die Solidaritätswelle um den Kampfhund Chico, der eingeschläfert wurde, nachdem er seine behinderte Besitzerin und ihren Sohn tötete, habe ich auch ein Jahr später klar vor Augen. Einen aggressiven Hund einzuschläfern, trübt viele Almans krasser als etwa rassistische Gewalt.
So empfindet in der aktuellen Bertelsmann-Studie »Religionsmonitor«3 die Hälfte aller Befragten den Islam als Bedrohung. Vor irgendwelchen Muslim_innen fürchtet man sich hier mehr als davor, von brutalen Kampfhunden zerfressen zu werden. Der Hund ist schließlich der beste Freund des Menschen. Vor allem von rassistischen, die ihre blutrünstigen Tiere auf Kanax hetzen. Sogar Almans scherzen über diese Tierliebe. Mit 15 übersprang ich auf meiner Die Ärzte‑CD den Track »Claudia hat ’nen Schäferhund« jedes Mal, weil ich die Idee einer sexuellen Beziehung zwischen Mensch und Hund ekelhaft fand. Eklig auch, wie eine Schulfreundin einen Witz mit der Pointe erzählte, dass Deutsche eher für Ratten als für Türken bremsen.
Tierschutz ist besonders unter Rechten ein Thema, solange sie sich dadurch als zivilisiert und überlegen profilieren können. Das Schächten verurteilen und sich gleichzeitig für Schweinefleisch als Menschenrecht einsetzen? Für rechtsextreme Parteien wie NPD und AfD kein Widerspruch. So beschreibt Max Czollek die antisemitische und antimuslimische Doppelmoral in seinem brillanten Buch Desintegriert euch! sehr präzise: »Wir essen friedlich Schweinefleisch, die anderen schächten Tiere.«
Juli 2019
Deutsche Bahn Unhinged
Bis ich Anfang 20 war, saß ich nur ein einziges Mal im ICE und dies war ein Versehen, da ich nicht wusste, dass ich mit meinem Schülerferienticket nicht mitfahren darf. Erst seitdem ich geschäftlich reise, bin auch ich Teil dieser Gesellschaft, die in der ICE-Werbung abgebildet wird. Ich habe dieses Jahr mehr Stunden im Zug als im Büro verbracht. Jede Zugfahrt erinnert mich nicht nur an den madigen Kommentar von Boris Palmer, der gegen die Deutsche Bahn Stimmung machte, da auf deren Startseite vor allem rassifizierte Menschen zu sehen waren, sondern auch daran, wie Rassismus maßgeblich Regeln formt. Meistens versuche ich, einen Platz im Ruheabteil zu erwischen, um auf dem Weg zur Arbeit noch andere Arbeit zu schaffen oder es mir zumindest vorzunehmen, während ich Serien, Musik oder Bücher ballere.
Neulich so: Ich sitze gegenüber einer Freundin am Vierertisch im Ruheabteil, beide von uns vertieft ins Schreiben, um uns herum ausschließlich Almans. Links von mir löst ein älteres Paar Kreuzworträtsel. Am Vierertisch nebenan sitzen drei aufgedrehte Sekt-Renates und ein Ich-quatsch-gern-mit-Fremden-Thomas, die lautstark schnacken, lachen und socializen. Genervt überlege ich, passiv-aggressiv auf das Ruheschild hinzuweisen, schäme mich aber direkt für meinen Gedanken und gebe auf. Also unterhalten meine Freundin und ich uns leise. Bis eine Funktionskleidungssabine vor uns steht und erklärt, dass wir uns in einem Ruheabteil befinden. Vielleicht seien uns ja die Schilder aufgefallen. Auf ihnen stehe »Psst!«. »Warum haben Sie das nicht vor anderthalb Stunden dem Tisch nebenan gesagt?«, frage ich Sabine. »Ich sage es jetzt in die Runde«, behauptet sie und schaut weiterhin nur mich und meine Freundin an.
Diesmal bin ich allein unterwegs. Sobald ich sitze, dauert es nur wenige Minuten, bis sich eine besoffene alman Männergruppe mit zischenden Bierflaschen und Schlagermusik aus Lautsprecherboxen grölend bemerkbar macht. »O nee«, seufze ich in mich hinein. Als ich umsteige, passiert das Gleiche noch mal. Diese neue Typengruppe hat sogar Eiswürfel und eigene Gläser dabei. Als ich die Schaffnerin bitte, irgendwas zu sagen, entgegnet diese nur, dass sie nichts dagegen tun kann, schließlich seien »die« betrunken.
Man zahlt ein halbes Vermögen für ein Bahnticket, nur um am Ende in einer verspäteten überfüllten Bahn zu landen, die sich, als würden die ersten drei Punkte nicht schon ausreichen, als halber Ballermann herausstellt. Ich bin kein_e Mathematiker_in, doch ich kenne die Elendsformel (Almans + Alkohol). Sie macht jede ICE