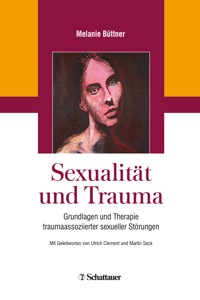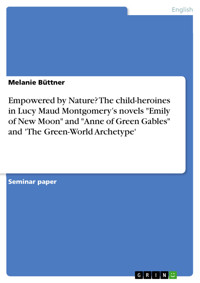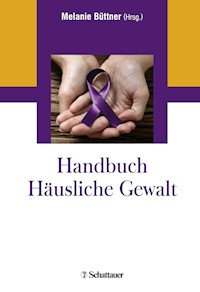
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Grundlagenwerk für Aufklärung, Intervention, Beratung und Therapie - Praxisorientiert: Interventionen zum Gewaltschutz, Strategien für die Beratung und Therapie, Fallbeispiele - State of the Art: Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis geben Einblicke in Grundlagen und Handlungsansätze - Hochaktuell: Gewalt im häuslichen Umfeld ist bis heute weit verbreitet - Konkurrenzlos: Das erste Standardwerk für alle relevanten Berufsgruppen Das multiperspektivische Handbuch führt in die Erscheinungsformen und Hintergründe häuslicher Gewalt ein und gibt einen Überblick über frühe Hilfen, Vorgehen beim Gewaltschutz, medizinische Versorgung, Beratung und Therapie. Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft erklären Grundlagen, zeigen Versorgungsbedarfe auf und stellen anhand konkreter Fallbeispiele Handlungsansätze vor. Zusammen mit Beiträgen zu Förderprogrammen und Forschungsprojekten auf Bundes- und EU-Ebene bildet das Buch ein umfassendes Nachschlage- und Standardwerk für alle Berufsgruppen, die mit häuslicher Gewalt in Berührung kommen. Hilfe für • Frauen und Männer, die Gewalt in Partnerschaften erleben oder früher erlebt haben • Männer und Frauen, die Gewalt in Partnerschaften ausüben und damit aufhören wollen • Kinder, die Partnerschaftsgewalt miterleben oder selbst Misshandlungen erfahren haben • Personen, die spezielle Unterstützung benötigen, wie - Frauen während der Schwangerschaft, Geburt und danach - Menschen mit Migrationsgeschichte - Menschen in gleichgeschlechtlichen und trans* Beziehungen - hochkonflikthafte Paare und ihre Kinder im Trennungsprozess - Mütter nach der Trennung - Betroffene von organisierter ritueller Gewalt im familiären Kontext Aus dem Inhalt: Erscheinungsformen, Hintergründe und Folgen von Gewalt | Frontline-Arbeit: Gewaltschutz, frühe Hilfen und Prävention | Versorgungsbedarf und Intervention im Gesundheitswesen | Beratung und Therapie für Betroffene | Beratung und Therapie für Täterpersonen | Beratung und Therapie mit heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Paaren | Beratung und Therapie für trans*Personen | Beratung und Therapie für betroffene Kinder
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 957
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Handbuch Häusliche Gewalt
Herausgegeben von Melanie Büttner
Mit Beiträgen von
Marilena de Andrade
Werner Bartens
Thomas Beck
Margrit Brückner
Melanie Büttner
Michael Diemer
Jörg Fichtner
Georg Fiedeler
Simon Finkeldei
Susanne Funk
Erwin Gäb
Silke Birgitta Gahleitner
Rebecca Gulowski
Peter Heinz
Maria Heller
Michaela Huber
Solveig Hussain
Birgit Jocher
Tita Kern
Andrea Kleim
Almut Koesling
Alexander Korittko
Stephanie Kramer
Leonhard Kratzer
Martina Kruse
Astrid Lampe
Friederike Masz
Elisabeth Mützel
Susanne Nick
Constance Ohms
Karin Paschinger
Bettina Pfleiderer
Christina Rothdeutsch-Granzer
Dorothea Sautter
Julia Schellong
Andreas Schmiedel
Monika Schröttle
Claudia Schumann
Birgit Schünemann-Homburg
Silke Schwarz
Saide Sesin
Stefanie Soine
Lisa Sondern
Sabine Stövesand
Michael Sztenc
Andrea Vent
Marion Winterholler
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besonderer Hinweis
Die Medizin unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben, insbesondere zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren, immer nur dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung des Buches entsprechen können. Hinsichtlich der angegebenen Empfehlungen zur Therapie und der Auswahl sowie Dosierung von Medikamenten wurde die größtmögliche Sorgfalt beachtet. Gleichwohl werden die Benutzer aufgefordert, die Beipackzettel und Fachinformationen der Hersteller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spezialisten zu konsultieren. Fragliche Unstimmigkeiten sollten bitte im allgemeinen Interesse dem Verlag mitgeteilt werden. Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische oder therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung.
In diesem Buch sind eingetragene Warenzeichen (geschützte Warennamen) nicht besonders kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen eines entsprechenden Hinweises nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © adobe stock/Andrey Popov
Lektorat: Dipl.-Psych. Mihrican Özdem, Landau
Projektmanagement: Dr. Stephanie Born, Stuttgart
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-40045-8
E-Book: ISBN 978-3-608-12063-9
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20477-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
Vorwort
Anschriften
Herausgeberin
Autorinnen und Autoren
GRUNDLAGEN
1 Häusliche Gewalt und die Folgen für die Gesundheit
Melanie Büttner
1.1 Wer ist von häuslicher Gewalt betroffen?
1.2 Wie äußert sich häusliche Gewalt?
1.2.1 Körperliche Gewalt
1.2.2 Sexuelle Gewalt
1.2.3 Emotionale Gewalt
1.2.4 Stalking
1.3 Gesundheitliche Folgen von häuslicher Gewalt
1.3.1 Folgen von Partnerschaftsgewalt
1.3.2 Langzeitfolgen von ungünstigen Kindheitserfahrungen
1.4 Was tun?
2 Emotionale Gewalt – die unsichtbare Keule
Werner Bartens
2.1 Gewalt ohne Spuren
2.2 Formen emotionaler Gewalt
2.3 Was anfällig macht für emotionale Gewalt
2.4 Wie emotionale Gewalt krankmacht
2.5 Emotionale Gewalt in der Partnerschaft
2.6 Was hilft gegen emotionale Gewalt?
2.7 Fazit
3 Häufigkeit von Partnerschaftsgewalt in Deutschland
Monika Schröttle
3.1 Ausmaß von Partnergewalt in Deutschland
3.1.1 Verfügbare Studien
3.1.2 Bevölkerungsweites Ausmaß von Gewalt gegen Frauen (und Männer)
3.1.3 Besonders stark betroffene Populationen
3.1.4 Gewalt im Lebensverlauf
3.2 Partnergewalt im Hellfeld der Polizeilichen Kriminalstatistik
3.2.1 Polizeiliches Hellfeld aus Perspektive der Dunkelfeldbefragungen
3.2.2 Aktuelle kriminologische Statistiken des Bundeskriminalamts
3.3 Fazit und Ausblick
4 Gewalt gegen Frauen in heterosexuellen Partnerschaften
Silke Schwarz
4.1 Definitionen und Erscheinungsformen
4.2 Theorien
4.2.1 Ebene des Individuums
4.2.2 Ebene der Partnerschaft
4.2.3 Ebene der Umgebung und Gesellschaft
5 Partnerschaftsgewalt gegen Männer
Georg Fiedeler
5.1 Männliche Opfererfahrungen und Männlichkeitskonstruktionen
5.2 Allgemeine Gewaltbetroffenheit von Männern
5.3 Forschungsgeschichte und wissenschaftliche Diskussion um Partnerschaftsgewalt gegen Männer
5.4 Prävalenz und Erscheinungsformen
5.5 Risikofaktoren
5.6 Schlussbemerkung
6 Partnerschaftsgewalt durch Frauen
Rebecca Gulowski
6.1 Forschungsfeld und Debatten
6.1.1 Deutungsproblematiken der (Gewalt-)Prävalenzforschung
6.1.2 »Geschlechtersymmetrie der Gewalt« oder »Gewalt im Geschlechterverhältnis«?
6.1.3 Aktuelle Prävalenzen
6.2 Phänomenologie
6.2.1 Ausübung der Gewalt – im Unterschied zu männlicher Partnerschaftsgewalt
6.2.2 Umstände der Gewalt
6.2.3 Beweggründe für Gewalt
6.3 Fazit
7 Gewalt in cis-gleichgeschlechtlichen und trans* Partner*innenschaften
Constance Ohms
7.1 Geschlechtliche Vielfalt und Vulnerabilität
7.2 Aktueller Forschungsstand zu Gewaltvorkommen in gleichgeschlechtlichen und trans* Partner*innenschaften
7.3 Besonderheiten gewalttätiger Beziehungsdynamiken in gleichgeschlechtlichen und/oder trans* Partner*innenschaften
8 Kinder, die von Partnerschaftsgewalt mitbetroffen sind
Marilena de Andrade, Silke Birgitta Gahleitner
8.1 Datenlage
8.2 Kinder bekommen die Gewalt nicht mit?
8.3 Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt auf Kinder und Jugendliche
8.4 Gewalterfahrungen und Geschlecht
8.5 Schluss
9 Gewalt gegen Kinder
Alexander Korittko
9.1 Traumadynamik
9.2 Wie aus Stress Persönlichkeitsmerkmale werden
9.3 Langzeitauswirkungen
9.4 Nicht von schlechten Eltern
9.5 Transgenerationale Weitergabe
9.6 Resilienz und Genesung
9.7 Therapeutische Ziele und Strategien
10 Organisierte rituelle Gewalt und ihr familiärer Kontext
Susanne Nick
10.1 Datenlage und Definition
10.2 Gewaltvolle familiäre Bindungen
10.2.1 Organisierte Kriminalität
10.2.2 Häusliche Gewalt
10.2.3 Ideologisch geprägte Gewalt
10.2.4 Psychische Folgen
10.3 Kinder und Jugendliche
10.4 Resümee und Ausblick
INTERVENTION, THERAPIE UND PRÄVENTION
I Frontline-Arbeit
11 Ersthilfe bei schwerer häuslicher Gewalt – Ergebnisse aus dem IMPRODOVA-Projekt
Lisa Sondern und Bettina Pfleiderer
11.1 Was ist IMPRODOVA?
11.2 Der Status quo in Deutschland
11.2.1 Definitionen und Arbeitsrichtlinien
11.2.2 Zusammenarbeit der Professionen
11.2.3 Aktuelle Datenlage
11.2.4 Risikoeinschätzung
11.2.5 Dokumentation
11.2.6 Trainingsangebote
11.2.7 Wodurch zeichnet sich gute Arbeit in dem Bereich aus?
12 Polizeiliches Einschreiten bei häuslicher Gewalt in Bayern
Andrea Kleim
12.1 Polizeiliche Definition von häuslicher Gewalt
12.2 Aufgabenstellung der Beauftragten für Kriminalitätsopfer
12.3 Einschreiten bei häuslicher Gewalt
12.4 Statistische Zahlen aus Bayern
12.5 Proaktive Opferberatung in München
12.6 Zusammenarbeit der Polizei mit Jugendamt und Familiengericht
12.7 Fazit
13 Gewaltschutz im Spannungsfeld von rechtsstaatlichem Handeln und Dynamiken häuslicher Gewalt
Margrit Brückner
13.1 Das Hilfe- und Schutzsystem gegen häusliche Gewalt
13.2 Zwei Fallanalysen
13.2.1 Fallbeispiel Familie Yalloun
13.2.2 Fallbeispiel Familie Engler
13.3 Rechts- und sozialstaatliche Interventionen in verschiedenen Fallkonstellationen
13.4 Schlussbetrachtungen: eigensinnige Nutzungen des Interventionssystems
14 Arbeit im Frauenhaus – Herausforderungen und Möglichkeiten
Birgit Jocher
14.1 Schutzraum Frauenhaus
14.1.1 Datenlage
14.1.2 Gefährdungseinschätzung und Sicherheitsmanagement
14.2 Lebenswelt Frauenhaus
14.2.1 Haussetting und Strukturen
14.2.2 Interventionen
14.2.3 Fallbeispiel
14.3 Kinder im Frauenhaus
14.4 Zwei Schritte vor, einer zurück: individuelle Wege aus der Partnerschaftsgewalt
14.4.1 Ambivalenz
14.4.2 Lösung aus der Gewaltbeziehung
15 »Stadtteile ohne Partnergewalt« (StoP) – ein nachbarschaftsbezogenes Handlungskonzept
Sabine Stövesand
15.1 Ziele des Projekts
15.2 Warum ein Gemeinwesenansatz?
15.3 Wie funktioniert StoP?
15.4 Fallstricke und Erfolge – Potenziale und Perspektiven
II
Intervention und Versorgung im Gesundheitswesen
16 Versorgung von Gewaltbetroffenen im Gesundheitswesen
Julia Schellong
16.1 Schlüsselstelle Gesundheitswesen – wie informiert sind Fachkräfte?
16.2 Handlungsfelder und Handlungsschritte
16.2.1 Handlungsfelder
16.2.2 Schritt 1: Gewaltinformiertheit signalisieren
16.2.3 Schritt 2: Ansprechen
16.2.4 Schritt 3: Körperliche Untersuchung
16.2.5 Schritt 4: Gerichtsverwertbare Dokumentation
16.2.6 Schritt 5: Schutzbedürfnis abklären
16.2.7 Schritt 6: Weitervermitteln
16.3 Integration medizinischer Fachkräfte in das Hilfesystem
17 S.I.G.N.A.L. – Intervention bei häuslicher Gewalt in Kliniken und Arztpraxen
Dorothea Sautter und Marion Winterholler
17.1 S.I.G.N.A.L.-Interventionsschritte
17.2 Intervention in Kliniken
17.2.1 S.I.G.N.A.L.-Modellprojekt
17.2.2 Weitere Entwicklung
17.3 Intervention in Arztpraxen
17.3.1 Bundesmodellprojekt MIGG
17.3.2 Weitere Entwicklung
17.4 Qualifizierung als Grundvoraussetzung
17.4.1 Aus-, Fort- und Weiterbildung
17.4.2 Nächste Schritte
17.5 Ausblick
18 Häusliche Gewalt bei Krankenhaus-Patientinnen und -Patienten – Entwicklung von Handlungsansätzen
Astrid Lampe und Thomas Beck
18.1 Ansprechen der Gewalt
18.1.1 Betroffene möchten auf Gewalt angesprochen werden
18.1.2 Ansprechen der Gewalt durch die Betroffenen
18.1.3 Ansprechen der Gewalt durch die Behandelnden
18.2 Opferschutzgruppen
19 Die frauenärztliche Praxis – Schlüsselrolle bei der Intervention gegen Gewalt an Frauen
Claudia Schumann
19.1 Frauenärztliche Praxis als erste Kontaktstelle
19.2 Gewalt ansprechen?!
19.3 Traumasensible Gesprächsführung und Untersuchung
19.4 Gewalt erkannt, Gewalt benannt – und dann?
19.5 Dokumentation der Verletzungen
19.6 Begleiten und Weitervermitteln
19.7 Ärztliche Rolle annehmen: eine Win-win-Situation
20 Geburtshilfliche Betreuung von gewaltbetroffenen Frauen
Martina Kruse
20.1 Auswirkungen von Gewalt und Trauma
20.1.1 Schwangerschaft
20.1.2 Geburt
20.1.3 Nach der Geburt
20.2 Handlungsoptionen
20.3 Grenzen der Arbeit und Selbstfürsorge
21 Häusliche Gewalt aus rechtsmedizinischer Sicht
Elisabeth Mützel
21.1 Ambulanzen des Münchener Instituts für Rechtsmedizin
21.2 Vorgehen bei der körperlichen Untersuchung
21.3 Dokumentation
21.4 Spurensicherung und Formen der Gewalteinwirkung
21.5 Arztrechtliche Aspekte und Ausblick
22 Psychische Gesundheit gewaltbetroffener Frauen: Ansätze zur besseren Versorgung
Silke Schwarz
22.1 Arbeitsgruppe »Psychische Gesundheit gewaltbetroffener Frauen und deren Kinder«
22.2 Defizite in der Gesundheitsversorgung
22.2.1 Psychotherapeutische Versorgung
22.2.2 Psychiatrische Versorgung
22.2.3 Suchtspezifische Versorgung und Gewaltschutzbereich
22.3 Ansatzpunkte für eine verbesserte Versorgung
22.3.1 Handlungsempfehlungen für die psychotherapeutische Versorgung
22.3.2 Handlungsempfehlungen für die psychiatrische Versorgung
22.3.3 Handlungsempfehlungen für die suchtspezifische Versorgung und für andere Bereiche
III
Psychosoziale Beratung
23 Beratung von Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erleben
Stefanie Soine
23.1 Parteilichkeit und psychosoziale Beratung
23.2 Einblicke in die Alltagspraxis der Beratungsarbeit
23.2.1 Torturen durch den Behördendschungel
23.2.2 Begleitende Beratung
23.2.3 Beratung für unterstützende Personen
23.2.4 Paradoxien und Herausforderungen
24 Beratung von Männern, die Gewalt in der Partnerschaft erleben
Georg Fiedeler
24.1 Unterversorgung männlicher Opfer
24.2 Proaktiver Beratungsansatz
24.3 Konzeptionelle und inhaltliche Aspekte der Beratung
24.4 Strukturierte Erstberatungen
24.5 Erfahrungen aus der Beratungspraxis
24.6 Fazit und Ausblick
25 Beratung von Männern, die Partnerschaftsgewalt ausüben
Andreas Schmiedel
25.1 Gewaltformen
25.1.1 Gewalt ist nicht gleich Gewalt
25.1.2 Gewalt ist eine Entscheidung und damit verzichtbar
25.1.3 Legalität und Legitimierung von Gewalt
25.2 Praxis der Täterarbeit
25.2.1 Grundlegendes
25.2.2 Wesentliche Elemente der Täterarbeit
26 Beratung von Frauen, die Partnerschaftsgewalt ausüben
Rebecca Gulowski und Birgit Schünemann-Homburg
26.1 Täterinnenarbeit in Deutschland
26.2 Weibliche Gewalt und Klientinnentypologie
26.3 Beratungsstelle violenTia
26.3.1 Der Beginn und die Idee von violenTia
26.3.2 Grundhaltung und Ziele
26.3.3 Beratungspraxis
27 Täterarbeit in Kooperationsbündnissen
Almut Koesling
27.1 Proaktive Täterarbeit
27.2 Ziel der Täterarbeit: Übernahme der Verantwortung
27.3 Umgang mit Täterstrategien: Transparenz und klare Absprachen
27.4 Transparenz und Verstehen
27.5 Herstellen des gemeinsamen Nenners – Beziehungsarbeit für Beziehungsarbeit
27.6 Vielfalt hat mehr Wert
28 Beratung und Therapie bei Gewalt in Beziehungen von cis-gleichgeschlechtlichen oder trans* Personen
Constance Ohms
28.1 Beraterische und therapeutische Grundlagen
28.1.1 Communitybasierte Beratung und Therapie
28.1.2 Queer Politics in der Beratung/Therapie
28.2 Beratung und Therapie bei interpersonaler Gewalt
28.3 Tabuisierung von interpersonaler Gewalt in den queeren Communitys
28.4 Anforderungen an die Beratungsstellen
29 Interkulturelle Beratung für Betroffene von häuslicher Gewalt und Zwangsheirat
Solveig Hussain, Andrea Vent und Saide Sesin
29.1 Warum interkulturelle Beratung?
29.2 Kulturalismus versus interkulturelle Beratungsarbeit
29.3 Kontaktaufnahme, Erstgespräch und Unterstützung
29.4 Methoden und Beratungsansätze
29.5 Zwangsverheiratung
29.6 Fazit
IV
Traumaorientierte Therapie und Beratung
30 Traumafokussierte Therapie bei Partnerschaftsgewalt
Leonhard Kratzer und Peter Heinz
30.1 Partnerschaftsgewalt aus Sicht der Psychotraumatologie
30.2 Traumafokussierte Psychotherapie der PTBS nach/während häuslicher Gewalt
30.3 Herausforderungen in der Psychotherapie mit Gewaltbetroffenen
30.3.1 Anhaltende Gewalt oder Täterkontakt
30.3.2 Reviktimisierung und intergenerationale Weitergabe von Traumata
31 Traumasensible Körpertherapie mit gewaltbetroffenen Frauen
Karin Paschinger
31.1 Bodymap zum Körpererleben
31.2 Physiotherapeutische Untersuchung
31.2.1 Schmerzen und Funktionseinschränkungen
31.2.2 Bruxismus
31.2.3 Atemdysfunktion
31.2.4 Beckenbodendysfunktion
31.3 Körpertherapie
31.4 Fallbeispiel
31.4.1 Anamnese und Bodymap
31.4.2 Gruppentherapie
31.4.3 Einzeltherapie
31.5 Fazit
32 Traumaorientierte Therapie für Personen, die Partnerschaftsgewalt ausüben
Michaela Huber
32.1 »Herumgeschubst«
32.2 Worauf es bei der Täterarbeit ankommt
32.2.1 Motivation?
32.2.2 Aufrichtigkeit?
32.2.3 Abhängigkeiten
33 Dem Schmerz begegnen und in die Liebe hineinwachsen – traumaorientierte Paartherapie
Friederike Masz
33.1 Wie kommt es zu Schwierigkeiten bei traumatisierten Paaren?
33.2 Streiten ist sinnlos
33.3 Emotionsskripte und Bindungsschemata
33.4 Die Eskalation
33.5 Wie kommt es zu Gewalt? Eine Hypothese
33.6 Dem Schmerz begegnen …
33.7 … und in die Liebe hineinwachsen
34 Embodimentorientierte Deeskalationsstrategien in der Paarberatung
Michael Sztenc
34.1 Vier Elemente der Deeskalation
34.1.1 Benennung individueller Bilder
34.1.2 Wahrnehmung körperlicher Anzeichen
34.1.3 Verabredung zur Deeskalation
34.1.4 Alternative Strategien
34.2 Übung zum Umgang mit Emotionen
34.2.1 Allgemeines zur Übung
34.2.2 Teil 1: Selbstbeobachtung
34.2.3 Teil 2: Prozessbeobachtung
35 Traum
a
mann – eine wort-, körper- und kunstorientierte Beratung für Männer mit gewaltbedingten Traumafolgen
Michael Diemer, Erwin Gäb, Maria Heller und Stephanie Kramer
35.1 Zum Projekt
35.2 Die chronischen Traumafolgen
35.3 Wie helfen wir den betroffenen Männern?
35.3.1 Individuelles Vorgehen
35.3.2 Vorgehen nach dem Bottom-up-Ansatz
35.4 Das Team – eine Einheit der Sicherheit
V
Unterstützung für Kinder
36 Arbeit mit hochkonflikthaften Paaren und vom Streit betroffenen Kindern im Trennungsprozess
Jörg Fichtner
36.1 Beschreibung und Erfassung von Hochkonflikthaftigkeit
36.2 Beratungsrelevanter Forschungsstand zu Hochkonflikthaftigkeit
36.3 Allgemeine Interventionsansätze
36.4 Anregungen zur therapeutischen Arbeit
36.4.1 Therapeutische Arbeit mit Eltern
36.4.2 Therapeutische Arbeit mit Kindern
36.5 Ausblick
37 Mütter nach der Trennung: Dilemma zwischen Eigenschutz, Schutz der Kinder und dem Wunsch einer gelingenden Vater-Kind-Beziehung
Susanne Funk
37.1 Fallbeispiel
37.2 Die Situation von Müttern bei häuslicher Gewalt
37.3 Die Situation von Kindern bei häuslicher Gewalt
37.4 Die Situation von Vätern bei häuslicher Gewalt
37.5 Das Dilemma der Mütter
37.6 Die Verantwortung der Väter
37.7 Elternberatung am Beispiel des Münchener Modells
38 Traumapädagogik, Traumaberatung und Traumatherapie für Kinder
Silke Birgitta Gahleitner, Marilena de Andrade und Christina Rothdeutsch-Granzer
38.1 Hilfesystem für Traumatisierte
38.2 Traumatische Belastungen im Entwicklungsverlauf
38.3 Interprofessionell und mehrdimensional verstehen
38.4 Interprofessionelle Unterstützungsmöglichkeiten anbieten
38.5 Schluss und Ausblick
39 Akutversorgung von Kindern und Jugendlichen nach Suizid und Tötung von Bezugspersonen
Tita Kern und Simon Finkeldei
39.1 Aufsuchende Psychosozial-Systemische Notfallversorgung (APSN)
39.2 Bindungsbasierte und systemische Zugänge
39.3 Vorgehen bei Suizid und Suizidversuch
39.3.1 Erschütterung von Verbindung und Orientierung
39.3.2 Kindgerechte Worte
39.4 Vorgehen bei Tötung und Tötungsversuch
40 Caring Dads – ein Interventionsprogramm für gewalttätige Väter
Almut Koesling
40.1 Ein aufrüttelnder Fachtag
40.2 Die Väter fallen aus dem System
40.3 Väter – eine unbeliebte Zielgruppe
40.4 Widerstände überwinden
40.5 Caring Dads – das Vorgehen
40.6 Zwei Fallbeispiele
40.6.1 Herr Mälzer
40.6.2 Herr Bertram
40.7 Fazit
Sachverzeichnis
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
es gab Zeiten, da war es legitim, die Menschen zu schlagen, die einem am nächsten stehen. Es war vielleicht nicht schön, galt aber als »normal« und gehörte in vielen Familien dazu. Vor allem dem Vater als »Oberhaupt der Familie« wurde dieses Recht zugestanden. Er sollte es zwar »nicht übertreiben«, aber eine »gewisse Züchtigung« wurde vielerorts als sinnvoll und notwendig angesehen. Dass sich dieses Verständnis in unserer Gesellschaft verändert hat und zuvor still geduldete Gewalt inzwischen als Unrecht angesehen und zumindest teilweise auch rechtlich geahndet wird, ist vor allem der Frauen- und Kinderschutzbewegung zu verdanken.
Heute gilt häusliche Gewalt als eine schwere Menschenrechtsverletzung (Europarat 2011). Wir haben verstanden, dass Gewalt nicht einfach nur wehtut, sondern traumatisiert und Körper und Seele schwer schädigt. Selbst wenn die Gewalt eines Tages vorüber sein sollte, leiden Betroffene oft noch Jahre oder sogar ein Leben lang an den Folgen. Viel zu oft kommt jemand durch die Hand seines Partners oder seiner Partnerin zu Tode. Und auch wer Gewalt »nur« miterlebt, ist mit den Auswirkungen konfrontiert – selbst wenn er nicht direktes Ziel von Übergriffen ist. Kinder etwa, die dabei sind, wenn ein Elternteil von dem anderen misshandelt wird. Gewalt wird von einer Generation an die nächste weitergegeben und im Falle von Gewalt gegen Frauen durch strukturelle soziale Mechanismen aufrechterhalten, die Frauen gegenüber Männern eine untergeordnete Position zuweisen. Neben all dem verursacht häusliche Gewalt enorme Kosten für unsere Gesellschaft und das Gesundheitswesen (Homberg et al. 2008).
Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich schon einiges getan. Steter Tropfen höhlt den Stein. Es gibt Schutz- und Hilfeangebote. Der Rechtsstaat besitzt Mittel, Betroffene zu schützen und gewalttätige Personen falls nötig der Wohnung zu verweisen (»Wer schlägt, geht«). Besser als früher wird über Gewalt aufgeklärt. Dennoch stehen wir bis heute vor zahlreichen Entwicklungsaufgaben. Längst nicht für alle Betroffene gibt es geeignete Hilfsangebote. Zuverlässigen Schutz zu gewährleisten und Rechtsansprüche durchzusetzen, ist oft nicht leicht. Hilfseinrichtungen kommen an ihre Grenzen. Und viele Berufsgruppen, die an Schlüsselpositionen stehen, sind noch nicht genügend für das Thema Gewalt sensibilisiert.
In besonderer Weise betrifft dies die medizinischen und therapeutischen Berufe: Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte etwa. Oder Fachpersonen in Psychotherapie, Familien- und Paartherapie, Kinder- und Jugendlichentherapie, Physiotherapie und Körpertherapie. Mit ihnen kommen gewaltbetroffene Personen oft zuerst in Kontakt. Wird die Gewalt jedoch nicht erkannt, kann Betroffenen nicht die Unterstützung zuteilwerden, die sie brauchen: Hilfe, um Gewalt zu beenden und sich und die Kinder zu schützen. Eine Behandlung, die Entlastung schafft, körperliche und psychische Gewaltfolgen lindert und Betroffenen hilft, ein lebenswertes und gewaltfreies Leben zu leben. Es ist heute möglich, konkret und wirkungsvoll zu helfen. Doch wie kann man Menschen in medizinischen und therapeutischen Berufen erreichen und für das Thema Gewalt sensibilisieren? Wie kann man sie dafür gewinnen, sich das Know-how anzueignen, das ihnen erlaubt, auf die Behandlungsbedürfnisse ihrer gewaltbetroffenen Patientinnen und Patienten einzugehen?
2011 verabschiedete der Europarat das »Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt«. Darin verpflichten sich die Mitgliedsstaaten des Europarats unter anderem dazu, »einen umfassenden Rahmen sowie umfassende politische und sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen«. Dies sei unerlässlich, »um nicht nur ihre künftige Sicherheit zu gewährleisten und ihre körperliche und seelische Gesundheit wiederherzustellen, sondern auch, um es ihnen zu ermöglichen, ihr Leben neu aufzubauen«. 2013 veröffentlichte die WHO Leitlinien zum »Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit sexueller Gewalt gegen Frauen« für die Gesundheitsversorgung und -politik. »Aus den Leitlinien der WHO ergibt sich für Deutschland der Bedarf, bundesweite fachliche Standards für die gesundheitliche Versorgung bei häuslicher und sexueller Gewalt zu entwickeln, einen (gesetzlichen) Versorgungsauftrag für die Gesundheitsversorgung zu formulieren und eine systematische curriculare Verankerung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Gesundheitsberufe voranzubringen«, formulierten Wieners und Winterholler 2016 im Bundesgesundheitsblatt (S. 1). Wie nah sind wir diesen Zielen bisher gekommen? Es scheint, es fehlt noch vieles.
Doch auch wenn sich die Strukturen nur langsam verändern, kann jede und jeder Einzelne, der oder die in einem helfenden Beruf tätig ist, viel tun, um zukünftige Gewalt zu verhindern und Betroffene mit ihren Belastungen und Gesundheitsproblemen nicht allein zu lassen. Wie das geht, beschreiben die Autorinnen und Autoren dieses Buchs. Hinschauen und mit den richtigen Mitteln aktiv werden, das ist es, was es braucht, um diese Aufgabe gemeinsam zu bewerkstelligen. Sie ist machbar, für jede und jeden von uns.
Zur Begriffswahl in diesem Buch
Bis heute existiert keine einheitliche und für alle verbindliche Definition von »häuslicher Gewalt«. Das wurde auch im Erstellungsprozess dieses Buchs deutlich, wo wir vor der Aufgabe standen zu verstehen, was genau die Autorin oder der Autor meint, wenn er oder sie von »häuslicher Gewalt« schreibt. Es gab Beitragende, die argumentierten, der Begriff »häusliche Gewalt« werde im deutschen Gewaltschutzgesetz analog Partnerschaftsgewalt definiert. Andere erklärten, »häusliche Gewalt« sei ein Fachbegriff, der sich vor allem auf Gewalt zwischen Partnern und deren Auswirkungen auf Kinder beziehe und deshalb synonym zu verwenden sei. Gewalt von Eltern gegen ihre Kinder sei nicht als Teil »häuslicher Gewalt« zu verstehen, vertraten andere. Es handele sich dabei vielmehr um »Kindesmissbrauch«. Wieder andere wiesen auf Definitionen von »häuslicher Gewalt« hin, die in bestimmten Bundesländern festgelegt und deshalb für ihre spezielle Tätigkeit verbindlich seien. Auch verwandte Begriffe spielten eine Rolle und wurden zum Teil synonym verwendet: innerfamiliäre Gewalt, Gewalt in der Familie, Gewalt in engen sozialen Beziehungen oder im sozialen Nahraum etwa. Andere Autorinnen und Autoren verwendeten Begriffe wie Partnergewalt, Partnerschaftsgewalt oder Gewalt in Paarbeziehungen, wo entsprechendes gemeint war, auch weil die Studien, auf die sie sich bezogen, präzise diese Gewaltform untersucht hatten.
In einer solchen Uneinheitlichkeit durchzublicken, ist nicht leicht. Um unseren Leserinnen und Lesern eine klare Orientierung zu ermöglichen, richten wir uns deshalb an der Definition des Europarats aus (▶ Kap. 1, Einstiegszitat). Für das Anliegen, das dieses Handbuch verfolgt, erscheint diese Begriffsfassung als die am besten geeignete. Wir sprechen also dort von »häuslicher Gewalt«, wo alle Personen gemeint sind, die einer Familie oder einem Haushalt angehören. Betrifft die Gewalt Personen in einer aktuellen oder früheren Paarbeziehung, verwenden wir den Begriff »Partnerschaftsgewalt«. Auch dieser steht in der Kritik, etwa weil Gewalt nicht partnerschaftlich sei. Der Begriff »Partnergewalt« erwies sich jedoch nicht als gute Alternative, weil damit Gewalt durch weibliche und trans* Personen unberücksichtigt bleibt. Außerdem: Wäre die Verwendung des Begriffs »Partner« legitim, wenn »Partnerschaft« es nicht ist? Mit dem wohl neutralsten Begriff »Gewalt in Paarbeziehungen« wurden die Texte wiederum sehr schwer lesbar. Deshalb fiel die Entscheidung mit »Partnerschaftsgewalt« letztlich auf einen vielleicht nicht ganz perfekten Begriff, der aber vielerorts bereits etabliert ist und von fast allen Autorinnen und Autoren akzeptiert werden konnte. Die zwei Beiträge zu Gewalt in cis-gleichgeschlechtlichen und trans* Partner*innenschaften gehen mit dem Sternchen einen eigenen Weg, der im übrigen Buch jedoch nicht umgesetzt werden konnte – möglicherweise zum Bedauern der einen und zur Erleichterung der anderen. Sind Kinder betroffen, sprechen wir übrigens zumeist von »Gewalt gegen Kinder« oder »Kindesmisshandlung«.
Wie auch immer wir Gewalt durch die Menschen, die uns am nächsten sind, begrifflich fassen möchten: Ich denke, das wichtigste ist, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Gewalt weniger wird. Weil sie wehtut und krank macht. Weil sie nicht mit unserem gesellschaftlichen Verständnis von Freiheit und Gleichheit vereinbar ist. Und da sind wir uns doch sicher alle einig.
Herzlich, Ihre Melanie Büttner
München, im August 2020
Danke!
Ich möchte allen Autorinnen und Autoren dieses Buchs ganz herzlich danken, dass sie ihr wertvolles Wissen zur Verfügung stellen und sich die Mühe gemacht haben, so wunderbare Texte niederzuschreiben. Ich hoffe, dass wir zusammen wichtige Impulse geben können, wie sich Menschen, die Gewalt erleben, wirkungsvoll helfen lässt, und dass wir damit viele Kolleginnen und Kollegen ermutigen, das Thema in ihre tägliche Arbeit einzubeziehen.
Ein ganz herzliches Dankeschön möchte ich auch Mihrican Özdem aussprechen, die das Lektorat wie gewohnt versiert und in wohltuender Ruhe durchgeführt hat. Eine große Hilfe! Außerdem danke ich Stephanie Born, Nadja Urbani und Wulf Bertram vom Verlag Schattauer/Klett-Cotta. Die Zusammenarbeit war mir wieder eine Freude!
Dieses Buch wurde in einer Zeit fertiggestellt, als sich durch die Corona-Pandemie das Leben für viele von uns stark verändert hat. Für mich bedeutete das im Homeoffice mit einem Kindergartenkind. Ohne meinen Mann Alex, der seine Arbeit zurückgestellt und auf Vieles verzichtet hat, um sich liebevoll um unsere Tochter zu kümmern, hätte ich das nicht geschafft. Dies erleben zu dürfen, steht im starken Gegensatz zu vielem, worum es in diesem Buch geht. Dein Beitrag ist für andere nicht sichtbar, aber trotzdem von ganz besonderem Wert. Ohne dich hätte es dieses Buch so nicht gegeben. Danke für deinen Einsatz und die Liebe, die du deinen Kindern und mir entgegenbringst.
P. S. Zur häuslichen Gewalt in der Corona-Pandemie
Von verschiedenen Seiten wurde in den vergangenen Monaten die Sorge geäußert, dass viele Menschen während der Pandemie mehr als zuvor in ihren vier Wänden von Gewalt betroffen seien. Lockdown, Quarantäne, Homeoffice mit Kindern, Arbeitsplatzverlust, Existenzängste – viele hatten und haben noch mit besonderen Belastungen zu kämpfen. Und dort, wo Stress entsteht, kommt es eher zur Gewalt. Dass wir in diesem Buch trotzdem nicht näher auf das Thema eingehen, hat vor allem damit zu tun, dass zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung vieles noch ungeklärt ist. So wie das Wissen über das Corona-Virus und seine gesundheitlichen Auswirkungen nur nach und nach wächst, so gibt es noch keine verlässliche Datenlage zur häuslichen Gewalt in dieser Zeit. Aktuell hoffen wir, dass wir um eine zweite Welle und weitere Lockdowns herumkommen und sich die Situation in jenen Familien, die besonders belastet sind, wieder beruhigt. Es wird wichtig sein, mögliche Gewaltanstiege im Blick zu haben, um verstärkt darauf reagieren zu können. Viele Maßnahmen, die in diesem Buch beschrieben werden, können hierbei hilfreich sein.
Literatur
Europarat (2011). Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und erläuternder Bericht. Istanbul: Eigendruck.
Homberg, C et al. (2008). Gesundheitliche Folgen von Gewalt unter besonderer Berücksichtigung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. Herausgegeben vom Robert Koch Institut. Berlin: Eigendruck.
WHO (2013). Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/ (Zugriff am 4. 8. 2020).
Wieners, K, Winterholler, M (2016). Häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Bundesgesundheitsblatt; 59: 73–80.
Anschriften
Herausgeberin
Dr. med. Melanie Büttner
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Sexualtherapeutin und Sexualmedizinerin (DGfS)
Clemensstraße 32
80803 München
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.melanie-buettner.de
Autorinnen und Autoren
Marilena de Andrade, B. A.
Sozialarbeiterin, Mitarbeiterin für den Arbeitsbereich Psychosoziale Diagnostik und Intervention an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin
Erich-Boltze-Straße 15
10407 Berlin
E-Mail: [email protected]
Dr. med. Werner Bartens
Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung
c/o Süddeutsche Zeitung
Hultschiner Str. 8
81677 München
Homepage: www.werner-bartens.de
Priv.-Doz. Dr. Thomas Beck
Leiter der Opferschutzgruppe am Landeskrankenhaus Innsbruck
Universitätsklinik für Medizinische Psychologie, Bereich Psychotraumatologie und Traumatherapie
Speckbacherstraße 23
A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Prof. (i. R.) Dr. Margrit Brückner
Professorin für Soziologie, Frauen- und Geschlechterforschung und Supervision
Frankfurt University of Applied Sciences
Fachbereich 4: Soziale Arbeit und Gesundheit
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt a. M.
E-Mail: [email protected]
Michael Diemer
Physiotherapeut, Traumafachberater/Traumapädagoge (DeGPT), Therapeut für Strukturelle Körpertherapie SKT
Praxis Mingmen
Richard-Strauss-Straße 11
81677 München
E-Mail: [email protected]
Dr. Jörg Fichtner, Dipl.-Psych.
Psychologischer Psychotherapeut und Fachpsychologe für Rechtspsychologie
Pestalozzistr. 46
80469 München
E-Mail: [email protected]
Georg Fiedeler, M. A.
Sozialpsychologe, Systemischer Therapeut, Leiter des Arbeitsbereichs »Beratung männlicher Opfer Häuslicher Gewalt« im Männerbüro Hannover e. V. und der Fachberatungsstelle »Anstoß – Gegen sexualisierte Gewalt an Jungen und männlichen Jugendlichen« in Hannover.
Männerbüro Hannover e. V.
Ilse-ter-Meer-Weg 7
30449 Hannover
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Psych. Simon Finkeldei
Psychologischer Psychotherapeut (VT), Lehrtherapeut, Supervisor, stellvertretender Vorstandsvorsitzender TraumaHilfeZentrum München e. V., fachliche Leitung der KinderKrisenIntervention der AETAS Kinderstiftung
Baldurstraße 27
80637 München
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Sozialpäd. Susanne Funk
Psychotherapeutin (HPG), Traumatherapeutin, Systemische Familientherapeutin, Trainerin für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen* und Mädchen*, in privater Praxis und Mitarbeiterin der Beratungsstelle Frauenhilfe München
Matterhornstraße 68b
81825 München
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Päd. Erwin Gäb
Diplom-Sozialpädagoge, Sozialtherapeut, Supervisor/Coach DGSv, Traumapädagoge/Traumafachberater (DeGPT/BAG TP), private Praxis für Männer in Lebenskrisen, Mitarbeiter im Trauma Hilfe Zentrum München e. V., Supervisor und Fortbildner im Bereich Traumapädagogik/Traumafachberatung
Silbergasse 8
90518 Altdorf
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. phil. habil. Silke Birgitta Gahleitner
Professorin für Klinische Psychologie und Sozialarbeit, Arbeitsbereich: Psychosoziale Diagnostik und Intervention, Leiterin des Masterstudiengangs Klinische Sozialarbeit
Alice-Salomon-Hochschule – University of Applied Sciences
Alice Salomon Platz 5
12627 Berlin
E-Mail: [email protected]
Rebecca Gulowski, M. A.
Konflikt- und Gewaltforscherin, Traumafachberaterin (DeGPT), wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut München, psychosoziale Beraterin bei violenTia
FTZ-violenTia
Implerstr. 38
81371 München
E-Mail: [email protected]
Dr. med. Peter Heinz
Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, Traumatherapeut (DeGPT), Supervisor, EMDR-Supervisor (EMDRIA), Chefarzt der Klinik für Psychotraumatologie der Klinik St. Irmingard in Prien am Chiemsee
Klinik für Psychotraumatologie
Klinik St. Irmingard
Osternacher Straße 103
83209 Prien am Chiemsee
E-Mail: [email protected]
Maria Heller
Diplom-Kunsttherapeutin (FH), Traumafachberaterin, Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Markgrafenweg 33
85570 Markt Schwaben
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Psych. Michaela Huber
Psychologische Psychotherapeutin, Supervisorin und Ausbilderin in Traumabehandlung
Söseweg 26
37081 Göttingen
E-Mail: [email protected]
Solveig Hussain, B. A.
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Traumapädagogik/Traumazentrierte Fachberatung (DeGPT), Beraterin bei LÂLE
LÂLE in der IKB e. V.
Brahmsallee 35
20144 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Sozialpäd. Birgit Jocher
Systemische Therapeutin/Familientherapeutin (DGSF), Beraterin im Frauenhaus der Frauenhilfe München
Postfach 400646
80706 München
E-Mail: [email protected]
Tita Kern, M. Sc.
Psychotraumatologin, Systemische Familientherapeutin (DGSF), Traumatherapeutin, fachliche Leitung der KinderKrisenIntervention der AETAS Kinderstiftung
AETAS Kinderstiftung
Dantestraße 29
80637 München
E-Mail: [email protected]
Andrea Kleim
Kriminalhauptkommissarin, Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer
Polizeipräsidium München
Kommissariat 105
Prävention und Opferschutz
Ettstr. 2
80333 München
E-Mail: [email protected]
Dr. phil. Almut Koesling
Erziehungswissenschaftlerin, Systemische Therapeutin (SG), Leitung des Arbeitsbereichs »Täterarbeit Häusliche Gewalt« im Männerbüro Hannover e. V.
Männerbüro Hannover e. V.
Ilse-ter-Meer-Weg 7
30449 Hannover
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Sozialarb. Alexander Korittko
Systemischer Lehrtherapeut und Lehrsupervisor
Baumbachstr. 3
30163 Hannover
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Sozialpäd. Stephanie Kramer
Geschäftsführerin vom Trauma Hilfe Zentrum München e. V.
Trauma Hilfe Zentrum München e. V.
Horemansstraße 8 Rgb.
80636 München
E-Mail: [email protected]
Dr. rer. biol. hum. Leonhard Kratzer
Psychologischer Psychotherapeut, Traumatherapeut (DeGPT), EMDR-Therapeut (EMDRIA), Leitender Psychologe der Klinik für Psychotraumatologie der Klinik St. Irmingard in Prien am Chiemsee
Klinik für Psychotraumatologie
Klinik St. Irmingard
Osternacher Straße 103
83209 Prien am Chiemsee
E-Mail: [email protected]
Martina Kruse, M. A.
Traumazentrierte Fachberaterin (DeGPT), Traumatherapeutin (PITT), Systemische Beraterin (SG), Familienhebamme
Kyllburgerstr. 7
50937 Köln
E-Mail: [email protected]
Ao. Univ.-Prof. Dr. Astrid Lampe
Stellvertretende Klinikdirektorin
Universitätsklinik für Medizinische Psychologie
Psychotraumatologie und Traumatherapie
Medizinische Universität Innsbruck
Speckbacherstr. 23
A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Friederike Masz
Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Traumatherapie
Traumatherapie Berlin
Mainzer Str. 27
10715 Berlin
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Elisabeth Mützel
Oberärztin, Leiterin der Kinderschutzambulanz
Institut für Rechtsmedizin
Nußbaumstr. 26
80336 München
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Psych. Susanne Nick
Therapeutische Leiterin der Spezialambulanz für Traumafolgestörungen
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
20246 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Dr. Constance Ohms
Systemische Therapeutin/Familientherapeutin (DGSF), Sozialwissenschaftlerin und Leiterin der Fachberatungsstelle gewaltfreileben
Beratungsstelle für Frauen*, Lesben, Trans* und queere Menschen
Kasseler Str. 1 A
60486 Frankfurt a. M.
E-Mail: [email protected]
Karin Paschinger
Physiotherapeutin
Zentrale Physiotherapie
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaningerstraße 22
81675 München
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer
Leiterin der Arbeitsgruppe Cognition & Gender
Klinik für Radiologie und Medizinische Fakultät Münster
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A16
48149 Münster
E-Mail: [email protected]
Dr. phil. Christina Rothdeutsch-Granzer
Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin, Sozialpädagogin, Traumapädagogin und traumazentrierte Fachberaterin, Gründerin des Institutes wundeRkinder
Nussbaumerstraße 37 A
8042 Graz
E-Mail: [email protected]
Dorothea Sautter, M. Sc. Psychologie
Psychologin, Hebamme, Referentin der Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e. V.
S.I.G.N.A.L. e. V. – Intervention im Gesundheitsbereich gegen häusliche und sexualisierte Gewalt
Sprengelstraße 15
13353 Berlin
E-Mail: [email protected]
Dr. Julia Schellong
Leitende Oberärztin und Oberärztin Psychotraumatologie
Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik
Haus 18
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Sozialpäd. (FH) Andreas Schmiedel
Leiter des Münchner Informationszentrums für Männer (e. V.), Genderthemen, Gewaltprävention, Sozialtraining, Teambuilding, Anti-Aggressivitäts-Trainer®
Feldmochinger Str. 6
80992 München
Ganghoferstr. 21
82223 Eichenau
E-Mail: [email protected]
Dr. Monika Schröttle
Leiterin des Forschungsbereichs »Gender, Behinderung, Menschenrechte und Gewalt«
Institut für empirische Soziologie an der FAU Erlangen-Nürnberg
Marienstraße 2
90402 Nürnberg
E-Mail: [email protected]
Dr. med. Claudia Schumann
Frauenärztin, Psychotherapeutin
Hindenburgstr. 26
37154 Northeim
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Päd. Birgit Schünemann-Homburg
Beraterin bei violenTia
Im Siechen 9
37290 Meißen
E-Mail: [email protected]
Dr. phil. Dipl.-Psych. Silke Schwarz
Psychologische Psychotherapeutin, stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e. V.
Sigmaringer Str. 1
10713 Berlin
E-Mail: [email protected]
Saide Sesin, M. A. (Mexiko)
Sozialarbeiterin, Diversity-und-Empowerment-Trainerin, Beraterin bei LÂLE
LÂLE in der IKB e. V.
Brahmsallee 35
20144 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Soz. Stefanie Soine
Lehrbeauftragte der Universität Bielefeld, Mitarbeiterin bei BORA e. V.
Friedelstr. 48
12047 Berlin
E-Mail: [email protected]
Lisa Sondern, M. Sc. Psych.
Psychotherapeutin, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Cognition & Gender
Klinik für Radiologie und Medizinische Fakultät Münster
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude A16
48149 Münster
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Sabine Stövesand
Professorin für Soziale Arbeit
University of Applied Sciences Hamburg
Department Social Work
Alexanderstr. 1
20099 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Dipl.-Psych. Michael Sztenc
Paar- und Sexualtherapeut, Klinischer Sexologe ISI, Co-Leiter des Instituts für Embodiment & Sexologie
Bühler Straße 47
66130 Saarbrücken
E-Mail: [email protected]
Dipl. Sozialpäd. Andrea Vent
Sozialarbeiterin, Systemische Beraterin (SG), Beraterin bei LÂLE
LÂLE in der IKB e. V.
Brahmsallee 35
20144 Hamburg
E-Mail: [email protected]
Marion Winterholler, M. pol. Sc.
Politikwissenschaftlerin, Diplom-Sozialpädagogin, Referentin der Koordinierungsstelle S.I.G.N.A.L. e. V.
S.I.G.N.A.L. e. V. – Intervention im Gesundheitsbereich gegen häusliche und sexualisierte Gewalt
Sprengelstraße 15
13353 Berlin
E-Mail: [email protected]
GRUNDLAGEN
1 Häusliche Gewalt und die Folgen für die Gesundheit
Melanie Büttner
»Die Definition von häuslicher Gewalt […] umfasst alle körperlichen, sexuellen, seelischen oder wirtschaftlichen Gewalttaten, die innerhalb der Familie oder des Haushalts unabhängig von den biologischen oder rechtlich anerkannten familiären Bindungen vorkommen. […] Häusliche Gewalt umfasst hauptsächlich zwei Arten von Gewalt: die Gewalt zwischen Beziehungspartnern, seien es derzeitige oder ehemalige Ehegatten und Partner bzw. Partnerinnen, und die generationenübergreifende Gewalt, zu der es im Allgemeinen zwischen Eltern und Kindern kommt. Es handelt sich hierbei um eine Definition, die gleichermaßen auf beide Geschlechter angewandt wird und Opfer und Täter beiderlei Geschlechts abdeckt.« Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention). (Europarat 2011)
1.1 Wer ist von häuslicher Gewalt betroffen?
Häusliche Gewalt(1) wird oft mit Gewalt gegen Frauen durch ihre männlichen Partner und Ex-Partner gleichgesetzt (▶ auch Vorwort). Doch auch Männer, trans* Personen und nichtheterosexuelle Menschen sind in ihren Partnerschaften in bedeutendem Ausmaß Gewalt ausgesetzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, auch diesen Betroffenen Sichtbarkeit zu verschaffen. Das Gleiche gilt für andere Personen, denen im familiären und häuslichen Umfeld Gewalt widerfährt: Kindern und Stiefkindern etwa, oder Eltern und Stiefeltern, Geschwistern und Stiefgeschwistern, Enkel und Großeltern. Häusliche Gewalt findet auch in anderen Beziehungskonstellationen als den Partnerschaften erwachsener Personen statt (▶ Abb. 1-1).
Betroffene erfahren oft nicht nur von einem anderen Menschen in der Familie oder dem Haushalt Gewalt. So kann es sein, dass eine Frau regelmäßig von ihrem Partner, ihrem Vater und ihrer Tochter geschlagen und verbal angegriffen wird. Oder ein Sohn wird nicht nur von der Mutter gehauen, sondern auch von seinem älteren Bruder sexuell missbraucht. Und eine pflegebedürftige Großmutter wird von ihrem Sohn und der Schwiegertochter körperlich vernachlässigt und schwer misshandelt. In vielen Fällen richten die Täterpersonen die Gewalt außerdem nicht nur gegen eine einzelne Person. Wer seinen Partner herumschubst, schlägt oft auch die Kinder. Wer seine Eltern verbal herabsetzt, behandelt seine Geschwister meist nicht besser. Wer seine Stiefkinder sexuell missbraucht, war nicht selten auch schon gegenüber seiner Partnerin übergriffig. Gewaltbetroffene Personen sind außerdem zuweilen auch Täter und schlagen zurück, wenn der Partner oder die Partnerin angreift, oder initiieren sogar selbst Gewalt.
Erkennen lassen sich diese Gewaltkontexte jedoch nur, wenn man sich vor Augen führt, dass es sie gibt. Erst dann können Personen, die im Opferschutz, der Beratung, der Medizin und der Psychotherapie tätig sind, allen Betroffenen und Täterpersonen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder dem Beziehungsverhältnis zueinander eine Unterstützung anbieten, die an ihre individuelle Situation angepasst ist, und ihnen helfen, die Gewalt zu beenden und die Gewaltfolgen zu lindern. Die Definition des Europarats fasst den Begriff »häusliche Gewalt(1)« deshalb breiter und bezieht auch andere Personen ein, die in der Familie oder dem häuslichen Umfeld Gewalt ausgesetzt sein können.
Kommt es in einer Partnerschaft oder zwischen anderen Familienmitgliedern zu Gewalt und leben Kinder mit im Haushalt, so bekommen diese die Gewalt sehr oft mit. Eine repräsentative Untersuchung von Kindern und Jugendlichen in den USA ergab, dass 20 % von ihnen Gewalt in ihrer Familie und 16 % Gewalt zwischen ihren Eltern beobachtet hatten. In der ältesten Gruppe der 14- bis 17-Jährigen beliefen sich die Häufigkeiten jeweils auf 35 % und 27 % (Finkelhor et al. 2009). Abbildung 1-1 stellt häusliche Gewalt dar und richtet den Fokus dabei auf die Frage, was Partnerschaftsgewalt(1) für die Kinder bedeutet.
Abb. 1-1 Häusliche Gewalt – Fokus Partnerschaftsgewalt: Was bedeutet sie für die Kinder? Infografik basierend auf der Themenmappe »Es soll aufhören« der Stiftung Kinderschutz Schweiz, 2020, www.kinderschutz.ch.
In vielen Fällen werden Kinder, die Gewalt zwischen ihren elterlichen Bezugspersonen miterleben, ebenfalls misshandelt (▶ Abb. 1-2) – manchmal nur durch ein Elternteil, manchmal durch beide (Jouriles et al. 2008). In einer weiteren Auswertung der Daten aus der repräsentativen Untersuchung von Finkelhor zeigte sich etwa, dass diejenigen Kinder und Jugendlichen, die Zeuge von Partnerschaftsgewalt geworden waren, in 57 % der Fälle auch selbst Misshandlungen erfahren hatten, in einem Drittel der Fälle (34 %) sogar aktuell im letzten Jahr. Damit waren sie fast viermal häufiger von Kindesmisshandlung betroffen als Kinder und Jugendliche, die keine Partnerschaftsgewalt miterlebt hatten (Hamby et al. 2010).
Abb. 1-2 Partnerschaftsgewalt(1)(1) als Kindeswohlgefährdung. Infografik basierend auf der Themenmappe »Es soll aufhören« der Stiftung Kinderschutz Schweiz, 2020, www.kinderschutz.ch.
Kinder, die einer solchen indirekten oder direkten Gewalt durch ihre elterlichen Bezugspersonen ausgesetzt sind, erleiden oder verüben später mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit in ihren eigenen Paarbeziehungen ebenfalls Gewalt (Capaldi et al. 2012; Herrenkohl et al. 2020, Jung et al. 2019). Doch nicht nur das: Gewalterfahrungen in der Kindheit erhöhen ebenso das Risiko für Gewalt in anderen Lebensphasen und -kontexten, z. B. in der Adoleszenz und anscheinend auch gegen ältere Menschen (Herrenkohl et al. 2020). Gewalt erstreckt sich in vielen Fällen also über die gesamte Lebensspanne und sogar über Generationen hinweg, was in der Fachliteratur als »Transgenerationalität von Gewalt(1)(1)« bezeichnet wird (▶ Abb. 1-3).
Abb. 1-3 Transgenerationaler Kreislauf der Gewalt (modifiziert nach Crooks 2011)
1.2 Wie äußert sich häusliche Gewalt?
Wenn es um häusliche Gewalt(1) geht, haben viele Menschen körperliche Übergriffe wie Schlagen, Treten oder Schubsen im Kopf, die zu Verletzungen am Körper und im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Doch auch psychische Gewalt ist weit verbreitet. Ständige Entwertungen, Herabsetzungen, Demütigungen und Einschüchterungen können schwere Folgen für die psychische Gesundheit von Betroffenen haben (Dokkedahl et al. 2019; Norman et al. 2012; Spinazzola et al. 2014) und gelten schon deshalb nicht als »leichte Form von Gewalt« (s. auch Kap. 2). Zusätzlich kann es im häuslichen Umfeld auch zu sexuellen Übergriffen kommen oder zur Kontrolle von sozialen Kontakten und Finanzen und anderen Formen der Einschränkung des freien Willens bis hin zur Zwangsheirat.
1.2.1 Körperliche Gewalt
Frauen als Betroffene
Viele Frauen erfahren im Lauf ihres (1)Lebens körperliche Gewalt, oft sogar wiederholt. Dies belegt auch eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland (Schröttle & Müller 2004; ▶ auch Tab. 1-1).
Tab. 1-1 Häufigkeit körperlicher Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Ergebnisse aus der Untersuchung von Schröttle und Müller (2004).
Seit dem 16. Lebensjahr
mindestens einmal
wiederholt
37,0 %
19,1 %
In den letzten 12 Monaten
mindestens einmal
wiederholt
6,6 %
3,2 %
Was in der Studie ebenfalls deutlich wurde: 50,2 % der betroffenen Frauen erklärten, es seien aktuelle oder frühere Partner, Partnerinnen oder Geliebte gewesen, die ihnen gegenüber körperlich gewalttätig geworden seien. 30,1 % benannten andere Personen aus Familie und Haushalt – zumeist Vater oder Mutter (57,9 %), Bruder oder Schwester (31,8 %), Stiefvater oder Stiefmutter (6,6 %), Sohn oder Tochter (3,9 %), Tante oder Onkel (3,5 %), Cousin oder Cousine (2,9 %), Großvater oder -mutter (2,2 %).
Frauen, die durch ihre aktuellen Partner (99 %) oder Partnerinnen (1 %)1 Gewalt erlebt hatten, berichteten, dass diese sie wütend weggeschubst (75,2 %), leicht (34,1 %) oder heftig geohrfeigt (11,7 %), sie schmerzhaft getreten, gestoßen oder hart angefasst hätten (21,3 %), gebissen oder gekratzt (6,5 %), ihnen den Arm umgedreht oder sie an den Haaren gezogen (11,1 %), mit etwas beworfen (12,3 %) oder gehauen, das verletzen konnte (4,0 %). Auf manche Frauen wurde mit Fäusten eingedroschen (5,1 %). Sie wurden verprügelt und zusammengeschlagen (4,1 %), gewürgt (3,5 %), mit einer Waffe bedroht (2,1 %) oder verletzt (1,2 %), verbrüht oder verbrannt (1,1 %). Einigen wurde gedroht, sie umzubringen (3,6 %) (ebd.).
Für die Wissenschaftlerinnen waren jedoch nicht nur die aktuellen, sondern auch die früheren Partnerschaften von Interesse. Dabei wurde deutlich, dass es hier nochmals häufiger zu Gewalt gekommen war, möglicherweise weil die Gewalt während der Trennung oder Scheidung eskaliert ist – so die Autorinnen. Diese Vermutung deckt sich auch mit einer weiteren Beobachtung der Studie: dass nämlich getrennte oder geschiedene Frauen mehr als doppelt so oft von Gewalt durch Partner und Partnerinnen betroffen waren als verheiratete.
War es zu körperlicher Gewalt gekommen, so war dies oft nicht nur einmal der Fall: 40,4 % der Frauen, die in ihrer aktuellen Partnerschaft Gewalt erlebt hatten, berichteten von wiederholter, 5,8 % von häufiger Gewalt. Für frühere Partnerschaften lagen die Zahlen nochmals höher: 60,2 % der betroffenen Frauen hatten mehr als einmal Gewalt erfahren, 20,8 % häufig. Diese Beobachtung lässt sich nach Überlegung der Autorinnen damit erklären, dass die Frauen sich von Partnern, die häufiger gewalttätig waren, möglicherweise eher getrennt hätten. Andererseits könne es sein, dass Gewalttätigkeiten eines aktuellen Partners eher heruntergespielt würden. Oft könne das volle Ausmaß der Gewalt erst nach der Trennung kritisch beurteilt werden.
Zusätzlich erbrachte die Studie Hinweise auf eine Fortsetzung von Gewalt über Generationen hinweg. Die Frauen hatten nämlich viel häufiger körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft(1) erlitten, wenn sie
in Kindheit und Jugend körperliche Gewalt zwischen ihren Eltern miterlebt hatten (47,0 % vs. 21,4 % bei Frauen ohne entsprechende Vorbelastungen),
in Kindheit und Jugend gelegentlich oder häufig körperlicher oder psychischer Gewalt(1) durch Erziehungspersonen ausgesetzt waren (38,1 % vs. 13,3 % bei Frauen ohne entsprechende Vorbelastungen),
vor dem 16. Lebensjahr sexuellen Missbrauch erlitten hatten (54,1 % vs. 22,7 % bei Frauen ohne entsprechende Vorbelastungen).
Wer als Frau in einer früheren intimen Beziehung bereits Gewalt ausgesetzt war, trägt außerdem ein besonders hohes Risiko, dass es in einer neuen Partnerschaft wieder dazu kommt (WHO 2010).
Auch gegenseitige körperliche Gewalt wurde in der Studie von Schröttle und Müller beobachtet, z. B. in Form von Gegenwehr. Nur ein Drittel der Frauen, die in der letzten gewaltbelasteten Beziehung mehr als einmal körperliche Gewalt erlebt hatten, gaben an, sich nie körperlich dagegen gewehrt zu haben. Zwei Drittel hatten sich mindestens einmal, 36 % gelegentlich oder häufig zur Wehr gesetzt. Bei knapp einem Fünftel zeigte sich außerdem, dass sie ihren Partner zumindest einmal zuerst körperlich angegriffen hatten, bei 4 % war das sogar gelegentlich oder häufig der Fall (Schröttle & Müller 2004).
Die bisher beschriebenen Befunde beziehen sich weitestgehend auf die Situation von Frauen in heterosexuelle(1)n Beziehungen. Eine repräsentative Untersuchung aus den USA gibt zusätzlich Aufschluss darüber, wie verbreitet körperliche Gewalt in den Partnerschaften von nichtheterosexuellen Frauen ist (Walters et al. 2013). In dieser Studie zeigte sich, dass die lebenslange Gewaltbetroffenheit bei lesbischen (40,4 %) und bisexuellen Frauen (56,9 %) nochmals deutlich höher lag als bei heterosexuellen Frauen (32,3 %).
Männer als Betroffene
Eine deutsche Pilotstudie befasste sich mit der Frage, in welchem(1) Umfang Männer in heterosexuellen Partnerschaften2 Gewalt ausgesetzt sind (Puchert et al. 2004)3. Anders als es die weit verbreitete Vorstellung vom weiblichen Opfer und männlichen Täter erwarten lässt, zeigte sich hier, dass Männer zum Teil erheblich von Gewalt durch ihre Partnerinnen betroffen sind. Mehr als jeder vierte Studienteilnehmer (51 von 190 Männern) berichtete z. B., in seiner aktuellen Partnerschaft – bzw. falls eine solche nicht vorhanden war, in der letzten Partnerschaft – zumindest einen Akt körperlicher Gewalt durch die Partnerin erlebt zu haben. Meistens handelte es sich dabei um wütendes Wegschubsen, leichte Ohrfeigen, schmerzhafte Bisse, Kratzen, Arm umdrehen, Haare ziehen, Treten, Stoßen oder hartes Anfassen. Von schwereren Gewaltformen wurde weniger häufig berichtet. Kein einziger Mann sagte etwa von sich, er sei von seiner Partnerin »verprügelt« oder »zusammengeschlagen« worden. Auch wiederholte und systematische Misshandlungen waren eher selten. Immerhin 7,9 % der Männer gaben jedoch an, zwei bis drei körperliche oder sexuelle Gewaltereignisse erlebt zu haben, 9,1 % mindestens vier. Aufgrund eines methodischen Fehlers der Studie war die Gewalt allerdings nicht mit letzter Sicherheit der Partnerin als Täterin zuzuordnen (ebd.).
Knapp die Hälfte der gewaltbetroffenen Männer erklärte, sich niemals körperlich gegen die Partnerin gewehrt zu haben. Rund zwei Drittel sagten von sich, sie hätten nie zuerst körperlich angegriffen. Andere Befragte gaben demgegenüber eine mehr oder weniger häufige Beteiligung an wechselseitiger körperlicher Gewalt an (ebd.).
Zusätzlich berichtet die Studie von körperlicher Gewalt durch Familienmitglieder, etwa durch Eltern, Kinder, Schwiegereltern, Geschwister, Schwager, Schwägerinnen oder andere. Umfassende Fallzahlen hierzu werden jedoch nicht genannt.
Die Häufigkeit körperlicher Gewalterfahrungen in den intimen Partnerschaften von schwulen Männern lag in der US-amerikanischen Repräsentativbefragung von Walters et al. (2013) etwas unter der von heterosexuellen Männern (25,2 % vs. 28,7 %). Erneut waren jedoch bisexuelle Personen besonders belastet: 37,3 % von ihnen gaben an, körperliche Gewalt durch einen Partner oder eine Partnerin erfahren zu haben.
Kinder als Betroffene
Wenn es zu Gewalt zwischen Partnern(1) oder Familienmitgliedern kommt, sind Kinder oft mitbetroffen (▶ Kap. 1.1 und Kap. 8). Viele Kinder sind außerdem zusätzlich oder stattdessen von körperlicher Gewalt betroffen, die sich gezielt gegen sie richtet. Eine repräsentative Untersuchung in Deutschland (Häuser et al. 2011) ermittelte etwa, dass 6,5 % der befragten Personen in ihrer Kindheit und Jugend geringem/mäßigem und 5,5 % mäßigem/schwerem oder schwerem/extremem körperlichem Missbrauch ausgesetzt waren. Gewalt, die Männer und Frauen in ihrer Herkunftsfamilie erleben und beobachten, kann nach Schröttle und Müller (2004) einen Einfluss nicht nur auf das spätere Gewaltverhalten, sondern auch auf das Erdulden von Gewalt in Partnerschaften haben.
1.2.2 Sexuelle Gewalt
Handlungen gegen die sexuelle(1) Selbstbestimmung können von unterschiedlicher Art und Schwere sein. Eine verbindliche Definition, was genau unter sexueller Gewalt zu verstehen ist, gibt es allerdings bis heute nicht. Zu den »leichteren Formen« sexueller Gewalt werden z. B. sexuelle Belästigungen wie verbale Anzüglichkeiten oder übergriffige Berührungen, aber auch digitale Grenzüberschreitungen wie das unaufgeforderte Zusenden von sexualisierten Text- oder Bildnachrichten gezählt. Die Nötigung zu ungewolltem Sex, Vergewaltigungen, sexueller Kindesmissbrauch(1) und das Gezwungenwerden zur Prostitution oder Mitwirkung an einem Pornofilm gelten demgegenüber als »schwerere Formen« sexueller Gewalt.
Frauen als Betroffene
Definiert man sexuelle Gewalt als erzwungene sexuelle(1) Handlungen, die mit körperlichem Zwang oder Drohungen gegen den Willen der Betroffenen durchgesetzt werden, so finden sich dazu in der repräsentativen Studie von Schröttle und Müller (2004) die folgenden Häufigkeiten bei Frauen (▶ Tab. 1-2).
Tab. 1-2 Häufigkeit sexueller Gewalt gegen Frauen in Deutschland (definiert als sexuelle Gewalt unter Anwendung von körperlichem Zwang oder Drohungen). Ergebnisse aus der Untersuchung von Schröttle und Müller (2004)
Seit dem 16. Lebensjahr
mindestens einmal
wiederholt
13,0 %
5,8 %
In den letzten 12 Monaten
mindestens einmal
wiederholt
0,9 %
0,4 %
Fast die Hälfte der betroffenen Frauen berichtete, durch aktuelle oder frühere Partner, Partnerinnen und Geliebte sexuelle Gewalt erlitten zu haben, 10 % durch jemanden aus der Familie. Im Vergleich zu körperlicher Gewalt ist sexuelle Gewalt in Partnerschaften weniger häufig: 6,4 % der Frauen, die mindestens eine Gewalthandlung durch ihren aktuellen Partner oder die Partnerin erlebt hatten, berichteten von versuchten, 6,1 % von vollendeten sexuellen Handlungen unter Zwang. Keine Betroffene war in ihrer Partnerschaft ausschließlich sexueller Gewalt ausgesetzt – stets war es zusätzlich zu körperlicher Gewalt und Drohungen gekommen. Wurde nach Gewalt in früheren Partnerschaften gefragt, lagen die Zahlen hier erneut höher: 18,2 % der betroffenen Frauen berichteten, der oder die Ex habe versucht, sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen, 24,5 % gaben an, dass es tatsächlich zu sexuellen Handlungen unter Zwang gekommen sei. Auch dies könnte ein Hinweis auf eine Gewalteskalation in Trennungssituationen sein (Schröttle & Müller 2004).
Hatte sich in der (Ex-)Partnerschaft sexuelle Gewalt ereignet, so war dies bei 77,2 % der betroffenen Frauen wiederholt der Fall, bei 14 % sogar häufiger als 40 Mal. Bei sexueller Gewalt in der Familie verhielt es sich ähnlich: 75,7 % der Betroffenen waren dem mehr als einmal ausgesetzt, 14,6 % mehr als 40 Mal (ebd.).
Auch wenn es um sexuelle Gewalt geht, sind bisexuelle Frauen besonders betroffen. 17 % gaben an, sie seien in der Vergangenheit in einer intimen Beziehung vergewaltigt worden – im Vergleich zu 6,3 % der heterosexuellen Frauen. Für lesbische Frauen konnten aufgrund zu geringer Fallzahlen keine Angaben gemacht werden (Walters et al. 2013).
Wie bereits dargelegt, erleben Frauen öfter körperliche und/oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, wenn sie in der Kindheit Misshandlungen ausgesetzt waren. Eine repräsentative Studie aus den USA liefert z. B. Hinweise dafür, dass sexuelle Missbrauchserfahrungen(1) in der Kindheit das Risiko erhöhen, später in einer Partnerschaft erneut sexuelle Gewalt zu erleben: So waren 45,6 % der Frauen, die innerhalb eines Untersuchungszeitraums von 2 Jahren sexuelle Gewalt durch einen Intimpartner erlitten hatten, in der Kindheit missbraucht worden. Unter den Frauen, die während der 2 Jahre keine sexuelle Gewalt durch Intimpartner erlitten hatten, war das nur bei 29 % der Fall (Testa et al. 2007).
Oft erleiden Menschen, die in Kindheit oder Adoleszenz sexuelle Gewalt erlebt haben, im Erwachsenenalter immer wieder entsprechende Viktimisierungen – evtl. auch durch andere Täter als den eigenen Partner. Je häufiger und schwerer die Übergriffe in Kindheit oder Adoleszenz waren, desto höher ist dabei das Risiko, später erneut sexuelle Gewalt zu erleiden (Classen et al. 2005). Körperliche und emotionale Gewalterfahrungen in der Kindheit tragen zusätzlich zum Reviktimisierungsrisiko bei (van Bruggen et al. 2006).
Einige Faktoren, die eine Rolle spielen können, wenn es zur sexuellen Reviktimisierung(1) kommt, hat Grauerholz zusammengetragen (▶ Kasten).
Ökologisches Modell zu sexueller Reviktimisierung (Grauerholz 2000)
Ontogenetische Entwicklung: persönliche Lebenserfahrungen und die Folgen
Folgen der initialen Viktimisierung: traumatische Sexualisierung, Ohnmacht und Stigmatisierung, geringer Selbstwert, erlernte Erwartung, viktimisiert zu werden, dissoziative Störung, Alkohol- und Drogenkonsum, soziale Isolation, Weglaufen von zuhause, frühe Schwangerschaft, Delinquenz
Erfahrungen in der Familie: Dysfunktion, Desorganisation und Auseinanderbrechen der Familie, Dysfunktion der elterlichen Beziehung, fehlende Unterstützung der Eltern, patriarchale Familienstruktur
Mikrosystem: Kontext, in dem die Gewalt stattfindet (Familie, intime Beziehung)
Expositionsrisiko: traumatische Sexualisierung, Stigmatisierung, geringer Selbstwert, dissoziative Störung(1), Alkoholkonsum, Delinquenz
Risikofaktoren für aggressives Täterverhalten: Wahrnehmung des Opfers als »leichte Beute« infolge von Stigmatisierung, Ohnmacht, geringem Selbstwert, geringer sozialer/familiärer Unterstützung und dem Wissen um frühere sexuelle Übergriffe
Gefühl des Täters, zur Aggression berechtigt zu sein infolge traumatischer Sexualisierung, Wissen um frühere sexuelle Übergriffe, Betrachten des Widerstands als vorgespielt
Unfähigkeit des Opfers, sich effektiv abzugrenzen: reduzierte Fähigkeit zur Abgrenzung durch erlernte Erwartungen, Stigmatisierung, Ohnmacht und Alkoholkonsum
Exosystem: soziale Strukturen (Job, soziale Netzwerke, Nachbarschaft)
Mangel an Ressourcen: geringer sozioökonomischer Status, unsichere Lebensbedingungen, frühe Schwangerschaft, alleinerziehend, Scheidung
Mangel an Alternativen aufgrund von sozialer Isolation und geringer familiärer Bindung und Unterstützung
Makrosystem: kulturelle Werte/Überzeugungen (z. B. Geschlechterrollen)
Kulturelle Tendenz, Opfern die Schuld für die Übergriffe zu geben
»Good-girl/bad-girl«-Verständnis von Femininität
Männer als Betroffene
Zum Vorkommen von sexueller Gewalt(1) gegen Männer in Partnerschaften gibt es in Deutschland nur wenige Erkenntnisse. Die Männer, die an der Untersuchung von Puchert et al. (2004) teilnahmen, berichteten kaum von sexuellen Gewalterfahrungen in Partnerschaften. Nur einer von 192 Männern gab z. B. an, dass in der aktuellsten Partnerschaft seine Partnerin mehrmals versucht hatte, ihn zu sexuellen Handlungen zu zwingen, es aber nicht dazu gekommen sei. Ein weiterer Mann berichtete, dass seine Partnerin ihn zu sexuellen Handlungen gezwungen habe, die er nicht wollte. Fünf, dass ihre Partnerinnen ihnen ihre sexuellen Bedürfnisse rücksichtslos aufgedrängt hätten, drei, dass ihre Partnerinnen sie psychisch oder moralisch zu nicht gewollten sexuellen Handlungen bewegt hätten.
Aus den USA liegen einige bevölkerungsrepräsentative Studien vor, die es erlauben, sich ein etwas genaueres Bild zu machen: 3,8 % der männlichen Teilnehmer einer Untersuchung gaben an, im Erwachsenenalter sexuelle Gewalt unter Androhung oder Ausübung körperlicher Gewalt erlebt zu haben (Elliott et al. 2004). Eine andere Studie (Choudhary et al. 2010) stellte fest, dass es sich bei den Täterpersonen nicht selten um aktuelle (13,3 %) oder frühere weibliche Intimpartnerinnen (24 %) handelte. Auch aktuelle männliche Intimpartner wurden bisweilen genannt (1,49 %), Angaben zu früheren männlichen Intimpartnern wurden nicht gemacht. Väter und Stiefväter wurden ebenfalls als Täterpersonen (23,2 %) benannt, so auch Mütter und Stiefmütter (1,6 %). Trifft die sexuelle Gewalt junge Männer in der Adoleszenz, waren es in einer anderen Studie in acht von neun Fällen weibliche Täterpersonen, die betroffenen Männer meist die eigenen Partner (Ybarra & Mitchell 2013).
Zur Situation von schwulen und bisexuellen Männern kann in der Repräsentativbefragung von Walters et al. (2013) aufgrund zu geringer Fallzahlen keine Auskunft gegeben werden. Peterson et al. (2011) weisen aber darauf hin, dass homo- und bisexuelle Männer ein besonders hohes Risiko haben, sexuell viktimisiert zu werden.
Kinder als Betroffene
Sexueller Kindesmissbrauch(2)(1)lässt sich angelehnt an die Definition der WHO als das »Involvieren eines Kindes in eine sexuelle Handlung« verstehen, »zu der es keine Zustimmung geben kann, da es diese nicht voll versteht und dafür aufgrund seiner Entwicklung noch nicht vorbereitet ist. Diese Handlungen erfolgen zwischen dem betroffenen Kind und einem Erwachsenen oder einem anderen Kind, das sich aufgrund seines Alters oder Entwicklungsstands in einer verantwortlichen, vertrauten oder überlegenen Position befindet. Die Handlungen zielen auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Person, die sie ausübt, und können Zwang und Ausbeutung einschließen, z. B. im Rahmen von Prostitution oder Pornographie« (WHO 1999).
Sexueller Missbrauch(1) wird dann als besonders schwerwiegend bewertet, wenn (Beitchman et al. 1992; Zoldbrod 2015)
es wiederholt oder über einen längeren Zeitraum dazu kam,
Penetration dabei eine Rolle spielte,
die Übergriffe sich innerhalb der Familie ereigneten,
es mehrere Täter gab oder
dabei körperliche Gewalt angewendet wurde.
Das Vorkommen sexuellen Kindesmissbrauch(3)s war in Deutschland von Anfang der 1990er Jahre bis Beginn der 2010er Jahre rückläufig, wie Stadler et al. (2012) beobachten konnten. Die Repräsentativbefragung berichtet von einem Rückgang sexuellen Missbrauchs mit Körperkontakt bis zum 16. Lebensjahr von 5,7 % auf 1,8 % (speziell bei den Frauen von 9,4 % auf 2,9 %)4 bzw. von 9,6 % auf 7,4 % bei den Frauen und von 3,2 % auf 1,5 % bei den Männern5. Diese positive Entwicklung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass es im familiären Umfeld inzwischen seltener zu sexuellen Übergriffen kommt.
Kinder, die sexuellen Missbrauch erleben, sind zusätzlich oft noch anderen Misshandlungen ausgesetzt. Nichtsexuelle Misshandlungen erhöhen jedoch wiederum das Risiko, sexuelle Gewalt zu erleiden (Perez-Fuentes et al. 2013; WHO 2010). Je mehr verschiedene nichtsexuelle Misshandlungen gleichzeitig vorliegen, desto schwerer gestalten sich in der Regel die sexuellen Gewalterfahrungen der Betroffenen (Dong et al. 2003).
1.2.3 Emotionale Gewalt
Frauen als Betroffene
41,5 % der befragten Frauen aus der(1) Studie(1) von Schröttle und Müller (2004) hatten psychische Gewalt erlebt. 63,8 % der Betroffenen waren schwer beleidigt, eingeschüchtert oder aggressiv angeschrien worden, 52,7 % wurden lächerlich gemacht, gehänselt, gedemütigt oder abgewertet, 35,9 % verleumdet, 31,2 % schikaniert oder unterdrückt, 29,6 % ausgegrenzt und ausgeschlossen, 25,9 % wegen ihres Geschlechts, Alters oder ihrer Herkunft benachteiligt. Anderen wurde gedroht, sie wurden erpresst oder zu etwas gezwungen oder waren Psychoterror und seelischer Grausamkeit ausgesetzt. In 29,6 % der Fälle wurde die psychische Gewalt durch Partner und Partnerinnen verübt, in 32,2 % der Fälle durch jemanden aus der Familie. Jeweils 19 % bzw. 18 % aller Befragten hatten in diesen Kontexten gelegentlich oder sogar häufig psychische Gewalt erlebt.
Psychische Gewalt ist(1) regelmäßig von körperlicher Gewalt begleitet oder geht in diese über. Fast ein Fünftel der Frauen, die psychische Gewalt erlitten hatten, gaben an, dass mindestens eine der erlebten Situationen auch zu körperlichen Übergriffen geführt habe. Etwa ein Fünftel bis ein Drittel hatten außerdem bedrohlichere Formen von psychischer Gewalt mit Gewaltandrohung und körperlichen Übergriffen erlitten. 68,5 % der Frauen, die im Verlauf ihres Lebens psychischer Gewalt ausgesetzt waren, hatten außerdem zusätzlich körperliche oder sexuelle Gewalt in Partnerschaften erlebt (ebd.).
Viele Frauen sind in ihren Partnerschaften außerdem Kontrolle ausgesetzt. 8,6 % der befragten Frauen gaben etwa an, dass ihr aktueller Partner oder die Partnerin eifersüchtig sei und ihre Kontakte unterbinde, 8,9 %, dass sie kontrolliert würden, wohin sie mit wem gehen, was sie tun und wann sie zurückkommen, 7,5 %, dass sie kontrolliert würden, wie viel Geld sie für was ausgeben (ebd.).
Erneut erscheinen die nichtheterosexuellen Frauen besonders betroffen: Im Vergleich zu 39,4 % der heterosexuellen gaben 50,6 % der lesbischen und 67 % der bisexuellen Frauen in der Studie von Walters et al. (2013) an, in einer intimen Partnerschaft verbale Aggression(1) in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen oder Demütigungen erlitten zu haben. Die Häufigkeiten von nötigender Kontrolle lagen bei den lesbischen Frauen bei 48,4 %, bei den bisexuellen bei 68,8 % und bei den heterosexuellen bei 40,5 %.
Männer als Betroffene
In der Studie von Puchert et al. (2004) fiel auf, dass die (1)befragten Männer in ihren Partnerschaften mehr psychische als körperliche Gewalt erfahren hatten. Besonders häufig handelte es sich dabei um eifersüchtiges Unterbinden von Kontakten (18 %) oder das Kontrollieren von Aktivitäten (18 %) und Finanzen (13 %). Dazu kamen Beschimpfungen und Beleidigungen (7 %) und Demütigungen oder Einschüchterungen durch wütendes, unberechenbares oder aggressives Verhalten (5 %).
Psychische und körperliche Gewalt traten auch bei den Männern oft gemeinsam auf. Je mehr psychische Gewalt Betroffene erlebten, desto mehr körperlicher Gewalt waren sie ausgesetzt und umgekehrt.
In den intimen Beziehungen von schwulen (44,5 %) und bisexuellen Männern (24,4 %) kommt verbale Aggression(2) ebenfalls vor, genauso wie Kontrollverhalten (45,2 % vs. 48,2 %). Die Häufigkeiten für beide Gewaltformen lagen bei heterosexuellen Männern bei 32,4 % bzw. 43 %.
Kinder als Betroffene
Nach Häuser hatten 10,3 % der befragten (1)Personen in Kindheit und Jugend in geringem/mäßigem und 4,6 % mäßigem/schwerem oder schwerem/extremem Ausmaß psychischen Missbrauch erlebt. Auch Kinder, die emotionale Gewalt erleben, sind oft weiteren Arten von Misshandlung ausgesetzt, wie z. B. körperlicher Gewalt, sexueller Gewalt oder Vernachlässigung (Norman et al. 2012; Spinazzola et al. 2014).
1.2.4 Stalking
Zu Nachstellungen, Belästigungen und Drohungen kommt es oft während der Trennung und Loslösung aus einer Partnerschaft. Ein Fünftel der befragten Frauen aus der Studie von Schröttle und Müller (2004) hatten schon einmal irgendeine Form von Stalking(1) erlebt, zu 60 % durch ehemalige Partner. Auch jeder fünfte Mann gab an, mindestens eine Art von Stalking nach einer Trennung erlebt zu haben (Puchert et al. 2004).
1.3 Gesundheitliche Folgen von häuslicher Gewalt
Gewalt kann nicht nur Ursache für teils(1) schwere und manchmal sogar tödliche körperliche Verletzungen und akute psychische Hochbelastung sein, sie trägt auch zur Entstehung vieler mittel- und langfristiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei. Dieser Zusammenhang wurde in vielen nationalen und internationalen Untersuchungen festgestellt – und zwar vor allem dann, wenn Gewalt immer wieder oder sehr früh im Lebensverlauf stattgefunden hatte. Oft handelt es sich bei den körperlichen und psychischen Folgen der Gewalt um komplexe, vielgestaltige Beschwerdebilder, die durch multiple Symptome gekennzeichnet sind (Homberg et al. 2008).
Wissenschaftlich besonders gut untersucht sind derzeit die Zusammenhänge von Partnerschaftsgewalt gegen(1) Frauen bzw. Kindesmisshandlungen einerseits und bestimmten Gesundheitsproblemen von Erwachsenen andererseits, während zu den gesundheitlichen Folgen bei anderen Betroffenen häuslicher Gewalt bisher weniger oder keine Erkenntnisse aus Studien vorliegen. Aus der klinischen Erfahrung lässt sich jedoch vermuten, dass viele der hier dargestellten Gewaltfolgen bei erwachsenen Personen jedes Geschlechts und Alters auftreten können, sodass einige Erkenntnisse aus dem folgenden Überblick möglicherweise auf andere Personengruppen übertragbar sind. Noch für 2020 ist außerdem die Veröffentlichung eines aktualisierten Gesundheitsberichts zu den Folgen von Gewalt gegen Frauen geplant (Schröttle & Glade, im Druck). Dieser kann die Auflistung, die hier vorgenommen wurde, ergänzen. Bei gewaltbetroffenen Kindern verhält es sich anders, denn hier äußern sich die Gewaltfolgen je nach Alter und Entwicklungsstand z. B. als verschieden ausgeprägte Traumaentwicklungsstörungen(1) (▶ Kap. 1.3.2).
1.3.1 Folgen von Partnerschaftsgewalt
Die gesundheitlichen Folgen von Partnerschaftsgewalt(1) sind oft schwerwiegend und können lebenslange Einschränkungen nach sich ziehen. Frauen, die in einer Partnerschaft körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben, weisen z. B. deutlich mehr gesundheitliche Beschwerden auf als andere Frauen (▶ Tab. 1-3).
Tab. 1-3 Körperliche oder sexuelle Gewalt(1)(1) durch (Ex-)Partner und Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen (Schröttle & Müller 2004)
Tabelle 1-4 (s. unten in diesem Unterkapitel) fasst verschiedene Gesundheitsfolgen bei betroffenen Frauen zusammen und stützt sich dabei auf die Ergebnisse der Forschungsarbeiten, auf die ich mich im Folgenden beziehe:
Unmittelbare Gewaltfolgen
Körperliche Verletzungen. Frauen, die körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer aktuellen oder früheren Partnerschaft erlitten hatten, berichteten über zahlreiche Verletzungsfolgen (Schröttle & Müller 2004, s. auch Tab. 1-4). Zu den Körperstellen, die besonders oft betroffen sind, zählen (Hellbernd et al. 2004):
Kopf und Gesicht
Unterarme und Hände (oft durch Abwehrbewegungen)
Nacken und Rücken
Bauch und Brust
Genital- oder Analbereich
Erleben Männer in (heterosexuellen) Partnerschaften Gewalt, so sind Ausmaß und Qualität der Verletzungen im Vergleich mit jenen gewaltbetroffener Frauen deutlich geringer (Homberg et al. 2008). 2018 starben in Deutschland 122 Frauen und 26 Männer nachgewiesenermaßen infolge von Gewalt durch aktuelle oder frühere Partner und Partnerinnen (Bundeskriminalamt 2019).
Psychische Beschwerden. Zu den direkten psychischen Folgeproblemen von Gewalt zählen z. B. (Homberg et al. 2008):
Angst und Bedrohungsgefühle
psychischer Stress
Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeiten
vermehrter Alkohol- und Medikamentenkonsum
Ein Teil dieser Beschwerden kann Ausdruck einer akuten Belastungsreaktion sein, die sich nach ICD-11 (o. J., aus dem Englischen übersetzt)6 folgendermaßen äußert:
Entwicklung vorübergehender emotionaler, somatischer, kognitiver oder Verhaltenssymptome als Folge der Exposition gegenüber einem Ereignis oder einer Situation (entweder kurz oder lang anhaltend) von extrem bedrohlicher oder schrecklicher Art (z. B. Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen, Kampfhandlungen, schwere Unfälle, sexuelle Gewalt, Übergriffe).
Zu den Symptomen können autonome Anzeichen von Angst (z. B. Tachykardie, Schwitzen, Erröten), Benommenheit, Verwirrung, Traurigkeit, Angst, Wut, Verzweiflung, Überaktivität, Inaktivität, sozialer Rückzug oder Benommenheit gehören.
Die Reaktion wird angesichts der Schwere des Stressors als normal angesehen und beginnt in der Regel innerhalb weniger Tage nach dem Ereignis oder nach dem Entfernen aus der bedrohlichen Situation abzunehmen.
Mittelbare Gewaltfolgen
Zu den mittel- und langfristigen Gesundheitsfolgen von Gewalt durch den Partner oder die Partnerin zählen:
Körperliche Beschwerden. Für viele verschiedene körperliche Beschwerden von Frauen werden in Übersichtsarbeiten (z. B. Hellbernd et al. 2004; Miller & McCaw 2019; Pastor-Moreno et al. 2020; Stockman et al. 2015) Zusammenhänge mit Partnerschaftsgewalt berichtet (▶ auch Tab. 1-4). Hatten betroffene Frauen zusätzlich noch anderen Formen von Gewalt erfahren – Misshandlungen in der Kindheit etwa – so waren sie gesundheitlich nochmals mehr belastet als andere (Schröttle & Müller 2004 nach Homberg et al. 2008). Ein Teil der Beschwerden, die Frauen nach Gewalt in der Partnerschaft schildern, ist Ausdruck von psychosomatischen Stressreaktionen infolge chronischer Anspannung, Angst und Verunsicherung (Hellbernd et al. 2004).
Tab. 1-4 Gesundheitliche Folgen von Partnerschaftsgewalt