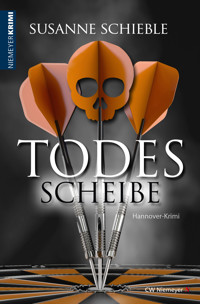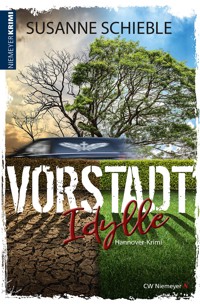7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet Hannover! Schlimmer hätte es für die Kölner Hauptkommissarin Williamson kaum kommen können. Ein Neustart in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist so gar nicht nach dem Geschmack der rheinischen Urgewalt. Aber wat sollet? Da muss sie mit ihrer Familie halt durch! Noch völlig hilflos in der norddeutschen Fremde führt sie ihr erster Fall an das Ufer des Maschsees – der Karnevalsprinz von Hannover wurde mausetot im See gefunden. Zusammen mit ihrer jungen Kollegin Elena Grifo und dem unbeliebten Mitarbeiter Sascha Cohen stößt sie immer tiefer in der hannoverschen Gesellschaft auf eine Mischung aus Schweigen, Verzweiflung und Hass. Ihr ganzer Spürsinn und ihre Erfahrung sind gefordert, um den wahren Zusammenhängen hinter der Fassade einer heilen Welt näherzukommen. Da taucht eine weitere Leiche auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Der Familie
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Die Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2022 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.com und Adobe StockEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8419-1
Susanne SchiebleHannover Helau
Kapitel 1
Die Wintersonne schien warm in den Glaserker, den er im letzten Jahr an das Wohnzimmer seines Hauses hatte anbauen lassen, und tauchte den Raum in ein goldenes Licht. Georg Middelstein, Rechtsanwalt und amtierender Karnevalsprinz von Hannover, hatte es sich heute erlaubt, früher Schluss zu machen. Er arbeitete normalerweise bis zu siebzig Stunden in der Woche. Da konnte er auch einmal einen Nachmittag früher aufhören. Zumal, wenn er keine Termine hatte, was selten genug vorkam. Mit einem wohligen Stöhnen ließ er sich in einen Sessel fallen und streckte die langen Beine von sich. Seine Frau Anna-Lena war oben und hatte sich hingelegt. Wie meistens. Er schloss die Augen und genoss für einen Moment die Stille, die er normalerweise schwer ertrug. Aber heute brauchte er das. Er hatte einen Entschluss gefasst, der sein Leben verändern würde. Er wollte es richtig machen. Einmal wollte er etwas richtig machen.
So begannen die letzten Stunden im Leben des Georg Middelstein.
Kapitel 2
„Ja is’ et denn wahr?“ Hauptkommissarin Williamson fluchte und beugte sich vor das chromglänzende Monstrum. Von unten schaute sie in die Düsen der Maschine. Kein Kaffee weit und breit.
Nach einem weiteren saftigen Fluch nahm Williamson ihre geliebte Kaffeetasse mit der Aufschrift Big Mama vom Gitter und wandte sich ab. Das ging ja gut los und konnte nichts werden. So hoch im Norden funktionierten noch nicht einmal die Kaffeemaschinen.
„Rooooaaaaaar“, hörte die Kommissarin hinter ihrem Rücken. Köstliches Röstaroma stieg in ihre Nase, und das kostbare Nass floss in das Auffanggitter.
„Du kannst mich mal“, knurrte sie und hob drohend den Zeigefinger: „Leg dich besser nit mit mir an!“
„Oho, werte Frau Kollegin, Sie werden doch nicht die Kaffeemaschine verhaften“, dröhnte eine Williamson schon jetzt verhasste Bassstimme. Hauptkommissar Balustreit – der Name ist bei ihm Programm, hatte sie bei der ersten Begegnung gedacht – stand unmittelbar hinter ihr und grinste. Mit grob geschätzt hundertfünfzig Kilo sah er wirklich aus wie Balu, der Bär. Seit ihrer ersten Begegnung vor zwei Tagen herrschte zwischen ihr und Balustreit eine Art brodelnder Waffenstillstand mit der Möglichkeit zur jederzeitigen Eskalation. Er hatte sie sofort als Konkurrentin wahrgenommen. Wenn es nach Williamson gegangen wäre, hätte sie auch dableiben können, wo sie war und wo sie gedacht hatte, bis zu ihrer Pensionierung zu bleiben – in ihrem geliebten Präsidium in Köln-Kalk. Williamson seufzte – sie hatte viel geseufzt in den letzten Wochen.
Et kütt wie et kütt, dachte sie und setzte, wie sie meinte, ihr bezauberndstes Lächeln auf. Ihre ehemaligen Kollegen in Köln hatten immer darüber gelästert, dass sie wirklich viele Qualitäten besaß, insbesondere im Bereich der Verbrechensbekämpfung. Diese erstreckten sich aber mit Sicherheit nicht auf den Einsatz weiblicher Reize, die mit „bezaubernd“ bezeichnet werden konnten.
„Nein, dat habe ich in der Tat nit vor, werter Herr Kollege“, antwortete sie und richtete sich zu ihren vollen 1,60 Meter auf. „Aber wenn Sie mir einen Vorschlaghammer besorgen könnten, so wären wir dat Problem ein für alle Mal los.“
Damit rauschte sie mit ihrer ganzen wohlbeleibten Würde an Balustreit vorbei in ihr Büro. Ihr Büro? Es war dunkel. Aber warum? Williamson tastete nach dem Lichtschalter. Das Licht flammte auf. Der Raum war klein. Eimer, Lappen und Putzmittel stapelten sich auf einem Stahlregal. Verdamp. Dies war definitiv nicht ihr Büro. Dies war die Besenkammer.
„Falsches Zimmer“, murmelte sie und schritt mit allem Stolz, den sie aufbringen konnte, an ihrem sprachlosen Kollegen vorbei. Das war bis Mittag herum im Kommissariat. Die Neue aus Köln konnte noch nicht mal ihr Büro finden. Williamson hätte schreien können. Kein Kaffee und dann das.
Kapitel 3
„Na, wie ist der Kaffee?“, fragte Elena Grifo, als Williamson in ihr Büro eintrat, hob aber nicht den Blick von ihrem Bildschirm.
„Ganz außerordentlich“, antwortete Williamson und knallte ihren Becher auf ihren Schreibtisch. „Wirklich toll.“
„Nicht?“, sagte Grifo. „Der Kaffee auf unserer Etage ist dank der neuen Kaffeemaschine der beste im ganzen Kommissariat.“
„Dat glaube ich“, knurrte die Kommissarin sarkastisch und ließ sich mit einem lauten Plumpsen auf ihren Stuhl fallen. „Wat machen Sie da eigentlich?“, fragte sie ohne echtes Interesse. Ihr war langweilig. War Hannover tatsächlich der graue Fleck auf der Landkarte, der die Stadt für sie immer gewesen war? In Köln, in der Millionenstadt, war immer etwas los. Da kannte sie sich aus. Aber hier? Hier passierte gar nichts. Kein Totschlag. Kein Mord. Noch nicht einmal ein klitzekleiner.
„Ich sehe die Vermisstendatei durch, helfe den Kollegen“, antwortete Grifo und strich ihr braunes Haar zurück. „Solange wir keinen neuen Fall haben, sollten wir die alten nicht aus dem Auge lassen. Sie können sich mal die ungeklärten Todesfälle anschauen. Ein frischer Blick schadet nie.“
„Mache ich“, antwortete Williamson und gähnte. Innerlich schmunzelte sie. Der Elan der jungen Kollegin amüsierte sie. Er erinnerte sie an ihren eigenen vor zwanzig Jahren. Na ja, vielleicht vor fünfundzwanzig Jahren.
Dann wollen wir mal, dachte sie und näherte sich ihrem PC. Computer waren für sie eine Wundertüte. Großartig, wenn sie funktionierten, auch wenn sie nicht wusste, wie sie funktionierten. Wenn sie aber nicht funktionierten, was bei ihr häufig vorkam, war sie verloren. In Köln hatte sie dann Kollegen, die ihr halfen. Aber hier?
„Frau Grüff… Frau Grifo, können Sie mir vielleicht zeigen, wie ich in die Datei komme, ich meine, dat is’ doch ein wenig neu für mich … und so … halt.“
„Na klar, kein Problem.“ Ihre Kollegin erhob sich mit der Eleganz einer Balletttänzerin und näherte sich mit einem Gang, der jedes Model vor Neid hätte erblassen lassen.
Oberkommissarin Grifo war jung, hübsch, unfassbar sexy und dazu auch noch kollegial – eine Kombination, die sie zur begehrtesten Kollegin im ganzen Kommissariat machte. Dass ausgerechnet sie warum auch immer von Kriminalrat Dr. Rico Habernickel der nicht gewollten Hauptkommissarin aus Köln zugeteilt wurde, trug dazu bei, dass Hauptkommissar Balustreit nicht gut auf seine neue Kollegin zu sprechen war.
Wegen ihres Namens Elena Grifo nannte Williamson sie in Gedanken „Grüffelo“, auch wenn die Oberkommissarin nun wirklich nichts mit dem haarigen Monster aus den Kinderbüchern gemein hatte, außer ihren langen braunen Haaren und ihrer Gutmütigkeit.
„So, das war es auch schon, bitte sehr.“
„Danke, Frau Grifo.“ Die Kommissarin grinste. Endlich etwas Positives an diesem Tag.
Kapitel 4
Die letzten Stunden im Leben des Georg Middelstein waren nicht hektisch, sondern ruhig und entspannt. Nach ausgiebigem Duschen zog er eine Jeans, ein weißes Hemd und darüber einen Hoody an. Lässig, aber trotzdem schick, so mochte er es am liebsten. Als er wieder ins Wohnzimmer kam, sah er, dass Cornelius versucht hatte, ihn zu erreichen. Schon wieder. Georg Middelstein rief ihn zurück. Cornelius nahm sofort ab.
„Georg, wir müssen reden!“ Er schrie fast ins Telefon.
„Nochmals?“, fragte der ironisch. „Es ist, wie es ist.“
„Georg!“ Cornelius’ Stimme klang beschwörend. „Bitte, hör mir zu. Du kannst das nicht machen. Gerade jetzt, in der heißen Phase des Karnevals. Wir hören damit auf, ich schwör’s dir.“
„Was willst du mir eigentlich sagen?“, erwiderte Middelstein. „Wir haben geredet. Tausendmal. Ich habe euch mehrfach gesagt, dass ich euch nicht länger decke. Ich kann das nicht länger verantworten.“ Georg Middelstein atmete tief durch. „Ihr wolltet meinen Vorschlag ja nicht annehmen.“
„Wir können es nicht!“, schrie Cornelius auf. „Jeder würde uns fragen, was los ist, vom Rathaus bis zum Verband. Jeder!“
„Tja.“ Middelstein betrachtete seine manikürten Fingernägel. „Dann decke ich euch nicht länger. Das kann mich in Teufels Küche bringen, und das weißt du.“
„Dann geraten lieber wir in Teufels Küche, was?“ Cornelius’ Stimme klang bitter. „Und du stehst da wie der strahlende Prinz.“
Middelstein konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. Er hörte, wie Anna-Lena im ersten Stock rumorte. Cornelius schwieg. Georg hörte nur seinen stoßweisen Atem.
„Ich muss aufhören“, sagte er in die Stille. „Tut mir leid.“
„Mir auch“, antwortete Cornelius lahm. „Mir auch.“
Kapitel 5
„Bin daheeem!“
Fast blieb ihr der über Jahrzehnte getätigte Ausruf im Halse stecken. Heimat. Nein, das war das Haus, das sie seit rund zwei Wochen bewohnten, wahrlich nicht. Aber Heimat ist da, wo die Familie ist, sinnierte Williamson. Also war das neue Haus doch so etwas wie Heimat? Das vermochte sie noch nicht zu sagen.
„Ah!“ Die Kommissarin fuhr erschrocken zurück, als sie in ihre geliebten Hausschuhe schlüpfte. Ein haariges Etwas tauchte vor ihr auf und fuchtelte mit den Armen.
„Ich bleibe hier nicht eine Minute länger!“, schrie es direkt vor ihrem Gesicht. „Ich will zurück nach Köööö-lln!“
„Wat is’ denn los, Nicola?“, fragte sie und strich dem haarigen Monster über den Kopf.
„Ich bleibe keine Minute länger in dieser schrecklichen Stadt. Sie haben mich ausgelacht. Wegen des Dialekts.“
„Wer hat gelacht?“
„Meine Klasse. Es ging darum, wer Rom angezündet hat. Ich habe gesagt: ‚Dat war der Nero. Un’ dann is’ Feuer an die Gebäude gekommen, un’ dann hat et gebrannt.‘ Un’ dann …“ Williamson nahm sie in die Arme.
„Aber dat war doch völlig richtig. Nero hat Rom angezündet und alles niedergebrannt.“
„Mama, du verstehst das nicht. Sie haben gesagt, dass man hier Hochdeutsch spricht und keinen Dialekt.“
„Weißt du wat, Nicola?“ Williamson strich ihrer jüngsten Tochter das Haar aus dem Gesicht. „Die sind neidisch. Einen Dialekt zu haben, bedeutet, dat man sich mit seiner Heimat identifiziert. Die Hannoveraner haben keinen Dialekt, also …“
„Sind sie keine Kölner“, schlussfolgerte Nicola und heulte erneut auf. „Sie hassen mich!“
„Nee, meine Süße, nee! Sie haben keinen Dialekt und deshalb keine Identifikation mit ihrer Heimat! Sie sind heimatlos!“
„Wirklich?“ Nicolas Augen wurden immer größer. „Und wir, Mama? Wo ist jetzt unsere Heimat?“
„Hier, Nicola!“, sagte Bernd-Karl, der lässig am Türrahmen lehnte. „Und nun lass deine Mutter los, die dringend ein Bier braucht, um ihren Tag zu verarbeiten.“
„Säufer“, kommentierte Nicola halbwegs getröstet und sprang ein wenig beruhigter die Treppe hinauf.
„Danke“, sagte Williamson. „Ich war gerade argumentativ an einem toten Punkt angekommen.“
Sie schmiegte sich an ihn. Bernd-Karl. Ihr Fels in der Brandung. Dabei war er es, der aus der Bahn geworfen worden war, als er, Beamter im Bauamt der Stadt Köln, aufdeckte, dass der Zusammenbruch des im Bau befindlichen U-Bahn-Tunnels und dann des Stadtarchivs auf einem massiven Korruptionsskandal gründete. „Kölscher Klüngel“, wie man so schön verharmlosend sagte. Bernd-Karl hatte herausgefunden, dass Berichte gefälscht worden waren. Sein Fehler war es, damit zu seinem Vorgesetzten zu gehen. Als Dank musste er von vorne anfangen. In Niedersachsen. In Hannover. Im Bauamt der Niedersächsischen Landeshauptstadt. Bernd-Karl war das notwendige Bauernopfer.
Williamson musste ihre Stelle im Präsidium räumen, den Ort, den sie über alles liebte. Sie konnte und wollte ihren Mann nicht allein aus Köln flüchten lassen. Und nun saßen sie hier. In einer Doppelhaushälfte in Hannover-Groß-Buchholz, direkt am Kanal. „Der Rhein is’ et gerade nit“, hatte sie bei der Ankunft gesagt.
„Nein. Aber dafür brauchen wir auch keine Angst vor Überschwemmungen zu haben“, hatte Bernd-Karl geantwortet. Er war derjenige, der nicht gejammert hatte, obwohl man ihm am übelsten mitgespielt hatte. Williamson war da nicht so stark, ebenso wenig wie ihre Töchter. Sie war so, wie sie war. Impulsiv, explosiv, von unendlicher Ungeduld, mit dem Charme eines Bulldozers, aber durchsetzungsstark. Und erfolgreich. Insofern kam Bernd-Karls Entlassung einigen im Präsidium in Köln gerade recht. Bernd-Karl ahnte das, aber Williamson selbst machte sich darüber keine Gedanken. Als Polizistin war sie dazu da, die Bösen ins Gefängnis zu stecken. Das war ihre Welt, das konnte sie.
„Wat gibt et zu essen?“, fragte sie, hob am Herd den Deckel vom Topf und schnupperte.
„Spaghetti Bolognese“, antwortete Bernd-Karl grinsend. Er wusste, dass er seiner bodenständigen Frau damit keinen Gefallen tat. Sie aß am liebsten rheinische, deftige Hausmannskost. Ihre Töchter aber nicht.
Wie erwartet verzog Williamson das Gesicht.
„Mit Eissalat“, fügte Bernd-Karl hinzu. Den mochte sie am allerwenigsten. Aber was soll’s? Der Tag war ohnehin im Eimer, da passte der Eissalat wie die Faust aufs Auge.
„Is’ lecker“, nuschelte Nicola anerkennend und strich zum wiederholten Male ihre Haare aus dem Gesicht. Sie, wie auch ihre drei Jahre ältere Schwester Carola, hatte das widerborstige Haar ihrer Mutter geerbt. Leider, wie beide nicht müde wurden zu betonen. Williamson selbst hatte sich schon vor langer Zeit mit ihrer „Haarpracht“ arrangiert und sie zu allem Überfluss auch noch rot gefärbt. Vor ihren roten Haaren stand ihre alte Abteilung in Köln stramm.
Carola mümmelte vor sich hin.
„Hallo?“, fragte Williamson ihre älteste Tochter genervt. „Is’ jemand zu Hause?“ Da sah sie das Kabel durch die Haarpracht ihrer Tochter blitzen und riss ihr die kleinen Knöpfe aus den Ohren.
„Kannst du nit wenigstens beim Essen mal voll da sein ohne diese Dinger im Ohr?“, schimpfte sie.
„Klar“, antwortete Carola verächtlich, „damit ich ganz genau weiß, wo meine Heimat ist, oder was?“
„Dat is’ doch wirklich nit zu fassen!“, hob ihre Mutter an.
„Lass gut sein, Mienchen.“ Ihr Mann legte seine Hand auf ihre. „Komm“, raunte er ihr zu, „es ist nicht leicht für sie.“ Damit zog er sie ins Wohnzimmer und schloss die Tür zur Küche.
„Et is’ nit leicht für sie“, zischte Williamson. „Un’ für mich? Weißt du, wo ich heute auf dem Weg zu meinem Büro gelandet bin? In der Besenkammer!“ Sie kämpfte mit den Tränen und holte tief Luft.
„Du hast recht“, sagte sie dann und versuchte ein Lächeln, das in einer Grimasse endete. „Wir sind erwachsen, sie nit. Aber et fällt mir doch verdamp schwer.“
„Ich weiß, Mienchen, ich weiß.“ Bernd-Karl nahm sie in die Arme und hielt sie fest. Wenn er sie „Mienchen“ nannte, schon zum zweiten Mal an diesem Abend, war es ihm sehr ernst. Mienchen war ein Kosename, der von ihrem Nachnamen herrührte. Manchmal nannte er sie liebevoll „Wilhelmine“, manchmal, wenn es richtig ernst wurde, „Mienchen“.
„Ich danke dir, dass du so zu mir hältst“, murmelte er, seine Lippen an ihrem Strubbelhaar. „Ich weiß, dass es viel verlangt ist, und ich hätte nie gedacht, dass wir als Resultat meines Handelns einmal hier landen würden.“
„Ich weiß“, antwortete Williamson und umarmte ihn fest. „Ich weiß.“
Kapitel 6
Williamson hielt einen Besen in der Hand und fegte die langen Gänge des Zentralen Kriminaldienstes in der Waterloostraße.
Ausgerechnet!, hatte Williamson gedacht, als sie das zum ersten Mal hörte. Dat is’ mein ganz eigenes Waterloo!
An jeder Ecke stand Balustreit, zeigte mit dem Finger auf sie und lachte. Die Kaffeemaschine auf ihrer Etage lief über, Carola und Nicola standen mit Kopfhörern in den Ohren daneben, beide mit einem Teller Spaghetti in der Hand. Williamson floh in ihr Büro, wo Grüffelo an ihrem Computer saß und ein Glas Kölsch über die Tastatur kippte.
„Wat soll denn dat?“, schrie Williamson sie an. Der Computer gab in regelmäßigen Abständen ein Piepsen von sich.
„Was soll was?“, murmelte Bernd-Karl verschlafen.
„Hä?“ Williamson fuhr auf.
„Du hast geträumt, es ist mitten in der Nacht.“ Aber das Piepsen des Computers aus dem Traum war geblieben.
„Dat is’ mein Handy. Mist. Dat is’ Grüffelo.“
„Wer?“
„Grüff… ich erklär’s dir später.“ Sie hämmerte auf den Tasten herum, bis tatsächlich eine Verbindung hergestellt war.
„Williamson!“, blaffte sie in ihr Mobilgerät.
„Hallo Chefin, hier ist Grifo. Wir haben einen Toten am Maschsee. Beim Nordufer. Gegenüber vom Sprengel Museum, auf der anderen Seite des Lakeside Hotels, können Sie gar nicht verfehlen. Spurensicherung ist unterwegs. Genauso wie Cohen.“ Williamson seufzte.
Der erste Seufzer des Tages, dachte sie und schaute auf die Uhr. 1.42 Uhr.
„Okay, bin gleich da.“ Sie befreite sich aus ihrer Deckenflut und wandte sich an ihren Mann, der sein Gesicht auf seinem Arm abstützte und sie schmunzelnd betrachtete.
„Et tut mir leid, aber anscheinend gibt et in Hannover doch noch Verbrechen.“
„Na, Gott sei Dank“, grinste er, „sonst wäre meine Frau bald vor Langeweile gestorben.“
Williamson schlüpfte in eines ihrer Kostüme, die sich nur farblich voneinander unterschieden: Verschiedene Brauntöne wechselten mit verschiedenen Grau- und Blautönen ab. Abgesehen davon bestachen sie durch ihre einzigartige Unförmigkeit. Dazu trug sie meist eine weiße Bluse oder auch schon mal einen Rollkragenpullover, so wie jetzt, denn es war Ende Januar in der niedersächsischen Landeshauptstadt empfindlich kalt. Sie gab ihrem Mann zum Abschied einen Kuss.
„Tschööö, minge Schatz.“
In der Garderobe schlüpfte Williamson in ihre braunen Halbschuhe und in ihren Wintermantel, dunkelbraun, unförmig.
Sie schnappte sich die Autoschlüssel und stieg in ihren geliebten, acht Jahre alten Ford Fiesta.
Sie hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Auto. Es hatte sogar einen Namen. Williamson nannte es „Marianne“. In ihrer Vorstellung war das Auto so etwas wie eine Freundin. Außerhalb ihrer Familie wusste das natürlich niemand. Das wäre ihr dann doch zu peinlich gewesen.
„Na, Mariannchen, et geht wieder los.“ Das vertraute Kribbeln stellte sich ein. Endlich konnte sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Das eigens für Hannover angeschaffte Navi baute sich auf, und sie setzte an, ihr Fahrtziel einzugeben. Ratlos starrte sie auf die vielen Namen, als sie die ersten Buchstaben eingegeben hatte.
„Wat soll et“, entschied sie und hämmerte einen Befehl ein. „Et hätt’ noch immer jot jejange.“
Kurz hinter dem Theater am Aegi tauchte links die Silhouette des imposanten Neuen Rathauses auf. Williamson hatte es für ein Schloss gehalten, als sie es das erste Mal erblickt hatte. „Nit gerade der Kölner Dom, aber ganz nett“, hatte sie gemeint. Im Stillen war sie beeindruckt. Es war weitaus imposanter als das Kölner Rathaus, aber das hätte Williamson niemals zugegeben.
Dem Navi folgend, fuhr sie auf das Rathaus zu.
„Sie haben das Ziel erreicht“, flötete die Dame im Navi. Williamson war verwirrt. Hatte ihre Kollegin nicht ein Hotel erwähnt? Na gut, manchmal gab es auch am Rathaus ein Hotel.
Sie stieg aus und erschauerte. Es war verdamp kalt. Und auch trotz des fahlen Mondlichts sehr dunkel. Von blinkenden Streifenwagen war weit und breit nichts zu sehen. Sie tauschte schnell ihre Schuhe gegen die Gummistiefel aus, die sie für solche Fälle immer mitführte. Besser, man war vorbereitet.
Die Kommissarin bog um die Ecke und blieb stehen. Alles still. Der See lag spiegelglatt vor ihr. Sie leuchtete mit einer Taschenlampe am Rathaus entlang und auf den See. Nichts.
„Verdamp, dat kann doch nit wahr sein!“, fluchte sie, zückte ihr Handy und rief Grifo an. „Wo sind Sie?“, fragte Williamson, „hier is’ alles dunkel und verlassen. Dat Rathaus ebenso wie der See!“
„Rathaus?“, fragte Grifo zurück, und Williamson konnte sie durchs Telefon förmlich grinsen sehen. „Sie sind am Maschteich, nicht am Maschsee. Ich erkläre Ihnen, wie Sie fahren müssen.“
Williamson würgte ein „Danke“ hervor und stieg wieder in ihre Marianne. Verdamp. Wenn das Cohen mitbekommen hatte, wusste es bald auch Balustreit und dann das ganze Kommissariat. Erst die blöde Kaffeemaschine, dann die Besenkammer und nun der Maschteich.
Nach kurzer Fahrt ragte links vor ihr der graue Betonklotz des Sprengel Museums auf, der sich im Mondschein schemenhaft gegen den Nachthimmel abhob. Halb links vor ihr lag der See, und da sah die Kommissarin auch schon das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge, das die kahlen Äste der Bäume am Seeufer gespenstisch beleuchtete. Große Scheinwerfer waren bereits aufgebaut und strahlten die Szenerie taghell an. Gegenüber vom Sprengel Museum liefen mehrere Personen zwischen dem Radweg, dem kurzen Rasenstück und dem Uferweg des Sees hin und her. Sie musste zugeben, dass dieses Gewässer schon eher als See bezeichnet werden konnte, und schämte sich nur noch mehr.
Cohen hatte sein Hinterteil auf die Kühlerhaube von einem der Streifenwagen gehievt und rauchte.
„Oho, unsere isländische Urgewalt ist auch schon eingetroffen“, dröhnte er und verzog den Mund so weit, dass Williamson seine Zähne aufblitzen sah.
„Ich komme aus Köln, nit aus Island!“, knurrte sie und rauschte an Cohen vorbei. Es war immer das Gleiche. Aufgrund ihres Namens dachten viele, sie oder ihr Mann kämen aus Island oder hätten zumindest isländische Wurzeln. Sie wusste es nicht genau. Was sie wusste, war, dass sie aus Köln kam, ebenso wie ihre Familie und die Familie von Bernd-Karl, die seit Generationen in der „schönsten Stadt der Welt“ lebte. Ob vielleicht im Mittelalter irgendwelche isländischen Wikinger oder so nach Köln gekommen waren und den Grundstein für die kölsche Familie Williamson gelegt hatten, mochte so sein oder auch nicht. Sie kam aus Köln, Bernd-Karl kam aus Köln, ihre beiden Familien kamen aus Köln. Basta.
„Ein Son ist doch wie der andere Son, nicht wahr?“, spottete Cohen. Wenn Grifo ein Geschenk von Dr. Habernickel war, dann war Cohen die Strafe. Er war der Stachel in ihrem Fleisch, die Spucke in ihrer Suppe. Da er Sascha Cohen hieß und damit fast so wie irgendein durchgedrehter Schauspieler, nannten ihn alle auf dem Kommissariat nur „Baron“.
„Sacha Baron Cohen, der Schauspieler“, hatte Grifo Williamson gleich am ersten Tag aufgeklärt. Am Abend hatte sie sich von Carola erklären lassen, wer der Schauspieler war, und sich auch einige Bilder im Internet angesehen. Der Schauspieler Sacha Baron Cohen hatte so viel mit Sascha Cohen aus dem Kommissariat im ZKD in der Waterloostraße gemeinsam wie Ecstasy mit Schlaftabletten. Das Problem war, dass Williamson seitdem vor ihrem inneren Auge des Schauspieler Cohens neongelben, hautengen Badeanzug an des Kriminalbeamten Cohens weniger durchgestyltem Körper kleben sah. Sie bekam dieses Bild einfach nicht aus dem Kopf. Manchmal half es, mit Cohens überheblicher Art fertig zu werden. Manchmal nicht.
Inzwischen war Williamson an der Leiche angekommen, die von den Tauchern aus dem Wasser geborgen worden war.
„Wat haben wir?“, fragte sie in die Runde und schob einen in einen weißen Overall gekleideten Halbstarken aus dem Weg. „Wissen wir schon, wer der Tote is’? Wie lange war er im Wasser? Gibt et Anzeichen dafür, wie er gestorben is’?“
Das Jüngelchen hatte inzwischen sein Gleichgewicht wiedergefunden.
„Nein, wir wissen noch nicht, wer der Tote ist. Er hat etwa zwei bis drei Stunden im Wasser gelegen, Genaueres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Anzeichen dafür, wie er gestorben ist, haben wir in der Tat.“ Der junge Mann beugte sich über die Leiche, die zweifelsohne männlich war, und drehte mit der gummibehandschuhten Hand den Kopf ein wenig zur Seite. Williamson beugte sich über den Toten.
„Hier!“ Der Junge zeigte auf eine kreisrunde Wunde am Hinterkopf. „Stumpfe Gewalteinwirkung. Könnte ein Schlag mit einem entsprechenden Gegenstand gewesen sein.“
„Nichts für ungut, junger Mann“, sagte sie und blickte sich um, „aber ich möchte doch gerne mit dem verantwortlichen Rechtsmediziner sprechen und nit mit einem Berufsanfänger.“ Auf leisen Sohlen, was typisch für Grifo war, war diese hinter die Kommissarin getreten.
„Darf ich vorstellen?“, fragte sie süffisant. „Das ist Dr. Sven Michellsen vom Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule in Hannover.“
Williamson richtete sich langsam auf. Dr. Sven Michellsen? Doktor? Wann hatte der denn seinen Doktortitel gemacht? Mit fünfzehn?
„Freut mich“, sagte Michellsen und reichte ihr seine Hand. „Sie müssen Williamson sein, die isländische Kölnerin.“
Sie klappte den Mund auf und zu, musste innerlich aber grinsen. Michellsen nahm ihr den Fauxpas nicht übel. Das hatte sie in dieser so verdamp korrekten Stadt noch nicht häufig erlebt.
„Mich auch“, sagte sie und ergriff die gummibehandschuhte Hand, die zuvor noch die Leiche untersucht hatte, was sie zu spät bedachte. „Ich … äh … ich dachte …“, stammelte sie, während sie unauffällig ihre Hand an ihrem Mantel abwischte.
„Schon gut“, Michellsen winkte ab, „passiert mir öfter.“
„Gut, Michel, dann können wir weitermachen.“
Nun klappte Michellsen seinerseits den Mund auf und zu. „Ich heiße …“
„Schon klar, aber hier liegt wohl ein Gewaltverbrechen vor, wir müssen nun ranklotzen.“ Williamson wandte sich zu Elena Grifo um. „Wir müssen so schnell wie möglich rausfinden, wer der Tote is’. Hatte er Papiere, Handy, Portemonnaie?“
„Nein“, antwortete Grifo. „Nichts. Zumindest haben die Taucher nichts gefunden, noch nicht.“
„Merkwürdig“, meinte die Hauptkommissarin. „Wenn man heutzutage aus dem Haus geht, hat man doch Geld, Papiere und vor allem ein Handy dabei.“
Sie beugte sich wieder über den Toten. Ein gut geschnittenes, markantes Gesicht, grau meliertes Haar, Mitte vierzig. Er trug Designer-Jeans, einen Hoody, darunter ein weißes Hemd. Unter der Kleidung zeichnete sich ein gut gebauter Körper ab. Gott sei Dank hatte die Leiche nicht so lange im Wasser gelegen. Sie trug noch keine Merkmale, die das Wasser mit menschlichem Gewebe anzurichten vermochte.
„Keine Jacke“, murmelte Williamson vor sich hin.
„Was?“, fragten Grifo und der Baron gleichzeitig.
Die Kommissarin blickte auf. „Keine Jacke“, wiederholte sie, „kein Mantel. Er mag hier wohl kaum vorbeigegangen, niedergeschlagen un’ in dat Wasser geworfen worden sein. Denn dann hätte er eine Jacke oder einen Mantel getragen, oder nit?“
„Es ist doch noch viel zu früh, um so etwas zu sagen“, meinte Cohen verächtlich. „Vielleicht wollte er nur kurz aus dem Auto, um frische Luft zu schnappen.“
Um diesem Idioten nicht länger zuhören zu müssen, holte sie ihr Handy hervor und schoss ein Bild von dem Toten. Ihr Blick fiel auf das auch um diese Zeit hell erleuchtete Hotel am gegenüberliegenden Ende des Uferweges. Sie schaute den Toten an. Dann das Hotel. Und wieder den Toten. Sie stapfte los. Ihre Gummistiefel quietschten.
Wie eine Urgewalt, nach Atem ringend, mit wildem Blick und wirrem Haar, stürmte die Kommissarin vorne durch die Drehtür und stand mitten im Foyer des Hotels. Die beiden Damen an der Rezeption starrten sie mit aufgerissenen Augen an. Die Erscheinung in Gummistiefeln und mit langem, unförmigem Mantel stakste mit entschlossenen Schritten auf sie zu. Sie wichen zurück.
Schon hatte Williamson ihr Handy gezückt und hielt der linken Dame das Bild von dem Toten unter die Nase.
„Kennen Sie den?“, raunzte sie die junge Frau an. Diese zuckte zurück.
„Hallo, hallo, wer sind Sie eigentlich?“, mischte sich ihre Kollegin ein. „Wie kommen Sie dazu, hier hereinzustürmen und in dieser Art und Weise aufzutreten?“
„Wer ich bin?“, schnauzte Williamson und hielt der indignierten Rezeptionistin ihren Ausweis unter die Nase. „Williamson, Kripo Kö… Hannover. Wir haben diesen Mann im Maschsee gefunden. Er is’ tot. Also, kennen Sie ihn, is’ er hier in diesem Hotel abgestiegen?“
„Wenn das so ist …“, stotterte die Rezeptionistin. „Also, ich weiß nicht. Ich habe meinen Dienst erst um Mitternacht angetreten. Ich habe ihn nicht gesehen.“
„Wat is’ mit Ihnen?“, wandte sich die Kommissarin an die jüngere der beiden.
„Ich bin seit 23.00 Uhr im Dienst, für mich gilt das Gleiche. Ich habe ihn noch nie gesehen.“ Der Blick der Frau glitt über sie hinweg. „Was machst du denn noch hier, Lucie?“
Williamson blickte sich um. Ihr war eine kleine Karawane gefolgt, die inzwischen ebenfalls das Hotel betreten hatte: Grifo, Cohen und eine junge Frau, die fast hinter der massigen Gestalt des Barons zu verschwinden schien.
„Wat soll dat?“, grollte Williamson. „Habe ich gesagt, dat Sie mir folgen sollen? Sie sollten beim Tatort bleiben!“
„Das ist die junge Frau, die den Toten gefunden hat“, erklärte Grifo und schob besagte junge Frau in ihre Richtung.
„Herrgott noch mal, dann befragen Sie sie doch!“, knurrte die Kommissarin. „Muss ich denn alles selber machen? Ach, wat soll et, nütz’ ja nix!“
Sie schob die junge Frau, die am ganzen Körper zitterte und so zerbrechlich aussah wie Williamson füllig, in Richtung der kleinen Sitzgruppe im Foyer.
„So, jetz’ setzen Sie sich erst mal.“ Die Kommissarin drückte den Körper der Frau in einen der Sitze. Diese schien darin zu versinken, so zierlich war sie.
„Wie heißen Sie?“
„Lucie Dermold, ich arbeite hier im Hotel im Service des Restaurants“, stieß die junge Frau hervor und schob eine rotblonde Strähne hinter ihr Ohr. „Ich wollte nach meiner Schicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Ich habe den Radweg genommen, der am See entlangführt Richtung Südstadt. Da habe ich auf den See geguckt. Er sah schön aus mit dem Mondlicht drauf. Da …“ Lucie schluchzte auf und atmete schneller. „Da habe ich etwas wahrgenommen.“ Sie zitterte immer stärker und stand sichtlich unter Schock. Beruhigend legte Williamson eine Hand auf den Arm der jungen Frau.
„Es sah ziemlich groß aus. Wie ein Paket oder so. Als ich genauer hingesehen habe, sah ich Haare … die bewegten sich ganz sacht im Wasser hin und her, ganz sacht …“ Lucie liefen die Tränen übers Gesicht. „Es war ein Mensch, ein Mann, oh Gott. Ich glaube, ich habe geschrien. Dann habe ich die Polizei gerufen.“
„Kennen Sie ihn?“, fragte Williamson unverblümt und zeigte das Foto auf ihrem Handy.
Lucie lehnte sich zurück. „Ich … ich habe ihn im letzten halben Jahr mehrmals im Restaurant gesehen.“
Die Kommissarin war elektrisiert. „Wann kam er? Immer um dieselbe Uhrzeit?“
„Meistens so gegen 20.00 Uhr. Zum Abendessen. Heute auch.“
„Wie hat er bezahlt? In bar oder mit Karte?“
„Immer in bar, was schon fast ungewöhnlich ist.“
„Er wollte keine Spuren hinterlassen“, murmelte Williamson. Sie blickte Lucie an. „Kam er allein oder war er in Begleitung?“
Lucie blickte verlegen zur Seite. „Er war in Begleitung. In Damenbegleitung.“
„Immer?“
„Immer. Und es waren unterschiedliche Damen.“
Die Kommissarin sah Lucie an und drückte kurz ihre Hand. „Danke“, sagte sie leise.
Dann erhob sie sich und stürmte auf ihre Mitarbeiter zu, die die beiden Damen an der Rezeption befragten.
„Cohen!“, befahl Williamson. „Sie bringen Frau Dermold in dat Kommissariat und nehmen ihre Aussage auf. Grifo, Sie kommen mit mir. Wir befragen die Angestellten, die im Moment im Hotel sind. Außerdem sollten wir den Geschäftsführer informieren, er soll kommen. Wir brauchen ihn hier.“ Sie war schon halb auf dem Weg zur Rezeption, dann wandte sie sich noch einmal um. Den unsensiblen Cohen mit Lucie Dermold ins Kommissariat zu schicken, war keine gute Idee, auch wenn sie lieber mit Grifo zusammengearbeitet hätte.
„Nein, wir machen et anders. Grifo, Sie begleiten Frau Dermold, Cohen, Sie kommen mit mir!“
Williamson wandte sich abrupt von ihm ab und den beiden Mitarbeiterinnen des Hotels zu.
„Also“, sagte sie zuckersüß, „noch mal von vorn.“ Sie zückte wieder ihr Handy und wischte so lange auf dem Display herum, bis sie das Bild des Toten wiedergefunden hatte. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, dass Grifo mit Lucie Dermold das Hotel verließ. Sie hatte fürsorglich einen Arm um die Schultern der zierlichen jungen Frau gelegt und sprach beruhigend auf sie ein. Gut so.
Die beiden Frauen schauten sie mit großen Augen an.
„Ich glaube“, sagte Williamson langsam und behielt ihren süßlichen Tonfall bei, „et is’ an der Zeit, mit der Diskretion aufzuhören und die Wahrheit zu sagen. Sie kennen ihn, habe ich recht?“
Die Frauen sahen sich an. Die ältere von beiden schüttelte unmerklich den Kopf, wie um zu signalisieren, dass nur ja nichts an die Polizistin weitergegeben werden sollte.
Das wurde nun aber eindeutig zu bunt hier! Was bildeten sich die beiden Dämchen eigentlich ein? Williamson spürte, wie eine Zorneswelle in ihr hochstieg, mit der sich einer ihrer gefährlichen Ausbrüche ankündigte.
„Magma“ hatten die Kollegen in Köln diese Welle getauft. Sie stemmte die Arme in die Hüften und öffnete den Mund, um loszupoltern, als ein gut aussehender Herr Mitte dreißig das Foyer betrat.
„Guten Morgen, Frau Kommissarin. Wie kann ich Ihnen helfen?“
Kapitel 7
Trotz der frühen Stunde war der Mann wie aus dem Ei gepellt. Er trug einen Kaschmirpullover, eine Hose aus gutem Tuch und einen hochwertigen Wollmantel, die dunkelblonden Haare waren im angesagten Undercut geschnitten. Sein Lächeln war so breit wie seine Kleidung teuer. Mehrere Gedanken schossen gleichzeitig durch Williamsons Kopf: Woher wusste er, dat sie hier ermittelte? Und verdamp noch mal, wieso tauchte er gerade in diesem Moment auf? Sie hätte den beiden Damen gerne noch eine Zeit lang ohne ihren Vorgesetzten auf den Zahn gefühlt. Denn dass es sich hierbei um den Geschäftsführer des Hotels handelte, war offensichtlich, da er sich in dem Raum bewegte, als ob ihm das Gebäude gehörte.
„Mein Name ist Holger Trespen, ich bin der Geschäftsführer des Hotels“, stellte er sich dann auch folgerichtig vor.
„Wer ich bin, wissen Sie ja schon“, knurrte Williamson unwillig. „Also gut, wenn Sie schon mal hier sind, kann ich genauso gut Sie fragen: Kennen Sie den Mann?“ Nun hielt sie ihm das Handy mit dem Foto des Toten unter die Nase.
„Zu meinem Bedauern ja“, antwortete Trespen und machte ein bekümmertes Gesicht, wobei Williamson nicht beurteilen konnte, ob seine Trauer echt war oder nicht. Sie hasste diese gelackten Typen.
„Würden Sie mir dann die Ehre erweisen, mir mitzuteilen, um wen et sich handelt?“, säuselte sie.
„Das ist Georg Middelstein“, antwortete Trespen und blickte sie erwartungsvoll an.
„Aha“, sagte Williamson trocken. Trespen schaute sie mit seinem unbeweglichen Gesicht nur weiterhin an. Sie hörte, wie Cohen hinter ihr scharf die Luft einsog. Was war hier los?
Offensichtlich erwarteten beide, dass ihr der Name etwas sagte, was aber nicht der Fall war. Verdamp, sie kannte sich in der Stadt noch nicht so aus, um alle Lokalpromis zu kennen!
„Der Prinz“, flüsterte Cohen schräg hinter ihr ehrfürchtig. Williamson blickte ihn ihrerseits verständnislos an.
„Der Prinz?“, fragte sie zurück und sah von Cohen zu Trespen.
„Der Karnevalsprinz“, antwortete Trespen und blickte sie auffordernd an, als ob damit alles gesagt wäre.
„Der WAT?“, fauchte Williamson. Hatte sie richtig gehört? Karnevalsprinz? Was war das denn? Es gab nur einen legitimen Prinzen der fünften Jahreszeit, und der kam aus Köln. Basta.
„Unser aktueller Karnevalsprinz“, erklärte Trespen.
Sie rang um Fassung. Nicht nur dass hier anscheinend auch so etwas wie Karneval veranstaltet wurde, nein, es gab sogar einen Prinzen dazu. Nur dass der unwiederbringlich tot war.
„Ich will Ihre Euphorie nit unbedingt dämpfen, aber falls Sie et nit bemerkt haben sollten, Ihr Karnevalsprinz für diese Session is’ mausetot und liegt am Ufer vom Maschsee, keine fünfhundert Meter von hier entfernt“, schnurrte sie. „Ich denke, Sie haben damit ein Problem, und zwar in mehrfacher Hinsicht, denn Sie stehen für den diesjährigen Karneval ohne Prinzen da, UN’ der werte Herr Prinz, Verzeihung, Middelstein, war auch noch Gast Ihres Restaurants. Hatte er hier auch ein Zimmer?“
Das verbindliche, aber nichtssagende Lächeln aus Trespens Gesicht war wie weggewischt, wie sie zufrieden registrierte. Gut so. Es war nur ein kleiner Sieg, aber ein Sieg. Der Geschäftsführer setzte nun eine betroffene Miene auf. Sie hatte ihn zwar aus dem Konzept gebracht, aber nur kurz.
„Es stimmt, Herr Middelstein war des Öfteren Gast in unserem Hotel, sowohl im Restaurant als auch als Übernachtungsgast.“
„Soso“, schnaubte sie und streifte die beiden Damen an der Rezeption mit einem triumphierenden Blick. Das war nicht unbedingt professionell, aber sie konnte nicht anders. Andererseits wurde sie das Gefühl nicht los, dass Trespen, indem er die eine Tatsache zugab, eine andere, tieferliegende zu verbergen suchte. Es war nur ein Bauchgefühl, ein Kribbeln unterm Zwerchfell. Den feinen Herrn Trespen würde sie noch weiterbefragen müssen, ob er wollte oder nicht.
Zunächst schob sie diesen Gedanken aber beiseite. Es galt erst einmal, handfeste Polizeiarbeit zu verrichten.
„Cohen, Sie befragen die beiden Damen“, entschied sie. Das hatten sie nun davon. Cohen war nicht unbedingt einfühlsam, und dass die beiden Frauen augenscheinlich geleugnet hatten, Middelstein zu kennen, machte es nicht besser, im Gegenteil.
„Un’ Sie“, wandte sie sich an Trespen, „zeigen mir sein Zimmer und schaffen mir dat Servicepersonal herbei, dat Middelstein heute Abend im Restaurant bedient hat.“
„Das war Lucie Dermold, die war bis eben noch hier“, mischte sich eine der beiden Damen ein.
„So? Dat is’ interessant, ich dachte, Sie kennen Herrn Middelstein gar nit“, säuselte die Kommissarin. „Wer war noch im Restaurant heute Abend beschäftigt?“
„Wir fertigen Ihnen eine Liste an“, beeilte sich der Geschäftsführer zu sagen und sandte einen raschen Blick in Richtung seiner Mitarbeiterin, der ihr nicht entging. Was war das? Eine Warnung? Hier gab es offensichtlich viele Verstrickungen, die sie nicht durchschaute. Noch nicht.
„Rufen Sie sie gleich an und schaffen Sie sie mir hier ran“, befahl sie und erstickte damit jeglichen Widerspruch im Keim. „Wir brauchen die Leute hier.“ Damit wandte sie sich an ihren Kollegen. „Cohen“, blaffte sie. „Bevor Sie die beiden befragen, fragen Sie bitte nach, wie weit die Spurensicherung am Fundort der Leiche is’. Dann fordern Sie im Kommissariat mehr Leute an. Die brauchen wir hier, um mit den Hotelgästen zu sprechen. Und zwar zack, zack.“
Der Baron verzog das Gesicht, wies die Rezeptionistinnen an, sich zur Verfügung zu halten, trat einen Schritt zur Seite und zückte sein Handy, wobei er einen missmutigen Blick in Richtung Williamson sandte.
Trespen ließ die Mundwinkel hängen und guckte erschrocken. „Sie können hier doch nicht alle Gäste befragen! Das ist Wahnsinn! Eine polizeiliche Befragung schadet unserem Ruf!“
Die Kommissarin fuhr herum. Wollte der Typ sie vergackeiern?
„Werter Herr Trespen, haben Sie nit zugehört? Ein Gast Ihres Hauses is’ tot. Is’ Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dat er hier im Hotel gestorben sein könnte? Also …“ Sie atmete tief durch. „Sie werden uns hier eine Möglichkeit einräumen, die Leute zu befragen, dann können sie zum Frühstück. Ansonsten bestelle ich jeden einzelnen Gast in dat Kommissariat! Klar?“
Trespen wurde rot, dann wieder blass, dann wieder rot.
„Klar“, beeilte er sich zu sagen.
„Zeigen Sie mir dat Zimmer, dat der Herr Middelstein bewohnt hat!“
Im Gesicht des Geschäftsführers zuckte ein Muskel, die zweite echte Regung, die Williamson wahrnahm. Doch schon gefror sein Gesicht wieder zu einer unerschütterlichen Maske.
„Natürlich, gern“, stieß er hervor und zeigte in Richtung des Fahrstuhls. „Wenn ich vorausgehen darf?“
„Sie dürfen“, antwortete die Kommissarin amüsiert und stapfte hinter ihm her. Fast schon an der Fahrstuhltür drehte sie sich noch einmal zu Cohen um, der gerade sein Telefonat beendet hatte. „Herr Cohen!“
Er schaute auf und sah sie mit seinen blauen Glupschaugen an. „Benachrichtigen Sie Frau Grifo und sagen Sie ihr, dat sie die persönlichen und beruflichen Verhältnisse von diesem Middelstein unter die Lupe nehmen soll. Und auch alles zu seiner Tätigkeit als Prinz.“
Der Kommissar nickte widerstrebend.
Williamson hatte Trespen genau beobachtet, als sie ihre Anweisungen gab. Seine Miene war unbewegt, aber sie hätte einen Besen aus der Besenkammer des Kommissariats gefressen, wenn er unter seiner zur Schau gestellten Gelassenheit nicht nervös geworden war. Wie zur Bestätigung fuhr er sich durch seine Tolle, die durch den Undercut noch mehr betont wurde. Die Fahrstuhltür öffnete sich, sie ließ Trespen vorangehen. Sie fuhren in den fünften Stock. Während der Fahrt schwiegen beide. Ihre Nähe schien den Geschäftsführer zu irritieren, was die Kommissarin mit Genugtuung wahrnahm.
Trespen führte sie zum Zimmer 518, öffnete die Tür und ließ ihr den Vortritt. Beide betraten das Zimmer.
„Schön, schön“, brummte die Kommissarin und sah sich um. Das Erste, das ihr auffiel, war die Aussicht. Durch das Fenster schimmerten schwach erleuchtet die Konturen der wuchtigen Fußballarena ins Zimmer. Wie sie hieß, hatte sie irgendwo gelesen, aber wieder vergessen.
„Erste oder zweite Liga?“, fragte sie.
Trespen zuckte zusammen.
„Hannover … Dings … 96“, schob Williamson nach und nickte in Richtung Fenster.
„Leider nur zweite Liga“, antwortete der Geschäftsführer. „Unser Hotel beherbergt am Spieltag viele Gäste, und wir haben rund um die Spiele viele Veranstaltungen, die damit im Zusammenhang stehen. Wenn Hannover 96 in der zweiten Liga spielt, spüren wir das natürlich auch.“
„Klar“, antwortete Williamson, hörte aber nicht richtig zu. Der 1. FC Köln war in dieser Saison erstklassig, das war das Wichtigste. Und vor allem nahm sie das Zimmer sofort gefangen.
Die Deckenbeleuchtung war aus, aber die Stehlampe und die Beleuchtung am Bett waren eingeschaltet, das Bett selbst war zerwühlt. Williamson streifte sich Gummihandschuhe über, die sie in großer Stückzahl in ihrer Manteltasche mit sich führte, ebenso wie Überzieher aus Plastik für die Füße. Es machte ihr einige Mühe, die Dinger über die Gummistiefel zu ziehen, aber es gelang ihr schließlich.
„Bleiben Sie an der Tür stehen“, wies sie Trespen an, der sich gerade anschickte, tiefer in den Raum zu treten. „Fassen Sie nichts an!“
Wortlos drehte sich der Geschäftsführer um und stellte sich mit dem Rücken an die Tür. Sie nickte ihm zu und grinste innerlich. Das Unbehagen des Geschäftsführers war mit den Händen zu greifen.
Sie stellte sich in die Mitte des Raumes, sog tief seinen Geruch ein und nahm einen herben, männlichen Duft wahr, vielleicht das After Shave des Mannes, der nun tot war. Und noch etwas anderes. Es war der Hauch eines Parfüms, das Williamson an Melone erinnerte und sicherlich sehr teuer war. Ein unzweifelhaft weiblicher Duft für eine Frau, die es gewöhnt war, exklusive Dinge zu tragen. Und sie roch noch etwas. Es war metallisch: der Geruch des Todes.
Langsam bewegte sie sich durchs Zimmer, wobei ihre Schritte von einem dicken, weißen Hochflorteppich geschluckt wurden, der perfekt zur Einrichtung passte. Als sie an die linke Seite des Bettes trat, stockte sie. Ein großer dunkler Fleck färbte den teuren Teppich dunkelrot.
Der is’ hin, dachte sie automatisch.
Das Blut sah wie eine rote Wunde in dem Weiß des Teppichs aus, wirkte dickflüssig und geronnen. Weitere dunkelrote Spritzer fand sie auf dem Bettlaken.
Ihr Blick fiel auf einen kleinen Tisch, der von zwei eleganten Sesseln eingerahmt wurde. Darauf standen auf einem Tablett eine Champagnerflasche und zwei Gläser. Sie betrachtete sie genauer. Gläser und Flasche waren leer, an einem Glas hafteten rote Lippenstiftspuren.
Vorsichtig trat sie vom Tisch zurück, wobei sie wie ein Tier Witterung aufnahm. Irgendetwas irritierte sie. Die Kommissarin wusste, dass sie spätestens jetzt die Spurensicherung informieren musste. Aber die Irritation war so stark, dass sie, den Kopf hin und her schwenkend, nach der Quelle des Unwohlseins, das ihr wie tausend Ameisen das Rückgrat hinauf- und hinunterkribbelte, suchen musste.
Ihr Blick blieb am Schreibtisch haften, der links vom Bett an der Wand stand. Ein Stuhl stand ordentlich davor, und eine Unterlage aus Leder bedeckte das Holz des Schreibtisches, wahrscheinlich Kirschbaum, vermutete Williamson. So weit so gut. Was irritierte sie dann so?
Und dann sah sie es. In der hinteren linken Schreibtischecke war das Holz verfärbt. Ein heller Kreis leuchtete ihr entgegen. Sie wandte sich an Holger Trespen, der nach wie vor reglos an der Tür stand und sie beobachtete.
„Sehen Sie den Schreibtisch?“ Sie deutete auf die Stelle mit dem Kreis. Er wollte näher kommen, aber sie hielt ihn mit einer Handbewegung auf. „Wat steht hier normalerweise?“
Trespen hob eine Augenbraue und sah sie an. „Eine Schreibtischlampe. Sie ist weg.“
Kapitel 8
Während Williamson auf ihre Kollegen und die Spurensicherung wartete, inspizierte sie das Bad. Ein kleiner schwarzer Herrenkulturbeutel stand auf dem Waschtisch. Im Kleiderschrank fand sie nichts, der Zimmersafe war leer. An der Garderobe hing ein dunkelblauer Wintermantel, der ähnlich teuer aussah wie der Mantel des Geschäftsführers. Auch der Stil war ähnlich. In den Taschen des Mantels fand sie nichts. Auf dem Nachttisch an der rechten Bettseite lagen eine Geldbörse, ein Schlüsselbund, die Schlüsselkarte des Hotels und ein Handy.
„Hallo?“, dröhnte die inzwischen wohlbekannte Stimme Cohens durch die Tür an ihr Ohr. „Frau Williamson, sind Sie da drin?“
Sie schob Trespen zur Seite, riss die Tür auf und stand Auge in Auge dem Baron gegenüber, der sie mit seinen großen, wässrigen blauen Augen anstarrte.
„Wo soll ich denn sonst sein?“, blaffte sie zurück. „Und nennen Sie mich einfach Williamson, dat reicht.“
„Okay, Williamson“, knurrte Cohen und wollte sich an ihr vorbei ins Zimmer schieben, als die Mitarbeiter der Spurensicherung auftauchten. Williamson berichtete kurz, was sie vorgefunden hatte, und wandte sich dann Cohen zu.
„Kommen Sie, wir gehen mit Herrn Trespen un’ suchen die Restaurantmitarbeiter“, forderte sie ihren ungeliebten Kollegen auf. „Mal sehen, wat die zu sagen haben.“
„Äh“, machte Cohen und deutete auf ihre Füße. Mit hochrotem Kopf streifte sich die Kommissarin die Überzieher von den Gummistiefeln, was wieder sehr mühsam war und wozu sie auf einem Bein hüpfen musste.
Unten an der Aufzugtür wartete eine der Rezeptionistinnen auf sie und knetete ihre Hände.
„Wir haben alle Servicemitarbeiter, die am vergangenen Abend Dienst hatten, herbestellt. Sie warten im Restaurant auf Sie.“
„Danke“, schnaubte Williamson und wandte sich an den Geschäftsführer, der dicht hinter ihr war. „Dann machen Sie uns mal zwei Kaffee, damit wir klar denken können.“
„Natürlich“, beeilte sich Trespen leicht irritiert zu antworten, winkte einen jungen Mann in Hotelkluft heran und forderte ihn auf, zwei Kaffee ins Restaurant zu bringen.
„Frau Kommissarin, darf ich eine Bitte äußern?“
Sie blieb stehen und sah ihn erwartungsvoll an.
„In etwa zwei Stunden beginnt das Frühstück. Wir haben viele Gäste, die geschäftlich hier sind und dementsprechend früh …“
„Wat wollen Sie mir damit sagen?“, schnitt sie ihm das Wort ab und spürte das Magma in sich hochsteigen.
„Ich … ich möchte Sie nur bitten, wenn Sie ein wenig diskret vorgehen könnten?“
Das war zu viel. Diskret? Was bildete sich dieser Lackaffe eigentlich ein?
„Diskret? Herr Trespen, darf ich Sie, in aller Höflichkeit, daran erinnern, dat ein Gast Ihres Hotels einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen is’? Un’ nit nur dat! Er is’ aller Wahrscheinlichkeit nach in IHREM Hotel, auf dessen guten Ruf Sie so sehr bedacht sind, ermordet worden. Aber wenn et Ihnen lieber is’, können natürlich auch alle Ihre Mitarbeiter in dat Kommissariat kommen. Ebenso Ihre Gäste. Die Frage is’ aber, ob Ihr Hotel dann den normalen Betrieb ÜBERHAUPT noch aufrechterhalten kann. Un’ bevor ich et vergesse: Ich brauche auch dat übrige Personal von gestern Abend. Auch dat muss befragt werden. Reicht dat fürs Erste?“
Während ihres Ausbruchs war sie immer lauter geworden und Trespen immer kleiner. Nun rauschte sie, den karpfenäugigen Cohen im Schlepptau, an ihm vorbei in Richtung Restaurant.
„Dem haben Sie es aber gezeigt“, feixte der Baron, der Trespen wohl auch nicht sonderlich leiden konnte. Zum ersten Mal kommentierte er eine Handlung Williamsons positiv.
„Wo wir gerade dabei sind“, gurrte sie nun wieder ganz ruhig. „Wieso haben Sie mir nit gleich gesagt, dat es sich bei dem Toten um Georg Middelstein handelt?“
„Ich war mir nicht sicher“, verteidigte sich Cohen. „Er sah so anders aus … als Leiche.“
„Aha, er sah so anders aus, verstehe.“ Beide hatten nun den Eingang des Restaurants erreicht. Mit einer Geste hielt sie ihren Mitarbeiter davon ab, direkt in den Raum hineinzustiefeln, und stellte sich ganz dicht vor ihn.
„Außerdem habe ich mich gewundert, dat der Trespen so schnell hier war. Ich hätte gerne die Dämchen noch eine Weile befragt, ohne dat mir der Geschäftsführer dabei im Nacken sitzt, sodat die beiden nit mehr offen reden.“
Sie machte eine kleine Pause und nahm ihren Kollegen mit zusammengekniffenen Augen ins Visier.
„Sie haben den Trespen angerufen oder ihn anrufen lassen, oder nit? Direkt, als wir im Hotel angekommen sind.“
Sie stach mit ausgestrecktem Zeigefinger in seine Richtung. „Damit wir uns hier richtig verstehen“, zischte sie und trat noch näher an ihn heran, so nah, dass sie Cohens Bartstoppeln sehen konnte. „Wenn Sie mir noch einmal eine wichtige Information vorenthalten oder unabgestimmt eine wichtige eigenmächtige Entscheidung treffen, interpretiere ich dat als vorsätzliche Behinderung UNSERER Polizeiarbeit. Dann wird dat Konsequenzen haben, verstanden?“
Was Cohen gemacht hatte, war der Versuch einer Schikane, davon war sie überzeugt.
„Klar, Chefin, klar“, stotterte Cohen.
Sie sah, wie Schweißperlen auf seine Stirn traten. Normalerweise mochte sie es nicht, wenn man sie „Chefin“ nannte, aber in diesem Moment korrigierte sie ihn nicht.
„Gut“, sagte sie zufrieden und marschierte ins Restaurant.
Die Mitarbeiter, zwei Männer und zwei Frauen, sahen durchweg übernächtigt aus. Die Frauen saßen an zwei kleinen Tischen, die Männer standen seitlich hinter ihnen. Alle vier blickten ihnen mit einer Mischung aus Neugier und Furcht entgegen.
Et sieht aus wie arrangiert, wie ein Gemälde, schoss es der Kommissarin durch den Kopf. Hatte man sie schon instruiert, was sie sagen sollten und was nicht?
„Sagen Sie Grüf… äh, Frau Grifo, sie soll herkommen, wenn sie fertig is’“, wandte sie sich an Cohen. „Ich brauche sie hier.“
Die Servicekräfte waren sehr jung. Das schien in diesem Hotel die Regel zu sein: durchweg junge Mitarbeiter. War das die Geschäftsphilosophie der Hotelkette generell oder nur dieser Geschäftsleitung hier? Irgendetwas stimmte nicht, das konnte sie körperlich spüren. Umso wichtiger war es, dass Grifo half. Williamson brauchte ihre Intuition und Menschenkenntnis.
Der junge Mann brachte den Kaffee.
Williamson blickte in die Runde. Bis auf das Klappern des Geschirrs von den Frühstücksvorbereitungen war es still.
„Vielen Dank, dat Sie gekommen sind. Wie Sie sicherlich bereits gehört haben, is’ vergangene Nacht ein Hotelgast, Georg Middelstein, wohl Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wir möchten nun den Abend des Toten, so gut et geht, rekonstruieren. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe.“
Die vier sahen sie erwartungsvoll an. Keiner sagte etwas.
Sie versuchte es erneut.
„Wir wissen, dat Herr Middelstein hier gegessen hat und dabei nit allein war, korrekt?“
„Perlhuhnbrust mit Mangoldgemüse und Kartoffelgratin“, sagte eine der Frauen leise. Die Hände hatte sie nebeneinander auf dem Tisch abgelegt und betrachtete sie interessiert, als ob sie dort etwas Wichtiges entdecken könnte. Vor allem wich sie so Williamsons forschendem Blick aus.
„Wat?“, fragte die Kommissarin überrascht.