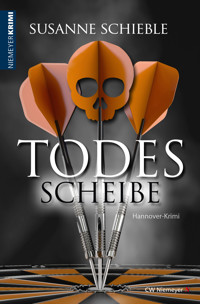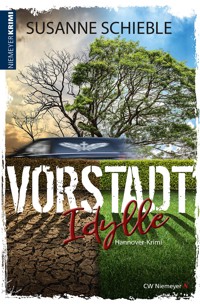
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
JE HEILER DIE WELT, DESTO TIEFER DER ABGRUND. Der Tod ist nicht genug! In einem Neubaugebiet bei Hannover wird ein Ehepaar in seinem Haus erschossen aufgefunden. Doch der Doppelmord stellt Hauptkommissarin Williamson sowie ihre Kollegen Grifo und Cohen vor einige Rätsel: Jemand hat zusätzlich brutal auf den Ehemann eingeschlagen. Warum? Hat es mit dem früheren Leben des Paares in Afrika zu tun? Je tiefer Williamson und ihr Team graben, desto weniger passt zusammen. Was die Hauptkommissarin allerdings zutage fördert, erschüttert sie bis ins Mark. Es lässt sie den Glauben an das Gute im Menschen verlieren. Und dann stellt sie auch noch fest, dass sie heimlich beobachtet und verfolgt wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Du bist der Schein rotgoldnen Herbsteslichts,Allein in mir schwillt wie ein Meer das LeidUnd lässt, rückflutend, müder Lippe nichts,Als Nachgeschmack von Schlamm und Bitterkeit.„Plauderei“ von Charles BaudelaireAus: „Le Fleur du Mal“ – „Die Blumen des Bösen“
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Die Figuren dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2023 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHISBN 978-3-8271-8453-5
Susanne SchiebleVorstadtidylle
Kapitel 1
Dräuende Sommerhitze hatte sich über den kleinen Ort Kleuthen gelegt. Die Luft flirrte schon am Morgen über dem Asphalt. Im Neubaugebiet war es still an diesem Sonntagvormittag. Die jungen Familien hatten sich in ihre Gärten zurückgezogen und genossen den freien Tag. Dann und wann war ein Juchzen zu vernehmen, wenn sich die Kinder nach dem Frühstück in den Pool stürzten oder das Trampolin bearbeiteten. Nur die wenigen Häuser, die von Ehepaaren, deren Kinder schon aus dem Haus waren, bewohnt wurden, lagen verlassen da.
Julian ärgerte sich. Immer musste Timo den Fußball über den Zaun kicken! Da kam er nicht ran, und dann verdonnerte Timo ihn auch noch dazu, ihn zu holen.
„Bist doch selbst schuld“, kreischte sein Freund ein ums andere Mal, „bist eben nicht Manuel Neuer, höchstens Kreisklasse!“
„Gar nicht wahr“, kreischte Julian zurück, „ich werde mal Torwartlegende, wirst schon sehen!“
Murrend schwang sich Julian über den Gartenzaun. Jetzt war der Ball auch noch unter einen Lieferwagen gerollt! Es war einer von den weißen, die öfters im Neubaugebiet zu finden waren. Julian fand diese Wagen besonders schön, denn an den Seiten war eine Robbe aufgeklebt. Julian legte den Kopf schief. Seltsam, bei diesem Wagen war die Robbe irgendwie anders.
Julian zuckte mit den Schultern und ging in die Hocke. Mit einem Ast bugsierte er den Ball unter dem Wagen hervor, wandte sich um und lief zu seinem Freund zurück. Für die nächsten Stunden bis zum Mittagessen war er Manuel Neuer. Den Lieferwagen mit der komischen Robbe hatte er völlig vergessen.
Am Nachmittag hatte die Hitze mit vierunddreißig Grad ihren Höhepunkt erreicht. Der ganze Norden Deutschlands, so auch Hannover und die Region, stöhnte unter den unzumutbaren Temperaturen. Auf einem VW Sharan in einem Carport ließ sich eine Amsel nieder. Sie öffnete den Schnabel und ließ ihren schönen Gesang ertönen – fast zum letzten Mal in diesem Jahr. Abrupt hörte sie damit auf, als etwas anderes ihre Aufmerksamkeit erregte. Um ein offenes Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses, in dessen Carport es sich die Amsel gemütlich gemacht hatte, schwirrten Fliegen. Es wurden immer mehr. Träge beobachtete die Amsel das Gesumme, als überlegte sie, ob sie sich eine kleine Zwischenmahlzeit gönnen sollte.
Kapitel 2
„Mann, ist das heiß!“, stöhnte Carola und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Ich muss unbedingt was trinken!“
„Is‘ ja auch kein Wunder, wenn man in der Gluthitze unbedingt Sport machen muss“, murrte ihre Mutter.
„Ach komm, Mienchen“, versuchte Carolas Vater zu schlichten und hakte sich bei ihr unter. „Ich finde es gut, dass sie einen Sport gefunden hat, der ihr so viel bedeutet.“
„Danke, Papa.“
Carola lächelte ihrem Vater zu und lief schon einmal voraus zum Essensstand, der auch kühle Getränke zu bieten hatte.
„Ja, vielleicht ein bisschen zu viel“, brummte Hauptkommissarin Williamson. „Is‘ dir schon mal aufgefallen, dat unsere Tochter nit nur deshalb so viel Spaß an Ai… dings hat, weil et ein toller Sport is‘, sondern weil da auch der Dings rumläuft, der …“
„Ole“, half ihr Bernd-Karl.
„Ole! Wat is‘ dat überhaupt für’n Name? Wieso heißen hier so viele Odo, Finn, Ubbo oder eben Ole? Et kommt mir vor, als ob die alle auf einem Fischkutter groß geworden wären!“
„Das kommt daher, weil wir in Norddeutschland leben, Mienchen. Hier gibt es eben norddeutsche Namen!“
„Wenn et sein muss“, brummte Williamson wieder und erschauerte, weil ihr ein Schweißtropfen den Rücken herunterlief. Sie hasste den Sommer. Zu hell, zu staubig, zu heiß. Viel zu … ach, wat soll et!
„Dat is‘ mir jedenfalls ein bisschen zu viel Nahkampf, wenn du verstehst, wat ich meine!“
Schmunzelnd legte Bernd-Karl einen Arm um seine Frau.
„Sie wird erwachsen, ob dir das nun gefällt oder nicht.“
„Eher nit“, murmelte Williamson wieder, lehnte sich aber an ihren Mann und atmete tief seinen Duft ein. Bernd-Karl! Wie immer schaffte er es, sie zu beruhigen.
Schließlich kamen sie bei Carola am Essensstand an.
„Mienchen, möchtest du Sushi?“, fragte Bernd-Karl seine Frau, die immer noch angestrengt umherschaute. Sofort glättete sich Williamsons Stirn. Sushi! Sie musste zugeben, dass sie den kleinen Fischhappen mit Reis geradezu verfallen war. Sie liebte Sushi! Und Bernd-Karl wusste das natürlich ganz genau.
„Gern“, strahlte sie und nahm auch schon eine der Boxen entgegen, die eine appetitliche Zusammenstellung verschiedenster Sushisorten enthielt. Williamson kämpfte wie immer mit den Stäbchen. So sehr sie Sushi mochte, so sehr verabscheute sie es, mit Stäbchen zu essen. Das hatte einen einfachen Grund: Sie bekam es einfach nicht hin.
„Habt ihr für meine Mutter vielleicht eine Gabel?“, flüsterte Carola einem jungen Servicemitarbeiter zu. „Die Stäbchen sind für sie … na ja, ein wenig schwierig.“
„Aber nur, weil du es bist“, antwortete er und ließ seine Muskeln spielen. Er hielt ihr eine kleine Plastikgabel hin und sah ihr tief in die Augen, um sie dann mit einem breiten Grinsen von oben bis unten zu mustern.
„Du siehst wirklich sportlich aus. Seit wann machst du hier mit? Ich sehe dich hier zum ersten Mal.“
„Na, na, junger Mann, widmen Sie sich mal wieder Ihrer Arbeit, nit? Da warten noch ‘ne Menge Leute, die auch essen wollen!“, ging Williamson dazwischen und schnappte sich die Gabel.
Eingeschüchtert wich der Angesprochene einen Schritt zurück. Gegen die rheinische Urgewalt hatte er keine Chance.
Williamson schob ihre Tochter ein Stück weiter zu einem Stehtisch, an dem Bernd-Karl schon wartete.
„Wat is‘ eigentlich los? Warum gehen den Kerlen so die Hormone durch, wenn sie dich sehen? Macht dat der Anzug, oder wat?“
„Das ist kein Anzug, das ist ein Aikidougi“, antwortete Carola und strich sich die verschwitzten Locken aus der Stirn. „Das muss ich tragen als Aikidoka.“
„Nur weil du Aiko machst, heißt dat noch lange nit …“
„Ai-ki-do!“, warf Carola dazwischen und rollte mit den Augen.
„Jaja, schon jut“, winkte Williamson ab und ließ den Blick über den Stadtpark mit den vielen bunten Ständen, an denen japanisches Kunsthandwerk und Fertigkeiten angeboten wurden, schweifen. „Ich muss schon sagen, wat die Janina hier auf die Beine gestellt hat, is‘ wirklich beeindruckend.“
„Nicht wahr?“, ertönte hinter ihr eine wohlklingende Männerstimme. „Das sage ich ihr auch immer, aber sie will es mir einfach nicht glauben.“
Die Williamsons drehten sich um. Wie aus dem Nichts war eine kleine Gruppe hinter ihnen aufgetaucht, deren unumstößlicher Mittelpunkt eine hochgewachsene, schwarz gelockte Dame war, die in einem wallenden, roten Seidenkleid steckte, das über und über mit schwarzen, unterschiedlich großen Paillettenkreisen bestickt war, die in der Sonne funkelten. Dazu trug sie schwarze, hochhackige Pumps, die ebenfalls mit Pailletten versehen waren.
Wie kann man damit den ganzen Tag laufen un‘ dann auch noch hier im Stadtpark?, fragte sich Williamson unwillkürlich. Sie selbst trug flache Halbschuhe, die alles andere als chic, dafür aber umso bequemer waren. Um Schuhe mit Absätzen machte sie einen großen Bogen – wenn möglich.
Die Dame kam nun mit ausgebreiteten Armen auf sie zu.
„Wilhelmine“, strahlte sie, „Bernd-Karl und Carola. Wie schön, euch zu treffen! Wie ich sehe, lasst ihr es euch schmecken. So viel Kunst und Kultur, da muss man ja hungrig werden!“
Und schon hatte sie Williamson in die Arme geschlossen und drückte sie fest. Die Kommissarin ließ es geschehen und musste gleichzeitig lächeln. Dr. Janina Mohwinkel und die großen Auftritte – eine unschlagbare Verbindung. Janina Mohwinkel war die Präsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Hannover und mittlerweile ihre beste Freundin.
„Ein tolles Fest, Janina“, sagte die Kommissarin zu ihr und ließ wieder den Blick schweifen. „Du hast alles gegeben, nit?“
„Und ob“, ertönte wieder die sonore Bassstimme. Sie gehörte Dr. Ansgar Storch, Rechtsanwalt und Liebhaber der japanischen Kultur und, wie Williamson wusste, Janinas „Gefährte“, wie sich die Präsidentin ausdrückte.
Stolz legte Ansgar Storch einen Arm um Janinas Schultern.
„Ich finde es in diesem Jahr besonders schön. All die vielen unterschiedlichen Angebote. Von Schmuck, über japanische Stoffe und Kalligrafie bis zur Gartenkunst. Und erst das Bühnenprogramm! Haben Sie die Koto-Spielerin gehört?“
Verständnislos blickte Williamson zu ihrer Freundin. Koto? Was war das nun wieder?
Da ertönte wieder eine Stimme, diesmal eine leise und doch autoritätsgewohnte sowie außerordentlich wohlklingende.
„Ohisashiburi desu, Frau Kommissarin Williamson. Es freut mich, Sie wiederzusehen.“
Williamson wollte reflexartig „Gesundheit“ sagen, verkniff es sich aber im letzten Moment. Die Geheimnisse der japanischen Sprache hatte sie noch nicht ergründet – und würde es wohl auch nie. Eine winzige Japanerin mit fein geschnittenen Gesichtszügen, in einen wunderschönen Sommer-Kimono gekleidet, verbeugte sich mit einem leichten Lächeln vor ihr.
„Et freut mich auch, Sie wiederzusehen, Frau Generalkonsulin Tanaka“, sagte Williamson und streckte ihr die Hand entgegen. Das Verbeugen ließ sie lieber sein.
„Wie haben Sie die Teezeremonie in Hamburg verkraftet?“, fragte Yoko Tanaka und zwinkerte ihr tatsächlich zu.
Williamson schüttelte sich innerlich. Im Frühjahr waren Bernd-Karl, Ansgar Storch, Janina und sie von der Generalkonsulin zu einer Teezeremonie nach Hamburg eingeladen worden. So sehr sie Sushi liebte, so sehr verabscheute sie die Bitterkeit des traditionellen grünen Tees. Generalkonsulin Tanaka war dies offensichtlich nicht verborgen geblieben.
„Et war … eine interessante Erfahrung“, antwortete Williamson ausweichend und zwinkerte zurück. Das Lächeln der Japanerin wurde breiter.
„Apropos Teezeremonie“, mischte sich nun Janina Mohwinkel ins Gespräch, „da müssen wir gleich hin. Vorher wollten wir uns aber noch ein wenig stärken.“
In diesem Moment kam ein junger, gut aussehender Mann mit blondem, verwuscheltem Haar auf die Gruppe zu und strahlte über das ganze Gesicht. Genau wie Carola trug er einen Aikidougi. Schnurstracks trat er auf Carola zu und nahm sie in die Arme.
„Da bist du ja“, strahlte er. „Komm, wir sind gleich wieder dran.“
Williamson spürte, wie das Magma in ihr hochkroch und einen ihrer gefürchteten Ausbrüche ankündigte. Mit einem schnellen Seitenblick auf seine Frau ergriff Bernd-Karl die Initiative, bevor sie etwas sagen konnte.
„Äh … geht ihr zwei doch schon mal vor. Wir kommen gleich nach.“
Die jungen Leute machten, dass sie davonkamen. Williamson klappte den Mund wieder zu und klimperte mit ihren braunen Knopfaugen.
Janina Mohwinkel sah sich suchend um.
„Wo ist denn Nicola? Ist sie nicht mitgekommen?“
„Nicola ist beim Manga-Stand“, antwortete Bernd-Karl, „und das schon, seitdem wir hier angekommen sind. Sie lässt sich alles genau erklären.“
„Ich verstehe ja nit, wieso man dat Comic-Zeichnen nach einem Obst benennt“, sagte Williamson und verstand ebenfalls nicht, wieso sie alle fassungslos anstarrten.
„Wieso heißt dat denn Mango?“, schob die Kommissarin hinterher.
Bevor irgendjemand etwas tun oder sagen konnte, um die Situation zu retten, ertönte plötzlich lautstark eine Melodie.
„Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat …“
Der Song war der neueste Klingelton ihres Handys – und zugleich die Torhymne von Williamsons Lieblingsfußballverein, dem 1. FC Köln.
Sie kramte in ihrer überdimensionalen Handtasche nach ihrem Mobiltelefon. Als sie es endlich gefunden hatte, ging sie ein Stück zur Seite, damit niemand mithören konnte.
„Ja!“, bellte sie in das Gerät.
„Chefin, es tut mir sehr leid, wenn ich Sie an Ihrem freien Sonntag störe“, ertönte die sanfte Stimme ihrer Mitarbeiterin Elena Grifo. „Aber wir haben zwei Tote in einem Einfamilienhaus in der Region. Es sieht nach Fremdeinwirkung aus.“
Williamson atmete tief durch.
„Da müssen wir hin, nütz‘ ja nix. Holen Sie mich am Stadtpark ab? Hinterer Eingang an der Kleefelder Straße?“
„Bin schon unterwegs.“
Sie mussten nicht viele Worte wechseln. Was gab es auch zu sagen?
Williamson unterbrach die Verbindung und gesellte sich zur Gruppe. Bernd-Karl sah schon an ihrem Gesichtsausdruck, was los war.
„So leid et mir tut, ich muss weg. Die Pflicht ruft.“
Janina Mohwinkel sah sie mitfühlend an.
„Wie schade, Wilhelmine. Und ich dachte, wir könnten heute Abend noch gemeinsam etwas essen.“
„Ein andermal gern. Ich muss da hin, nütz‘ ja nix.“
Ansgar Storch tippte sich mit zwei Fingern an die Schläfe.
„Waidmannsheil, Frau Kommissarin.“
Irritiert schaute sie ihn an.
„Ich gehe nit auf die Jagd, Herr Dr. Storch. Aber danke.“
Dann wandte sie sich an ihren Mann, nicht ohne vorher mit einem sehnsüchtigen Blick die halb aufgegessenen Sushi zu streifen.
„Und pass‘ mir auf Carola auf. Der Odo is‘ mir ein bisschen zu sehr im Nahkampfmodus.“
„Ole, Mienchen.“
„Oder so.“
Kapitel 3
Williamson eilte durch den Stadtpark Richtung Teehaus. Dort drängten sich die Besucher vor dem jetzt noch geschlossenen Bambustor und warteten auf die nächste Teezeremonie. Direkt daneben verlief ein kleiner, kaum erkennbarer Pfad zu einem Tor am hinteren Ende des Stadtparks, das fast niemand kannte. Janina hatte den Williamsons geraten, diesen extra für das Sommerfest geöffneten Eingang zu nutzen, dann seien sie direkt im „Getümmel“, wie sie sich ausdrückte.
Plötzlich lief Williamson ein Schauer über den Rücken. Sie spürte, dass sie beobachtet wurde. Abrupt drehte sie sich um, aber sie konnte niemanden entdecken, der sie ins Visier genommen hatte. Überall nur lachende Kinder, verliebte Pärchen und flanierende Familien im hellen Sonnenschein, durchbrochen von den Farbtupfern der bunten Kostüme der … sie hatte schon wieder vergessen, wie die Fans von dem Mango hießen. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und wandte sich ab. Das Kribbeln in ihrem Bauch ignorierte sie. Die Hitze setzte ihr anscheinend mehr zu, als sie gedacht hatte. Es war aber auch verdamp heiß!
Zehn Minuten später ließ sie sich erleichtert neben Grifo auf den Beifahrersitz des Dienstwagens plumpsen. Im Inneren war es angenehm kühl.
Unauffällig musterte Williamson ihre junge Kollegin, die die langen braunen Locken zu einem schicken Pferdeschwanz hochgebunden hatte und ein eng geschnittenes Top und Jeansshorts trug, die ihre langen Beine perfekt in Szene setzten. Elena Grifo hätte beim Sommerfest alle Herzen höherschlagen lassen. Die Kommissarin fragte sich, mit was Grifo an ihrem freien Sonntag ihre Zeit verbracht hatte. Oder mit wem. So gut sie sich verstanden und so sehr sie sich vor allem bei der anstrengenden Lösung des ersten gemeinsamen Falles Anfang des Jahres nahegekommen waren, so schnell verschloss sich Grifo wie eine Auster, wenn ihre Gespräche etwas privater wurden. Dies hatte dazu geführt, dass Williamson kaum etwas über ihre Mitarbeiterin wusste, außer dass sie segelte und sogar ein kleines Boot in einem Nordseehafen besaß. Aber von da konnte sie unmöglich hergekommen sein, das hätte noch nicht einmal Grifo mit ihrem rasanten Fahrstil geschafft. Williamson akzeptierte die unsichtbare Grenze, die ihre Kollegin um sich herum errichtet hatte. Im Prinzip war eine Trennung von Beruflichem und Privatem nicht schlecht, aber trotzdem …
„Wat wissen wir bis jetz‘?“, unterbrach Williamson ihre eigenen Gedanken, bevor diese davongaloppieren konnten.
„Noch nicht viel. Nur, dass ein Ehepaar in seinem Haus tot aufgefunden wurde. In Kleuthen, einem kleinen Ort mit dreitausend Einwohnern nordwestlich von Hannover. Er besteht hauptsächlich aus Wohngebieten, älteren und neueren. Der Ort ist in den letzten Jahren stark gewachsen und gehört zum sogenannten Speckgürtel rund um Hannover. Die meisten Bewohner arbeiten in der Stadt.“
„Ah, so“, brummte Williamson. Sie kannte derartige Orte auch aus der Umgebung von Köln. „In einem so kleinen Ort kennt fast jeder jeden. Dat kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil.“
Grifo schaute sie von der Seite an, während sie gewohnt sicher über den Messeschnellweg in Richtung A 2 fuhr.
„Dann sollten wir die Vorteile nutzen und die Nachteile in einen Vorteil umwandeln, was meinen Sie, Chefin?“
Williamson grinste.
„Sie sagen et!“
Kleuthen präsentierte sich als Postkartenidylle. Am Ortseingang hieß sie ein liebevoll gestaltetes Schild in dem „Kleinod der Region Hannover“ willkommen. Sie passierten zwei Kreisel mit stilvoll gestalteten Blumenbeeten und danach einen Ortskern, der den alten Teil Kleuthens darstellte. Er bestand aus den typischen Klinker- und Fachwerkhäusern rund um einen gepflasterten Marktplatz, in dessen Mitte ein Brunnen stand, aus dem zwei schmiedeeiserne Skulpturen herausragten, ein Junge und ein Mädchen, mittelalterlich gekleidet. An den Fenstern der Häuser und rund um den Platz quoll ebenfalls eine Blütenpracht aus den Blumenkästen und leuchtete in bunten Farben.
„Die werden hier nit oft ein Gewaltverbrechen erlebt haben“, kommentierte Williamson die perfekte Umgebung.
„Bestimmt nicht“, stimmte Grifo zu und nickte heftig mit dem Kopf, sodass ihr Pferdeschwanz auf und ab wippte. „Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für uns?“
„Dat kann ich jetz‘ noch nit sagen, Frau Grüff… Grifo“, antwortete Williamson.
Jetzt wäre es ihr fast schon wieder passiert: Aufgrund des Namens nannte Williamson ihre Kollegin im Stillen – oder manchmal eben nicht im Stillen – „Grüffelo“. Auch wenn Elena Grifo ihr versichert hatte, dass sie nichts dagegen habe, wenn ihr ein „Grüffelo“ herausrutschte, versuchte sie es nach Möglichkeit zu vermeiden, um peinliche Situationen erst gar nicht heraufzubeschwören. Meistens gelang es ihr, manchmal nicht.
Verlegen blickte Williamson aus dem Seitenfenster und ignorierte das leichte Lächeln, das sich auf Grifos Züge gelegt hatte. Die Kommissarin betrachtete das Neubaugebiet, in das sie gerade abgebogen waren. Auch hier das gleiche Bild: akkurat gepflegte Vorgärten hinter weißen Gartenzäunen, schicke Einfamilienhäuser und großzügige Gärten, in denen Kinder spielten und Hunde am Zaun hin und her liefen. Einfach perfekt – für Williamsons Geschmack zu perfekt.
„Da frage ich mich immer, wat hinter den Gartenzäunen los is‘“, sagte Williamson und umfasste mit einer ausholenden Geste die gesamte Umgebung.
In diesem Moment bog ihre Kollegin in eine Seitenstraße ein und musste gleich darauf scharf bremsen. Eine Menschenmenge blockierte die kleine Straße vollständig. Aufgeregt schnatternde Frauen und wild umherschauende Männer standen dicht beieinander und gestikulierten wild, Kinder liefen zwischen den Beinen der Erwachsenen herum. Einige zeigten aufgeregt auf einen großzügig geschnittenen Bungalow, vor dem Polizei- und Krankenwagen standen. Die wild blinkenden Lichter der Einsatzwagen schienen die aufgeheizte Luft zum Flirren zu bringen.
„Wat soll dat?“, schrie Williamson und öffnete energisch das Fenster. Sie streckte den Kopf heraus und wedelte mit ihrem rechten Arm, damit die Menge Platz machte, um sie durchzulassen. Keine Chance. Die Menge bekam gar nicht mit, dass sie hier hinter ihr standen.
Grifo hupte.
„Hey, gute Frau“, ein bärtiger Mann wandte sich ihnen zu. „Sie können hier nicht durch, es hat da vorne zwei Tote gegeben. Die Polizei ist schon da.“
Vertraulich beugte er sich zu Williamson ans geöffnete Fenster.
„Das waren zwei ganz normale Leute, die da gestorben sind. Da soll eine Menge Blut sein in dem Haus!“
„Nix ‚gute Frau‘, juter Mann. Wir sind von der Kriminalpolizei un‘ müssen hier durch. Un‘ Sie“, Williamson stach mit ihrem molligen Finger in Richtung des Gesichts des Mannes, „sorgen jetz‘ umgehend dafür, dat wir hier durchkommen, sonst belange ich Sie wegen Behinderung unserer wichtigen Polizeiarbeit, is‘ dat klar?“
Der Mann schreckte zurück, als er des hochroten Kopfs der Kommissarin gewahr wurde. „Magma“ hatten die ehemaligen Kollegen in Köln ihre gefürchteten Ausbrüche getauft. Doch diesmal blieb der Ausbruch aus.
Stattdessen krümmte Williamson den Zeigefinger, der immer noch auf das Gesicht des Mannes gerichtet war, und bewegte ihn hin und her.
„Kommen Sie doch mal her, Herr …“ Williamson legte den Kopf schräg, klimperte mit ihren Knopfaugen und lächelte einladend.
Der Mann kam zögernd näher.
„Wrede. Sebastian Wrede“, flüsterte er verschwörerisch zurück.
Die Kommissarin blickte nach rechts und links.
„Sie können uns helfen, Herr Wrede. Sorgen Sie dafür, dat der Weg bis zum Haus frei wird, damit wir weiterfahren können. So helfen Sie der Polizei un‘ unseren Ermittlungen. Damit sind Sie für uns unersetzlich.“
Sebastian Wrede richtete sich zu seiner vollen Größe auf und streckte die Brust heraus. Es fehlte nur noch, dass er salutierte.
„Selbstverständlich, Frau Kommissarin. Der Polizei helfe ich doch gern. Schließlich muss ein Verbrechen aufgeklärt werden.“
Der Mann wandte sich ab und ging zackigen Schrittes an die Arbeit.
„Lasst den Wagen durch, Leute. Die sind von der Kriminalpolizei“, schrie er.
Das aufgeregte Gesumme legte sich beinahe sofort, und die Menge teilte sich wie das Rote Meer in der Bibel. Grifo fuhr langsam hinter Wrede her, der die Menge mit hoch erhobenen Händen beschwichtigte und immer wieder: „Das sind Damen von der Kriminalpolizei“, rief.
Williamson schaute zurück. Sofort schloss sich der Menschenauflauf hinter ihnen wieder, und das Getuschel setzte erneut ein.
„Gut gemacht“, flüsterte Grifo mit breitem Grinsen.
„Zuckerbrot un‘ Peitsche“, flüsterte Williamson zurück und zwinkerte ihr zu. „Funktioniert immer.“
Sebastian Wrede machte vor dem Bungalow halt, verbeugte sich leicht und stemmte die Hände in die Hüften.
„Da sind wir. Das ist das Haus der Jansens.“
Grifo parkte hinter einem zerbeulten alten Audi, und die Kommissarinnen stiegen aus. Williamson stellte sich auf die Zehenspitzen und klopfte dem großen Mann auf die Schulter.
„Danke, Herr Wrede, jut gemacht. Ich werde Sie lobend erwähnen.“
Wann und wobei, ließ sie offen. Sie hatte das ohnehin nicht vor.
Wieder machte Wrede eine leichte Verbeugung, drehte sich um, hob die Hände zum Gruß in die Menge, die ihm stehend applaudierte. Dass er die Aufmerksamkeit genoss, war nicht zu übersehen.
„Wenn ich et nit besser wüsste, würde ich sagen, wir sind auf einem Jahrmarkt“, kommentierte Williamson sarkastisch und schaute ihm hinterher.
„Mit Gruselfaktor“, meinte Grifo und wandte sich dann an einen stämmigen Mann, der an der Eingangstür stand. Er hatte ein großes Taschentuch aus seiner abgewetzten Jeans, die ihm unter dem Bauch hing, hervorgezogen und wischte sich damit im Gesicht herum. Sein Hemd war an der Brust weit aufgeknöpft und offenbarte ein dichtes Gewimmel von Brusthaaren. Es war schweißdurchtränkt.
„Herr Cohen, was haben wir?“
Williamson seufzte. Grifo war ein Geschenk des Himmels – oder vielmehr das von Kriminalrat Dr. Rico Habernickel, der ihr die junge Oberkommissarin am Anfang des Jahres zugeteilt hatte. Aber er hatte ihr eben auch Sascha Cohen zugeteilt, ihren zweiten Mitarbeiter. Richtig schlau wurde sie aus ihm nicht. Anfangs war er ihr abweisend, gar feindselig begegnet, aber sie hatte herausgefunden, dass er ein hervorragender Rechercheur war. Das war ihr nur recht, denn so konnte sie ungestört mit Grifo ermitteln. Er war ihr gegenüber im Laufe der Zeit ein wenig aufgetaut, steckte aber immer noch mit ihrem größten Konkurrenten im Kommissariat, Hauptkommissar Balustreit, die Köpfe zusammen. Sie war ihm gegenüber nach wie vor vorsichtig.
Da er Sascha Cohen hieß, wurde er im Kommissariat gerne „der Baron“ genannt, nach dem Schauspieler Sacha Baron Cohen, wobei sich die Gemeinsamkeit beim Namen erschöpfte.
Die Haare, die er auf der Brust hatte, fehlten ihm auf dem Kopf. Die wenigen Strähnen hatte er über die Glatze gekämmt, was aber auch nichts nutzte: Die Kopfhaut war nicht zu übersehen. Als er die beiden erblickte, traten seine blauen Augen hervor.
„Chefin, da sind Sie ja. Hier ist vielleicht was los! Evelyn und Rudolf Jansen, siebenundfünfzig und achtundfünfzig Jahre alt. Sie lebten hier allein. Die Frau liegt im Flur, erschossen. Der Mann befindet sich im Schlafzimmer im Bett …“, Cohen schüttelte sich und wurde unter dem Schweißfilm, der seine Haut bedeckte, blass. „Sie sollten sich das selbst ansehen.“
Williamson beobachtete seine Reaktion aus zusammengekniffenen Augen. So mitgenommen hatte sie ihren Mitarbeiter noch nie erlebt.
„Dat werde ich. Schnappen Sie sich derweil ein paar Kollegen un‘ sperren Sie hier ab. Dat is‘ ja nit zum Aushalten! Außerdem können Sie gleich mit den Befragungen anfangen. Nachbarn, Freunde un‘ so. Die stehen hier bestimmt alle rum. Sie kennen ja den ganzen Quatsch!“
„Mache ich. Die Frau, die den Mann gefunden hat, ist eine Nachbarin und wird gerade zu Hause von unserer Polizeipsychologin betreut. Sie steht unter Schock.“
Auch Cohen sah aus, als stünde er unter Schock. Er war noch eine Spur blasser geworden, falls das überhaupt möglich war. Natürlich war der Anblick von zwei getöteten Menschen nicht schön, aber als Kriminalkommissar der Mordkommission war er das doch gewohnt. Was hatte ihn nur so aus der Fassung gebracht?
„Gut, Herr Cohen.“
Williamson wandte sich an Grifo, die schweigend gewartet und die Kollegen von der Kriminaltechnik beobachtet hatte, die in beständigem Fluss ins Haus hinein- und wieder herausgingen und sehr beschäftigt waren.
„Dann wollen wir mal, nütz‘ ja nix!“
Damit betrat Williamson das Haus, Grifo dicht hinter ihr.
„Halt!“ Eine energische, weibliche Stimme hielt sie auf, und eine behandschuhte Hand bedeutete ihnen, stehen zu bleiben. Sie gehörte zu einer zierlichen Gestalt in einem weißen Ganzkörperanzug, der „Uniform“ der Kriminaltechnik.
„Frau Kommissarin, Sie wissen doch, dass Sie hier nicht so einfach reinmarschieren können! Sie sollten sich schon wenigstens Überzieher über die Schuhe stülpen und Handschuhe tragen!“ Beides wurde ihr von derselben behandschuhten Hand unter die Nase gehalten.
„Ich weiß ja, dass ich Sie nicht in einen Anzug reinbekomme. Hier!“
Hektisch schüttelte Williamson den Kopf, nein, in einen dieser weißen Plastikanzüge stieg sie nicht, komme was wolle.
„Nit in tausend Jahren, Frau Walter, danke!“
Schnell schnappte sie sich die Schutzdevotionalien und versuchte, auf einem Bein hüpfend, die Überzieher über ihre Schuhe zu bugsieren. Mit hochrotem Gesicht blickte Williamson schließlich auf und schnaufte.
„Geschafft. Wir können loslegen. Wat haben wir?“
Alina Walter, die Leiterin der Kriminaltechnik, verzog das Gesicht hinter der Schutzmaske und ging einige Schritte voran. Ihre Kollegen waren im Flur emsig dabei, Spuren zu sichern und die Leiche zu fotografieren, die im Gang lag.
„Hier liegt die Frau, noch im Morgenmantel. Es sieht so aus, als ob sie die Tür geöffnet hätte, und noch bevor sie reagieren konnte, wurde ihr in die Stirn geschossen. Die Wucht war so stark, dass sie ein Stück nach hinten geschleudert wurde.“
Alina Walter beugte sich zu der Leiche hinunter und zeigte auf das Einschussloch in der Stirn. Es war so klein, dass man kaum glauben konnte, dass es eine derart verheerende Wirkung entfalten konnte. Unter dem Kopf der Frau hatte sich eine Lache geronnenen Blutes ausgebreitet. Die Kommissarin schluckte. Alina Walter fing ihren Blick auf, und schweigend schüttelte Williamson den Kopf. Nein, sie würde sich den Hinterkopf der Frau nicht ansehen.
Auch sie beugte sich zu der Frau hinunter, die leicht verdreht auf dem Rücken lag. Sie war mittelgroß, mit halblangen, gelockten, braunen Haaren. Auch im Tod war erkennbar, dass sie eine gepflegte Frau mit einem hübschen Gesicht gewesen war, auf das sich ein Ausdruck des Erstaunens gelegt hatte.
„Profis“, murmelte Williamson, richtete sich auf und blickte zurück zur Tür.
Grifo, die wie immer schweigend dabeigestanden und sich eifrig Notizen in ihrem akkurat geführten Schreibheft gemacht hatte, hob den Kopf.
„Es war vielleicht ein Auftragsmord. Saubere Arbeit.“
Alina Walter schüttelte den Kopf. Ihre braunen Augen hinter der Schutzmaske blitzten.
„Das könnte man meinen, aber warten Sie ab, bis Sie den Mann gesehen haben. Kommen Sie.“
Die Kriminaltechnikerin ging voraus durch ein geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer in den hinteren Teil des Hauses. Aus dem Augenwinkel sah Williamson große fremdartige Gegenstände an den Wänden hängen oder frei im Raum stehen. An der Tür zum Schlafzimmer, in dem weitere Kollegen ihrer Arbeit nachgingen, hielt Alina Walter an und drehte sich um.
„Ich warne Sie lieber vor. Kein schöner Anblick“, sagte sie in ihrer nüchternen Art.
Die Kommissarinnen schauten sich an und folgten ihr in den Raum. Neben Williamson sog Grifo scharf die Luft ein. Und auch die erfahrene Kommissarin, die schon viel gesehen hatte, spürte, wie sich Speichel in ihrer Mundhöhle sammelte. Der typisch metallische Geruch von Blut lag in der Luft. Ihnen bot sich ein grässlicher Anblick.
Kapitel 4
Der Mann lag auf dem Rücken. Dass es sich überhaupt um einen Mann handelte, konnten die Kommissarinnen nur an seinem Körperbau erkennen, denn das Gesicht war nur noch eine breiige, blutige Masse. Auch der Körper hatte einiges abbekommen und lag seltsam verrenkt auf den blutbesudelten Laken. Blut befand sich in breiten Spritzern nicht nur auf dem Bett und dem Boden, sondern auch am Kopfteil und sogar an der Wand über dem Bett. Auf das Opfer musste mit roher Gewalt eingeschlagen worden sein, und das nicht nur einmal.
„Mein Jott, da muss jemand komplett ausgerastet sein!“, entfuhr es Williamson. Sie schlug nach einer brummelnden Fliege, die um ihr Gesicht herumflog.
Elena Grifo schüttelte sich, überwand sich dann aber und ging einige Schritte auf das Bett zu.
„Das sieht nach einem Fall von Overkill aus.“ Sie schluckte und wandte sich dann an ihre Vorgesetzte. „Wut, Chefin. Große Wut, ansonsten ist das nicht erklärbar.“
Als Overkill wurde eine Mehrfachtötung bezeichnet, bei der deutlich mehr Gewalt aufgewendet wurde, als nötig gewesen wäre. Genau das schien hier der Fall zu sein.
Eine schlaksige Gestalt, die über die Leiche gebeugt war, richtete sich auf und drehte sich zu Grifo um. Trotz des furchtbaren Anblicks in dem Zimmer blitzte für einen kurzen Moment ein freudiger Ausdruck in den blauen Augen auf, und das jungenhafte Gesicht hinter der Schutzmaske verzog sich zu einem leichten Lächeln.
„Elena.“ Dr. Sven Michellsen, der verantwortliche Rechtsmediziner, schaute dann über die junge Kollegin hinweg und sah zu Williamson. „Frau Kommissarin.“
Williamson nickte dem jungen Mann zu.
„Michel.“
Unter anderen Umständen wäre Dr. Michellsen in lautes Lachen ausgebrochen, da Williamson seinen Namen bei jeder Begegnung verballhornte und ihn konsequent „Michel“ nannte. Aber heute blieb er ernst und wandte sich zu dem Toten um, der nicht mehr als der Mann zu erkennen war, der er einmal gewesen war.
„Du hast recht, Elena. Auf den Mann wurde mit aller Gewalt eingeschlagen, aber er wurde dennoch erschossen. Hier“, Michellsen zeigte auf das, was einmal die Stirn des Mannes gewesen war.
Grifo und Williamson beugten sich über den verunstalteten Kopf und versuchten, ihre Abscheu zu überwinden. Das war einmal ein Mensch gewesen, und ihm gebührte Respekt, auch im Tod. In Williamson regte sich der unbändige Wunsch, diesen Mord, und um nichts anderes konnte es sich hier handeln, aufzuklären.
Michellsen zeigte auf die blutige Masse.
„Hier ist der Schuss hineingegangen. Zusätzlich wurde er brutal erschlagen.“
„Zusätzlich? Was meinst du damit?“
Elena Grifo wandte den Blick von dem furchtbar zugerichteten Gesicht des Toten ab und sah Michellsen in die Augen. Dieser hielt ihren Blick einen Moment zu lange gefangen, wie Williamson feststellte. Unter anderen Umständen wäre sie darüber amüsiert gewesen. Heute nicht.
„Er hat einen Schuss in die Stirn abbekommen, genau wie die Frau. Zusätzlich wurde er brutal zu Brei geschlagen.“
Auch die Hauptkommissarin wandte sich von dem Toten ab und Michellsen zu.
„Kannst du sagen, wat zuerst war? Der Schuss oder dat Schlagen? Un‘ vor allem wann ungefähr?“
„Genau kann ich das noch nicht sagen, da müssen wir die Obduktion abwarten. Ich vermute, dass der Schuss zuerst erfolgt ist und dann brutal auf ihn eingeschlagen wurde. Die Leichenstarre ist voll ausgeprägt, bei beiden Opfern. Also liegt der Angriff circa sechs bis acht Stunden zurück. Aber wie gesagt, Genaueres …“
„… kannst du erst nach der Obduktion sagen, schon klar“, vervollständigte Elena Grifo den Satz.
Williamson schluckte und bedeutete ihrer Kollegin, dass sie sich zurückziehen sollten, damit die Kollegen ihrer Arbeit nachgehen konnten. Sie durchquerten wieder das Wohnzimmer und gingen an der Leiche der Frau im Flur vorbei, die von den Kollegen gerade in einen Leichensack gepackt wurde.
„Holen Sie Cohen un‘ lassen Sie uns in den Garten gehen, Frau Grifo. Ich gehe schon mal vor.“
Mit diesen Worten verließ Williamson das Haus, ging um es herum geradewegs in den geschmackvoll hergerichteten Garten. Sie verfolgte mit den Augen eine Hummel, die sich gerade auf einem Lavendelbusch niederließ, wo viele ihrer Artgenossinnen bereits emsig bei der Arbeit waren. Der Busch verströmte einen betörenden Duft und ließ vor Williamsons innerem Auge die wunderschöne Landschaft der Provence entstehen. Wann waren sie dort im Urlaub gewesen? Vor zwei Jahren?
Williamson sog genießerisch den Duft des Lavendels ein. Wie friedlich es im Garten war! Unglaublich, dass wenige Meter hinter ihr im Haus der Jansens so ein schreckliches Verbrechen geschehen war.
Die Kommissarin setzte sich auf einen der Gartenstühle und fuhr sich durch ihre roten Haare, die wie immer nach allen Seiten abstanden. Plötzlich waren Schritte zu hören, und Grifo und Cohen bogen um die Ecke. Schweigend setzten sie sich. Alle drei beobachteten eine Weile das Treiben der Insekten im Lavendel und das Picken der Amseln auf dem makellos gestutzten Rasen.
Schließlich schlug Williamson mit beiden Händen auf ihre Oberschenkel.
„Also jut. Nütz‘ ja nix. Wat haben wir?“
Grifo und Cohen zückten ihre jeweiligen Notizbücher. Cohen begann.
„Evelyn und Rudolf Jansen, siebenundfünfzig und achtundfünfzig Jahre alt. Sie lebten seit fünfzehn Jahren hier in Kleuthen, zunächst mit ihren Kindern Nina und Philipp. Die beiden sind inzwischen aus dem Haus und studieren in Hamburg und Aachen. Eine unauffällige Familie. Alle Anwohner sagen das Gleiche: Sie waren beliebt, fleißig und freundlich und in das Gemeindeleben integriert. Rudolf war im Fußballverein aktiv, und Evelyn engagierte sich ehrenamtlich im hiesigen Jugendklub.“
„Wat machten die beiden denn beruflich?“
Cohen blickte wieder auf seine Notizen.
„Rudolf Jansen war Tiefbauingenieur bei der Kannichen Hoch- und Tiefbau GmbH in Hannover. Evelyn Jansen war Lehrerin für Deutsch und Englisch am Gymnasium hier in Kleuthen, das nicht nur für die Schülerinnen und Schüler hier vor Ort zuständig ist, sondern dessen Einzugsgebiet sich auch auf die Nachbarorte erstreckt“
„Klingt alles völlig normal.“ Williamson rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl hin und her. Fast schon zu normal für ihren Geschmack. Das wohlbekannte Kribbeln unter der Bauchdecke machte sich bemerkbar.
Grifo blickte auf.
„Die Kinder müssen informiert werden. Ich übernehme das.“
Sie sprang auf und verschwand. Die Kommissarin schickte einen gedanklichen Dank an Kriminalrat Habernickel. Ihre junge Kollegin war einfach unersetzlich.
Cohen hob den Kopf und wies mit dem Kinn zum rechten Nachbargrundstück.
„Es gab eine Ausnahme, was die Beliebtheit der Jansens betrifft. Mit dem Nachbarn dort lag Rudolf Jansen im Streit. Es ging um die Hecke. Wann und wie sehr sie geschnitten werden sollte oder so.“
Williamson verzog das Gesicht.
„Glauben Sie im Ernst, dat der Doppelmord da drin wegen einer falsch geschnittenen Hecke passiert is‘?“
Cohen öffnete den Mund, sagte aber nichts, sondern sah sie nur mit seinen großen, wässrig-blauen Augen an.
Die Kommissarin hob in einer entschuldigenden Geste die Hände.
„Sie haben ja recht. Wir müssen alles berücksichtigen. Wie heißt der jute Mann denn?“
„Michael Wanner. Kein angenehmer Zeitgenosse, wenn Sie mich fragen.“
Williamson blickte ihren Mitarbeiter überrascht an. Es war äußerst selten, dass Cohen eine persönliche Beobachtung mitteilte. Michael Wanner musste bei ihm einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Sie stemmte sich aus ihrem Sitz.
„Na, dann wollen wir den lieben Herrn Nachbarn mal befragen. Un‘ wer weiß? Vielleicht is‘ er durchgedreht un‘ hat die beiden umgebracht, weil sie sich nit über die Heckenhöhe einig werden konnten“, sagte sie und marschierte los. Cohen blieb nichts anderes übrig, als hinterherzulaufen.
„Äh … Herr Cohen, der Wanner is‘ jetz‘ doch zu Hause, oder nit?“
Der Kommissar schrak zurück und nickte hastig.
„Ja, er müsste jetzt im Haus sein.“
„Na dann los“, bestimmte seine Vorgesetzte.
Auf ihren stämmigen Beinen marschierte sie voran zum Nebenhaus. Die Menge hatte sich weitestgehend zerstreut, nur noch vereinzelte Grüppchen standen herum und tuschelten. Gerade als sie auf der kleinen Zuwegung des Nachbarhauses waren, ging ein Raunen durch die noch verbliebenen Menschen. Zwei Särge wurden aus dem Haus getragen und in die bereitstehenden Leichenwagen gehievt. Hinter einer Absperrung waren Übertragungswagen, Kameraleute und Journalisten mit Mikros aufgereiht. Die Medienleute brüllten Williamson und Cohen Fragen zu, die beide geflissentlich ignorierten.
Energisch drückte Williamson auf die Klingel, die unter einem selbst gemachten Tonschild angebracht war, auf dem in ungelenker Schreibschrift „Wanner“ geschrieben stand, darunter waren zwei Herzchen aufgemalt.
Mit einem Ruck wurde die Tür aufgerissen. Ein untersetzter Mann mit gelocktem, dunkelblondem Haar und Dreitagebart öffnete.
„Wir sagen nichts!“, stieß er hervor und blitzte Williamson aus schmalen Augen an. Er war unübersehbar wütend.
„Mir schon!“, antwortete Williamson trocken und hielt ihm ihre ID-Karte unter die Nase.
„Williamson, Kripo Hannover, meinen Kollegen Cohen kennen Sie ja schon.“
Der Mann schrak zurück, fasste sich aber gleich darauf wieder.
„Ah … so. Sie müssen entschuldigen, aber die Presse … die nervt ganz schön mit ihren Fragen.“
„Wem sagen Sie dat? Dürfen wir reinkommen? Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Sie sind doch Michael Wanner, oder?“
Der Nachbar beugte sich zu ihrer Karte herunter und studierte sie genau. Dann holte er tief Luft und nickte.
„Ja, klar. Kommen Sie.“
Er öffnete die Tür und ging voran durch das Einfamilienhaus, das schlicht mit wenigen Möbeln eingerichtet war. Michael Wanner machte eine Geste Richtung Terrasse.
„Am besten, wir gehen nach draußen. Meine Frau und ich haben gerade einen Kaffee getrunken auf den Schreck.“
Sie betraten eine kleine Holzterrasse, auf der Gartenmöbel, ebenfalls aus Holz, und ein Sonnenschirm standen. Eine schmale Frau mit blassem Gesicht und kurz geschnittenem, braunem Haar saß auf einem der Stühle und nippte an einer Kaffeetasse. Sie blickte auf, und ihre Augen weiteten sich. Vor Schreck oder vor Erstaunen, fragte sich Williamson.
„Meine Frau Doris“, stellte Wanner seine Frau vor und wandte sich dann an sie. „Die Herrschaften“, er betonte das Wort „Herrschaften“ auf sarkastische Weise, „sind von der Kriminalpolizei.“
„Bitte, nehmen Sie Platz“, hauchte Doris Wanner und deutete mit schlaffer Geste auf die noch zwei verbliebenen Stühle. Ihr Mann runzelte missbilligend die Stirn, sagte aber nichts. Ihm war deutlich anzumerken, dass ihm das freundliche Verhalten seiner Frau nicht passte.
„Möchten Sie auch einen Kaffee?“, fragte Doris Wanner mit ihrer leisen Stimme.
Bevor die Kommissare antworten konnten, ging Michael Wanner dazwischen.
„Das wird nicht nötig sein, Schatz. Die Herrschaften bleiben nicht lange!“
Williamson ließ sich nicht beirren.
„Gern, Frau Wanner, dat is‘ sehr nett. Wir nehmen beide einen.“
Michael Wanner stand immer noch neben dem Tisch. Sein Gesicht war dunkelrot angelaufen, und er hatte die Hände zu Fäusten geballt. Machtlos sah er zu, wie seine Frau aufstand, um zwei weitere Tassen zu holen.
Williamson blickte zu ihm auf. Er schien eine kaum zu bändigende Wut in sich zu tragen – ein Typ, der Streit geradezu anzog.
„Setzen Sie sich, Herr Wanner. Sonst kriege ich einen steifen Nacken!“
„Mir doch egal!“, stieß er heftig hervor, setzte sich aber hinter den Tisch auf eine Holzbank, die mit geblümten Sitzkissen geschmückt war. Der stämmige Mann sah auf der Bank merkwürdig fehl am Platze aus.
Doris Wanner kam mit zwei Tassen zurück und schenkte ihnen den Kaffee ein. Nachdem Williamson die zwei obligatorischen Stück Zucker dazugegeben und umgerührt hatte, nahm sie ihr Gegenüber ins Visier.
„Also, Herr Wanner. Sie haben meinem Kollegen gesagt, dat et mit Rudolf Jansen Streit gegeben hat. Worum ging et da?“
Wanner hatte immer noch die Hände zu Fäusten geballt. Auch wenn er saß, sah es so aus, als wäre er gespannt wie eine Feder, jederzeit bereit, aufzuspringen, um Gott weiß was zu tun.
„Ich habe die verdammte Hecke geschnitten! Da kommt mein Herr Nachbar angerannt und schreit mich an, mich! Ich solle das sein lassen, weil Vögel in der Hecke brüten könnten! Stellen Sie sich das mal vor!“
Wanner war immer lauter geworden, die Fäuste hatte er bei den letzten Worten auf den Tisch fallen lassen, dass das Geschirr schepperte.
Williamson schnappte sich ihre Tasse und hielt sie fest. Während ihr Mann immer lauter geworden war, war Frau Wanner immer tiefer in ihren Stuhl eingesunken, den Blick auf ihre Kaffeetasse gerichtet. Sie legte behutsam die Hand auf seinen Arm.
„Michael, bitte …“
Mit einer heftigen Bewegung stieß er ihre Hand beiseite.
„Lass mich!“
Er sprang auf und lief auf der Terrasse hin und her. Schließlich blieb er stehen und stach mit seinem Zeigefinger in Richtung der Kommissarin.
„Wissen Sie, wie Rudolf Jansen war? Er war ein Wichtigtuer und Besserwisser! ,Ach, die armen Tiere, die verlieren ja ihr Zuhause und können nicht brüten! Das geht ja gar nicht!‘ Er wollte unsereins belehren, immer wieder! Das war so zum Kotzen, das sage ich Ihnen!“
Schnaufend hielt er inne. Williamson hatte seinen Ausbruch ruhig verfolgt und klimperte nun mit ihren Knopfaugen, während Cohen ungerührt an seinem Kaffee schlürfte. Eine Weile war nur dieses Geräusch zu hören.
„Herr Wanner, beruhigen Sie sich. Wenn ich et mal sarkastisch ausdrücken wollte, sind Sie dat Problem ja jetz‘ los. Keiner wird sich mehr aufregen, dat Sie die Hecke in der Verbotszeit schneiden.“
„Was wollen Sie damit sagen?“, fuhr Wanner auf. „Verdächtigen Sie etwa mich? Ich glaube es nicht! Sie sind komplett verrückt geworden!“
Er machte zwei Schritte auf die Kommissarin zu, aber er hatte nicht mit Cohen gerechnet. Während Doris Wanner immer wieder mit verzweifelter Stimme: „Michael, Michael“, rief, war er so schnell aufgesprungen und an die Seite seiner Chefin getreten, dass Wanner noch nicht einmal mit der Wimper zucken konnte.
„Vorsicht, Herr Wanner“, sagte Cohen mit gefährlich leiser Stimme, „überlegen Sie jetzt genau, was Sie tun.“
Mit nach wie vor geballten Fäusten, das Gesicht hochrot vor Zorn und mit aufgepumptem Oberkörper, stand Michael Wanner vor den Kommissaren. Seine Frau war ebenfalls aufgesprungen und hatte wieder beruhigend eine Hand auf seinen Arm gelegt.
„Die Polizisten machen doch nur ihre Arbeit, Michael“, flüsterte sie. „Bitte, setz‘ dich wieder hin.“
Überraschenderweise ließ sich der Mann von seiner Frau wieder zur Bank führen und setzte sich. Anscheinend hatte sie mit ihrer ruhigen und behutsamen Art einen gewissen Einfluss auf ihn. Auch Cohen nahm wieder Platz, behielt aber den cholerischen Nachbarn im Auge.
„So, nachdem wir uns alle wieder beruhigt haben, muss ich Ihnen die Frage stellen, wo Sie heute Morgen gewesen sind“, sagte Williamson und ließ Wanner nicht aus den Augen.
„Ja, was glauben Sie denn, wo ich war? Ich war hier, den ganzen Morgen. Wir haben bis neun Uhr geschlafen, dann gefrühstückt, dann waren wir im Garten, das war alles!“, schrie Wanner und machte schon wieder Anstalten aufzuspringen.
„Genauso war es“, wisperte Doris Wanner und nickte bekräftigend dazu.
Beschwichtigend hob Williamson beide Hände.
„Sehen Sie, dat war et auch schon. Hat doch gar nit wehgetan.“
Sie erhob sich, Cohen ebenfalls.
„Danke, Herr Wanner, Frau Wanner. Wir finden allein hinaus.“
Im Gehen wandte sie sich noch einmal um und sah zu ihrer Überraschung, dass der Mann die Arme auf die Knie aufgestützt hatte und den Kopf hängen ließ. Doris Wanner dagegen war dicht hinter sie getreten.
„Ich begleite Sie hinaus“, sagte sie leise.
Auf dem Weg zur Haustür hielt sie die Kommissarin am Arm fest.
„Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Immerzu denkt er, die ganze Welt will ihm Böses. Er meint es nicht so.“
Die Kommissarin sah der Frau forschend ins Gesicht, sah die dunklen Ringe, die eingefallenen Wangen und die müden Augen. Sie überkam eine Welle des Mitleids. Doris Wanner hatte es mit ihrem Mann nicht leicht, und sie war unglücklich, das war nicht zu übersehen. Williamson hätte ihr gern gesagt, dass es immer eine Möglichkeit gab, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, aber wie sie immer zu ihrer jungen Kollegin Grifo sagte: Sie konnte nicht die ganze Welt retten.
„Danke für den Kaffee, Frau Wanner“, sagte sie stattdessen, wandte sich ab, drehte sich an der Haustür aber noch einmal um. „Viel Glück“, sagte sie leise. „Kommen Sie, Cohen, wir haben noch viel zu tun.“
Kapitel 5
„Boah, wat für ein Stinkstiefel“, schnaubte die Kommissarin und sah sich zu Cohen um, der dicht hinter ihr ging. „Übrigens danke, Herr Cohen. Einen Moment lang habe ich wirklich gedacht, der Wanner geht auf mich los. Dat wäre noch die Krönung des heutigen Tages gewesen.“
Cohen lächelte leicht, was er äußerst selten tat, und entblößte dabei zwei gelbe Zahnreihen.
„Nichts zu danken, Chefin. Der Typ ist ja gemeingefährlich.“
„Ein Choleriker“, pflichtete ihm Williamson bei, „die arme Frau.“
Inzwischen hatten sich auch die letzten Grüppchen der Anwohner zerstreut. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie die neue Pressesprecherin der Polizei, Dr. Anja Schling, ein Interview mit einem Fernsehsender gab. Gut so. Solange sie das nicht tun musste … sie hasste das. Hoffentlich wurde sie nicht von den Presseleuten entdeckt, als leitende Ermittlerin müsste sie sonst auch noch Rede und Antwort stehen.
Sie wechselte an die rechte Seite Cohens und schob ihn halb vor sich her, damit sie von ihm verdeckt war.
„Wir gehen wieder in den Garten, da können wir ungestört reden“, flüsterte sie und klammerte sich an seinen Arm.
Ihr Kollege wusste nicht, wie ihm geschah. Sichtlich irritiert schaute er auf seine Vorgesetzte hinab, die ihn wie einen Schutzschild vor sich herschob.
„Wenn Sie meinen, Chefin, aber müssen Sie mich so festhalt…“
„Pssssst“, machte Williamson und klammerte sich nur noch fester an ihn. „Ich will nit, dat die Presseleute mich entdecken, kapiert!?“
Cohen begriff und bugsierte sie halb schiebend, halb ziehend in den Garten der Jansens. Dort trafen sie auf Elena Grifo, die in einem der Gartenstühle saß und ihre Notizen sortierte. Sie blickte mit ernstem Gesicht auf.
„Die beiden Kinder Nina und Philipp sind informiert und auf dem Weg hierher. Nina kommt aus Hamburg, das heißt, sie wird nicht so lange brauchen. Philipp studiert in Aachen, das dauert mindestens drei bis vier Stunden, bis er hier ist.“
„Wie alt sind die beiden denn, un‘ wat studieren die?“
„Nina ist zweiundzwanzig Jahre alt und studiert Psychologie im vierten Semester, Philipp ist mit fünfundzwanzig Jahren der Ältere. Er studiert Maschinenbau und macht im nächsten Jahr seinen Abschluss“, antwortete Grifo. „Die beiden sind geschockt, vor allem die Tochter. Sie ist am Telefon zusammengebrochen. Zum Glück war ihr Freund bei ihr, mit ihm habe ich dann noch gesprochen. Er wird sie fahren. Der Sohn hat mir versprochen, mit dem Zug zu kommen. Er wirkte deutlich gefasster.“
„Dat heißt nix, Frau Grifo. Wenn ihm erst mal bewusst wird, dat seine Eltern tot sind …“ Williamson führte den Satz nicht zu Ende, das war auch nicht nötig.
Die junge Oberkommissarin schüttelte den Kopf.
„Ich weiß. Vielleicht wird es ihm auf der Zugfahrt klarer. Er fühlte sich auf jeden Fall in der Lage dazuzukommen. Ich habe die Telefonate zusammen mit unserer Psychologin Tanja Meineke geführt, um mich abzusichern.“
„Jut, Frau Grifo, nütz‘ ja nix. Wir mussten et ihnen ja sagen, un‘ irgendwie müssen sie kommen.“
Williamson und Cohen berichteten Grifo anschließend von ihrem Besuch bei Michael Wanner und seiner Frau.
„Irgendwie kann ich mir nit vorstellen, dat er et war, dazu war dat Ganze zu professionell aufgezogen, bis auf den Overkill. Allerdings is‘ er jähzornig un‘ war wütend auf Jansen“, schloss Williamson ihren Bericht. „Er is‘ sogar auf mich los, aber Herr Cohen hat sich ihm heldenhaft in den Weg gestellt!“
Was sie nicht sagte, war, dass ihr Bauch bei Michael Wanner nicht kribbelte. Überhaupt nicht.
Sascha Cohen war währenddessen tatsächlich rot geworden. Verlegen rieb er sich wieder mit seinem Taschentuch ein ums andere Mal durchs Gesicht.
„Das war doch selbstverständlich, Chefin“, murmelte er und knüllte das nasse Tuch.
„Jut“, Williamson schlug sich wieder mit beiden Händen auf die Oberschenkel, „wat haben die Befragungen der Nachbarn ergeben?“
Elena Grifo zuckte mit den Schultern.
„Um es auf einen Nenner zu bringen: nichts. Die Jansens werden überschwänglich gelobt. Wenn man den Nachbarn Glauben schenkt, standen sie kurz vor der Heiligsprechung. Die Gefühlslage ist irgendwo zwischen Trauer, Schock, Ungläubigkeit und Wut. Niemand scheint etwas gesehen zu haben.“
„Wat is‘ mit der Frau, die Rudolf Jansen gefunden hat?“
Grifo schaute wieder auf ihre Notizen, ebenso Cohen.
„Andrea Dornholz“, sagten beide wie aus einem Munde. Und Cohen fügte hinzu: „Sie wohnt mit ihrer Familie gegenüber.“
„Alles klar“, sagte Williamson und erhob sich schwerfällig. Es war noch immer verdamp heiß. „Dann wollen wir mal Frau Dornholz aufsuchen. Sie is‘ hoffentlich mittlerweile in der Lage dazu, uns ein paar Fragen zu beantworten.“
„Frau Meineke ist bei ihr. Ebenso ihre Familie, das tut ihr sichtlich gut“, antwortete Elena Grifo.
Auf dem Weg aus dem Garten heraus drehte sich Williamson zu Cohen um und bat ihn zu überprüfen, ob Michael Wanner einen Waffenschein habe.
„Sicher is‘ sicher“, meinte sie leichthin und zwinkerte ihm zu.
Das Haus gegenüber war ein modernes, weiß gestrichenes Einfamilienhaus mit Gaubenfenstern und bunten Blumen davor. Eine Laterne und weitere Dekogegenstände komplettierten den hübschen Eingangsbereich. „Dornholz“ stand in geschwungenen Lettern über einer Klingel, die Grifo jetzt drückte. Ein hochgewachsener, gut aussehender Mann mit einem modischen Kurzhaarschnitt öffnete. Williamson schätzte ihn auf Anfang vierzig.
„Sie sind die Polizistinnen“, stellte er nüchtern fest und bat sie herein. „Christoph Dornholz, freut mich.“
„Williamson, dat is‘ meine Kollegin Grifo“, antwortete Williamson. „Wie geht et Ihrer Frau?“
„Es geht so“, antwortete der Mann und wandte sich kurz zu ihr um. „Es war ein ziemlicher Schock.“
„Dat glaube ich“, sagte Williamson knapp. Mehr gab es nicht zu sagen.
Christoph Dornholz führte sie in einen lichtdurchfluteten und großzügig gestalteten Wohnbereich mit offener Küche. Große Fenster ließen die späte Nachmittagssonne ein, die das Ess- und Wohnzimmer in ein angenehmes Licht tauchte. Durch die Fenster war eine elegant angelegte Holzterrasse zu erkennen, die durch eine Markise vor der Sonne geschützt war. Farblich perfekt aufeinander abgestimmte Gartenmöbel rundeten das Ensemble ab. Dort saß am Tisch ein kleiner blonder Junge und malte eifrig ein Bild. Er war ganz in seine Tätigkeit vertieft, die kleine Zunge blitzte zwischen den Lippen hervor. Williamson musste lächeln, und auch Grifo schmunzelte.
Eine hellgraue Wohnlandschaft beherrschte das Wohnzimmer, auf der zwei Frauen saßen, auf dem Couchtisch standen eine Karaffe mit Wasser und Gläser. In der Karaffe schwammen Zitronenscheiben, etwas, was Williamson für total überflüssig hielt. Aber wat soll et? Die Menschen waren eben verschieden … Bevor sich ihre Gedanken wieder selbstständig machen konnten, rief sie sich selbst zur Ordnung. Was war heute nur los? Das musste die Hitze sein!
Sie straffte sich und blickte auf die beiden Frauen. Andrea Dornholz war eine schlanke, sportlich aussehende Frau mit halblangem, glattem, dunklem Haar, das ihr nun in Strähnen ins vom Weinen verquollene Gesicht fiel. Immer wieder knüllte sie ein Papiertaschentuch, das sie fest umklammert in ihren Händen hielt. Die andere Frau war Tanja Meineke, die Polizeipsychologin, die tröstend den Arm um die Schultern von Andrea Dornholz gelegt hatte. Beide sahen auf, als Grifo und Williamson auf sie zukamen.
„Juten Tag, Frau Dornholz, Frau Dr. Meineke.“ Williamson nickte den beiden Frauen zu und stellte sich und Grifo der Nachbarin vor. Diese nickte.
„Sie möchten mir Fragen stellen“, sagte sie erschöpft und lehnte sich zurück. „Also gut, fangen Sie an.“
„Aber nur, wenn du dich dazu in der Lage fühlst, Liebes“, warf ihr Mann ein und sah sie besorgt an.
„Es geht schon, Chris“, antwortete Andrea Dornholz und lächelte schwach.
Williamson und Grifo setzten sich. Christoph Dornholz holte zwei weitere Gläser und schenkte ihnen Wasser ein. Dann ließ er sich neben seiner Frau nieder und nahm sie in die Arme.
Williamson ließ die Stille wirken, um allen die Möglichkeit zu geben, sich zu sammeln.
„Frau Dornholz, mir is‘ bewusst, dat dat jetz‘ nit einfach wird, aber wir müssen Ihnen einige Fragen stellen, denn wir wollen den- oder diejenigen, die dat getan haben, kriegen. Wir versuchen, Sie nit unnötig zu belasten, aber ich hoffe, Sie verstehen, dat wir mit unseren Ermittlungen weiterkommen müssen.“
Williamson kam sich bei solchen Sätzen furchtbar ungelenk vor. Einfühlsamkeit und Geduld waren nicht unbedingt ihre Stärke, aber sie konnte gegenüber der wichtigsten Zeugin nicht mit der Brechstange agieren, das war ihr schon klar.
„Ich verstehe, bitte stellen Sie Ihre Fragen“, sagte Andrea Dornholz mit bemüht fester Stimme.
Williamson nickte. „Danke, Frau Dornholz. Also, Sie haben die Toten gefunden …“
„Nein, nur Rudolf“, unterbrach die Nachbarin sie sofort. Sie holte tief Luft. „Ich fange am besten von vorne an. Ich habe heute Morgen einen Kuchen gebacken. Lemoncheesecake, das ist der Lieblingskuchen von Julian.“ Sie schaute auf und sah durchs Fenster auf den kleinen Jungen, der nach wie vor am Gartentisch konzentriert malte. Ein zärtlicher Ausdruck hatte sich in ihre Augen geschlichen.
„Aber er ist auch der Lieblingskuchen der Jansens. Wenn ich gebacken hatte, dann bekamen die beiden von uns Kuchen ab. Das hatte sich über die Zeit so eingespielt.“ Die Nachbarin lächelte schwach. „Meinen Lemoncheesecake mochten sie ganz besonders gern.“ Die aparten Gesichtszüge der Frau verzogen sich, und Tränen traten in ihre Augen.
„Sie haben sich also gut verstanden?“, fragte Elena Grifo mit ihrer sanften Stimme. Jut so, dachte Williamson. Grifo mit ihrer Feinfühligkeit hatte immer beruhigenden Einfluss auf Zeugen, so auch auf Andrea Dornholz.
Das Ehepaar nickte.