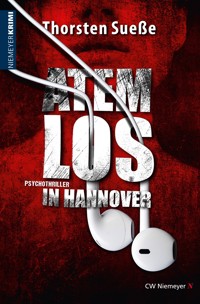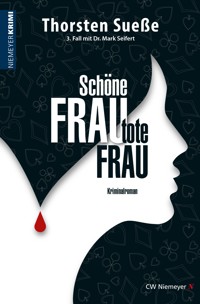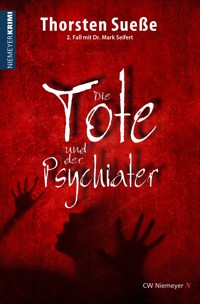7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hannover-Krimi
- Sprache: Deutsch
Töte ich Menschen, ohne mich daran zu erinnern? Diese Frage stellt sich der 20-jährige Paul. In ihm existieren zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, die – bis auf wenige Ausnahmen – nichts voneinander wissen. Ein Hannoverscher Bestsellerautor wird abends vor seinem Haus von einer unbekannten Gestalt getötet. Paul befürchtet, der Täter zu sein, kann sich jedoch an nichts erinnern. Kurz darauf beginnt der renommierte Psychiater Dr. Mark Seifert eine heimliche Affäre mit Pauls Mutter, bringt damit eine tödliche Kaskade ins Rollen. Es gibt ein altes, düsteres Geheimnis, dessen Aufdeckung einige Personen in Pauls Umfeld um jeden Preis verhindern wollen. Die verstörende Wahrheit kostet mehrere Menschenleben. Gelingt es Mark Seifert, die Hintergründe der Tötungsserie aufzudecken, bevor der Täter ein weiteres Mal zuschlägt? Wie die Hauptfigur Dr. Mark Seifert, Psychiater mit kriminalistischem Spürsinn, ist auch der Autor Dr. Thorsten Sueße Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
In Erinnerung an John Lennon (1940–1980),dessen geniale künstlerische Kreativität ich immer als Auseinandersetzung mit seiner schwierigen Kindheit interpretiert habe.
Der Kriminalroman spielt in der Region Hannover.Personen und Handlung sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Geschehnissen wären rein zufällig.Im Verlag CW Niemeyer sind bereitsfolgende Bücher des Autors erschienen:Toter Lehrer, guter LehrerDie Tote und der PsychiaterSchöne Frau, tote Frau
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comDruck und Bindung: Nørhaven, ViborgPrinted in DenmarkISBN 978-3-8271-9508-1
Thorsten SueßeHannover sehenund sterben4. Kriminalfall mit Dr. Mark Seifert
Dr. med. Thorsten Sueße, geboren 1959 in Hannover, verheiratet, zwei Kinder, wohnt seit vielen Jahren mit seiner Familie am südlichen Rand seiner Geburtsstadt. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin, leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover.
Bei der Darstellung der Handlung seiner Kriminalromane orientierte er sich an seinem eigenen Arbeitsalltag, der durch eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Polizei geprägt ist.
Der Autor veröffentlichte bisher unter anderem ein Fachbuch über die NS-„Euthanasie“ in Niedersachsen, ein Theaterstück und zahlreiche Kurzgeschichten in diversen Anthologien, außerdem schrieb er ein Drehbuch für einen Spielfilm. Als Auszeichnung für seine wissenschaftliche Dokumentation über die Tötung psychisch Kranker aus den niedersächsischen Heil- und Pflegeanstalten im Dritten Reich erhielt er (zusammen mit einem Koautor) den Dissertationspreis 1986 der Gesellschaft der Freunde der Medizinischen Hochschule Hannover.
Daneben betätigte er sich als Schauspieler, hauptsächlich im Bereich Theater, hatte aber auch Sprechrollen in Fernseh- und Kinoproduktionen.
Er ist Mitglied im Bundesverband junger Autoren und Autorinnen.
Hier gelangen Sie zur Internetseite von Thorsten Sueße: www.thorsten-suesse.de
Teil 1 Das erste Opfer des Rosenquarz-Mörders
Kapitel 1
Philipp Rathing beendete die Vorlesung seines Buches, indem er langsam den Kopf hob und für zwei Sekunden, ohne ein Wort zu sagen, den Blick durch die Reihen seiner zahlreichen Zuhörer schweifen ließ. Diese zwei Sekunden, kurz vor dem zu erwartenden Applaus, genoss er immer besonders, wenn das Publikum weiterhin an seinen Lippen hing, um sicherlich liebend gern noch die eine oder andere Passage aus seinem Roman vorgetragen zu bekommen.
Und wie jedes Mal an dieser Stelle verkündete er lakonisch, in einem gespielt belanglos klingenden Tonfall: „So, das war’s für heute Abend.“
Die Antwort war ein anhaltendes Klatschen. Philipp nickte lächelnd in die Runde. Die Autorenlesung, veranstaltet von der Buchhandlung Decius in der Celler Innenstadt, war zum Glück vollständig ausverkauft.
Es folgten die üblichen Fragen aus dem Publikum, in dem für Lesungen überdurchschnittlich viele Männer saßen – was sicherlich mit der Thematik des Romans „Hannover sehen und lieben“ zu tun hatte:
„Warum haben Sie das Thema Homosexualität in dieser ungewöhnlichen Weise behandelt? In manchen Punkten wirkt Ihre Darstellung tatsächlich missverständlich.“
„Gab es einen besonderen Grund, gerade über dieses Thema zu schreiben?“
„Halten Sie Homosexualität wirklich für psychotherapeutisch behandelbar?“
„Hatten Sie mit den schwulen Bikern oder dem Pastor vorher persönlich zu tun?“
„In der Zeitung liest man immer wieder von Anfeindungen gegen Sie und Ihren Roman. Was sagen Sie dazu? Haben Sie manchmal Angst, aus dem Haus zu gehen?“
Philipp antwortete mit wohlgesetzten, zuvor genau durchdachten Formulierungen, einem Mix aus Humor und sozialem Engagement, angelehnt an das Motto: Tu Gutes und rede darüber.
Auf das Frage-und-Antwort-Spiel folgte das Signieren der verkauften Romane. Dann die Verabschiedung mit Shakehands vom Veranstalter mit dem gegenseitigen Versprechen, beim nächsten Roman wieder für eine gemeinsame Veranstaltung in Celle zusammenzukommen. Für den Erfolgsautor aus Hannover, dessen Romane (zumindest früher) bundesweit auf der Spiegel-Bestsellerliste standen und auch schon in andere Sprachen übersetzt worden waren, gehörte Celle natürlich nicht unbedingt zu denjenigen Städten, in denen er im kommenden Herbst als Erstes sein nächstes Buch präsentieren wollte. Da hatte er Berlin, Hamburg, München oder Köln im Blick. Aber letztendlich durfte er sich nie zu schade sein, selbst in noch viel kleineren Städten als Celle aufzutreten.
Es war kurz nach 22 Uhr, als er in seinen BMW einstieg, um nach Hannover zurückzufahren. Seine gute Stimmung, gepuscht durch die gelungene Lesung, bekam einen erheblichen Dämpfer, als er sein iPhone wieder anstellte und sofort registrierte, dass ihm Melanie auf die Voice-Mailbox gequatscht hatte.
Hör ich mir ihr Gejammer jetzt an – oder erst morgen? Scheißegal, bring ich’s hinter mich.
„Das lasse ich mir nicht mehr bieten!“, tönte Melanies Stimme aus dem iPhone. „Ich will das jetzt klären. Melde dich kurzfristig!“
Das Wort „bitte“ hatte sie nicht verwendet. Er wusste, um was es ging.
Kein Bock, mir heute noch den Abend mit ihr zu versauen. Sie soll dankbar sein, dass ich überhaupt noch mit ihr und ihren Kindern Kontakt halte!
Er würde sie morgen Vormittag anrufen. Eine Strecke von vierzig Kilometern und ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrt lagen vor ihm. Das Gespräch mit dem Publikum in Celle ging ihm durch den Kopf.
Die meisten haben die feine Ironie meines Romans kapiert. Aber ein, zwei Hohlköpfe waren damit mal wieder überfordert. Fast wie dieser dämliche schwule Biker aus Hannover, der überhaupt nichts rafft.
Philipps Gedanken schweiften ab zu dem durchgeknallten Psycho, der den Autor in seinem eigenen Garten überfallen hatte. In seiner damaligen Verfassung war Ralf Grothe recht bedrohlich aufgetreten. Gut, dass Mark Seifert dafür gesorgt hatte, den Kerl für ein paar Wochen in die geschlossene Psychiatrie einzuweisen. Inzwischen musste der Typ längst entlassen sein.
Solange der seine Psychopharmaka schluckt, müsste er mich in Ruhe lassen. Aber die letzten Tage habe ich da meine Zweifel, dass er das tut.
Vor Kurzem hatte sich Philipp auf seinem Grundstück mehrfach beobachtet gefühlt, hatte sogar eine Gestalt direkt vor seinem Gartenzaun weghuschen sehen. Das passte zusammen! Bevor Grothe ihn vor mehreren Monaten körperlich attackiert hatte, war der Biker ebenfalls zwei Tage zuvor um Philipps Haus gezogen.
Mark hat versprochen, dass sich sein Sozialpsychiatrischer Dienst um Grothe kümmert. Mal sehen, ob seine Leute das hinkriegen. Oder hat das was mit Ramona zu tun? Quatsch! Bodo wird kaum um mein Grundstück schleichen.
Philipp versuchte seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Viel angenehmer war es, sich mit dem derzeitigen Erfolg zu beschäftigen. „Hannover sehen und lieben“ lief eigentlich ganz gut, trotz – oder vielleicht auch wegen – der anfänglichen Kontroversen. Schon seit zehn Jahren stand auf dem Cover seiner Romane nur noch das Namenskürzel P. R., welches hoffentlich jeder potenzielle Käufer sofort mit Philipp Rathing verband. Eine raffinierte Anspielung auf Public Relations, die gleichfalls Assoziationen weckte zum weltweit bekannten Kürzel J. R. aus der amerikanischen Erfolgsserie „Dallas“.
Für die Fahrt im Dunkeln von Celle nach Hannover konnte Philipp bequem die Autobahn nutzen. In Anderten, einem Stadtteil im Osten der niedersächsischen Landeshauptstadt, besaß er ein Einfamilienhaus mit Garten, welches er nach dem Auszug von Melanie und ihren Kindern meistens allein bewohnte.
Als er in die Straße einbog, die zu seinem Haus führte, hatte er plötzlich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Er verspürte einen unangenehmen Druck im Magen, der sich schnell im gesamten Bauch breitmachte.
Die blöden Gedanken vorhin an den Psycho-Biker. Jetzt mach ich mich schon selbst verrückt. Hat er’s doch geschafft, dass ich mich wieder unwohl fühle.
Philipp erreichte die Einfahrt zu seinem Haus, bremste ab und fuhr langsam auf sein Grundstück Richtung Garage. Im Licht der Scheinwerfer war nichts Ungewöhnliches zu entdecken.
Was hab ich erwartet? Grothe wird schon nicht hier im Dunkeln vor dem leeren Haus auf mich warten.
Mit der Fernbedienung öffnete er die Garage und fuhr den Wagen hinein. Die Bewegungsmelder erhellten den vorderen Teil des Gartens. Als er das Garagentor wieder verschloss und auf die Haustür zusteuerte, wurde er zunehmend ruhiger. Kein ungebetener Gast, der ihm ans Leder wollte.
Er steckte den Schlüssel ins Schloss der Haustür, als er hinter sich ein Geräusch hörte.
Scheiße! Ich hatte doch recht!
Er drehte sich um und sah der Gestalt direkt ins Gesicht. Als Letztes bemerkte er irritiert die Pistole, die sein Gegenüber auf ihn gerichtet hatte. Dann beendeten zwei Schüsse das Leben des hannoverschen Bestsellerautors.
Kapitel 2
Irgendwann vorher …
Er lebte sein ganzes Leben in zwei Welten, wobei er meistens in der einen nicht wusste, was er in der anderen tat. Das ging schon fast zwanzig Jahre so.
An die ersten sechs Lebensjahre hatte er allerdings keinerlei Erinnerung. Sie waren komplett ausgelöscht. Diese Zeit kannte er lediglich von alten Fotos oder aus Erzählungen.
Seit seiner frühen Kindheit war er ein Schlafwandler. Mitten im Schlaf verließ er mit offenen Augen das Bett und ging im Haus seiner Eltern umher. Er bediente sich am Kühlschrank, fing an zu essen. Mehrfach war es sogar vorgekommen, dass er beim Schlafwandeln das Haus verlassen hatte. Wenn er später wieder ins Bett zurückkehrte und am nächsten Morgen aufwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Einmal hatte sich ihm beim Schlafwandeln sein älterer Bruder in den Weg gestellt. Er war gewalttätig geworden und hatte den Bruder geschlagen. Später wusste er nicht, was passiert war. Ängste und Hemmungen verschwanden während des Schlafwandelns.
Er wurde mehrfach von neurologischen und psychiatrischen Fachärzten untersucht, war in einem Schlaflabor. Die Diagnose lautete Somnambulismus, was lediglich die medizinische Bezeichnung für Schlafwandeln war. Eine Schlafstörung, bei der der Erbfaktor eine Rolle spielte. In seiner Familie hatten zumindest seine Mutter und ihr Bruder als Kind damit zu tun gehabt.
Nach der ärztlichen Prognose hätte das Schlafwandeln bei ihm mit der Pubertät aufhören müssen. Bei ihm war das nicht der Fall. Das typische Nachtwandeln war tatsächlich seltener geworden. Aber stattdessen weitete sich sein ungewöhnliches Verhalten zunehmend auf den ganzen Tag aus. Er vollzog tagsüber komplexe Handlungen, für die ihm jegliche Erinnerung fehlte. Er joggte durch den Park, kaufte im Internet ein oder stritt sich mit einer Person. Wenn andere ihm davon erzählten, spukte manchmal eine vage Erinnerung durch seinen Kopf, von der er zuvor gedacht hatte, es wäre nur ein Traum gewesen.
Die Ärzte sprachen davon, dass er neben dem Schlafwandeln in dissoziative Zustände geraten würde. Einzelne Wahrnehmungs- und Gedächtnisinhalte würden dabei voneinander abgetrennt. Offenbar ein Schutzmechanismus der Psyche, um bestimmte belastende Vorgänge und Erinnerungen fernhalten zu können. Er hatte auf Anraten der Ärzte zwei Jahre eine ambulante Psychotherapie gemacht. Nach Ende der Therapie fing er an, seine erste Mystery-Geschichte zu schreiben. Sie handelte von Gaylord, dem Schlafwandler, der zusätzlich unter dissoziativen Zuständen litt und der sein Störungsbild dafür nutzte, um in einer gnadenlosen Welt seine Ideale durchzusetzen. Die Inhalte der Zeitungsausschnitte, die er vor Jahren gesammelt hatte, waren in seine erste Geschichte eingeflossen. Vor einigen Jahren hatte in der Region Hannover ein Serienmörder neben jedes seiner Opfer Gegenstände deponiert, welche vermutlich eine symbolische Bedeutung hatten – ein Grablicht und eine Spielkarte. Aus ermittlungstaktischen Gründen hatte die Polizei diese Information erst nach Aufklärung der Mordserie an die Presse gegeben.
Mit achtzehn veröffentlichte er bei Amazon seine erste Mystery-Geschichte als E-Book. Ein Jahr später folgte die zweite.
Als Autor gab er seinen richtigen Namen an: Paul Stern.
Kapitel 3
Drei Monate vor dem Mord an P. R.
Der Wecker meldete sich pünktlich um sechs. Mit der flachen Hand versuchte ich dem nervigen Gepiepe ein Ende zu machen, erwischte aber leider nicht den Aus-Knopf, sondern die rechte Seite des Weckers, der zwischen mein Bett und meinen Nachttisch fiel und munter weiterpiepte, natürlich mit zunehmender Frequenz und Lautstärke. Ich machte das Licht an, brachte mühsam den Störenfried wieder zum Vorschein und beendete den Krach. Auf jeden Fall war ich jetzt putzmunter, aber schon zu Beginn des Tages schlecht drauf. Der Blick auf die zweite leere Doppelbetthälfte verstärkte mein Stimmungstief. Dort hatte bis vor zwei Wochen Anna gelegen. Jetzt war sie weg, ausgezogen bis auf Weiteres. Dabei hatte Anfang dieses Jahres alles noch so anders ausgesehen.
Vor zwei Jahren wollten wir den Zustand mit den zwei eigenen Wohnungen beenden und uns gemeinsam ein Haus anschaffen. Wir hatten bereits ein Objekt gefunden, aber die Kaufverhandlungen zogen sich hin und scheiterten schließlich. Stattdessen war Anna als Übergangslösung in meine Drei-Zimmer-Wohnung im hannoverschen Zooviertel eingezogen. Ihre Wohnung in Linden hatte sie aufgegeben.
Momentan wohnte Anna bei einer befreundeten Kollegin, die wie sie Lehrerin am Lindener Hermann-Hesse-Gymnasium war. Manchmal hatte ich ein Fünkchen Hoffnung, dass Anna und ich wieder zusammenkommen würden. Aber nur manchmal – und heute Morgen gerade nicht.
Es war Freitag, der 16. Dezember. In gut einer Woche war Heiligabend, und ich würde die Festtage mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Anna verbringen.
Ein kleiner Lichtschimmer war mein rechter Fuß. Vor einigen Wochen war ich damit umgeknickt und hatte mir im oberen Sprunggelenk einen Außenbandriss zugezogen. Bis gestern musste ich deshalb eine Stützschiene tragen. Die Genesung meines Fußes vermochte meine Laune nur unwesentlich zu verbessern.
Ich schleppte mich ins Badezimmer. Der Spiegel dort zeigte einen achtundvierzigjährigen Mann mit einem deprimierten Gesichtsausdruck.
„Mark Seifert, du gefällst mir gar nicht“, sagte ich zu mir selbst.
Schade, dass ich mich als Psychiater nicht selbst behandeln kann. Momentan hätte ich es bitter nötig.
Ich war Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und leitete den Sozialpsychiatrischen Dienst, eine Einrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes des Kommunalverbands Region Hannover. Der Sozialpsychiatrische Dienst verfügte über eine Zentrale und zwölf Beratungsstellen, ausgestattet mit insgesamt hundert Fachkräften, die sich um die ambulante Versorgung derjenigen psychisch Kranken kümmerten, die nicht oder nicht ausreichend vom kassenärztlichen System erreicht wurden.
Nach einem mageren Schnellfrühstück machte ich mich auf den Weg zur Arbeit.
Jeden Freitag hatte ich mich selbst zur psychiatrischen Notfallbereitschaft für das Gebiet der Landeshauptstadt eingeteilt, um den Bezug zur Praxis zu behalten.
Kurz vor acht Uhr betrat ich die Zentrale des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der vierten Etage des Timon Carrés, einem sechsstöckigen Gebäudekomplex, in dem sich ansonsten zahlreiche Arztpraxen befanden, mitten im hannoverschen Stadtteil Döhren.
In meinem Vorzimmer war Sonja Mock, meine langjährige Sekretärin, gerade am Telefonieren. Mit der freien Hand gab sie mir ein Zeichen, mich ruhig zu verhalten.
„Nein, Frau Dahlmann-Weinberger“, sagte Mockie auf ihre ruhige, aber bestimmte Art, „leider ist Herr Dr. Seifert nicht im Hause, und ich weiß auch nicht, ob er heute noch reinkommt.“
Bei dem Namen „Dahlmann-Weinberger“ spürte ich gleich meinen flauen Magen. Es handelte sich dabei um eine Frau Ende dreißig, mit der ich in den letzten Wochen bereits mehrfach ausführlich telefoniert hatte. Unsere Gespräche drehten sich dabei im Kreis. Die Frau suchte immer wieder Beziehungen zu dem Typ Mann, mit dem sie in ihrer Jugend äußerst schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Die Reinszenierung eines alten Traumas. Dabei lehnte die Frau jegliche Gespräche mit Therapeuten der zuständigen Sozialpsychiatrischen Beratungsstelle ab. Bei Frau Ende dreißig waren meine Gedanken sofort wieder bei Anna.
Meine Sekretärin legte den Hörer auf und lächelte mich an: „Das ist für heute erledigt.“
„Danke, Mockie, Sie haben mich gerettet. Ein Telefonat mit Frau Dahlmann-Weinberger gleich zu Beginn des Tages hätte ich diesen Freitag nicht durchgehalten.“
Ich ging in mein Büro und hoffte, dass Mockies erfolgreiche Abwehr dieses Telefonats ein gutes Zeichen für den weiteren Tagesverlauf sein würde. Da hatte ich mich leider gründlich geirrt.
Kapitel 4
Philipp Rathing unterbrach die Arbeit am Manuskript seines neuen Buches. An diesem Freitag hatte er ganz früh mit dem Schreiben begonnen.
Der Nachfolge-Roman von „Hannover sehen und lieben“ musste unbedingt wieder ein Bestseller werden, nachdem sich sein vorletztes Buch und das davor leider nur mäßig verkauft hatten. Philipp gehörte zu den wenigen Schriftstellern, die tatsächlich von ihrem künstlerischen Schaffen recht gut leben konnten. Nebenher schrieb er journalistische Artikel für bundesweit erscheinende Magazine, lektorierte zusätzlich Bücher und Magazine, hatte früher bereits Drehbücher für eine erfolgreiche Fernsehserie verfasst. In seinem aktuellen Manuskript ging es um Flüchtlinge in Deutschland, ein Thema, mit dem er zwar in seinem eigenen Alltag wenig zu tun hatte, das er jedoch als aktuell und zugkräftig einschätzte. Er saß in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und überflog auf dem Monitor seines PCs die letzten Sätze, die er in die Tastatur getippt hatte. Dann blickte er über den Bildschirm hinweg durchs Fenster. Das Arbeitszimmer lag im ersten Stock seines Hauses.
Übernachtungen von Frauen kamen in dieser Arbeitsphase nicht in Betracht. Seine Konzentration galt von morgens bis abends, manchmal sogar bis spät in die Nacht, ausschließlich dem Buch. Als seine langjährige Lebenspartnerin Melanie und deren Kinder noch hier wohnten, hatte es deswegen öfters Streit gegeben. Ihnen fehlte bisweilen das Verständnis, dass laute Musik, Geschrei oder sonstige Turbulenzen ihn bei seiner Arbeit störten. Ein offenes Ohr für Alltagsprobleme aller Art hatte er hingegen in der Findungsphase für das Thema eines neuen Romans. Seit er die Adventszeit allein in Anderten verbringen musste, verzichtete er im Haus auf jeglichen vorweihnachtlichen Schnickschnack.
Das Haus hatte er vor achtzehn Jahren, zusammen mit seiner drei Jahre später verstorbenen Frau, gekauft. Viele persönliche Erinnerungen an diese Zeit waren mit dem Gebäude verknüpft, in welchem er, allein schon wegen des ansprechenden Gartens (seine zweite Passion neben dem Schreiben!), um jeden Preis wohnen bleiben wollte. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau war Melanie mit ihren beiden kleinen Kindern dort eingezogen. Aber das spielte heute alles keine Rolle.
Am späten Nachmittag vor zwei Tagen hatte ein Mann auf einem Motorrad vor Philipps Grundstück, das in einem ruhigen Wohngebiet mit Einfamilienhäusern lag, haltgemacht. Der Mann war korpulent, trug schwarze Lederkleidung mit einer Kutte darüber, die vorne und hinten die geschwungene Regenbogenflagge zierte. Vom Fenster hatte Philipp in der einsetzenden Dunkelheit nicht alles genau erkennen können. Aber es konnte sich nur um Ralf Grothe handeln. Der Kerl hatte einen leeren Flachmann in den Garten des Schriftstellers geworfen und irgendetwas gerufen, das Philipp im Haus nur undeutlich verstehen konnte – möglicherweise „blödes Schwein“ oder so. Für die Einschaltung der Polizei reichte der Vorgang nicht aus. Grothe war ein Mitglied der Rainbow-Biker. Die hatten in den vergangenen Monaten mehrfach gegen sein Buch gewettert. Und ihm vermutlich auch die anonymen Mails mit den fiesen Beschimpfungen geschickt, deren Adresse sich nicht zurückverfolgen ließ. Im September, kurz nach Veröffentlichung von „Hannover sehen und lieben“, war Philipps Haustür von Unbekannten mit Hundekot beschmiert worden. Er konnte den Anfeindungen, über die schon mehrfach die Presse berichtet hatte, auch Positives abringen. Sie machten sein Buch für unentschlossene Käufer interessanter.
Zum Einlegen einer Zigarettenpause entschloss er sich, in den Garten zu gehen. Er hatte sich eine Winterjacke angezogen. Es war etwa fünf Grad über null. Die Weihnachtstage würden vermutlich wieder ohne Schnee auskommen müssen. Er ging im Garten auf und ab, was meistens seine Einfälle für die nächsten Passagen des Romans beflügelte.
Von der Straße her hörte er das Knattern eines Motorrads. Auf der Maschine hockte die korpulente Gestalt von vorgestern.
Er ist es! Grothe! Was mache ich jetzt?
Philipp war nicht der Typ, der sich gleich wie ein ängstliches Mäuschen verkroch. Er entschloss sich, ruhig stehen zu bleiben und mit keiner Geste zu signalisieren, dass ihm die Situation Unbehagen bereitete.
Der Biker war ungefähr im gleichen Alter wie Philipp, also Ende vierzig. Ein ungepflegt wirkender dunkler Vollbart mit etlichem Grau ließ ihn verwegen aussehen. Er trug wieder die typische Motorradkleidung mit der Rainbow-Kutte. Und darunter sah er recht kräftig aus.
Bei einer Prügelei zieh ich mit Sicherheit den Kürzeren! Standhaft bleiben, aber nicht provozieren.
Grothe hatte den Schriftsteller ebenfalls ausgemacht. Er brachte sein Motorrad zum Stehen, stieg ab und stürmte mit schnellen Schritten durch das vordere Gartentor auf Philipp zu.
Weglaufen oder Stärke zeigen?
Philipp erstarrte auf dem Rasen und war für einen kurzen Moment entscheidungsunfähig. Die brennende Zigarette entglitt seiner Hand.
Okay, bleibt nur Stärke vortäuschen.
Grothe machte keine Anstalten, stehen zu bleiben. Philipp streckte den rechten Arm aus und hielt die Handfläche nach vorn: „Stopp! Was soll das? Was wollen Sie?“
Sein Gegenüber kam tatsächlich zum Stehen. Die Mundwinkel zuckten, beide Arme vollführten ruckartige Bewegungen, bevor er laut verkündete: „Ich bin gekommen, um mit dir, du verkappter Schwulenhasser, abzurechnen. Dein verdammtes Drecksbuch!“
Der steht total unter Dampf!
„Verlassen Sie bitte sofort mein Grundstück!“, entgegnete Philipp, wobei seine Stimme leicht brüchig wirkte.
Grothe stand mit zwei Schritten direkt vor dem Schriftsteller und drückte ihm die rechte flache Hand ins Gesicht. Philipp taumelte zurück. Der Biker setzte nach, schubste seinen Widersacher mit beiden Händen gegen den Brustkorb. Philipp kam ins Straucheln, konnte mit Mühe verhindern, zu Boden zu stürzen.
In seiner Verzweiflung hatte der Autor einen Geistesblitz.
„Da ist die Polizei!“, schrie er und deutete mit dem Finger hinter Grothe, der verblüfft innehielt und sich umdrehte. Aber da war niemand!
Philipp nutzte die Verwirrung und flüchtete Richtung Terrasse.
„Eh, du Arsch, dich krieg ich!“, hörte er hinter sich den Biker brüllen.
Der Schriftsteller stieß die angelehnte Terrassentür auf, rettete sich ins Wohnzimmer und verschloss sofort hinter sich die Tür. Der Angreifer erschien auf der Terrasse. Philipp fingerte sein Smartphone aus der Hosentasche und rief mit zittriger Stimme die Polizei um Hilfe.
Grothe schlug wechselseitig mit beiden Handinnenflächen gegen die Glasscheibe der Terrassentür. Dann machte er einige Trippelschritte und rieb die Hände an seinen Oberschenkeln. Er war sichtlich aufgeregt, aber noch unentschlossen, ob er die nächste Grenze überschreiten und versuchen sollte, das Glas der Tür einzuschlagen.
Philipp atmete kurz auf, als der Angreifer die Terrasse verließ und in den Garten zurückkehrte.
Zu früh gefreut!
Grothe hatte einen der größeren Ziersteine entdeckt, aufgehoben und marschierte damit auf die Terrasse zu.
Philipp rannte über den Flur zur vorderen Haustür. Hinter ihm klirrte eine Scheibe. Durch den Haupteingang flüchtete er aus seinem Haus, rannte zur Straße, rief laut um Hilfe.
Kapitel 5
Ich hatte heute mit zwei Notfalleinsätzen zu tun, die auf ihre Art ein Symbol dafür waren, dass es bei mir zurzeit nicht rund lief.
Als Erstes meldete sich das Polizeikommissariat Hannover-Misburg. In Anderten war ein vermutlich psychisch kranker Mann von der Polizei überwältigt worden, nachdem er zuvor den Schriftsteller Philipp Rathing auf dessen Grundstück körperlich angegriffen hatte. Die Polizei hatte den Mann mit aufs Kommissariat genommen.
„Es geht um einen Ralf Grothe. Der war völlig von der Rolle. Wir mussten ihn für den Transport an Händen und Füßen fesseln“, erklärte mir am Telefon der zuständige Polizeioberkommissar. „Jetzt schreit er in der Gewahrsamszelle rum … Könnten Sie bitte sofort kommen und ärztlich überprüfen, ob die akute Fremdgefährdung tatsächlich auf einer psychischen Krankheit beruht?“
Sollte das nach fachärztlicher Einschätzung der Fall sein, müsste der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden.
„Wir kennen ihn aus dem letzten Jahr … Anzeige wegen Körperverletzung“, ergänzte der Polizist. „Damals hatte der kassenärztliche Bereitschaftsdienst eine Psychose mit manischer Auslenkung diagnostiziert. Daraufhin wurde Grothe auf freiwilliger Basis ins Krankenhaus gebracht.“
„In einer halben Stunde sind wir bei Ihnen“, versprach ich.
Philipp Rathing, wie interessant, ging mir durch den Kopf. Vor neunundzwanzig Jahren, 1987, hatte ich mit ihm zusammen Abitur im Lindener Hermann-Hesse-Gymnasium gemacht. Zuletzt hatten wir uns vor gut neun Jahren gesehen, bei der 20-Jahr-Feier unseres Abi-Jahrgangs.
Kurz durchforstete ich unsere elektronische Patientendatei. Einen Ralf Grothe konnte ich nicht entdecken. Bisher also keine Berührungspunkte mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst.
Ich verständigte Saskia Ahlborn, eine erfahrene Sozialarbeiterin Ende fünfzig. Heute war sie meine Begleitung bei allen Notfalleinsätzen.
In meinem VW Golf fuhren wir über den Schnellweg in den östlichen Teil Hannovers. Ich steuerte durch den erstaunlich zäh fließenden Verkehr. Der Wagen hatte schon sehr viele Winter hinter sich gebracht, war dafür noch ganz gut in Schuss, verfügte allerdings nicht über zeitgemäße Technik wie eine Bluetooth-Freisprechanlage. Mein Smartphone, auf dem die Notrufe eingingen, hatte ich daher während der Fahrt an Saskia weitergereicht.
Ich war froh, während der Fahrt nichts mit Telefonaten zu tun zu haben. So konnte ich mich meiner Gedankenkette widmen, in der sich Berufliches und Privates vermischte: Philipp Rathing, Hermann-Hesse-Gymnasium, Anna … Der Auszug meiner langjährigen Lebenspartnerin ließ mich einfach nicht los.
Gut, dass Saskia neben mir saß und die nächsten Minuten alle Anrufer von mir fernhielt.
Denn schon klingelte es.
*
Saskia Ahlborn nahm den Anruf, weitervermittelt über die Einsatzleitstelle, entgegen: „Guten Tag, mein Name ist Ahlborn, Sozialarbeiterin der Notfallbereitschaft des Sozialpsychiatrischen Dienstes.“
Ein unsicher klingender Mann meldete sich, nannte kurz seinen Namen, teilte besorgt mit: „Peter Horand, ein Bekannter von mir, ist in letzter Zeit schlecht drauf, irgendwie mürrisch … und redet wenig. Er ist Frührentner und arbeitet nicht mehr. Heute Morgen wollt ich ihn anrufen, aber er geht nicht ans Festnetz. Und hat sein Handy ausgeschaltet.“
„Könnte es sein, dass er einkaufen ist und vergessen hat, sein Handy wieder einzuschalten?“, fragte Saskia das Naheliegendste.
„Kann sein, glaube ich aber nicht.“
„Ist bei Herrn Horand eine psychische Erkrankung bekannt? Gab es schon mal Hinweise auf Suizidalität?“
„Das weiß ich nicht. Ich bin kein Psychiater.“ Der letzte Satz klang leicht ärgerlich. „Könnten Sie mal nach meinem Bekannten sehen?“
Saskia erfragte Adresse und Telefonnummer von Peter Horand und erklärte:
„Herr Dr. Seifert und ich sind gerade auf dem Weg zu einem eiligen Notfall. Anschließend kümmern wir uns um Ihre Angelegenheit. Wohnen Sie in der Nähe von Herrn Horand und könnten dort schon mal nach dem Rechten sehen?“
„Wir wohnen in verschiedenen Stadtteilen. Ich sitz hier zu Hause und ruf von meinem Festnetzapparat an. Aber dann fahr ich da eben selbst hin.“
„Das ist ein guter Vorschlag. Bitte melden Sie sich jederzeit, wenn’s neue Erkenntnisse gibt.“
Der Anrufer beendete das Gespräch.
*
Im Polizeikommissariat Misburg wurden wir dringend erwartet. Kai Duensing, Mitte dreißig, der für den Fall Ralf Grothe zuständige Polizeioberkommissar, bat uns, ihm in ein Büro im hinteren Teil des Kommissariats zu folgen und Platz zu nehmen. Ein nüchtern eingerichteter Raum mit dem allernotwendigsten Inventar. Aktenschrank, Schreibtisch mit PC, ein kleiner Tisch, insgesamt vier Stühle.
„Herr Grothe wird gleich hierhergebracht. Dann können Sie mit ihm reden und eine Diagnose stellen“, erklärte Duensing. „Ich als medizinischer Laie halte den Mann für völlig verrückt.“
Zwei kräftige Polizeibeamte führten Ralf Grothe herein. Seine Hände waren auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt. Der Grund dafür war schnell erkennbar. Sämtliche Muskeln seines Körpers schienen unter Anspannung zu stehen. Er wirkte wie eine tickende Zeitbombe, leistete jedoch im Moment keinen Widerstand. Alles an ihm war schwarz: sein Pullover, seine Lederhose, seine Stiefel. Bis auf das schüttere Haupthaar und den Bart, wo inzwischen das Grau überwog.
„Der Herr Irrenarzt ist also auch schon eingetroffen“, gab er zur Begrüßung lautstark von sich. „Bist du überhaupt dafür qualifiziert, schwule Gehirne zu analysieren?“
Seine Bewacher setzten ihn auf einen der Stühle, postierten sich links und rechts dahinter.
Saskia und ich saßen dem gefesselten Mann gegenüber, den Tisch zwischen uns. Duensing hielt sich etwas abseits.
Wir stellten uns Grothe mit Namen und Funktion vor. Ich bat ihn darum, im folgenden Gespräch beim Sie zu bleiben.
„Die studierten Herrschaften legen Wert auf Etikette … Na, dann will ich mal zeigen, dass ich gute Manieren habe“, brummte er und ergänzte mit Blick auf Saskia: „Du … entschuldige … Sie brauchen keine Angst zu haben. An Muschis geh ich nicht ran.“
„Ich bin nicht davon ausgegangen, dass Sie mir was antun“, antwortete Saskia ruhig. „Und bei Muschis fühle ich mich nicht angesprochen.“
Ehe ich eine Frage stellen konnte, äußerte Grothe verärgert: „Die haben mir hier die Jacke ausgezogen. Jetzt könnt ihr gar nicht erkennen, wer ich bin … Schon mal was von den Rainbow-Bikern gehört?“
Ich nickte. Es handelte sich um einen in der Region Hannover ansässigen Motorradclub für schwule Biker. Ich teilte ihm mein Wissen mit, wodurch ich kurzfristig bei ihm punktete.
„Für’n Hetero gar nicht so übel.“
Ich nutzte die Gunst des Augenblicks und fragte ihn, was er bei Philipp Rathing in Anderten gewollt habe.
„Ich hab Rathing einen Besuch abgestattet, um ihm persönlich die Quittung für sein ekliges Geschmiere zu verpassen. Erst interviewt er mich scheinheilig, dann schreibt er diese Kacke, die mich und die Jungs lächerlich macht und alle Schwulen und Lesben zu Psychopathen abstempelt.“ Grothe redete sich in Rage, immer schneller und mit zunehmender Lautstärke. Schließlich endete er mit dem Satz: „Ich bin der Rächer des guten Rufs aller Schwulen und Lesben, habt ihr’s kapiert?!“
Als Nächstes fragte ich ihn, bei wem er zuletzt in ambulanter psychiatrischer Behandlung gewesen sei.
„Dr. Mielke, ganz okay der Typ. Geh ich seit paar Monaten nicht mehr hin. Die Medikamente brauch ich nicht mehr.“
Dr. Mielke war ein niedergelassener Psychiater in Hannover. Die verordneten Psychopharmaka hatte Grothe offenbar abgesetzt.
Von Grothe erfuhr ich noch, dass er sich letztes Jahr einige Wochen freiwillig in der Psychiatrischen Klinik in Langenhagen aufgehalten hatte. Er lebte allein in einer Mietwohnung. Aktuell war er antriebsgesteigert und enthemmt. Es war davon auszugehen, dass er innerhalb kürzester Zeit erneut bei Philipp aufkreuzen und diesen körperlich attackieren würde. Das Kriterium der weiter bestehenden akuten Fremdgefährdung war damit erfüllt.
Diagnostisch ging ich von einer manischen Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung aus.
„Wären Sie bereit, sich wieder in Langenhagen stationär aufnehmen zu lassen?“, fragte ich ihn.
„Ich geh nicht wieder in die Klapse! Brauch ich nicht und will ich nicht mehr! Morgen beginne ich meinen eigenen Roman. Der handelt von bornierten Hetero-Schmierfinken!“
„Falls Sie sich zu keiner freiwilligen Aufnahme entschließen, würde ich einen Unterbringungsbeschluss anregen“, legte ich die Karten auf den Tisch.
Grothes Stimmung verschlechterte sich rapide.
„Ich lass mich von dir nicht in die Klapse wegsperren!“, schimpfte er und versuchte sich aufzurichten. Die Polizisten hinter ihm drückten ihn auf den Stuhl zurück.
Er begann, mir lautstark eine Serie von Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Für meine Entscheidung brauchte ich keine weiteren Informationen. Ich beendete das Gespräch, und der schimpfende Rainbow-Biker wurde von den Beamten in die Gewahrsamszelle zurückgebracht.
„Wir können jetzt aber nicht drei Stunden warten, bis ein richterlicher Unterbringungsbeschluss verfügt wird“, teilte Duensing mit. „Grothe noch drei Stunden in unserer Zelle, das hält keiner der Beteiligten aus.“
Dieser Auffassung schloss ich mich an. Bei sehr eiligen Notfallsituationen war es rechtlich möglich, dass anstelle eines Richters ein von der Kommune autorisierter Ordnungsbeamter die Zwangseinweisung bis zum Ende des Folgetages anordnen konnte, wenn ein in der Psychiatrie erfahrener Arzt die Notwendigkeit dafür bestätigt hatte. Und genau diesen Ordnungsbeamten rief ich jetzt an.
*
Der Ordnungsbeamte hatte nach einem kurzen persönlichen Gespräch mit Grothe dessen sofortige Einweisung in die Langenhagener Klinik verfügt. Zwei Polizeibeamte begleiteten den immer noch gefesselten Grothe zum Ausgang des Kommissariats. Ich ging vor ihm, mehrere Schritte voraus. Saskia hatte das Gebäude schon verlassen. Vorm Eingang führte eine Treppe mit vierzehn Stufen nach unten, wo der Rettungswagen parkte, der Grothe in die Klinik transportieren sollte. Im Rahmen der Amtshilfe würde die Polizei den Krankentransport bis zur Klinik begleiten. Ich stand gerade auf der obersten Stufe, als ich am unteren Ende der Treppe einen Mann sah, den ich neun Jahre nicht mehr persönlich gesehen hatte – Philipp Rathing.
Was will der denn hier?
Überrascht blieb ich stehen. Dafür, dass ihn gerade zu Hause ein enthemmter Maniker überfallen hatte, sah er erstaunlich frisch aus. Unter dem offenen Mantel trug er ein Sakko. Er machte den Eindruck, als hätte er noch was vor.
Dann passierte alles auf einmal. Ich hörte Grothe hinter mir schreien, der offenbar ebenfalls Philipp entdeckt hatte. Gleichzeitig erwischte mich ein Tritt am Gesäß, vermutlich von Grothe, der beim Anblick seines Widersachers vor Wut explodierte. Ich taumelte nach vorne, verlor das Gleichgewicht, stürzte, rollte einige Treppenstufen nach unten, bis ich endlich meinen Sturz abbremsen konnte.
„Rathing, du Abschaum, irgendwann erwischen wir dich!“, brüllte Grothe. „Du wirst Hannover sehen und sterben!“
Die Polizisten hatten ihn zu Fall gebracht, sodass er auf dem Boden kniete und nicht mehr um sich treten konnte.
Ich spürte Schmerzen in der Schulter, im Rücken und an der Schläfe. Dabei hatte meine Winterjacke noch einen gewissen Schutz dargestellt. Duensing und der Ordnungsbeamte halfen mir auf die Beine. Hätte nur noch gefehlt, dass ich wieder mit dem Fuß umgeknickt wäre. Dann kam Saskia dazu.
Ich hatte eine Schürfwunde an der rechten Schläfe und würde die nächste Zeit jede Menge blaue Flecken mit mir herumtragen.
Nachdem Grothe endgültig im Rettungswagen verschwunden war, kam mir Philipp auf der Treppe zum Kommissariat entgegen. In den letzten Jahren hatte er sich nur geringfügig verändert. Er hatte dunkelblonde Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken, einige Falten um die Augen und einen minimalen Bauchansatz.
Immer darauf bedacht, im besten Licht dazustehen – so kenn ich ihn aus Schulzeiten.
„Hallo Mark, alter Kumpel. Tut mir total leid, dass du wegen mir eine verpasst bekommen hast“, sagte er und drückte fest meine Hand.
„Nicht deine Schuld. Ich hab für einen Moment nicht richtig aufgepasst … Und wie geht’s dir?“
„Der Angriff von Grothe belastet mich mehr, als man mir vielleicht ansieht.“ Sein anfängliches Lächeln verschwand und machte einem bedrückten Gesichtsausdruck Platz. „Ich bin hierhergefahren, um bei der Polizei meine Aussage von heute Morgen zu ergänzen. Im direkten persönlichen Gespräch hielt ich das für am besten.“
Eigentlich müsste er doch heute die Nase voll haben von Polizei und enthemmten Bikern. Dass er trotzdem sogar persönlich hier gleich wieder auftaucht, kommt mir merkwürdig vor.
Philipp hatte es eilig, und auch auf mich wartete der nächste Notfall.
„Könnte sein, dass ich mal deinen fachlichen Sachverstand für eines meiner nächsten Bücher brauche“, sagte er mit einem Augenzwinkern. „Hättest du eine Visitenkarte für mich?“
Ich tat ihm den Gefallen und wollte mich verabschieden, als mir unten vor der Treppe zum Kommissariat ein Mann in einer dunkelblauen Winterjacke auffiel. Auf Anhieb konnte ich ihn nicht zuordnen, aber ich kannte ihn von irgendwoher. Er guckte zu uns herauf, aber sein Interesse galt offensichtlich nicht mir, sondern Philipp.
*
Der Mann spürte eine Mischung aus Beklemmung und Ärger, machte sich große Sorgen um Peter Horand. Sein Gefühl sagte ihm, dass da etwas mit seinem Bekannten nicht stimmte. Als er vor der Haustür des mehrstöckigen Mietshauses stand und ein paarmal hintereinander klingelte, nahm seine Unruhe zu.
Nichts! Peter macht nicht auf.
Er klingelte bei Rosenhahn. Der war Rentner wie Peter und wohnte eine Etage unter ihm, gleichzeitig war er der Besitzer des Hauses. Zum Glück war Rosenhahn da und betätigte den Summer.
Er erzählte Rosenhahn kurz von seiner Besorgnis, ging dann einen Stock weiter, in die zweite Etage. Auf Klingeln und Klopfen erfolgte keine Reaktion. Aber als er sein Ohr an die geschlossene Wohnungstür legte, meinte er etwas zu hören. Sehr leise.
Das sind doch Stimmen?! Aber völlig monoton. Und immer das Gleiche. Was ist da los?
Das klang nicht nach Besuch. Das klang nach Fernseher, oder einer CD, die beim Abspielen an einer Stelle festhing. Aber was war mit Peter?
Der geht doch nicht raus, wenn drinnen der Fernseher läuft. Liegt er hilflos in der Wohnung?
Rosenhahn hatte als Vermieter für Peters Wohnung einen Schlüssel. Für den Notfall. Das war auf jeden Fall einer.
Er ließ Rosenhahn aufschließen. Was er dann zu sehen bekam, erschreckte ihn zutiefst. Peter hatte sich am Heizkörper im Wohnzimmer erhängt. Vorher hatte er offenbar seine Lieblingsplatte, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band von den Beatles, aufgelegt.
Auf der zweiten Schallplattenseite war eine Endlosrille, in welche die Beatles als Gag ein Stimmengewirr hatten pressen lassen. Peters Plattenspieler besaß keine automatische Endabschaltung. Das Stimmengewirr wurde so lange abgespielt, bis der Tonarm manuell entfernt wurde. Peter war dazu nicht mehr in der Lage gewesen.
Rosenhahn verständigte die Polizei. Die fand einen handschriftlichen Abschiedsbrief und keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.
*
Saskia und ich stiegen in mein Auto ein, das wir in der Nähe vom Polizeikommissariat Misburg abgestellt hatten. Ich hatte mir nicht mehr die Mühe gemacht herauszufinden, wer der Mann in der dunkelblauen Winterjacke war und was er womöglich von Philipp wollte. Ich musste mich um das Hilfeersuchen kümmern, von dem Saskia vorhin kurz berichtet hatte. Ein Mann mit Namen Horand war heute Morgen telefonisch nicht erreichbar gewesen.
Gerade wollten wir das weitere Vorgehen besprechen, da klingelte mein Diensthandy.
Ich nahm das Gespräch an, eine Polizeibeamtin meldete sich. Nach meinem Treppensturz folgte jetzt der nächste Tiefschlag. Die Polizistin teilte mit, dass sie wusste, dass die psychiatrische Notfallbereitschaft zu einem Herrn Horand im Stadtteil Sahlkamp gerufen worden war. Sie sei jetzt bei ihm vor Ort. Wir bräuchten nicht mehr zu kommen. Der Mann habe sich das Leben genommen.
Ach, du Scheiße! Heute kommt’s ja richtig dicke!
In der Wohnung des Toten wurden wir tatsächlich nicht mehr gebraucht. Wie meine telefonische Rücksprache mit Mockie ergab, war Peter Horand nie Patient in einer der Beratungsstellen des Sozialpsychiatrischen Dienstes gewesen.
Schon kam der nächste Anruf.
Kein guter Tag für mich!
Am frühen Nachmittag trafen Saskia und ich wieder in unseren Büroräumen im Döhrener Timon Carré ein. Ich war völlig fertig, sah es aber als meine Aufgabe an, noch einmal den Bekannten von Peter Horand anzurufen. Ich wollte ihn fragen, wie er mit Horands Suizid zurechtkam und ob er Interesse an einem Gespräch mit mir hätte. Saskia beharrte darauf, sich selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Schließlich habe nur sie mit dem Mann gesprochen, daher wolle auch sie das Telefonat mit ihm führen.
Ich willigte ein (und war wirklich nicht unglücklich darüber, dieses Telefonat nicht führen zu müssen). Außerdem sagte ich mir, dass ich damit vermeiden wollte, dass Saskia den Eindruck bekam, ich könnte ihr das Ganze nicht zutrauen.
Kurz vor Dienstschluss informierte sie mich darüber, dass sie den Mann telefonisch erreicht hatte. Er hätte nachvollziehbar erklärt, dass er damit klarkäme und keine weitere Unterstützung von uns benötige.
Saskia legte eine elektronische Akte Peter Horand an und übernahm die kurze Dokumentation unserer Telefonate. Zuvor schon hatte ich erstmals Ralf Grothe bei uns aktenkundig gemacht.
Anschließend war Feierabend, und ich fuhr nach Hause, wo leider niemand auf mich wartete.
Kapitel 6
Heute war Samstag, der Tag nach meinem unerfreulichen Freitagsnotdienst.
Gleich frühmorgens machte ich mich auf den Weg zur Markthalle in der Innenstadt von Hannover. Meine Beweglichkeit war durch die schmerzhaften Prellungen, die ich gestern erlitten hatte, etwas beeinträchtigt. Trotzdem genoss ich ein Prosecco-Frühstück an einem italienischen Stand vor der breiten Fensterfront mit Blick auf den riesigen weihnachtlich geschmückten Tannenbaum neben dem Alten Rathaus, nahm bewusst das lebendige Treiben in den Gängen der Markthalle auf. Hier tobte das Leben, und ich hatte keinerlei dienstliche Verpflichtungen.
Vom Zeitschriftenstand hatte ich mir die heutige Ausgabe der täglich erscheinenden Boulevardzeitung TAGESBLATT Hannover besorgt. Auf dem Titel prangte als Überschrift: „Bestsellerautor P. R. in seinem Haus überfallen“. Daneben war ein Foto von ihm mit Mantel und Sakko vor dem Polizeikommissariat Misburg. Ein kleines Foto zeigte verpixelt einen knienden Mann, umringt von Polizisten – Ralf Grothe, nachdem er mir einen tückischen Tritt versetzt hatte. Im Innenteil der Zeitung ging der Artikel weiter. Dort war ein Archivfoto von Philipps Haus in Anderten zu sehen.
Jetzt fällt mir ein, wer der Typ in Dunkelblau vor dem Kommissariat war. Kleber, ein Reporter, der fürs TAGESBLATT arbeitet.
Ich hatte vor zwei Jahren kurz mit Kleber zu tun gehabt. Er wollte damals Informationen von mir zu einem Notfalleinsatz. Ich hatte ihm gesagt, dass er solche Informationen grundsätzlich nicht von mir bekommen würde.
Philipps Besuch der Polizeiwache war vorher mit Kleber genau abgesprochen.
Bestimmt hatte sich der Reporter von Fotos vor dem Kommissariat mehr versprochen, als wenn diese zum wiederholten Mal Philipp vor seinem Haus zeigten (wo der Überfall eigentlich stattgefunden hatte). Denn solche Fotos waren in den letzten Monaten schon mehrfach in den Zeitungen erschienen.
In dem Artikel wurde Philipp zitiert, dass der Angriff auf ihn seinem neuesten Roman galt, in welchem er Vorurteile gegen Homosexualität mit satirischen Stilmitteln der Lächerlichkeit preisgab. „Der Vorfall zeigt mir die Brisanz des Themas, über das wir ins Gespräch kommen sollten. Gerne kontrovers, aber nicht mit Gewalt.“ Es wurde berichtet, dass der Angreifer zusätzlich einen Arzt des Sozialpsychiatrischen Dienstes verletzt habe und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sei. Die Namen von Grothe oder mir wurden nicht genannt.
So wie ich die Sache sehe, hat Philipp den gestrigen Vorfall gut als Publicity für sein aktuelles Buch genutzt. Und zwar ganz gezielt und durchdacht. Ein Fuchs war er schon immer, der seinem Kürzel P. R. alle Ehre macht.
Kapitel 7
25 Tage vor der Ermordung von P. R.
„Ich find es total lieb von dir, dass du Oma helfen willst“, sagte Luisa und streichelte Kilians Wange. Er hatte den grauen Renault Twingo direkt vor das Haus von Luisas Oma gefahren und den Motor abgestellt.
Der 21-jährige Kilian wandte Luisa den Kopf zu: „Ist doch kein Ding. Für die Oma meiner Lissi hab ich immer Zeit.“
Dabei grinste er seine drei Jahre jüngere Freundin an. Sie schnallte sich ab, nahm seinen Kopf in beide Hände und küsste ihn zärtlich auf den Mund.
Seit letztem Herbst waren Kilian und Luisa befreundet. Sie ging noch zur Schule, machte im nächsten Jahr Abitur. Er befand sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Mediengestalter Bild und Ton bei h1, dem Bürgerfernsehen für die Region Hannover.
Kilian war ein schlanker, sportlicher Typ von durchschnittlicher Größe mit kurzen braunen Haaren. Luisa dagegen war merklich kleiner, zierlich, trug einen Long Bob in Dunkelbond.
Es war Samstag, der 18. Februar, nachmittags. Das Haus von Luisas Oma stand in einer Reihe mit weiteren Einfamilienhäusern. Alle mit rotem Satteldach, kleinem Garten und mittelhohem Holzzaun.
Luisa klingelte. Es dauerte eine Weile, bis Frau Lübke, eine weißhaarige Frau Mitte achtzig, die Tür öffnete.
Luisa nahm ihre Oma in den Arm: „Ich habe Kilian mitgebracht. Er wird alles wieder in Ordnung bringen.“
„Ich krieg das hin“, bestätigte er. „Mit den Händen bin ich äußerst geschickt.“
Und Silikon-Spray hatte er auch mitgebracht.
Frau Lübke freute sich über die Besucher, war aber etwas aufgeregt, vermutlich weil sie nicht oft Besuch bekam. Sie bestand darauf, ihren beiden Gästen Kaffee und Kuchen anzubieten. Wobei der Kuchen ein alter Fertigkuchen von Bahlsen war.
Seit dem Tod ihres Mannes vor zwölf Jahren wohnte Frau Lübke allein in dem Haus. Sie wollte keine Putzfrau, keinen Pflegedienst und kein Essen auf Rädern. Und sie wollte auf keinen Fall in ein Altersheim. Ihren Sohn und ihre Schwiegertochter bat sie selten um Hilfe („die haben selbst genug zu tun“). Aber mit manchen Dingen des Alltags, wie Instandhaltung des Hauses und Gartenpflege, war sie zuletzt überfordert. „Manchmal ist es schon grenzwertig, wie Oma lebt“, hatte Luisa einmal zu Kilian gesagt.
Die aktuellen Probleme von Frau Lübke waren für Kilian Kleinigkeiten. Der Haustürschlüssel ging schwer ins Schloss, im Bad mussten zwei Glühbirnen der Deckenlampe ausgewechselt werden, und der Receiver fürs Antennenfernsehen war verstellt.
Scheiße, hab echt ein schlechtes Gewissen bei dem, was ich jetzt vorhabe, schoss Kilian durch den Kopf. Und Lissi und die Oma ahnen nicht das Geringste.
Luisa hatte gesehen, dass in der Spüle noch Geschirr stand. Der Geschirrspüler war defekt. Den bekam Kilian nicht wieder hin. Seine Freundin half ihrer Oma unten in der Küche beim Abwasch, während er mit Glühbirnen, Klapptritt und Schraubendreher bewaffnet ins erste Stockwerk ging, um sich der Deckenlampe im Bad zu widmen. In seiner Hosentasche versteckte er ein Paar Latexhandschuhe.
Zunehmend machten sich Gedächtnisausfälle bei der alten Dame bemerkbar. Er wusste von Luisa, dass Frau Lübke bei ihrer Bank immer persönlich tausend Euro auf einmal abhob, das Geld in der Handtasche nach Hause trug und dort in einer Kassette deponierte, versteckt zwischen der Wäsche im Schlafzimmerschrank. Dahinter steckte die Idee, stets ausreichend Bargeld im Haus zu haben, da Frau Lübke überhaupt nicht mehr richtig einschätzen konnte, was ein Einkauf sie kosten würde. Es war wohl auch schon vorgekommen, dass sie sich erneut Geld von der Bank geholt hatte, obwohl das Bargeld zu Hause bei Weitem noch nicht aufgebraucht war. Oder dass sie größere Summen Geld verlegt oder verloren hatte. Allerdings wollte sie sich von ihrem Sohn keinesfalls in ihre Finanzen hineinreden lassen, obwohl sie den Überblick völlig verloren hatte.
Die Geldkassette, ich hoffe, ich finde sie problemlos.
Kilian streifte sich die Handschuhe über (falls doch später die Polizei ins Spiel kam) und öffnete vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer, das neben dem Bad lag. Luisa und ihre Oma unterhielten sich in der Küche.
Die Frau ist alt und hat mehr Geld, als sie braucht, rechtfertigte er sich in Gedanken. Das Erbe ihres Mannes und die monatlichen Einnahmen ihrer vermieteten Wohnungen. Ich brauch es umso mehr. Und sie merkt nicht, wenn was fehlt.
Er betrat das Schlafzimmer, in dem noch immer ein Doppelbett stand. Zum Fußende eine Schrankwand im Stil der Siebzigerjahre.
Hier sollte ich eigentlich fündig werden.
Er öffnete die Schranktüren.
Wo ist die verdammte Geldkassette?!
Auf keinen Fall durfte er im Schrank Unordnung verursachen, sonst schöpfte die Alte sofort Verdacht.
Dauert länger als gedacht!
Von unten rief Luisa: „Hast du alles, Kilian, kommst du klar?“
Sie darf auf keinen Fall raufkommen!
„Alles in Ordnung!“, antwortete er. „Keine Probleme!“