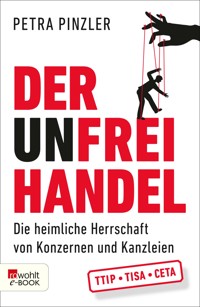Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist heute Fortschritt? Brauchen wir mehr oder weniger Wachstum? Niedrigere Steuern oder bessere Umverteilung? Mehr Freizeit? Rettet uns die Technologie vor der Klimakrise oder ein anderes Verhalten? Die Journalistin Petra Pinzler sortiert die Fäden: Wo sind die Ideen, die uns ein gutes Leben bringen, und wer will uns dagegen Rückschritt als Fortschritt verkaufen? Ihr Buch beantwortet große Fragen mit lebensnahen Antworten und misst die kursierenden Fortschrittskonzepte an den gegenwärtigen Herausforderungen. Zukunftsweisendes Aufräumen in unsicheren Zeiten. »Als Arzt habe ich gelernt: erst Diagnose stellen, dann über Therapie sprechen. Petra Pinzlers politisch versierte Diagnose ist allen zu empfehlen, die verstehen wollen, wie unsere Demokratie wieder fähig wird, die großen Krisen zu lösen.« Dr. Eckart v. Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen »In Zeiten der Zumutung können wir Schuldige suchen oder den Mut finden, Ressourcen zu bündeln, um neue Strukturen zu schaffen. Wer Lust auf Letzteres hat, wird mit diesem Buch belohnt.« Prof. Dr. Maja Göpel, Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin »Petra Pinzler ist eine kluge Beobachterin des politischen Berlin, die auch nicht vor den großen Fragen jenseits der Tagespolitik zurückschreckt.« Prof. Dr. Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft und Professor für Sozialökonomie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PETRA PINZLER
Hat das Zukunft oder kann das weg?
Der Fortschrittskompass
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Was ist heute Fortschritt? Brauchen wir mehr oder weniger Wachstum? Niedrigere Steuern oder bessere Umverteilung? Mehr Freizeit? Rettet uns die Technologie vor der Klimakrise oder ein anderes Verhalten? Die Journalistin Petra Pinzler sortiert die Fäden: Wo sind die Ideen, die uns ein gutes Leben bringen, und wer will uns dagegen Rückschritt als Fortschritt verkaufen? Ihr Buch beantwortet große Fragen mit lebensnahen Antworten und misst die kursierenden Fortschrittskonzepte an den gegenwärtigen Herausforderungen. Zukunftsweisendes Aufräumen in unsicheren Zeiten.»Als Arzt habe ich gelernt: erst Diagnose stellen, dann über Therapie sprechen. Petra Pinzlers politisch versierte Diagnose ist allen zu empfehlen, die verstehen wollen, wie unsere Demokratie wieder fähig wird, die großen Krisen zu lösen.« Dr. Eckart v. Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen»In Zeiten der Zumutung können wir Schuldige suchen oder den Mut finden, Ressourcen zu bündeln, um neue Strukturen zu schaffen. Wer Lust auf Letzteres hat, wird mit diesem Buch belohnt.« Prof. Dr. Maja Göpel, Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin»Petra Pinzler ist eine kluge Beobachterin des politischen Berlin, die auch nicht vor den großen Fragen jenseits der Tagespolitik zurückschreckt.« Prof. Dr. Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft und Professor für Sozialökonomie
Vita
Petra Pinzler arbeitet als Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit. Sie schreibt zudem Bücher über Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz und die Frage, was die Gesellschaft gut und Menschen zufrieden macht. Nach einem Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften besuchte sie die Kölner Journalistenschule. 1994 begann sie bei der Zeit, für die sie von 1998 bis 2001 als Korrespondentin aus Washington berichtete, bis 2007 aus Brüssel und seither aus Berlin.
Meinen Eltern Ute und Horst Pinzler
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Anfang — Über uns
Kapitel 1
Über die Politik — Wie die Ampel mehr Fortschritt versprach und warum das schiefging
Kapitel 2
Wie die Zukunft in die Welt kam — Eine kurze Geschichte des Fortschritts
Kapitel 3
Was ist Fortschritt heute? — Über Marsreisen, KI und bezahlbaren Wohnraum
Kapitel 4
Die Grenzen des Möglichen — Welche Zukünfte erlaubt der Planet noch?
Kapitel 5
Gibt es im Kapitalismus eine Zukunft? – oder muss der weg?
Kapitel 6
Den Markt nutzen — Über die systemverändernde Macht von Effizienz, Kreisläufen und Preisen
Kapitel 7
Was ist moderne Wirtschaftspolitik? — Über marode Brücken, Stahlkocher und echte Generationengerechtigkeit
Kapitel 8
Innovationspolitik praktisch — Wie kommt das Neue in die Welt – und nach Deutschland?
Kapitel 9
Wie Zukunftspolitik (nicht) funktioniert — Ein Lehrstück
Kapitel 10
Wie Ungleichheit den Fortschritt hemmt – und die Demokratie bedroht
Kapitel 11
Und in Deutschland? — Was eine Straße über Fortschritt und Fairness in Deutschland erzählt
Kapitel 12
Warum die Parteien so schlecht zur Wirklichkeit passen — Über alte Grundwerte in Krisenzeiten
Kapitel 13
Konservativ und trotzdem modern sein: Die CDU
Kapitel 14
Was bedeutet Gerechtigkeit heute?: Die SPD
Kapitel 15
Ökologie als Markenkern: Die Grünen
Kapitel 16
Die Freiheit, die sie meinen: Die FDP
Kapitel 17
Chill doch mal! — Wie die Politik auf kreativere Ideen für die Zukunft kommen könnte
Kapitel 18
»Den Utopien-Muskel trainieren« — Wie wir die Zukunft ändern können
Kapitel 19
Über Krisen und Gummistiefel — Und darüber, wie der Kanzler sein Kabinett überraschte
Kapitel 20
Was nun, Regierung? — Über die ungenutzten Spielräume der Politik
Wir — Oder warum die Zukunft uns alle angeht
Dank
Anmerkungen
Anfang: Über uns
1
Über die Politik: Wie die Ampel mehr Fortschritt versprach, und warum das schiefging
2
Wie die Zukunft in die Welt kam: Eine kurze Geschichte des Fortschritts
3
Was ist Fortschritt heute? Über Marsreisen, KI und bezahlbaren Wohnraum
4
Die Grenzen des Möglichen: Welche Zukünfte erlaubt der Planet noch?
5
Gibt es im Kapitalismus eine Zukunft? Oder muss der weg?
6
Den Markt nutzen: Über die systemverändernde Macht von Effizienz, Kreisläufen und Preisen
7
Was ist moderne Wirtschaftspolitik? Über marode Brücken, Stahlkocher und echte Generationengerechtigkeit
8
Innovationspolitik praktisch: Wie kommt das Neue in die Welt – und nach Deutschland?
9
Wie Zukunftspolitik (nicht) funktioniert: Ein Lehrstück
10
Wie Ungleichheit den Fortschritt hemmt: Und die Demokratie bedroht
11
Und in Deutschland? Was eine Straße über Fortschritt und Fairness in Deutschland erzählt
12
Warum die Parteien so schlecht zur Wirklichkeit passen: Über alte Grundwerte in Krisenzeiten
13
Konservativ und trotzdem modern sein: Die CDU
14
Was bedeutet Gerechtigkeit heute? Die SPD
15
Ökologie als Markenkern: Die Grünen
16
Die Freiheit, die sie meinen: Die FDP
17
Chill doch mal! Wie die Politik auf kreativere Ideen für die Zukunft kommen könnte
18
»Den Utopien-Muskel trainieren«: Wie wir die Zukunft ändern können
19
Über Krisen und Gummistiefel: Und darüber, wie der Kanzler sein Kabinett überraschte
20
Was nun, Regierung? Über die ungenutzten Spielräume der Politik
Wir: Oder warum die Zukunft uns alle angeht
Dank
Anfang
Über uns
Wieder einer dieser Tage. Morgens das Radio gleich wieder ausgestellt. Nichts als Krisen, Kriege und Katastrophen. Kurz das Fenster geöffnet. Draußen ist es viel zu warm für die Jahreszeit, das Wetter spielt schon seit Tagen verrückt. Mal zu viel Regen, dann zu viel Sonne. Auf dem Weg zur Arbeit mit dem Handy gesurft, kurz vom neuesten Krach in der Regierung gelesen. Unerfreulich, wie fast immer. Hochgeschaut. Und da steht er plötzlich, der Spruch, jemand hat ihn an eine Wand gesprüht: Alles wird gut!
Alles wird gut? Den Satz kennt jeder. Und hin und wieder flackert sie ja auch auf, diese Hoffnung: Irgendwann werden gute Nachrichten aus dem Radio kommen oder den Social-Media-Feed füllen. Es werden Menschen regieren, die große Probleme lösen. Das Klima wird geschützt, das Artensterben gestoppt und der Frieden ist zurück. Der Fortschritt wird die Welt zu einem besseren Ort gemacht haben. Und warum auch nicht? Schließlich hat die Menschheit das Feuer bezähmt, die Demokratie erfunden und die Waschmaschine. Um nur drei Errungenschaften zu erwähnen.
Sie finden die Aufzählung verwunderlich und die Hoffnung naiv? Damit sind wir dann mittendrin im Thema dieses Buches. Ich möchte Sie mit auf die Suche nehmen, und zwar nach der Antwort auf die eine wichtige Frage in unser aller Leben: Was macht die Zukunft zu einem guten Ort? Die Frage ist nicht neu, doch kommt gerade etwas sehr Neues dazu. Anders als in der jüngeren Vergangenheit blicken wir heute immer häufiger mit Sorge auf die kommenden Jahre. Immer leichter fällt es uns, Dystopien auszumalen. Wir misstrauen dem Techno-Optimismus, und das oft genug zu Recht. Wir erinnern uns an all die gesellschaftlichen Utopien, die sich in Albträume verwandelt haben und sind deswegen skeptisch, wenn jemand von einer besseren Gesellschaft schwärmt. Dass der Fortschritt es schon irgendwie richten wird, glauben wir jedenfalls immer seltener. Und diejenigen, die ernsthaft behaupten, es werde schon alles gut, die schauen wir befremdet an. Deutschland, so könnte man auch sagen, hat ein Problem mit der Zukunft.
Dabei geht es den meisten Menschen heute besser denn je. Könnten wir unsere Vorfahren aus der Vergangenheit ins heutige Deutschland beamen, sie würden uns für verrückt halten. Jedenfalls, wenn wir sorgenvoll von unserem Leben erzählen. So viel Freiheit wie heute hatten wir hier nie. Frauen können mehr als jemals zuvor leben, wie sie wollen. Jugendliche werden ernster genommen. Menschen haben Rechte. Es gibt genug zu essen, die Wohnungen sind warm und langweilig ist es selten, denn jeden Tag kommt etwas Neues in die Welt. Und was vor einem Jahrhundert noch als verrückte Fantasie galt, ist heute völlig normal: Wissen auf Knopfdruck, Reisen um die Welt, maßgeschneiderte Medizin. Und Jahr für Jahr wächst die Lebenserwartung weiter.
Zugleich aber spüren wir die Widersprüchlichkeit der Gegenwart. Da ist der Krieg mit großer Grausamkeit in unsere Nachbarschaften zurückgekehrt, und mit ihm die Angst. Flüchtlinge aus aller Welt drängen verzweifelt ins Land. Die wilden Tiere sterben aus, die Wälder sind krank, die Ozeane kippen. Das, was gestern noch Sicherheit versprach, könnte vielleicht morgen schon nicht mehr da sein. Es schwindet die Hoffnung, dass die Vereinten Nationen eine Weltordnung etablieren, in der die Menschheit ihre Probleme kooperativ löst. Stattdessen erlebt die Geopolitik eine Renaissance und sie zwingt uns, erneut viel zu viel Geld für Rüstung auszugeben. Auf die amerikanische Schutzmacht ist nicht mehr unbedingt Verlass, Russland ist vom Nachbarn zur Bedrohung geworden und China hat sich zum ökonomischen Rivalen gewandelt. Immer häufiger wird die Wirtschaft als strategische Waffe eingesetzt. Und ob die neuen Technologien zum Fluch oder Segen werden, ist längst nicht ausgemacht. Sicher ist nur, dass Google, Amazon, Tiktok, ChatGPT und viele andere Tech-Unternehmen, nicht in Deutschland ansässig sind, sondern dort, wo andere entscheiden.
Als ob das nicht schon reicht, ist auch noch unser Staat eher schlecht als recht im 21. Jahrhundert angekommen. Ausgerechnet dort, wo wir ihn täglich erleben, wird er immer unzuverlässiger. Die Digitalisierung der Verwaltung gibt es zwar seit Jahren schon – in Estland und Österreich. Die Schulen sind mitnichten die Leuchttürme eines Landes, das Bildung so dringend nötig braucht, obwohl bei jeder Wahl das Gegenteil versprochen wird. Auf dem Land schließen Arztpraxen und Kindergärten. Und ja, früher war nicht nur mehr Lametta. Früher war es tatsächlich kein Witz, wenn jemand sagte: Pünktlich wie die Bahn.
Wann genau ist die Vergangenheit zum Sehnsuchtsort geworden? Wann die Zukunft zu etwas Bedrohlichem? Seit wann sorgen wir uns um unsere künftige Sicherheit, seit wann ist Freiheit nichts Selbstverständliches mehr? Seit die »Polykrise« ins Bewusstsein drängt, sagt der britische Historiker Adam Tooze und er beschreibt die Lage der Welt als etwas Einzigartiges, als eine bis dato unbekannte Zusammenballung von potenziellen Gefahren.1 Denn Krisen gab es zwar immer schon, so viel Krise gleichzeitig aber war noch nie. Heute könnten wir den gesamten Planeten vernichten, jedenfalls den Teil, den wir zum Überleben brauchen. Weil die Waffen tödlicher denn je sind und lokale Kriege die Gefahr in sich tragen, zu Weltenbränden zu werden. Und weil die Umweltkrise all diese Konflikte massiv verschärft.
Dabei ist die Wirkungskette einfach zu verstehen, aber schwer zu bekämpfen, es geht um komplexe Systeme. Nur ein Beispiel: Hitze macht unseren Nachbarkontinent Afrika zunehmend unbewohnbar, das führt zu lokalen Konflikten um Land und Wasser, also flüchten immer mehr Menschen, auch nach Europa. Ihre Zahl heizt hier die innenpolitische Lage auf, das treibt den Populisten die Leute zu, und damit sinken wiederum die Chancen für eine ehrgeizige Klimapolitik – mit deren Hilfe die Ursachen bekämpft werden könnten. Und schon hat er sich geschlossen, der Krisen-Teufelskreislauf.
Noch können wir die Wohnungstür schließen, die Nachrichten abschalten und Katzenfilmchen gucken. Doch immer häufiger schleicht sich die Wirklichkeit dann aus dem Unterbewusstsein ins Denken, und schon sind die Fragen da: Wie wird es weitergehen? War da nicht gerade erst die Dürre in Spanien, die Überschwemmung an der Ahr, der Starkregen im Saarland, die Sturmflut an der Ostsee? Erleben wir nicht mehr nur ein Jahrhunderthochwasser, sondern das Jahrhundert der Hochwasser? Kommt das Unheil immer näher? Und vielleicht kommt es gar nicht einfach so daher. Wir beschleunigen es doch durch die Art, wie wir essen, wohnen und durch die Welt jetten. Geht es jetzt ans Bezahlen, beginnt jetzt das Ende der Ausnahmejahrzehnte – jene Zeit der Behaglichkeit, in der immer mehr Wachstum und immer mehr Wohlstand zur trügerischen Selbstverständlichkeit wurden? Erleben wir das Ende eines goldenen Zeitalters und den Beginn einer neuen, unheilvollen Epoche?
Zwei Drittel der Deutschen blicken besorgt auf das Land: »Das Vertrauen in eine bessere Zukunft ist fundamental erschüttert: Die Mehrheit der Deutschen befindet sich in einem ›No Future‹-Modus.« Die Menschen »erkennen die großen Zukunftsprobleme, haben aber keine Idee, wie sich diese Jahrhundert-Herausforderungen bewältigen lassen.«2 Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Rheingold Instituts aus dem Jahr 2021. Man könnte annehmen, dass Corona bei den Antworten eine große Rolle gespielt hat. Doch auch Ende 2023 geben bei einer Erhebung der Stiftung für Zukunftsfragen sechs von zehn Befragten an, dass sie angstvoll auf das kommende Jahr blicken – je älter und je ärmer, desto mehr.3 Bei einer Umfrage der Schufa blicken im Frühjahr 2024 sogar drei Viertel der Deutschen ängstlich in die Zukunft.4 Und besonders bedrückend sind die Aussagen von Jugendlichen, also denjenigen, die sich voller Hoffnung auf ihr Leben freuen sollten. Nach einer Studie, die die Barmer Ersatzkasse beim Meinungsforschungsinstitut Sinus in Auftrag gegeben hatte, haben zwei Drittel von ihnen Angst vor dem Klimawandel.5
Kollektive Weltuntergangsgefühle verändern eine Gesellschaft. Der Soziologe Andreas Reckwitz, der sich Gedanken über die Folgen gemacht hat, war noch in jüngerer Vergangenheit der Meinung: »Ohne die Vorstellung, dass die Zukunft besser sein wird als die Gegenwart, so wie auch die Gegenwart bereits besser ist als die Vergangenheit, kann die moderne Gesellschaft bisher nicht existieren. Sie lebt von positiven Zukunftserwartungen.« Neuerdings aber ist er deutlich zurückhaltender, fordert, den Glauben an »eine vermeintlich automatische Entwicklung zum Besseren aufzugeben«, und wünscht sich, dass die Gesellschaft die Fähigkeit entwickelt, »mit Verlusten umzugehen«.6
Von solch düsteren Gedanken war die Ampelkoalition weit entfernt, als sie hoffnungsfroh die Merkel-Regierung ablöste. Scholz und sein neues Team wollten im Gegenteil das Zentrum und der Motor eines progressiven, hoffnungsfrohen Landes werden, dessen Bevölkerung fest an ein besseres Morgen glaubt. Sie wollten optimistische Antworten auf die großen Fragen geben: Was kann sich das Land ökonomisch noch leisten, was muss es modernisieren? Vor welchen Krisen fürchten wir uns zu Recht, auf welche Sicherheit können wir uns auch morgen noch verlassen? Wie wappnen wir uns gegen die Klimakrise? Was müssen wir ändern und worauf können wir uns freuen? Vor allem aber hatte sie suggeriert: Bei uns seid ihr in guten Händen.
Geblieben sind Ratlosigkeit, Streit und die Unfähigkeit, ehrlich mit uns zu sprechen. Schlimmer noch, die Erwartung, dass die Politik die Zukunft im Griff hat, ist einem bösen Gefühl gewichen, und das gleich in allen gesellschaftlichen Schichten: Wut!7 Die Akademikerinnen sind wütend, die Arbeiter, Junge und Alte, Frauen und Männer. Wir schimpfen auf die anderen und die auf uns. Und alle zusammen auf die Politik: Diese Regierung macht ihren Job so erbärmlich schlecht! Wenn auch auf sonst nichts, darauf können wir uns einigen. Im Frühjahr 2024 sind bereits 80 Prozent und damit eine große Mehrheit unzufrieden mit der Politik der Ampel, trotz Mindestlohnerhöhung, Energiepreisbremse und Deutschland-Ticket.
Nun lässt sich tatsächlich leicht argumentieren, dass die aktuelle Politik nicht auf der Höhe der Zeit ist. Dass die Ampel so viel falsch macht. Dass eine fortschrittliche Regierung die großen Probleme endlich viel beherzter angehen müsste. Oder wenigstens die parlamentarische Opposition einen Strauß überzeugender Alternativen bieten sollte. Immer häufiger verschwinden die sachliche Kritik, das Argument und die ernsthafte Debatte über die richtigen Lösungen jedoch unter einer Welle von Emotionen. Wir müssen heute wieder ernsthaft um die Demokratie fürchten, darum, dass Wählende sich voller Frust abwenden. Immer mehr Menschen weigern sich, wie Erwachsene zivilisiert über Themen zu streiten, sie empfinden das Ringen um Kompromisse als Versagen des politischen Systems. Sie rotten sich auf Telegram zusammen, beleidigen auf X (Twitter) andere und bedrohen ausgerechnet diejenigen, die in den Kommunen mühsam versuchen, etwas zum Besseren zu verändern. Und auf dieser Welle aus Hass surfen dann Populisten und verbreiten die Botschaft, dass wir vorwärts in die Vergangenheit müssen.
Dieses Buch sucht nach dem Gegenteil. Es soll als Kompass auf dem Weg in eine gute Zukunft dienen, der ganz privaten und der des Landes. Deswegen sucht es nach den Faktoren, die eine Gesellschaft braucht, um die alten Ideen vom Fortschritt nicht nur zu entstauben und zu aktualisieren, sondern daraus auch künftig und trotz alledem die nötige Kraft für Veränderungen zu schöpfen. Es erzählt, welche klassischen Fortschrittskonzepte es gab, welche heute noch passen, und wie die Konzepte der Parteien modernisiert werden müssten. Es diskutiert, ob es im Kapitalismus noch eine Zukunft geben kann, und wenn ja, in welcher Art von Kapitalismus. Welche Politik es dafür braucht. Und warum viele der nötigen Reformen ohne mehr Gerechtigkeit nicht umsetzbar sein werden.
Dabei drängt die Zeit, mehr denn je. Denn eines ist klar: Die Polykrisen werden – so oder so – für Wandel sorgen. Wer heute über Fortschritt redet oder sogar für ihn wirbt, muss das immer mitdenken. Fortschritt hat zwar seit jeher viele Gestalten, er kann mehr Freiheit bedeuten, mehr Gerechtigkeit oder Wohlstand, neue Ideen, Dinge, Lebensweisen oder alles zusammen. Menschen haben ganz unterschiedliche Prioritäten, und genau das bringt eine plurale, lebendige Gesellschaft voran. Alle ihre Wünsche eint heute jedoch eines: Damit sie verwirklicht werden können, braucht es einen gesunden Planeten. Das klingt trivial, ist es aber leider nicht mehr. Wir werden nur dann weiter würdig auf dieser Erde leben, lieben und innovativ sein können, wenn Politik und Wirtschaft die physikalischen Gesetze und die Begrenztheit der Natur respektieren. Und genau das tun sie derzeit nicht. Bleibt das auch künftig so, werden die Kräfte der Regierungen und die Finanzen des Staates immer stärker durch die Folgen immer schlimmerer Naturkrisen gebunden sein. Fortschritt passt also nur dann noch ins 21. Jahrhundert, wenn er die Klimakrise und die Begrenztheit der Natur berücksichtigt. Gesellschaften, die sich dieser Erkenntnis verweigern, werden bald schon immer mehr Getriebene der Veränderungen sein. Weil mit jedem Jahr der Ignoranz die Spielräume für eine aktive Gestaltung der Zukunft schrumpfen. Und die Reparaturarbeiten immer teurer werden.
Die entscheidende Frage ist also nicht, ob sich Deutschland verändert, sondern wie und wann. Und ob wir, ob unsere Regierungen, den Spielraum nutzen, den es jetzt noch gibt. Dieses Buch wird daher immer wieder um diese eine Frage kreisen: Wie geht eine fortschrittliche Politik, die die planetaren Grenzen achtet?
Ein Hinweis noch vorweg, quasi als Gebrauchsanweisung: Weil alle Theorie grau ist und Ideen von Fortschritt und Entwicklung leicht ins Theoretische abschweifen, wird dieses Buch immer wieder auch den Praxistest machen, also hineintauchen in die aktuelle deutsche Politik. Sie dient als Lehrstück, sie illustriert, was in der aktuellen Wirtschafts- und Umweltpolitik zukunftsfähig ist – und was wegmuss. Warum ist die Ampel als Tiger gestartet und schnell als Bettvorleger gelandet? Warum tun sich die Regierungsparteien so unsagbar schwer damit, unser so reiches Land zu modernisieren oder überhaupt nur überzeugende Bilder eines modernen und sicheren Landes zu entwickeln? Warum fällt ihnen das Gespräch mit uns so schwer? Wie ist die Lage bei den Christdemokraten, die möglicherweise die kommende Regierung führen werden? Warum wirken die Grundwerte aller Parteien so altmodisch, wie müssten sie modernisiert werden? Und wo gibt es Ideen für eine andere, zukunftsfähigere Politik? Oder kurz: Wie kommt der Fortschritt ins Land?
Die Suche nach den Antworten hat zu Innovationsexperten und Ministerinnen geführt, zu Regierungsberatern, Wirtschaftsweisen und Menschen, die sich jeden Tag für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unser Wohlergehen engagieren. Komplexitätsforscher erklären, wieso die moderne Datenanalyse manche Science-Fiction schon heute alt aussehen lässt. Die Hausphilosophen der Silicon-Valley-Tycoons kommen mit ihren sehr speziellen Ideen für die Weiterentwicklung der Menschheit zu Wort. Ökonominnen und Sozialwissenschaftler diskutieren, was man vom Kapitalismus noch brauchen kann und wofür den Staat, wie Gerechtigkeit und Fortschritt zusammenhängen. Es stellt diejenigen vor, die gegen das »Wird alles eh nix mehr«-Weltuntergangsgefühl kämpfen. Und dann nehme ich Sie auch noch mit zu einem faszinierenden Experiment. Bei dem geht es darum, zu lernen, was vielen von uns fehlt: Zukunftskompetenz.
Ohne zu sehr zu spoilern: Es geht noch was in diesem Land.
Wie? Die Antworten sind so interessant wie die Zukunft selbst.
Kapitel 1Über die Politik
Wie die Ampel mehr Fortschritt versprach und warum das schiefging
Das Selfie erscheint heute irreal: Annalena Baerbock, Christian Lindner, Robert Habeck und Volker Wissing lächeln in eine Handykamera. Alle vier sehen ein wenig müde aus, das weiße Licht schmeichelt nicht gerade, bei Lindner spiegelt es sich auf der Stirn, bei Habeck auf der Nase. Doch gerade das Unperfekte macht das Besondere aus, signalisiert es doch: Hier beginnt etwas, das im Stil modern, im Ton fröhlich und im Inhalt neu sein wird. Hier schließen sich zwar sehr unterschiedliche Parteien zusammen, aber ihre neue Koalition wird von Pragmatismus getragen werden, von dem gemeinsamen Willen, das Land zum Besseren zu verändern, und das schnell: Bei der Digitalisierung, der ökologischen Transformation, den Bürgerrechten. Alle vier stellen das Foto zeitgleich auf Instagram. Alle schreiben den gleichen Text: »Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.«
Der Blick zurück in die Flitterwochen der Ampel ist nicht nur von historischem Interesse. Zukunftsfähige Politik des 21. Jahrhundert muss sich sehr grundsätzlich von der des vergangenen Jahrhunderts unterscheiden, nicht nur weil die Krisen häufiger und heftiger werden. Auch können die Fortschrittskonzepte der Vergangenheit nicht mehr einfach so in die Zukunft fortgeschrieben werden. Erfolgreiche Regierungspolitik braucht also einen neuen Kompass. Und die Ampel hat genau den versprochen. Sie suggerierte gleich am Anfang ihrer Partnerschaft, dass sie uns verstanden hat und entsprechend handeln will. Dass bei ihr manches anders, aber vieles besser werden wird als unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese Koalition will das Land modernisieren. Sie will nicht vor allem reagieren, sondern regieren. Was ganz offensichtlich eher schlecht als recht funktioniert hat. Warum? Tauchen wir kurz ein in die jüngere Geschichte und suchen nach den Schlüsselmomenten, die das Scheitern der Ampel dokumentieren. Nach den tiefer liegenden Gründen für all den Streit. Und nach den Kräften, die die Koalition von der ersten Minute an gleich wieder auseinandertreibt. Dann wird nicht nur klar, warum die aktuelle Regierungspolitik so dysfunktional ist. Sondern auch, was für Lehren die nächsten Regierungen daraus ziehen sollten. Und auch wir.
Also zurück in die so hoffnungsvollen Monate des Anfangs. Fast surreal wirkt im Rückblick, wie fröhlich die Vier an jenem 29. September 2021 sind. So viel gute Laune war lange nicht und auch nicht so viel Hoffnung. Selbst wenn hier keine heiße politische Liebesaffäre beginnt, sondern eine arrangierte und auf kühler Nutzenkalkulation basierende Vernunftehe, weckt der Start doch erstaunlich viele positive Gefühle. Das neue Regierungsteam wirkt nicht nur unverbrauchter, jünger und pragmatischer als die Vorgänger. Mit ihm scheint auch ein neuer Stil in die Politik einzuziehen. »Eng, intensiv, mitunter leidenschaftlich und vor allem vertrauensvoll« seien die Koalitionsgespräche verlaufen, beschreibt der Sozialdemokrat Olaf Scholz die neue Arbeitsweise. Der Grüne Robert Habeck verspricht eine »lernende Politik«, um »Gegensätze zu überwinden«. Und FDP-Chef Christian Lindner sagt, man wolle sich »nicht gegenseitig begrenzen, sondern gegenseitig erweitern«1. So gut ist die Stimmung in jenen Tagen, dass sogar der notorisch unzufriedene Spiegel kommentiert: »Dieses Bild, es kann der Anfang von etwas sein.«2
Das Gefühl des Neustarts entsteht auch dadurch, dass in der Koalition Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Stilen zusammengekommen sind: Der Grüne Robert Habeck, dessen Krawatten noch ziemlich schief sitzen. Der Liberale Marco Buschmann, der mit seiner Musik einen SoundCloud-Account betreibt. Der Publikumsliebling Karl Lauterbach. Das grüne Ausnahmetalent Ricarda Lang, die trotz oder wegen ihrer Jugend mit ungewöhnlicher Coolness in jede Talkshow geht, und bald schon zur Hoffnung der Grünen wird. Der liberale Pfälzer Volker Wissing, der als Landesminister schon Ampelerfahrung hat und davon schwärmt. Eine SPD-Fraktion, die so altersgemischt und divers ist wie nie. Ein Blick reicht, um zu wissen: Das ist eindeutig das Ende der einfarbigen Jacketts. Stilistisch wird es in Berlin ab sofort deutlich moderner als in der Merkel-Ära, und vielleicht geht noch mehr. Vielleicht entsteht hier eine neue progressive Mitte.
Die Spitzen der Ampel befeuern diese Erzählung gern – und eine kurze Weile auch erfolgreich. »Ein neuer Aufbruch ist möglich. Fangen wir an. Deutschland wartet auf diesen neuen Aufbruch«, wirbt FDP-Chef Christian Lindner auf dem digitalen Parteitag seiner Partei für das neue Bündnis.3 Annalena Baerbock klingt nicht viel anders, sie spricht von einem neuen gesellschaftspolitischen Motor: »Es gibt bei dieser Farbkonstellation auch eine Chance, eine neue Dynamik, einen gesellschaftspolitischen Aufbruch zu schaffen, um unser Land auf die Höhe der Zeit zu bringen.«4 Oder, um es mit Robert Habecks Worten zu sagen, weil die am meisten vor Begeisterung sprühen: »Einen Regierungswechsel, wie er jetzt ansteht, hat es in den 72 Jahren Bundesrepublik nur selten gegeben – aus meiner Sicht nur 69, 82 und 98. Diese Wechsel waren immer weit mehr als das, was die Politik selbst vorangebracht hat. Sie waren immer auch Spiegel der Veränderungen in der Gesellschaft. Sie markierten immer eine Zäsur für neuen Wandel.«5
Nötig wäre er, der Wandel. Die Zukunft dieses Landes braucht eine andere Art der politischen Zusammenarbeit. Man kann das, was wir gerade erleben, mit dem Wort »Epochenwechsel« beschreiben. Man kann es die »Geschichtlichkeit des Augenblicks« nennen oder »Polykrisenzeiten«. All das klingt groß, aber genau darum geht es: Um gewaltige Veränderungen und daraus abgeleitet die Frage, wie die Politik auf die neue Wirklichkeit reagiert oder reagieren sollte. Viele der modernen Krisen sind latente Probleme, die unsere Sicherheit noch nicht unmittelbar, aber doch immer stärker beeinträchtigen. Geopolitische Machtverschiebungen dauern, kriegerische Konflikte schwelen oft schon Jahre, die Klimakrise kommt nicht über Nacht, und viele Insekten sterben heute zwar viel zu schnell aus – aber dennoch zu langsam für die Schlagzeilen von Zeitungen. Eine Regierung wird solche Probleme nicht lösen, indem sie immer nur reagiert, wenn es brennt. Statt nur das nächste Feuer zu löschen, muss sie sehr grundsätzlich über andere Formen des Brandschutzes nachdenken. Will sie für Sicherheit sorgen, muss sie präventiver wirken als ihre Vorgängerinnen – wohl wissend, dass sie dafür vielleicht gar nicht oder erst in der Zukunft gelobt werden wird. Und dass die Opposition im Zweifel nur über die hohen Kosten schimpft und den Nutzen ignoriert. Sie muss daher viel mehr als ihre Vorgängerinnen erklären können, was auf uns zukommen wird, warum Prävention jetzt (!) sein muss. Und auch, dass manche Probleme womöglich gar nicht und andere nur gemeinsam, unter tätiger Mithilfe von Demokratinnen und Demokraten, von Bürgerinnen und Bürgern gelöst werden können.
Eines ist jedenfalls sicher, und das bereits zum Amtsantritt der Ampel: Die vergleichsweise ruhigen Zeiten, in denen Angela Merkel die Sorgen der Welt still und leise auf ihre Schultern geladen und dann irgendwie erledigt oder verschoben hat, jedenfalls aber die Menschen damit wenig behelligte, sind vorbei. Künftige Regierungen werden den Wandel immer schlechter ignorieren oder einfach so wegmanagen können. Der Koalitionsvertrag verspricht, daraus eine Chance zu machen, er propagiert die positive Variante des Wandels, jedenfalls im Titel.
»MEHR FORTSCHRITT WAGEN«. In Großbuchstaben prangen diese Worte während der ersten gemeinsamen Pressekonferenz der Ampel über der Bühne. Und darunter: »BÜNDNIS FÜR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT«. Die Verhandler der Parteien haben mit dem Motto ein kleines Kunststück vollbracht. Sie haben einen alten Slogan von Willi Brandt modernisiert. Der sozialdemokratische Bundeskanzler hatte Ende der 60er-Jahre mit einer sozialliberalen Koalition vielen Menschen Hoffnung auf einen Neuanfang gemacht, unter der Losung »Mehr Demokratie wagen«.6 Dieses Zitat wird nun variiert und damit neu interpretiert.
Zwar sind die Grünen nicht sehr glücklich mit diesem Motto, sie finden »Fortschritt« zu technokratisch. Den Liberalen klingt er zu sozialdemokratisch. Aber beide Parteien machen mit, auch in Ermanglung besserer Ideen. Als der Koalitionsvertrag schließlich steht, muss es außerdem schnell gehen mit der Überschrift und auch mit der dazu passenden Erzählung. »Es war von Anfang an sehr klar, was alles verändert werden wird. Es gab also Tabus wie die Rente bei der SPD, das Tempolimit für die FDP und den Atomausstieg bei den Grünen. Dann hatte jede Partei noch ein paar Herzensprojekte, die sie durchsetzen wollte. Die tauchten im Koalitionsvertrag hinter vielen Spiegelstrichen auf. Es fehlte jedoch von Anfang an die große Idee, wie das Land durch eine gemeinsame Politik aus einem Guss würde modernisiert werden können«, sagt jemand, der dabei war und viel darüber nachdenkt, was gleich zu Beginn falsch gelaufen ist. Immerhin steht im Titel des neuen Vertrages für jede Partei zusätzlich ein Wort, das deren Markenkern auf den Punkt bringt und trotzdem die anderen beiden nicht sofort auf die Palme treibt. Die Liberalen bekommen die »Freiheit«, die Sozialdemokraten die »Gerechtigkeit« und die Grünen die »Nachhaltigkeit«. Und dann gibt es mit dem »Fortschritt« eben das Schlüsselwort, das alles klammert. Jedenfalls theoretisch. Eine kleines »progressives Lagerfeuer«7 wurde da angezündet und flackerte zu Beginn ja auch ganz schön.
Viel ist darüber geschrieben worden, wer sich am Ende bei den Verhandlungen mehr durchgesetzt hat. »Der Koalitionsvertrag der Ampel war jedenfalls hinreichend vage formuliert – um neue Politik zu ermöglichen«, urteilt der ehemalige SPD-Chef Norbert Walter-Borjans im Rückblick und er sieht darin im Grunde eine Chance – immer noch. Als Beispiel für die Möglichkeiten, die das Papier bietet, fällt ihm spontan ein: »Nicht mal Steuererhöhungen wurden – anders als oft behauptet – ausgeschlossen.« Borjans bedauert, dass sich daran heute kaum noch jemand erinnere. Tatsächlich bietet der Vertrag an sich viel Spielraum für neue Politik, jedenfalls deutlich mehr als das, was SPD, Grüne und FDP während der Koalitionsverhandlungen so an Lieblingsthemen in den Topf werfen. Möglich gewesen wäre ein gemeinsames Projekt, das mehr ist als die Summe der einzelnen Ideen. Sie hätten gemeinsame Stärken suchen und finden können, statt nur die jeweiligen Schwächen der anderen auszukosten. Aus Sozialdemokratie, Liberalismus und Ökologie hätte etwa Neues geformt werden können: progressive Politik.
Hätte, wäre, könnte: So viel Konjunktiv. Von Anfang an ist auch klar: Wie dieses gemeinsame Reformprojekt entstehen wird, weiß niemand so genau. Schließlich hatten, vielleicht mit Ausnahme von Olaf Scholz und seinem Vertrauten Wolfgang Schmidt, alle anderen Ampelaner eher mit Jamaika, also einer Kombination von CDU, CSU, FDP und Grünen, als mit einer rot-gelb-grünen Regierung gerechnet. Aber nun waren sie schon mal an der Macht, und sie mochten es. »Die Situation erinnert etwas an die britische Prinzessin Lady Di und Prince Charles. Nicht die Partner waren die Objekte der Begierde, sondern sie waren vor allem verliebt in die Situation. Lady Di in das Prinzessinnen-Sein, und die Ampel-Partner in den Zustand, die Regierung zu stellen«, erinnert sich der Politikwissenschaftler Knut Bergmann an jene Wochen. Warum aber nicht einfach mal machen? Gute Ideen entstehen oft erst durch gemeinsames Handeln, und das wiederum sorgt dann für den nötigen Kitt. Schnell einigen sich die Spitzen der Koalition deswegen darauf, ihre konkrete Politik nicht in Interviews, sondern in vertraulicher Kooperation zu entwerfen und Streit intern auszutragen.
In der ersten Regierungserklärung am 15. Dezember fasst Bundeskanzler Scholz das Gründungsdokument so zusammen: Seine Regierung werde eine des »technischen Fortschritts«, des »sozialen Fortschritts« sowie des »gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritts«. Überall biete sich »die Kraft und die Möglichkeit des Fortschritts«. Und damit es auch alle verstehen: »Im 21. Jahrhundert brauchen wir nicht weniger Fortschritt, sondern mehr Fortschritt. Aber wir brauchen besseren Fortschritt, wir brauchen klugen Fortschritt. Fortschritt für eine bessere Welt, für ein besseres Land, für eine bessere Gesellschaft, für mehr Freiheit für jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger – das ist der Fortschritt, den wir wollen.«8 Das F-Wort taucht in der Rede dreißigmal auf. Das sind selbst für eine wörtliche Rede so viele Wiederholungen, dass es nervt. Dabei ist die Grundidee von Scholz‹ Rede gar nicht schlecht. Er will das Leitmotiv seines künftigen Handels noch einmal klar machen. Er spricht von »uns«, davon, dass »wir« ein Wagnis eingehen müssen, auch weil das Weiter-so gefährlicher wäre. Er signalisiert, dass er auf neue Technik setze, aber auch auf Partizipation. So, als wolle er signalisieren: Mit uns wird so manches anders, aber hey, keine Sorge, es wird fair werden und die Zukunft kann mit uns sogar Spaß machen.
Das hat zunächst auch deswegen Anziehungskraft, weil die Spitzen der drei Parteien zwar auf ihre jeweils ganz eigene Weise von dem gemeinsamen Projekt sprechen, aber alle sehr hoffnungsfroh klingen. Da redet Olaf Scholz vom Respekt und davon, dass »die Menschen« bei all der Veränderung nicht alleingelassen werden. Niemand werde auf den Kosten der nötigen Transformation hin in eine klimaneutrale Zukunft sitzen bleiben. Christian Lindner spricht von einem Land, das digitalisiert und in dem die Bürokratie endlich abgebaut wird. Und die Grünen erzählen von einer Zukunft, in der zwar die Klimakrise brutale Folgen haben wird, zugleich aber die Infrastruktur klimaneutral, das Land widerstandsfähiger und die Natur besser geschützt sein wird.
Mehr Gemeinwohl und mehr Marktwirtschaft. Sozialer Ausgleich und Wettbewerbsfähigkeit. Umweltschutz und Innovation. So viel Sowohl-als-auch war selten. Und obendrauf kommt, quasi als Sahnehäubchen, das Postulat von Olaf Scholz. Er werde ein Kanzler sein, der ohne »Verzichtsideologie« regiere.9
In den ersten Wochen funktioniert es zwischen SPD, FDP und Grünen handwerklich erstaunlich gut. Es lohnt, noch einmal daran zu erinnern – weil es zeigt, dass durchaus mal etwas ging. Das Kabinett arbeitet anders zusammen als die Merkel-Regierung. Kanzler, Ministerinnen und Minister treffen sich vor der wöchentlichen Kabinettssitzung in einer informellen und höchst vertraulichen Runde. Und die bleibt auch, anders als fast alle anderen Runden in Berlin, für Medien erstmal weitgehend unzugänglich. Das wiederum suggeriert, dass erst hinter den Kulissen inhaltlich hart und grundsätzlich miteinander gerungen wird und nur die Ideen öffentlich präsentiert werden, die alle mittragen. Leider, dies nur kurz vorweg, wird sich auch dieser Eindruck später als falsch erweisen. Was sehr schade ist. Denn dieses Format könnte, wenn es denn wirklich für offene und auch mal sehr grundsätzliche Gespräche genutzt würde, durchaus als Modell für künftige Regierungen taugen.
Am stärksten verblüfft zu Beginn die Haltung des FDP-Chefs. Christian Lindner, der sich diese Regierung nicht gewünscht hatte, ist anfangs geradezu beseelt, wenn er sich öffentlich äußert. Nicht Robert Habeck, sondern er hat das Finanzministerium erobert und deswegen kann Lindner nun sogar den Grünen gönnen. Großmütig sagt er: Er wolle ein »Ermöglichungsminister« werden. Und bei einem seiner ersten Auftritte in der Bundespressekonferenz spricht er, gefragt nach der Energiewende, plötzlich von der Notwendigkeit der »Freiheitsenergien«. Windräder und Solarpanel definiert er kurzerhand zu Garanten für die Unabhängigkeit und Freiheit des Landes um, der Ausbau der Erneuerbaren bekommt so ein liberales Gewand. Es scheint, als ob Lindner an einem neuen Narrativ bastelt, an einer eigenen, liberalen Begründung für den Kampf gegen die Klimakrise. Kurz füttert er sogar die Hoffnung, die Ampel werde eine gemeinsame Idee von »Fortschritt« entwickeln.
Was dann passiert, ist bekannt. Diese Regierung bekommt nicht einmal hundert Tage Schonzeit. Erst muss sie die letzten Monate der Coronazeit managen. Am 24. Februar 2022 überfällt dann Russland die Ukraine. Ab jetzt ist hartes Krisenmanagement gefragt. Die Sicherheitspolitik muss von Grund auf modernisiert werden. Nach Deutschland kommen mehr als eine Million Flüchtlinge. Das deutsche Wirtschaftsmodell wird stark erschüttert. Jahrzehntelang hatte Russland billiges Gas geliefert, nun kappt Putin die Nord-Stream-1-Pipeline. Die Energiepolitik gleicht nach wenigen Wochen einem Scherbenhaufen.
Schon das alles nur stichwortartig aufzuzählen, macht atemlos. Tatsächlich ist das aber der Zustand, in dem sich so mancher Ampelaner in den besonders betroffenen Ministerien in den ersten Monaten 2022 befindet. Momente des Zurücklehnens gibt es nur selten. Krise, Reaktion und wieder eine neue Krise bestimmten den Alltag, jedenfalls im Kanzleramt, im Wirtschafts-, Finanz- und Außenministerium. Ein Gesetz folgt auf das nächste, eine Notmaßnahme der anderen. Was im Land durchaus für Zustimmung sorgt: Im Notfall reagieren kann diese Regierung, so der Eindruck der ersten Monate, und vor allem kann es der (noch) höchst populäre Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Es gibt im Rückblick zwei Interpretationen der ersten Krisenmonate. Die erste lautet, die Ampel hatte Pech, sie konnte gar kein gemeinsames Projekt entwickeln. Es fehlte ihr schlicht die Zeit. Während der Koalitionsgespräche ging es jeder Partei vor allem darum, möglichst viele eigene Forderungen in den Vertrag zu bekommen. Danach wechselte sich dann eine Krise mit der nächsten ab, also war auch keine Zeit mehr, grundsätzlicher darüber nachzudenken, durch welchen Fortschritt das Land modernisiert werden soll. Die andere Interpretation lautet, dass der Krach ohne die Krisen noch viel früher aufgebrochen wäre. Weil sie sowieso nie auf die Idee gekommen wäre, die wirklichen Differenzen auszudiskutieren. Weil ihr Stil eben das Durchhangeln von Projekt zu Projekt sei. Welche stimmt, dazu später mehr. Jedenfalls ist schon nach den ersten paar Wochen vom Gönnen-können und gegenseitigem Stärken wenig zu spüren.
Das hat wohl auch mit den Umfragen zu tun. Sowohl SPD als auch FDP beäugen von Beginn an argwöhnisch die Zustimmungsraten, die der grüne Wirtschaftsminister in der Öffentlichkeit bekommt. Dagegen sinken die Werte der Liberalen rasant. Ein gutes halbes Jahr nach Kriegsausbruch sind dann Landtagswahlen in Niedersachsen, und die FDP scheitert an der Fünfprozenthürde. Bei den Liberalen bricht jäh ein altes Trauma wieder auf: Die Panik, wieder aus dem Bundestag zu fliegen. Von diesem Moment an ist es vorbei mit der Harmonie. Man müsse verhindern, dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Wahlabend. Seine Partei habe »große Probleme mit dieser Koalition«10. An jenem Abend kann man die künftige Familienaufstellung schon ahnen, oder jedenfalls den Blick, den die Liberalen darauf haben: Grüne und SPD stehen als zwei linke Parteien eng beieinander und sie sind die leider notwendigen, aber ungeliebten Dritten im Bunde. Das stimmt zwar so nicht: Als explizit linker Politiker hat sich Scholz nie verstanden und signalisiert das auch in den folgenden Monaten nicht. Doch die heiteren Tage der Ampel sind vorbei.
Das Selfie aus den Anfangstagen, so lernt die Öffentlichkeit schnell, zeigt leider nur die ersten Wochen der Koalitionäre. Es hat damals eben doch keine dauerhaft neue, erfrischende Art des Regierens begonnen. Keine Mitte jenseits von rechts und links. Sondern etwas, das schon bald den Frust über die Politik massiv verstärkt: Streit, Disziplinlosigkeit und Durchstecherei. Ein ständiges Gestolpere. Eine Art des Regierens, die beim Publikum ein tiefes Misstrauen gegenüber der Politik speist. Diese Regierung, so verfestigt sich bald schon der Eindruck, hat die Zukunft alles andere als im Griff. Sie schafft es nicht, eine gemeinsame Politik für das 21. Jahrhundert zu entwerfen.
Ende Februar 2024 stellen Christian Lindner und Robert Habeck noch ein Selfie auf Instagram. Warum sie es tun, ist offensichtlich, da soll die Ungezwungenheit des Anfangs wieder aufleben, ein bisschen wenigstens. Und es soll zeigen, dass trotz alledem doch was geht. Aufgenommen haben sie es im Kanzleramt vor der Kabinettssitzung. Habeck trägt die Krawatte mittlerweile sehr selbstverständlich, Christian Linder einen schwarzen Rolli und beide einen Dreitagebart. Das Foto zeigt die gleiche lässige Haltung wie das aus der Anfangszeit, und es soll wohl signalisieren: Auch wenn wir uns manchmal zoffen, sind wir trotzdem Kumpel. »Wir erweitern den Kapitalzugang für Start-up-Firmen«11 steht neben dem Bild. Die beiden loben sich dafür, dass sie Steuergeld für die Start-up-Szene lockergemacht haben. Doch das Publikum ist nicht mehr amüsiert. Es sieht jetzt nur noch ein schlecht ausgeleuchtetes Foto zweier Politiker.
Geschichte lässt sich nicht wiederholen. Deswegen kann darüber, ob sie sich auch anders hätte entwickeln können, immer nur spekuliert werden. Und dennoch ist ein Versagen der Ampelaner offensichtlich: Sie haben zwar »Fortschritt« über ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Sie haben aber nie wirklich darüber nachgedacht, wie sie den Begriff gemeinsam mit einem modernen Inhalt füllen könnten, und zwar mit einem, der für alle drei passt. Und der sich deutlich von dem der Vergangenheit unterscheidet. Was also war er bisher, dieser Fortschritt?
Kapitel 2Wie die Zukunft in die Welt kam
Eine kurze Geschichte des Fortschritts
Was für ein Moment. Immer wieder schlägt er den einen Stein auf den anderen. Ob aus Langeweile? Aus Neugierde? Niemand kann diese Fragen heute eindeutig beantworten. Niemand weiß, ob da überhaupt ein »er« oder vielleicht eine »sie« die Steine in den Händen hatte. Sicher aber ist: Irgendwann entsteht ein Funke, der fällt auf Reisig oder Zunderschwamm, und plötzlich glimmt es. Der Mensch merkt, dass Feuer nicht nur als zu verehrender Blitz aus dem Himmel fällt. Man kann es selbst erzeugen. Damit ist die Macht entdeckt, die die Zukunft der Menschheit radikal verändern wird. Und eine der wichtigsten Innovationen der Geschichte.
Noch müssen die Menschen lernen, dass es zum Feuermachen zwei ganz bestimmte Steine braucht, einen sogenannten Feuerstein und einen, der Schwefelkies enthält. Es wird auch noch dauern, bis jemand die Sache mit dem Zunder versteht. Doch das Funkenschlagen wird von Frauen, Männern, Alten und Jungen so oft wiederholt, bis die Menschheit das Feuer beherrscht. Irgendwann vor einer Million Jahre, vielleicht auch erst vor ein paar 10 000 Jahren wird das gewesen sein. Wer die Technik beherrscht, kann Nahrung durch Kochen, Braten und Räuchern verdaulicher und haltbarer machen, kann sich in kalten Nächten am Feuer wärmen. Also länger leben. Nach und nach wird die Energie den gesamten Alltag verändern. Höhe, Ferne, Kälte und Masse werden beherrschbar. Menschen werden ein Leben führen, dessen Energiedurchsatz von Jahr zu Jahr wächst: Morgens klingelt der elektrische Wecker, dann geht es im beheizten Badezimmer unter die heiße Dusche, nach dem Kaffee mit Auto, Bahn oder E-Bike zum Job, dann wird am Fließband oder Computer gearbeitet. Abends gibt es Essen aus der Mikrowelle, vom Lieferdienst oder manchmal auch noch selbst gekocht, dazu oder danach den gestreamten Film. Nichts davon geht ohne Energie.
Diese Entwicklung liegt damals, an jenem Tag oder in jener Nacht des ersten künstlich erzeugten Funkens, weit jenseits jeder Vorstellungskraft. Auch der Gedanke, dass es überhaupt so etwas wie eine sich entwickelnde Menschheit geben und das Feuer dabei helfen wird, ist unseren Vorfahren fremd. Das wird noch Jahrtausende so bleiben. Der kurze Blick in die frühe Geschichte offenbart damit etwas Verblüffendes: Die Idee, dass es überhaupt so etwas wie eine vom Menschen veränderbare und bessere Zukunft und damit Fortschritt gibt, ist ziemlich neu. Jedenfalls gemessen an der langen Geschichte der Menschheit. Für uns ist das heute fast undenkbar, so sehr ist unsere Gegenwart von Zukunftserwartungen geprägt. Viele Entscheidungen treffen wir nur, weil wir uns davon morgen etwas erhoffen: Wir sparen heute, um künftig eine Reise machen zu können. Wir demonstrieren heute, damit sich die Politik morgen ändert. Und die besonders Genialen unter uns tüfteln lange an etwas, um irgendwann mal unsere Welt zu verändern. Oder auch nur, um viel Geld zu verdienen.
Noch viele Jahrtausende lang ist das für unsere Vorfahren anders. Da leben, lieben und sterben Menschen ohne eine Ahnung davon, dass ihr Schicksal oder gar das einer ganzen Gesellschaft durch ihre eigene Genialität, ihren Erfindungsgeist oder ihre Anstrengung verbessert werden könnte und sollte. Zuständig für die Zukunft sind die wechselnden Götter – die verteilen Glück oder Unglück, Lohn oder Strafe. Es verändert sich wenig, das Leben aufeinanderfolgender Generationen unterscheidet sich über Jahrhunderte kaum. Ein Handwerker oder eine Bäuerin führen im 15. Jahrhundert ein Leben, das dem ihrer Eltern und dem ihrer Kinder weitgehend gleicht, wenn nicht gerade eine Hungersnot, eine Seuche oder ein Krieg dazwischenkommt und es damit noch etwas elender wird.
Ein sehr früher Versuch, die Zukunft zum eigenen Nutzen zu beeinflussen, ist ausgerechnet das Glücksspiel. Im Mittelalter sind Würfelspiele noch verpönt, ab dem 17. Jahrhundert werden sie dann zunehmend beliebter. Und damit stellt sich auch die Frage, wie und ob man die Würfel nicht doch beeinflussen kann. Schließlich wendet sich der Mathematiker und Religionsphilosoph Blaise Pascal dem Problem zu und schickt seine Ideen und Berechnungen an seinen Freund, den Mathematiker Pierre de Fermat. Der Briefwechsel der beiden, der am 29. Juli 1654 beginnt, wird in die Geschichte eingehen – als Geburtsstunde der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und damit als einer der ersten Versuche, das Schicksal in die Hand zu nehmen. Selbst wenn es um so etwas gänzlich Unberechenbares wie das Würfelspiel geht.
Die Philosophin Hannah Arendt verortet die Idee, dass es so etwas wie dauerhaften Fortschritt geben könnte, erst so etwa ab dem 17. Jahrhundert. Damals wird nach und nach das zyklische Zeitverständnis des Mittelalters durch ein lineares abgelöst. Dazu muss die Zeit allerdings erst zum Kontinuum werden, darf nicht mit immer neuen Herrschern immer wieder neu anfangen, an Sommertagen länger sein als an Wintertagen und in verschiedenen Königreichen unterschiedlich gemessen werden. Die Zukunft muss den Göttern entwendet und damit zu etwas werden, das sich nicht nur durch Säen, Ernten, Einlagern und Erntedank beeinflussen lässt. Sondern auch durch Genialität und Mut, Wettbewerb und Kooperation, durch die Fähigkeit, andere zu überzeugen oder zu organisieren. Durch Unternehmertum und politisches Talent. Man muss dafür das eigene Schicksal als etwas begreifen, dessen Zukunft man selbst gestalten kann. Und sich selbst als Teil einer Gesellschaft, die durch das eigene Handeln verändert wird: Weil jemand ein neues Medikament erfindet oder eine hilfreiche Technik, eine neue Gesellschaftstheorie entwirft, sich für eine bessere Gesellschaft oder auch nur erträglichere Arbeitsbedingungen einsetzt. Damit die Zukunft gestaltet und dauerhaft verbessert werden kann, muss sie also erst denkbar sein. Und sie musste gedacht werden. Der »Erwartungshorizont« muss über den »Erfahrungshorizont«1 hinausgehen und das bedeutet: Menschen dürfen sich das, was kommen könnte, nicht mehr nur als Verlängerung oder Wiederholung der Gegenwart in die Zukunft vorstellen, sondern als etwas komplett Neues.
Als sie das endlich können, beginnt eine grundsätzlich neue Epoche: die Moderne. Philosophen, Historiker und Soziologen verorten diese »Moderne« ab dem 19. Jahrhundert. Der Mensch befreit sich endgültig von den Fesseln des absolutistischen Staates, strebt unabhängig nach Wissen und Wahrheit und schließt sich mit anderen zusammen, um eine politische Ordnung zu errichten, an deren Regeln jeder beteiligt ist – jedenfalls in der Theorie.2