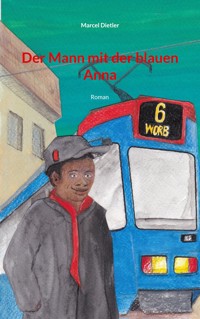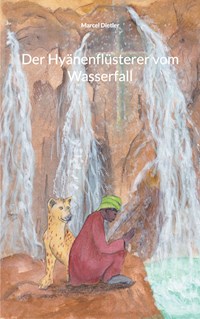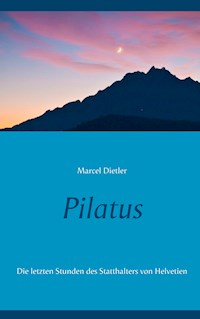Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ich hatte einen Traum: Die Kirche kam aufgeregt zu Gott und beklagte sich bitter über die Menschen, die ihr davonlaufen würden. Gott hörte längere Zeit geduldig zu, sagte jedoch nach einer Weile freundlich, aber bestimmt: «Kirche, würdest du mir jetzt bitte aus dem Weg gehen, ich möchte weiterwirken.» Den Kirchen laufen die Menschen in Scharen davon. Dabei sind Kirchen eine so gute Sache, dass man sie erfinden müsste, wenn es sie nicht bereits gäbe. Aber die Kirche wird sich selber neu erfinden. Wer der Kirche eine Chance geben will, wird nach dem Buch vom Marcel Dietler greifen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Das Bild auf dem Buchumschlag erinnert an die Jünger im Seesturm, an Petrus, der aus dem Boot steigt, auf dem Wasser geht, beinahe versinkt, aber von Jesus gerettet wird. Die Kirche hat eine Zukunft, aber sie ist im Sturm. Sie muss aus dem Boot alter Sicherheiten steigen und Neues wagen. Die Kirche auf dem Bild ist bereits ausgestiegen. An ihrem Turm befindet sich eine Uhr, deren Zeiger auf neun Uhr stehen. Laut der Apostelgeschichte ereignete sich das Pfingstwunder zur dritten Tagesstunde, das ist nach heutiger Stundenzählung um neun Uhr früh. Die Zeiger der Turmuhr stehen also auf Hoffnung.
Ich widme dieses Büchlein den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RefLab, einem Projekt der reformierten Kirche Zürich, insbesondere drei Personen, die mir vertraut sind: Carla Maurer, meiner Nachnachfolgerin an der Schweizer Kirche London, sowie Manuel Schmid und Stephan Jütte, die ich beim Mitverfolgen ihrer fröhlichen Podcast-Streitgespräche – Woran glauben Christen und was können sie getrost aufgeben? – ins Herz geschlossen habe.
Dank
Mein Dank geht an Sabine Szabo für die Gestaltung des Umschlags und an Kathrin und Urs Meier-Scheidegger für Lektorat und Layout.
Inhalt
Vorwort
Teil 1
Besuch bei einer Kirche von Ex-Verbrechern
Das neue Jerusalem
Kirche und Reich Gottes
Partnerschaft
Was ist mit Europa los?
Die Kirche der Zukunft wird eine mystische Kirche sein
Was ist Mystik?
Dschalal ad-Din Muhammad Rumi
Christliche Mystik im zwanzigsten Jahrhundert
Mystik für Menschen wie du und ich
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn buddhistisch erzählt
Maria und Martha
Mit Gott Pfannkuchen backen: Bruder Lorenz
Der Atheist Steiner und das Lied Gott ist gegenwärtig
Die Mystik der atheistischen Theologin Dorothe Sölle
Eine untypische Mystik: die Pfingstbewegung
Die Mystik des Nicht-Mystikers Karl Barth
Kinder sind Mystiker
Von Blattläusen und Marienkäferchen
Was für eine Zukunft hat die Kirche?
Die Kirche auf dem Markt
Teil 2
Von Heutigem und Ewigem – unser Leben in der Dreieinigkeit
Die Kreuzigung Jesu – ein mörderisches Zusammenspiel von damaliger Kirche und Staat
Der Menschensohn
Ich bin, der ich bin
Die sieben Zeichen
Kyrios Christos – Christus ist der Herr
Der Logos als Weltenschöpfer
Der Heilige Geist als Kraft und Person
Wer Gott erfahren hat, versteht David durch und durch.
Das apostolische Glaubensbekenntnis
Na(s)chwort
Vorwort
Der christliche Glaube ist wie ein befruchtender Regen, der immer weiterzieht. Jetzt ist er zu uns gekommen. Das soll Martin Luther gesagt haben. Ich habe es zwar in keinem Luthertext gefunden, es ist aber trotzdem ein gutes Wort.
Der befruchtende Regen ist zu uns gekommen. Wo ist dieser Regen denn heute? Und wer ist «uns»? In meiner Jugendzeit (ich habe Jahrgang 1937) war das Christentum mehrheitlich eine Religion der Europäer und Amerikaner, also eine Religion der Weissen. In der Schweiz gehörten damals 98 Prozent der Bevölkerung einer christlichen Kirche an. Stolze 52 Prozent waren evangelischreformiert, heute sind es gerade noch 26 Prozent, also genau die Hälfte. 2019 bezeichneten sich in Zürich 40, in Basel gar 50 Prozent der Menschen als konfessionslos. Selbst im frommen Kanton Wallis waren es 18 Prozent. Und diese Entwicklung schreitet munter voran – jedenfalls in Europa. Weltweit ist die weisse Christenheit heute eine Minderheit. Die Christen sind mehrheitlich coloured people, und das nicht wegen der schrumpfenden Zahlen bei den weissen Christen, sondern weil die Coloured-people-Christenheit ein grosses Wachstum verzeichnet. Das Coloured-people-Christentum ist ein völlig anderes Christentum als das nüchterne reformierte, auch ein völlig anderes als das katholische Schweizer Christentum. Diese Christen werden in Zukunft auch unsere Kirchen nachhaltig prägen.
Teil 1
Besuch bei einer Kirche von Ex-Verbrechern
Ich habe in Lima in Peru an einem Sonntagsgottesdienst teilgenommen, der von zwanzigtausend Personen besucht wurde. Der Gottesdienst dauerte mehrere Stunden. Als ich die riesige Halle betrat, lobten sie gerade Gott. Als Ausländer fiel ich auf, und so kam sofort einer der Pastoren brüllend auf mich zu. Er brüllte nicht etwa, weil er sich über den Besuch des Fremden geärgert hätte, sondern weil das Gotteslob der zwanzigtausend Leute so laut war. Brüllend fragte er mich, ob er mich zum Essen einladen dürfe – im Gottesdienst wurde nämlich gegessen und getrunken. Die Verpflegungsnische befand sich auf einem Podium, von dem aus ich alles gut mitverfolgen konnte. Während ich mit dem Pastor ein reichhaltiges Frühstück einnahm, ging die lärmige Anbetung weiter. Es war spannend. Viele brachen vom heiligen Geist getroffen in Tränen aus, andere fielen zu Boden. Das Gotteslob wurde von Zeit zu Zeit unterbrochen durch kurze Predigten und Beiträge von Menschen, die bezeugten, wie sie zum Glauben gekommen waren. Weil der Gottesdienst sehr lange dauerte, wurden die Leute hungrig und tauchten auf dem Imbisspodium auf. Sie assen, nahmen aber zwischen den einzelnen Bissen weiterhin am Gemeindegesang teil. Mein Gastgeber erzählte mir brüllend, viele dieser Gemeindeglieder seien ehemalige Verbrecher und Terroristen, geheilte Alkoholiker und Drogenabhängige. Geheilte Säufer und gläubig gewordene Verbrecher loben Gott nicht gesittet mit Bach-Arien und ruhigen Kirchenliedern. Es klingt anders als bei uns, immer noch ein bisschen wie in einer Räuberhöhle. Nach zwei Stunden in diesem heiligen Getümmel – ich meine das nicht ironisch, es war tatsächlich heilig – musste ich mal. In der grossen Toilettenhalle standen etwa zwanzig Männer vor den Pinkelschüsseln, singend und betend. Mein Pinkelnachbar fragte mich treuherzig, ob er mir erzählen dürfe, warum er beim Pinkeln Halleluja rufe. Ich wollte das gerne wissen. Der Mann hatte seit Tagen nicht mehr richtig urinieren können, doch jetzt im Gottesdienst floss und floss es. Ich überwand meine Schweizer Hemmung und stimmte in sein lautes Dank-Halleluja ein.
Der mehrstündige Gottesdienst war ein fremdartiges, aber gutes Erlebnis. So etwas würde auch vielen Schweizer Pfarrerinnen und Pfarrern guttun – allerdings erst nach einer erklärenden Einführung. Ohne Einführung würden die meisten entsetzt die Flucht ergreifen.
Das neue Jerusalem
In einem ebenso ungewohnten Gottesdienst wie demjenigen in Lima, der aber in der Urwaldsiedlung Segunda, ebenfalls in Peru, gefeiert wurde, durfte ich vor tausend Gläubigen sogar predigen. Voll ausgeschrieben heisst der Ort Segunda Jerusalén, zweites Jerusalem, doch auf der Landkarte steht nur Segunda. In meinem Tagebuch finde ich über Segunda Jerusalén die Notiz: «Die Lesung dieses Berichts ist für feinfühlige Schweizer Rationalisten ungeeignet. Für Kopfverlust, ausgelöst durch heftiges Kopfschütteln, lehne ich jegliche Verantwortung ab.»
Segunda ist eine kleine Stadt mit zehntausend Einwohnern. Es gibt dort keine Kriminalität; Segunda ist das gewaltfreie Jerusalem. Dass es keine Kriminalität gibt, ist in Peru aussergewöhnlich. In Segunda werden die Haustüren jedoch auch nachts nicht verschlossen. Aussergewöhnlich ist weiter die Tatsache, dass es in der Stadt kein Hotel gibt. Wer in Segunda übernachten will, muss beim Gemeindebüro anrufen. In der Gemeindeverwaltung befindet sich das einzige Telefon der Stadt. Man muss am Telefon sagen, wer man ist, wann man nach Segunda kommt und warum. Dann wird das Anliegen per Lautsprecher über die ganze Stadt ausgerufen. Wer dem Aufruf als erster Folge leistet, erhält den Gast. Ich hörte, wie ich in Segunda als reformierter Pfarrer aus der Schweiz ausgerufen wurde, der beabsichtige, die Prophetenstadt kennenzulernen. Innerhalb von zehn Minuten hatte ich den Namen meiner Gastfamilie.
Prophetenstadt? In welchem Sinn sollte Segunda denn eine Prophetenstadt sein? – Die Geschichte ihrer Entstehung erinnert mich an Abraham, der den Befehl erhalten hatte, seine Vaterstadt zu verlassen und an den Ort zu gehen, den ihm Gott zeigen würde. Laut alten Zeitungsberichten, welche man mir zu lesen gab, sahen sich die Behörden von Rioja, der Provinzhauptstadt der Region San Martín im Norden von Peru, im Februar 1974 mit dem Problem konfrontiert, dass an ihrem kleinen Flugplatz per Flugzeug, per Bus oder auch zu Fuss Leute eintrafen, die einander nicht kannten, die aber alle eines gemeinsam hatten: Alle waren an ihren Ursprungsorten Mitglieder einer Pfingstkirche gewesen und alle behaupteten, von Gott den Befehl erhalten zu haben, alles zu verlassen, nach Rioja zu reisen und dort auf weitere Anweisungen zu warten. Es blieb den Behörden nichts anderes übrig, als diese Verrückten zu verpflegen und am Flugplatz übernachten zu lassen. Ursprünglich waren es lediglich sechzehn Personen gewesen, doch die Gruppe wurde täglich grösser, bis sie schliesslich zu Fuss abzog.
Am 25. Februar 1974 hatte der Bauer Tomás Pachamora Devila im Dorf Tingo María im Gebet die Weisung erhalten, ein Gastmahl für zweihundert Personen vorzubereiten. Er tat es, und als die Gotteswanderer eintrafen, stärkten sie sich an dem Essen. Sie wählten den Gastgeber zu ihrem Leiter und nannten ihn Prophet Severo. Der Prophet verkaufte seinen Hof und zog mit Frau und Kindern mit der Gruppe auf indigenen Trampelpfaden in den Regenwald. Nach einem mehrtägigen Marsch warf er den Wanderstab und erklärte: «Dort, wo der Stab hingefallen ist, bauen wir den Tempel. Im Berg vor uns liegt unser Reichtum.» Die Auswanderer bauten Häuser und den Tempel. Was der Prophet nicht gewusst hatte: Es war bereits eine Strasse geplant, welche just an ihrer Siedlung vorbeiführen würde. Der Berg wurde zum Bergwerk und damit zur Grundlage für eine blühende Zementfabrik, was ohne die im Bau befindliche Strasse nicht möglich gewesen wäre. Das Land, das als unfruchtbar galt, wurde den Pfingstlern zu einem Spottpreis überlassen. Es gelang der Gruppe, das erworbene Land fruchtbar zu machen. Den Ausdruck Biofarming gab es damals noch nicht, doch genau in diesem Sinn begannen diejenigen, die nicht Zement produzierten, zu arbeiten. Das Wunder der abrahamitischen Auswanderung sprach sich herum, es wanderten weitere Pfingstgläubige ein, auch einige Katholiken. So gibt es in Segunda nun einen riesengrossen, hallenartig aussehenden Tempel mit Blechdach und eine kleine Kapelle für die katholische Minderheit, und Segunda ist bekannt für seinen Zement und seine Bioprodukte.
Meine Gastgeber hatten sich auf der Abrahamwanderung kennengelernt. Gladys ist indigener Abstammung, Ciros Vorfahren waren aus Italien nach Peru gekommen. Von allem Anfang an herrschte in Segunda ein Rassengemisch – Gott ist der Vater aller Menschen. Im neuen Jerusalem sollten die Angehörigen verschiedener Rassen lernen, dass man eine gemeinsame Familie ist. Wenn meine Gastgeberin lachte, blitzte in ihrem Mund ein Goldzahn. Bereits gewöhnt an viele Wundererzählungen, fragte ich sie: «Gladys, wie bist du zu deinem goldenen Zahn gekommen?» Gladys brach in schallendes Lachen aus. «Ach so», rief sie, «du bist in Segunda bereits Menschen begegnet, denen Gott durch ein Wunder die Zähne geflickt hat. Du wirst es nicht glauben, Marcel», wieder schüttelte es sie vor Lachen, «meinen Goldzahn hat der Zahnarzt in Rioja eingesetzt. Bei mir hat das Zahngebet nicht funktioniert. In unserer Stadt gibt es weder einen Arzt noch einen Zahnarzt. Wenn wir krank sind, lassen wir zuerst für uns beten, was sehr oft eine Heilung zur Folge hat, aber wenn keine Heilung geschieht – was ebenfalls häufig ist –, gehen wir ganz selbstverständlich zum Arzt nach Rioja und niemand wirft uns Unglauben vor, wenn wir das tun. Ärzte und Zahnärzte arbeiten ja schliesslich auch für Gott.»
Durch das öffentliche Telefonat hatte der Prophet von dem zu erwartenden Gast gehört und meine Gastgeber gebeten, mich ihm vorzustellen. Der freundliche alte Mann stutzte, als ich vor ihm stand. «Kann es sein, dass wir uns kennen?», fragte er. Auch ich war überrascht, denn mir kam der sympathische Mann ebenfalls bekannt vor. Doch warum sollte ich ausgerechnet in einer Regenwaldstadt in Peru einen Mann kennen, noch dazu den Propheten einer Kirche, die Herr und Frau Schweizer wohl als Sekte bezeichnen würden? Der Prophet begann zu strahlen: «Ich hab’s, du bist der Schweizer Vater der Strassenkinder von Cusco. Ich habe eine Tochter in Cusco, wir sind uns in Cusco in einem Gottesdienst begegnet.» Jetzt erwachte auch in mir die Erinnerung. Wir hatten nach besagtem Gottesdienst beim Gemeindemittagessen am selben Tisch gesessen und ein freundliches Gespräch über das Leben von Strassenkindern geführt. Dem bescheiden wirkenden Mann war aufgefallen, dass die Kinder mich Papito nannten. Severo war begeistert, den Strassenkinder-Schweizer in seiner Urwald-Prophetenstadt willkommen zu heissen. «Wir haben in Segunda jeden Abend Gottesdienst», teilte er mir mit, «am Samstag ist die feiernde Gemeinde am grössten, da kommen über tausend Leute. Würde es dir Freude machen, im Samstagsgottesdienst zu predigen? Als Schweizer Pfarrer hast du ein akademisches Studium absolviert. Akademische, logisch aufgebaute Predigten sind bei uns selten, nur wenn ein Gastprediger kommt, können wir solide Bibelauslegung geniessen. Bei uns läuft alles über prophetische Eingebungen, da kommt die Bibel manchmal zu kurz. Von dir erwarten wir eine kräftige Bibelauslegung, so etwas im Sinn von Calvin.» Severo kannte Calvin und wusste von reformierter Bibelauslegung. Seine Offenheit und sein Vertrauen berührten mich. Der Prophet hatte eine grosse Achtung vor der Schweiz. «Manchmal predigen bei uns auch Schweizer Pfingstler», erzählte er. «Wenn mein holpriges Spanisch nicht stört, sage ich gerne zu», antwortete ich.
Es war Dienstag. Mit Bibel und Wörterbuch machte ich mich sofort an die Arbeit für meine Samstagspredigt. Ich wurde jedoch dauernd gestört. Durch die Lautsprecherstimme wusste die ganze Stadt, dass ein Schweizer zu Besuch gekommen war. Männer und Frauen wollten mich verköstigen und mir möglichst viel vom geistlichen Leben in der Umgebung zeigen. Man führte mich in Urwalddörfer zu christlichen Gruppen, zu halbnackten Waldbauern, die gleichzeitig Prediger waren. Wenn ich nicht mit Erwachsenen unterwegs war, klopften Kinder an die Türe meiner Gastgeber und fragten, ob nicht der Pfarrer aus der Schweiz mit ihnen spielen würde. Sie gingen mit mir schwimmen. Die Stadt Segunda schmiegt sich direkt an die Andenkette. Aus einem Felsen schiesst ein mächtiger eiskalter Wasserschwall, Wasser, das man ungefiltert trinken darf. Die Kinder setzten sich und mich in Autoschläuche. Zisch! sausten wir bergab und landeten mit einem Plumps in einem kleinen Waldsee. Zu Fuss wieder hoch und dann wieder hinuntergesaust, immer wieder. Es war wunderbar mit diesen Kindern. «Nos vemos sábado – wir sehen uns am Samstag», sagten sie zum Abschied. Sie wussten bereits, dass ich am Samstag predigen würde, und wollten dabei sein.
Der riesige Tempel mit dem Blechdach war bereits gut gefüllt mit erwartungsvollen Menschen, als ich in der Pastorenschar mit dem Propheten einzog und auf der Bühne Platz nahm. Noch immer strömten Menschen herein. Beim Betreten des Tempels knieten sie andächtig nieder und beteten still zwei, drei Minuten lang, bevor sie einen Platz suchten und sich setzten. Das war jedoch die einzige Stille, die mir entgegenkam. Auf das Blechdach trommelte der Regen – wir befanden uns ja im Regenwald –, an der Decke bewegten mächtige Ventilatoren die heisse Luft und Musiker übten bereits für den Gottesdienst.
Der Gottesdienst begann mit einem Lied. Nach dem Lied drehten sich Männer, Frauen und Kinder in Richtung Ausgang, ballten drohend die Fäuste und brüllten: «Fuera! Raus!», worauf der Teufel mit sämtlichen Dämonen schleunigst die Flucht ergriff. Alle hatten ihre eigene Bibel mitgebracht. Die vom Propheten und anderen Pastoren angekündigten Verse wurde von der ganzen Gemeinde laut gelesen. Gute Leserinnen und Leser achteten darauf, ob alle die Texte richtig lasen oder ob jemand Hilfe benötigte. Es fand ein eigentliches Alphabetisierungsprogramm statt. Nicht nur Kinder hatten Schulung nötig, es gab auch Erwachsene, die kaum lesen und schreiben konnten. Auf die Schulung folgte eine längere Zeit der Alabanza – Anbetung, das Geniessen Gottes. Die Alabanza bestand aus Musik, Gesang und freien Gebeten von Gemeindegliedern. Manche Arbeiterinnen und Arbeiter, welche tagsüber hart gearbeitet hatten, wurden vom Schlaf übermannt. Sie wurden von Männern und Frauen, welche eigens für den Weckdienst mit langen Weckstecken ausgerüstet waren, durch einen sanften Schlag an die Schulter geweckt. Nach einer Weile verstummten der Gesang und die freien Gebete, nur die Musik spielte noch. Frauen traten auf die grosse weite Fläche zwischen Pastorenbühne und Gemeindebänken und begannen zu tanzen. «Sie werden gleich Prophetien sprechen», flüsterte mir der Prophet zu. Auch meine jugendlichen Badefreunde und -freundinnen wollten tanzen, sie wurden jedoch vom Weckpersonal auf die Sitzbänke zurückgewiesen. «Dürfen Kinder nicht prophezeien?», fragte ich. «Doch», lautete die Antwort, «aber die Kinder, die du gesehen hast, sind keine Propheten, sie haben mit dir im Wasser Spass gehabt und sich mit dir angefreundet, und jetzt hoffen sie, dass du sie beim Tanzen fotografierst. Du darfst die Prophetinnen durchaus fotografieren; sie werden es nicht merken, sie sind in Verzückung.» Die Musik hörte auf zu spielen, doch in den Herzen der Prophetinnen klang die Musik offenbar weiter. Es war ganz still im Tempel, man hörte nur die nackten Füsse der Frauen, die zu der unhörbaren Musik weitertanzten. Plötzlich standen die Tänzerinnen still und begannen zu weissagen, Worte der Ermutigung, lieb und harmlos. Doch es konnte offenbar auch anders sein. Der Prophet flüsterte mir zu: «Manchmal werden konkrete Sünden ausgesprochen, die jemand begangen hat, und diejenigen, welche sie getan haben, stehen auf und bitten Gott um Vergebung. Diebesgut muss wieder zurückerstattet werden, sonst gibt es keine Vergebung.» Auf einmal ging mir auf, warum es in Segunda keine Polizei braucht: Die Täter werden prophetisch überführt. Severos Geflüster entnahm ich, dass manchmal Krankheiten erkannt wurden, an welchen Gemeindeglieder litten. Dann hiess es beispielsweise: «Wir haben jemanden in unserer Mitte, der unter Atemnot leidet (oder unter Zahnweh oder einer schweren Krankheit). Die Person mit dem geschilderten Leiden möge nach vorn kommen.» Die Person mit dem angesprochenen Leiden kam dann nach vorn und wurde geheilt oder eben auch nicht; der Zahn wurde durch Gebet erneuert oder eben auch nicht. Ich erinnerte mich an Gladys’ Goldzahn. Nach dem prophetischen Teil gab es wieder Musik und anschliessend Sorpresas – Überraschungen. Neu Eingewanderte wurden begrüsst, gesegnet und in die Gemeinde aufgenommen. Ihnen wurden erfahrene Gemeindeglieder zugeteilt, die ihnen helfen sollten, in Segunda ein Haus zu bauen und Arbeit in der Zementfabrik oder in der Biolandwirtschaft zu finden.
Der Gottesdienst hatte bereits zwei Stunden gedauert, als ich im Rahmen der Sorpresas an die Reihe kam. Ich befand mich in einer Gemeinde, die völlig anders feierte als Europäer in evangelischen oder katholischen Gottesdiensten. Die Segunda-Jerusalén-Gottesdienste lassen sich auch nicht vergleichen mit europäischen freikirchlichen Gottesdiensten. Europäer sind sehr befremdet, wenn sie derartige Gottesdienste miterleben. Für landeskirchliche Theologinnen und Theologen ist so etwas psychologische Manipulation und Freikirchler urteilen noch schärfer: So etwas ist vom Teufel. Ähnliche Probleme stellten sich den ersten Christen jüdischer Herkunft fern von Jerusalem, als Griechen und Römer den Christusglauben annahmen. Leute wie Petrus waren bei den neuen Glaubensformen sehr misstrauisch. In Jerusalem hatten sie einen Mann, der für seine Weisheit bekannt war. Diesen schickten sie zu diesen so ganz anderen Gläubigen. Er kam mit gutem Bericht zurück. Diese Geschichte ist zu finden in Apostelgeschichte 11,23, die ich als Predigttext ausgewählt hatte.
Als Barnabas hinkam und die Gnade Gottes sah, freute er sich.
Ich sprach in meiner Predigt von meiner Freude über diese so ganz andere Glaubensart in Segunda Jerusalén und zeigte meine Bereitschaft, von ihnen zu lernen, teilte ihnen aber auch mit, dass unsere Art zu glauben und zu feiern für sie genauso befremdend sein würde, und dass das Lernen gegenseitig sein dürfe. Ich nahm Bezug auf die Aussage des Propheten, dass seine Leute kaum etwas über die historischen Hintergründe der Bibel wüssten. Die Gemeindeglieder waren das, was wir Fundamentalisten nennen, doch waren sie das auf sympathisch inkonsequente Art und Weise. Auf der einen Seite glaubten sie, dass jedes Wort der Bibel vom heiligen Geist inspiriert sei, doch anderseits prophezeiten sie munter Dinge, die mit der Bibel wenig oder nichts zu tun hatten. Ich liess Texte lebendig werden, in denen die Bibel selber einiges aus ihrer Entstehungsgeschichte preisgibt. Hörspielartig erzählte ich aus 2. Könige 22, wie die Judäer zur Zeit von König Josia kaum etwas von der damaligen Heiligen Schrift gewusst hatten. Die Bibel war schlicht und einfach verlorengegangen. Doch bei einer Renovation des Tempels stiessen die Arbeiter auf die eingemauerte Schriftrolle. Das Auffinden des heiligen Textes veranlasste den König, eine geistliche Reformation anzuordnen. Auch den Propheten Jeremia holte ich aus der historischen Verborgenheit und liess König Jojakim wütend eine Schriftrolle verbrennen, worauf Jeremia die Worte seinem Sekretär unerschrocken noch einmal diktierte und dabei auch die Verbrennung der Schriftrolle erwähnte. Aus dem Neuen Testament gefiel vor allem den Kindern der Knabe Markus, der die Verhaftung Jesu mitten in der Nacht im Garten Gethsemane miterlebt hatte. Das neugierige Kind war den Gästen seiner Eltern insgeheim im Nachthemd in den Garten Gethsemane gefolgt, wo es sich in einem Gebüsch versteckte. Die Tempelpolizei entdeckte den Knaben und wollte ihn ergreifen, doch sie erwischten bloss das Nachthemd und der Bub entwischte ihnen nackt (Mk. 14,51). Meine Badespass-Kinder brachen wegen des nackten Buben und der Soldaten, welche das leere Nachthemd in den Händen ärgerlich anstarrten, in schallendes Gelächter aus. Der nackte Bub wurde später der Schreiber des Markusevangeliums. Die Gemeinde hörte meinen Ausführungen gebannt zu. Mit meinem langsamen, holprigen Spanisch hatte meine Predigt mehr als eine Stunde gedauert, doch sie fanden, ich hätte viel zu kurz gepredigt. Auch dem Propheten hatte meine Predigt gefallen. Er fragte mich allen Ernstes, ob ich nicht als Bibelausleger und Englischlehrer bei ihnen bleiben möchte.
Kirche und Reich Gottes
Ich werde manchmal gefragt, wie es sich anfühle, zu einer sterbenden Sache zu gehören. Ich antworte dann jeweils, ich würde gar nicht einer sterbenden Sache angehören. Im Blick auf die zahlenmässig schrumpfende Landeskirche bin ich zwar traurig; die reformierte Landeskirche ist meine Heimat. Ich fühle mich auch mit der katholischen Kirche sehr verbunden. Was in der katholischen Kirche zurzeit alles ans Licht kommt, erfüllt mich allerdings nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Scham. Ich kann jeden verstehen, der unseren Landeskirchen davonläuft. Da ist Vieles am Sterben. Im Blick auf die weltweite Kirche aber kann ich freudig sagen: «Ich diene einer stürmisch wachsenden Sache. Es grünt und blüht und wächst, teils verrückt und theologisch sogar schräg, aber es findet Wachstum statt. Das Reich Gottes ist im Kommen.»
Ist die Kirche denn überhaupt identisch mit dem Reich Gottes? Ich habe einmal den Satz gelesen: Die ersten Christen erwarteten zu Pfingsten das Reich Gottes – und es kam die Kirche. Reich Gottes ist in der Bibel überall dort, wo der Wille des Menschen und Schöpfung liebenden Gottes sich durchsetzt oder Menschen diesem Willen bewusst oder unbewusst dienen – der Perserkönig Kyros etwa, der den von den Babyloniern verschleppten Judäern die Rückkehr in ihr Land ermöglichte, wird im Alten Testament geradezu mit einem Messias verglichen (2. Chr. 36,22; Esra 1,1; Jes. 44,28 und 45). Die Kirche – jedenfalls die Institution Kirche – ist keineswegs identisch mit dem Reich Gottes, dass aber die Gemeinschaft von Christusgläubigen zum Reich Gottes gehört, wird im Neuen Testament klar bezeugt. Kirche als solche Gemeinschaft ist bei Paulus der Leib Christi in dieser Welt. Sobald diese Gemeinschaft sich organisiert, wird sie zur Institution – was nicht heisst, dass sie aufhört, Leib Christi zu sein, doch Institutionen kommen und gehen, während das Reich Gottes ist, bleibt und kommt. Das Schrumpfen der klassischen Kirchen in Europa ist nicht gleichbedeutend mit dem Verschwinden der Gottesherrschaft, diese breitet sich selbst in Europa nach wie vor aus. Auch das Judentum ging mit der Zerstörung des zweiten Tempels (des herodianischen Tempels) ja nicht unter, ausserdem trat neben und aus dem Judentum eine neue Dynamik Gottes auf den Plan: das Christentum. Als konstantinische Institution entwickelte das Christentum grosse Macht und bewirkte oft das Gegenteil dessen, was Christus gebracht hatte. Aber man darf nicht nur das Negative sehen, in der mächtigen katholischen Kirche wurde auch immer wieder das Reich Gottes sichtbar. Aber jedenfalls war die katholische Kirche – und dasselbe gilt für die Kirchen, die aus der Reformation hervorgingen – nicht das von Christus bezeugte Salz in der Suppe, sondern die Suppe selber. Heute hingegen sind die einst so mächtigen katholischen und evangelischen Kirchen dabei, wieder Salz zu werden.
Wenn im Alten Testament der Perserkönig Kyros mit dem Messias verglichen wird und folglich der Ausbreitung der Gottesherrschaft dient, dann dürfen wir auch die Tätigkeit von Amnesty International und den Einsatz der Klimajugend als etwas Messianisches betrachten. Ob sich Aktivistinnen und Aktivisten bewusst oder eher unbewusst biblischer Bilder bedienen, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich habe gestaunt, Jugendliche aus der Westschweiz in einem selbstgebastelten Schiff auf dem Bundesplatz vor dem Bundeshaus zu sehen. Über dem Schiff standen die Worte: Nous sommes tous dans le même bateau.