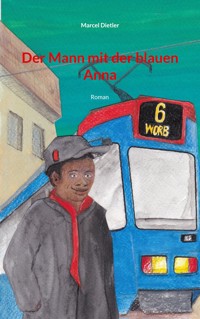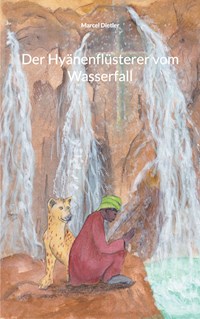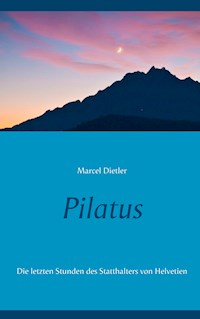Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass eines der seltsamsten Hotels auf der Welt auf der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz steht? Sie teilen in diesem Hotel mit Ihrer Frau/Ihrem Mann zwar das Bett, aber der eine von Ihnen liegt in Frankreich, der andere in der Schweiz. Das Hotel spielte im zweiten Weltkrieg auf dem Fluchtweg vieler Juden eine bedeutende Rolle. Und wussten Sie, dass es in der Schweiz ein Concentrationslager gab - mit C geschrieben? Beide, das Hotel und das Concentrationslager mit C, kommen in dem Buch vor, das Sie gerade in den Händen halten. Aber vielleicht interessiert Sie weder das seltsame Hotel noch das Concentrationslager mit C. Sie suchen nach Liebesgeschichten. In diesem Fall müssten Sie den Roman Simone und Simon erst recht lesen; denn er enthält eine Liebesgeschichte, welche Sie sich kaum vorstellen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmung
Simone, die Hauptperson im Roman, ist eine über achtzig Jahre alte Frau, eine Waadtländerin. Ihre frühste Kindheit verbrachte sie in Lausanne, die meisten Schuljahre absolvierte sie jedoch in Bern. Simone ist eine perfekte Bilingue, Ärztin im aktiven Ruhestand. Die Coronapandemie erinnert sie an die Kriegszeit. Im zweiten Weltkrieg kämpften Länder gegeneinander, in der Coronazeit ist es ein Kampf gegen ein Virus. In diesem gleichsam neuen Krieg wagt es Simones langjährige jüdische Freundin Judith endlich, über den Überlebenskampf ihrer Familie im besetzten Elsass zu sprechen. Judith ist eine liberale, aber gläubige Jüdin geblieben, Simone dagegen ist Agnostikerin geworden. Das Bild eines Urahnen lässt sie jedoch nicht in Ruhe. Der Mann im Bild, Simon Perrin, war Pfarrer in einem Waadtländer Dorf. Die Agnostikerin Simone beginnt mit dem gläubigen Urahnen eine Art Selbstgespräch.
Agnostiker sind nicht Atheisten. Die Bezeichnung stammt aus dem Griechischen und bedeutet Nichtwissende. Ob es einen Gott gibt oder nicht, weiss Simone nicht. Es wird Gott ihrer Ansicht nach zwar eher nicht geben, aber man kann nie wissen. An irgendetwas glauben selbst Agnostiker. Simone ist in Glaubensfragen ein typischer heutiger westeuropäischer Durchschnittsmensch. So wie Simone sind doch die meisten jüngeren Menschen. Das dachte ich jedenfalls, solange ich Pfarrer war und sowohl mit jungen als auch mit alten Leuten Gespräche führte. Für die alten Leute, denen ich als ihr Pfarrer begegnete, war der Glaube noch eine Selbstverständlichkeit. Seit ich im Ruhestand eher nicht kirchlich orientierten Menschen meiner Generation begegne, stelle ich fest, dass der Glaube selbst für meine Generation keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Das beschäftigt mich. Wir über Achtzigjährigen werden schon sehr bald aus dem Leben verschwinden. Und doch stellt diese abtretende Generation kaum noch die Frage: Wo werden wir dann sein? Werden wir überhaupt noch sein? Jedenfalls fragt sie nicht öffentlich. Mir kommt grosses Achselzucken entgegen. Und da frage ich mich: Wie kann ich als Mann, der vom Glauben getragen wird, diesen Mitmenschen – alten und jungen – etwas von dem weitergeben, das mir aufgegangen ist? So habe ich, gedrängt von Freunden, im hohen Alter mit Bücher-Schreiben angefangen. Mein erstes Buch trägt den Titel: Ich freue mich auf meine Beerdigung – ich werde dabei sein.
Mein neustes Buch Simone und Simon ist ein Roman. Er enthält viel Persönliches, von mir und von anderen Menschen. Das im Buch erwähnte Bild mit Simones theologischem Vorfahren gibt es; es hat mich inspiriert. Das Jüdische gehört zu unserer Familiengeschichte. Und die Hauptfigur des Romans wohnt nicht zufällig in Nidau, dem Nachbarstädtchen der zweisprachigen Stadt Biel-Bienne – ich war dort Pfarrer. Darum wird im Roman auch ein verrückter Pfarrer von Nidau erwähnt. Als das galt ich. Eine Atheistin sagte damals zu mir: «Ich kann nicht – oder noch nicht – glauben, was Sie verkündigen, aber ich fühle mich, wenn ich komme, auf seltsame Weise geliebt.»
Das wünsche ich meinen Leserinnen und Lesern. Egal ob Sie glauben oder noch nicht glauben: Fühlen Sie sich beim Lesen geliebt.
Ich widme dieses Buch meiner ehemaligen Schulkameradin vom städtischen Gymnasium Bern, Françoise Verrey Bass, die mich mit dem Bild ihres Vorfahren zum vorliegenden Roman inspiriert hat. Von ihr stammt auch das Gedicht Le cri, das ich mit ihrer freundlichen Genehmigung verwenden durfte. Die geschilderten Selbstgespräche zwischen Simone und Simon dagegen haben mit meiner Schulkameradin nicht das Geringste zu tun.
Inhalt
Erster Teil
Der Urahn zwischen dem Klopapier
Ach! aber für Lenoren war Gruss und Kuss verloren
Ein Halleluja mit Nebenwirkungen
Saint-Gingolph
Das Gnägifluchtloch
Laisse-toi tomber dans les mains du Seigneur
Alte Freundinnen
Zweiter Teil
Heil Hitler
Der Prophet
Auf dem Steinenhof
Der fliegende Edelstein
Das Hauptmann-Wunder
Das Fluchthotel
Das Concentrationslager mit C
Dritter Teil
The Kiss of Life
Le cri – der Schrei
Prinzessin Mamatunde aus dem Emmental
Der Aarefall
Der Test
Die Schlange auf dem Apfelbaum
Tod und Auferstehung
Erster Teil
Der Urahn zwischen dem Klopapier
Simone Perrin war völlig ausser Atem, als sie mit der grossen Packung Klopapier im Keller ankam. Die betagte Ärztin war bei verhältnismässig guter Gesundheit, doch sie spürte die vierundachtzig Jahre, die sie auf dem gebeugten Rücken trug. Das Buckelchen war ein Zeichen ihres hohen Alters. Ein Nachbarskind hatte sie kürzlich gefragt, was sie da auf dem Rücken habe. Simone hatte ein geheimnisvolles Gesicht gemacht und verschmitzt lächelnd erklärt: «Da drin sind die Flügelchen, die ich als Engel einmal haben werde.» Simone glaubte zwar weder an Gott noch an ein Leben nach dem Tod, doch so etwas konnte man einem Kind ja nicht sagen. Sie schob die WC-Papierpackung auf ein Regal. In der zweiten Welle der Pandemie hatte sie bei Coop problemlos Toilettenpapier einkaufen können. Niemand hatte versucht, es ihr zu entreissen. Bei der ersten Welle war das noch anders gewesen. Sie schüttelte den Kopf. Dass ein Virus die ganze Welt erfassen konnte, verstand sie als Ärztin zwar, aber dass im Zusammenhang mit Covid-19 die gesamte Menschheit von Australien bis Europa von einem Klopapier-Hamsterwahn ergriffen worden war, erschütterte sie zutiefst. In ihrem Nidauer Coop hatte sogar die Polizei für Ordnung sorgen müssen. Sie seufzte. Würde sie nach dem Glauben an Gott nun auch den Glauben an die Menschen verlieren?
«Zwischen dem Glauben an Gott und dem Glauben an die Menschen gibt es einen Zusammenhang», behauptete eine strenge Stimme. Die Stimme war zwar eine Simone-Gedanken-Stimme, doch schien sie direkt aus einem Bild zu kommen, aus einem alten Porträt, einem Erbstück, das Simone nach dem Tod der Eltern nicht in ihrem Wohnbereich hatte aufhängen wollen, es wegzuwerfen jedoch auch nicht übers Herz gebracht hatte. Sie hatte es im Keller in einem Regal untergebracht. Das Bild zeigte einen Urahn: Simon Perrin, Pfarrer in Lutry. Der Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater blickte seine Nachfahrin zwischen dem Klopapier hervor mit einer Mischung aus Güte und calvinistischer Unerbittlichkeit an. «Bin ich denn wirklich so rigoros, wie du jahrelang gemeint hast, mein Kind?», fragte der Ur-hoch-vier-Grossvater. Simone schob das Klopapierpaket zur Seite. Jetzt war das ganze Porträt zu sehen. Simon und Simone Perrin – Urahn und Nachfahrin trugen denselben Vor- und Nachnamen. Und beide, Simon und Simone, lebten in der Zeit einer Pandemie, Simon zur Zeit einer Pockenseuche, Simone während der Coronaepidemie. Pasteur Perrin hatte mit ganzer Kraft für die Pockenimpfung geworben. Aus diesem Grund hatte er den Pockenroman von Jeremias Gotthelf auf Französisch übersetzt. Albert Bitzius, der Pfarrer im emmentalischen Lützelflüh mit dem Dichternamen Jeremias Gotthelf, hatte im Auftrag der Berner Regierung einen Roman geschrieben, um die impfgegnerische Landbevölkerung für die Pockenimpfung empfänglich zu machen. Im Roman verweigerte die Bäuerin Annebäbi Jowäger die Impfung für sich und die ganze Familie. Die Weigerung hatte furchtbare Folgen: Jowägers einziges Kind erkrankte an Pocken. Zwar überlebte Jakobeli, doch blieb er für den Rest des Lebens gezeichnet, ein unansehnlicher junger Mann mit einem von Pockennarben entstellten Gesicht. Ein Mann scheinbar ohne Aussicht auf ein künftiges Liebes- und Familienleben, bis wie ein Engel vom Himmel das Waisenmädchen Meieli auftauchte. Gotthelfs Roman war der Deutschschweizer Landbevölkerung richtig eingefahren.
«Damals hörte man noch auf die Kirche», meldete sich der Vorfahr im Bild. «Der Roman wirkte, weil Jeremias Gotthelf Pfarrer war. Darum habe ich – auch ein Pfarrer – seinen Roman auf Französisch übersetzt. Die Westschweizer Kantonsregierungen waren mir sehr dankbar.» – «Alle Achtung, Arrière-Gand-Papa!», meinte Simone zu dem Mann im Bild. «Auch jetzt haben wir wieder Impfgegner. Du bleibst als Pfarrer immer Pfarrer, selbst nach fast zweihundert Jahren. Ich bin zwar Agnostikerin, doch du sollst wieder zu Ehren kommen.» Simone blies den Staub vom Bild. Mit einer Toilettenpapierrolle in der Linken und dem Bild des Urahnen in der Rechten verliess sie den Keller. Sie betrat den Aufzug, drückte mit dem Daumen der Hand, die das Klopapier hielt, auf den Knopf des vierten Stockwerks, und fuhr in ihre Wohnung hinauf.
Es war eine geräumige Viereinhalbzimmer-Wohnung mit Blick auf den Bielersee. Heute war der See allerdings genauso unsichtbar wie der liebe Gott: Der Herbstnebel brütete einer kalten feuchten Henne gleich über der Stadt. Typisch für das Seeland. «Ohne meinen Mann Reinhard wäre ich nie in dieses Nebelloch gezogen», dachte Simone. Sie stellte das Porträt auf das rote Sofa in der gemütlichen Leseecke und warf einen Blick durch das Fenster. Unwillkürlich fröstelte sie. Sie sah nicht einmal bis zum Nachbarhaus. Im Sommer war das mittelalterliche Städtchen Nidau wunderschön, doch im Herbst und Winter war es ein Ort zum Depressiv-Werden, besonders in der Coronakrise. In ihrer Geburtsstadt Lausanne konnte man im Herbst und Winter viel mehr Sonnentage geniessen als im Seeland. Auch in Bern, wohin ihr Vater mit seiner Familie aus beruflichen Gründen gezogen war, hatte es mehr Sonnentage gegeben. Dank ihrer Berner Schulzeit war Simone zweisprachig aufgewachsen und dank ihrer Zweisprachigkeit war die Lausanne-Bernerin ihrem Mann Reinhard Stalder gerne nach Nidau gefolgt. Reinhard arbeitete als Uhrmacher in Biel, Simone eröffnete eine Praxis im Haus, in dem das Ehepaar wohnte. Das war praktisch. Da Arbeitsplatz und Privatwohnung nicht getrennt waren, konnte Simone auch immer ein Auge auf das Töchterchen Silvie und die Buben Manuel und Yanis haben. Zuhause sprachen die Kinder französisch, draussen spielten sie auf Deutsch. In der zweisprachigen Stadt Biel besuchten sie zunächst die französische Schule, später das zweisprachige Gymnasium. Simone war eine hingebungsvolle Mutter und eine leidenschaftliche Ärztin. Mit dem ihr zwar angeborenen, aber auch noch weiterentwickelten Einfühlungsvermögen gelang es ihr immer wieder, die psychischen Ursachen für ein körperliches Leiden aufzuspüren, was bei den Verdrängungsmechanismen der Patientinnen und Patienten nicht selbstverständlich war. Wenn sie auf den wunden Punkt stiess, pflegte sie sich in ihrem Sessel zufrieden zurückzulehnen, ihre Patienten anzulächeln und zu sagen: «So, jetzt habe ich Sie.» Dieser Satz klang so liebevoll, dass die Patienten sich geborgen fühlten. Manch einer änderte seine Lebensweise und wurde gesund.
«Du hast eben die Seelsorge in den Genen», rief es vom roten Sofa.
«Mag sein», antwortete Simone ihrem Urgrossvater in Gedanken. «Ich werde dein Bild in mein Schlafzimmer hängen.»
«Ausgezeichnet», meinte Simon, «dann kann ich dir das Lied singen: Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich.»
«Wenn du solche Sonntagschulerinnerungen in mir wachrufen willst, dann werde ich mit anderen Erinnerungen Gegensteuer geben. Im Gymnasium haben wir Dürrenmatt gelesen.»
«Ich weiss», grinste der Vorfahr, «der Pfarrersohn Friedrich Dürrenmatt – sein Drama Der Mitmacher ist ganz schön makaber.»
Simone staunte. «Was, du Vorfahr aus einem vergangenen Jahrhundert kennst Dürrenmatt?»
«Gewiss, mein Kind, vergiss nicht, ich bin deine innere Stimme. Du brauchst gar nicht nach dem Dürrenmatt-Band zu greifen. Ich kann gleich selber zitieren: Die Burgdorf-Thun-Bahn überfuhr, während es aus den offenen Fenstern fröhlich herüberscholl: «Gott ist die Liebe, drum sag ich’s noch einmal, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich», das Auto des Blaukreuz-Inspektors. Als wir Sonntagsschüler hinzukamen, war von dem Blaukreuz-Inspektor, der, wie so oft, zu uns ins Pfarrhaus zum Sonntagsessen kommen wollte, nur noch der stattliche weisse Bart einigermassen übrig.»
Simone schüttelte sich. «Und so etwas schreibt ein Pfarrersohn!»
«Ja, ein Pfarrersohn, so wie du die Ur-Ur-Ur-Ur-Grosstochter eines Pfarrers bist. Der Schriftsteller Dürrenmatt, der sich bemühte, Gott loszuwerden, hat ein Leben lang mit Gott gerungen. Er ist Gott nie losgeworden. So wie du auch ...»
«Gib sofort Ruhe, Grand-Papa, sonst lasse ich dein Bild wieder im Keller verschwinden.»
«Das würde dir wenig nützen, denn ob du es willst oder nicht, ich befinde mich im Keller deiner Seele, zusammen mit deinem gläubigen Papa.»
«Den Glauben meines Vaters habe ich bis und mit Konfirmation in der französischen Kirche Bern geteilt und darüber hinaus sogar noch zwei Jahre lang in der Theatergruppe der Kirche weiter gepflegt, aber dann bin ich meine eigenen Wege gegangen.»
«Die eigenen Wege geht keiner ohne Verbindung mit den alten Wegen. Du bist geschieden von deinem Mann, aber durch deine Kinder und Grosskinder ist er immer noch da.»
«Du hast ja recht, Grand-Papa. – Wenn das so weitergeht, fange ich noch an, mit mir selber laut zu sprechen», hörte Simone sich ganz laut sagen. Sie musste ihre depressiven Gedanken verscheuchen. Die Impfgegner hatten sie an Jeremias Gotthelf denken lassen, den ihr Vorfahr auf Französisch übersetzt hatte. Sie stand auf und trat an die Bücherwand. Irgendwo befand sich der Jeremias-Gotthelf-Band mit Annebäbi Jowäger. Doch sie zog den Band nicht heraus. Dieser würde sie nur wieder mit schweren Gedanken erfüllen. Sie wollte jetzt endlich einmal nicht an irgendwelche Seuchen denken, weder an die Coronapandemie noch an die spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 gewütet und ihren Grossvater mütterlicherseits das Leben gekostet hatte. Ob Corona auch zwei Jahre dauern würde? Die schweren Gedanken liessen sich nicht verjagen. Sie begab sich in ihr Büro und setzte sich an den Computer.
«Hoffentlich finde ich eine aufmunternde E-Mail,» murmelte sie. Es hatte sich einiges angesammelt: Car Tours machte Reisevorschläge für den Frühling; ein Hotel in Verbier lud ein zu Skiferien. Das Wallis hatte zurzeit eine tiefe Coronafallzahl. In diesem Bergkanton hatten sie zur Rettung des Weihnachts- und Skitourismus rechtzeitig einen Lockdown verhängt, das hatte die Fallzahlen gesenkt. Nun waren sie in der Lage, Skitouristen willkommen heissen. Doch das konnte morgen schon anders sein. Das Angebot war ohnehin nichts für Simone. Sie hatte das Skifahren bereits im Alter von fünfundsechzig Jahren aufgegeben. Ihre Augen suchten weiter. Ein Brian meldete einen Internetauftritt. «Wahrscheinlich etwas Pornographisches», mutmasste sie ärgerlich und beförderte Brian in den Spamordner.
Ihr Gesicht hellte sich auf: Eine ehemalige Patientin, welche vor zwei Wochen einen komplizierten Beinbruch erlitten hatte, schrieb, dass sie nun doch operiert werden könne, allerdings weder in Biel noch in Bern, denn in beiden Städten waren die Spitalbetten mit Covid-19-Patienten belegt; Operationen, die nicht lebenswichtig waren, wurden abgesagt. Dank Simones Intervention konnte ihre frühere Patientin nun aber in Thun operiert werden. Als Ärztin schmerzte sie die Erkenntnis, dass das Krankenhauspersonal am Limit war. Ärzte und Pflegefachleute hatten keine freie Minute, sie konnten sich nicht mehr erholen; zudem hatten sie keine Möglichkeit, sich für die Schwerkranken und Sterbenden die nötige Zeit zu nehmen. Simone biss auf die Zähne. Sollte sie, die Vierundachtzigjährige, sich freiwillig melden und ihre Hilfe anbieten? Doch sofort verwarf sie diesen Gedanken. Altersmässig gehörte sie längst zur Risikogruppe.
Aus einer weiteren E-Mail kam ihr der Name Mark Mauerhofer entgegen. Mark war ein Schulkollege aus der Gymnasialzeit, Pfarrer im aktiven Ruhestand. «Heute ist für dich ein reicher Pfarrertag», meldete sich der Gotthelf-Übersetzer vom Sofa. «Bestimmt hat dir der Schulkollege eine historische Abhandlung über Seuchen im Mittelalter geschickt.» Simon hatte recht, Mark sandte ihr im Anhang einen Vortrag über die Pestepidemien. Es war zum Verzweifeln. Die Menschen dachten Tag und Nacht an nichts anderes mehr als an die Epidemie. In den USA starben täglich mehr Menschen an Corona als Soldaten während des zweiten Weltkriegs an jedem Kriegstag. Simone hatte ein neues Wort gelernt: Übersterblichkeit, surmortalité. In der Schweiz herrschte surmortalité. Der Tod war weltweit für alle Menschen sehr real geworden und betraf nicht nur die anderen, sondern jeden höchst persönlich. Es war nicht erstaunlich, dass ihr Gymerkollege, der historisch interessiert war, eine Abhandlung über die Pestausbrüche geschrieben hatte. In vielen europäischen Städten war bei den grossen Pestepidemien mehr als die Hälfte der Bevölkerung gestorben, ganze Ortschaften waren vom Erdboden verschwunden. Mark erwähnte in seiner Abhandlung auch die Reformationszeit. Die Pest hatte damals auch in Zürich gewütet. Der Reformator Zwingli hätte sich retten können, denn er weilte beim Ausbruch der Seuche auf dem Land. Er eilte jedoch sofort in die Stadt zurück. Dass Zwingli um der Menschen willen den sicheren Ort verlassen hatte und in das verseuchte Zürich zurückgekehrt war, hatte Simone nicht gewusst.
«Gläubige Menschen stellen sich mutig dem Tod», rief es vom roten Sofa her. «Zwingli wusste: Ein Seelsorger gehört zu den Kranken und Sterbenden.»
Der Reformator wurde selber angesteckt und rang mit dem Tod. Simone las weiter in Marks Bericht: Zwingli überlebte und schrieb nach seiner Genesung ein Not- und Danklied. In der Mail ihres Gymerkameraden fand sie die Worte und die Noten:
Hilf, Herr Gott, hilf in dieser Not
an meine Tür klopft an der Tod.
Steh du mir bei zu dieser Frist,
Herr Jesus Christ, der du des Todes Sieger bist.
Ist es dein Will, zieh aus den Pfeil,
der mich verwundet; hilf und heil.
Rufst du zum frühen Tode mich;
dein Krug bin ich. Mach ganz ihn oder ihn zerbrich.
Tröst, Herr Gott, tröst. Die Krankheit steigt,
und Seel und Leib dem Schmerz sich beugt.
Nach deiner Gnad steht mein Begehr;
zu mir dich kehr; denn ausser dir ist Hilf nicht mehr.
Hin rinnt mein Leben; es ist um.
Still wird es bald, mein Mund ist stumm.
Mag nicht mehr stammeln nur ein Wort;
die Kraft ist fort, all meine Sinne sind verdorrt.
Gesund, Herr Gott, ich bin gesund.
Es preiset dich mein Herz und Mund.
Ins Leben wiederum ich kehr;
dein Lob und Lehr will ich verkünden immer mehr.
Simone setzte sich ans Klavier. Sie begann das Zwinglilied zu spielen und zu singen. Sie dachte an den Konfirmandenunterricht. Als die letzte Strophe verklungen war, spottete Simon: «Da schau her, ein kleiner Rückfall in die Konfirmationszeit. Pasteur Charles Brütsch von der französischen Kirche in Bern, wenn ich mich nicht irre.» Simone nickte versonnen. Charles Brütsch war ein guter Seelsorger und ausgezeichneter Prediger gewesen. Wenn Walter Lüthi, der berühmte Berner Münsterpfarrer, nicht predigte, besuchte auch ihr Deutschschweizer Gymerkamerad Mark den französischen Gottesdienst von Pasteur Brütsch. Sie lächelte. Charles Brütsch war Mitglied der theologischen Prüfungskommission gewesen. Als Mark vor einem Gremium von Experten – alle Experten waren Pfarrer – seine Prüfungspredigt ablegen musste, war Charles Brütsch nach dem Amen begeistert auf den werdenden jungen Pfarrer losgestürmt, hatte ihm auf die Schultern geklopft und laut lachend gesagt: «Künftiger Kollege, Sie haben vor den Experten nicht eine Prüfung abgelegt, sondern diesen Herren gezeigt, wie sie predigen müssten!» Diese Prüfungsgeschichte hatte Mark ihr persönlich erzählt. «Ich bin froh, dass Charles Brütsch mich konfirmiert hat», erklärte Simone am Klavier in Richtung Sofa. Sie erwartete von Simon eine Bemerkung über ihre Widersprüchlichkeit, einerseits den Glauben abzulehnen, andererseits jedoch ein Zwinglilied zu singen und sich mit Dankbarkeit an den Pfarrer zu erinnern, der sie konfirmiert hatte. Sie wusste bereits, was sie dem Bild auf dem Sofa antworten würde, falls es sich melden sollte. Sie würde Simon sagen, dass Pasteur Brütsch eben einen freieren Glauben gelebt habe als ihr streng calvinistischer Vater. Bei Pasteur Brütsch konnte man atmen, bei ihrem Vater erstickte man glaubensmässig. Doch Grand-Papa Simon im Bild beabsichtigte kein Streitgespräch. Ihn verlangte nach etwas ganz anderem.
«Ich habe Hunger», flüsterte er.
Simone musste lachen; es war ja schliesslich ihr eigener Hunger, der sich gemeldet hatte. Im Gemüsefach fand sie einen kleinen Kürbis. Sie bekam Lust auf Kürbissuppe. «Ist Kürbissuppe ok für dich, Grand-Papa?»
«Kürbisse galten zu meiner Zeit noch als fremdartiges Gemüse, das man nicht ass», brummte der Alte, «und ok würde man nie gesagt haben. Englisch galt damals als eine Nicht-Sprache; Französisch war in aller Leute Mund.»
«Ich weiss», gab Simone zu, «Kürbisse stammen aus Südamerika. Zu deiner Zeit hatten sie ihren Siegeszug erst in Spanien und Italien angetreten. Und was Wörter wie OK, Cool und Lockdown anbetrifft, bleibt Französisch trotzdem die schönste Sprache der Welt.»
«Da sind wir uns einig, Chouchou, doch Deutsch ist auch nicht schlecht. Gotthelf hat ein Werk mit der Aussagekraft eines Homer hinterlassen, und Berndeutsch ist ein wunderbarer Dialekt – absolument savoureux.»
«Woher rührt eigentlich deine Vorliebe für Berndeutsch, Grand-Papa? Das ist doch für einen Waadtländer nicht selbstverständlich? Unser Papa wurde immer wütend, wenn wir Kinder miteinander Berndeutsch sprachen.»
«Die Liebe meines Lebens, deine Ur-Ur-Ur-Ur-Grossmutter war eine Berner Patrizierin, Marie-Claire de Wattenwyl. Die Berner Aristokraten haben abwechslungsweise berndeutsch und französisch gesprochen. Ich habe dieses Gemisch übernommen, das hat mir bei den Gotthelf-Übersetzungen sehr geholfen.»