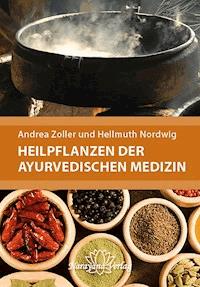
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Narayana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ayurveda, die traditionelle indische Heilkunde, gehört zu den ältesten Heilmethoden und erfreut sich auch im Westen großer Beliebtheit. Das Standardwerk „Heilpflanzen der Ayurvedischen Medizin“ ist eines der umfassendsten Kompendien und beschreibt detailliert über 220 der wichtigsten Heilpflanzen in übersichtlicher Tabellenform. Die Autoren geben eine lebendige Einführung in die Ayurvedische Heilkunst, deren Grundlagen und das besondere Verständnis von Krankheiten. Die einzelnen Pflanzen werden detailliert beschrieben, wie z.B. Wirkung auf Dosas, Inhaltsstoffe und Herkunft. Besonders die genauen Angaben zur Zubereitung, Dosis und Anwendung sowie Hinweisen auf Nebenwirkungen machen die Mittelbeschreibungen auch für den westlichen Therapeuten einfach nutzbar. Ausführlich wird die Wirkung der Heilpflanzen auf die Körpersysteme wie Atemwege, Verdauung, Haut, Herz-Kreislauf-System, Urogenitaltrakt sowie Nervensystem beschrieben. Die Anwendungen umfassen z.B. Ocimum tenuiflorum bei Erkältungskrankheiten, Kokosnuss bei Magenschleimhautentzündungen, Safran bei Migräne oder Pluchea lanceolata bei rheumatischen Beschwerden. Besonders wertvoll sind klinische Tipps zu einzelnen Pflanzen aus der westlichen Praxis erfahrener Ayurveda-Therapeuten. Die vorliegende neue Ausgabe wurde bereichert durch eine Beschreibung der Darreichungsformen und Rezepturen. Dabei geht es um Zubereitungsformen wie die Herstellung von medizinischen Pulvern und Ölen, vergorenen Säften, Pflanzenauszügen, Konfitüren und Harzen. Zahlreiche Farbfotos veranschaulichen die Heilpflanzen. Ein Nachschlagewerk, welches in Umfang und Praxistauglichkeit unübertroffen ist. "Die Besonderheit dieses Buches ist, dass die Autoren die Heilpflanzen in rund 100 Wirkungsgruppen eingeteilt haben. Es ist wohl das einzige Buch, das so viele Wirkungen detailliert beschreibt. Für den praktischen Gebrauch ist diese Darstellung von großem Nutzen. Besonders wertvoll ist dieses Buch auch deshalb, weil es das Werk des hochangesehenen indischen Gelehrten Prof. P. V. Sharma zur Grundlage hat. Seine Veröffentlichung fällt in eine Zeit, in der in Deutschland das Bedürfnis nach einem tieferen Verständnis der ayurvedischen Medizin wächst. Was die Wirkungen und den Gebrauch von Heilpflanzen angeht, so bin ich sicher, dass das vorliegende Buch den Wissensdurst der Leser stillen wird." Prof. Dr. Subhash Ranade Einführung in die ayurvedische Medizin Die Energetik von Heilpflanzen Das Nervensystem, die Sinnesorgane, Haut und Haare, Herz und Kreislauf, Atemwege, Verdauungssystem, Nieren und Harnwege, Fortpflanzungsorgane, Abwehrsystem, Körpertemperatur und Fieber, Allgemeine Wirkungen Wirkungen auf Gewebe (dhatus) und Körperkanäle (śrotas) Wirkungen auf die einzelnen dosas Die 223 Heilpflanzen (Hauptteil) Die Zubereitungsformen im Überblick: Svarasas: Frischen Pflanzensäfte Kalkas: Pasten Kvathas: Abkochungen Himas: Kaltauszüge Phanthas: Warmwasserauszüge Asavas und Ari as: Kräuterweine Sattva: Feste Pflanzenessenzen Panakas: Sirup-Zubereitungen Guggulus: Harze und vieles mehr Zitat aus Traditional South Asian Medicine „Dies ist ein phytotherapeutisches Handbuch, das in mustergültiger Weise etwa 225 Ayurvedische Heilpflanzen, ihre Anwendungsweisen und ihre Wirkungen vorstellt.“ Rahul Peter Das
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andrea Zoller und Hellmuth Nordwig
HEILPFLANZEN DER AYURVEDISCHEN MEDIZIN
Ein praktisches Handbuch über Zubereitung, Dosis und Wirkung von über 220 Ayurvedischen Heilpflanzen und deren Rezepturen
Mit 340 Abbildungen und 400 Tabellen
Andrea Zoller und Hellmuth Nordwig
HEILPFLANZEN DER AYURVEDISCHEN MEDIZIN
Ein praktisches Handbuch über Zubereitung, Dosis und Wirkung von über 220 Ayurvedischen Heilpflanzen und deren Rezepturen
Mit 340 Abbildungen und 400 Tabellen
2. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage 2012
3. Auflage 2017
ISBN 978-3-95582-159-3
Herausgeber: Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, 79400 Kandern Tel.: +49 7626 9749700 E-Mail: [email protected]
© 2012, Narayana Verlag
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form - mechanisch, elektronisch, fotografisch - reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Für unsere Kinder
Phyllis, Julian, Simon, Leah und Annabell
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort der Autoren
Die Absicht dieses Buches
Einführung in die Ayurvedische Medizin
Die fünf Elemente,mahābhūtas
Die drei „Verderber“,doṣas
Die sieben Gewebe,dhaṭus
Das Verdauungsfeuer agni, die Abfallprodukte, mala, und das „Unverdaute“,āma
Gesundheit und Krankheit
Die Energetik von Heilpflanzen
Die Eigenschaften,„guṇas“
Der Geschmack,„rasa“
Der Geschmack nach der Verdauung,„vipāka“
Die Wirkung auf den Körper,„vīrya“
Außergewöhnliche Wirkungen,„prabhāva“
Nervensystem
Hirntonika„medhya“
Narkotika„madakāri“
Antinarkotika/Anregende Drogen„saṁjñāsthāpana“
Hypnotika„nidrājanana“
Wachhaltende Drogen und Stimulantien„nidrāśamana“
Analgetika„vedanāsthāpana“
Krampferzeugende Drogen„ākṣepajanana“
Krampflösende Drogen„ākṣepaśamana“
Sinnesorgane
Augentonika„cakṣuṣya“
Pupillen erweiternde/verengende Drogen
Ohrentonika„karṇa“
Nasentonika/„nasya“-medikamente„śirovirecana“
Haut und Haare
Schweißtreibende Drogen„svedajanana“
Schweißhemmende Drogen„svedāpanayana“
Haarwuchsfördernde Drogen„romasaṁjanana“
„Haartherapeutische“ Drogen„keśavardhana“
Drogen gegen vorzeitiges Ergrauen der Haare„keśarañjana“
Enthaarende Drogen„romaśātana“
Hautreizende Drogen„vidāhī“
Entzündungshemmende Pflanzen„vimlapana“
Abszessreifende Pflanzen„pācana“
Abszessaufbrechende Pflanzen„dāraṇa“
Öle für die Ölungstherapie„snehana“
Hilfsdrogen für die Ölungstherapie„snehopaga“
Pigmentbildende Pflanzen„varṇya“
Juckreizlindernde Drogen„kaṇḍūghna“
Gegen Lepra und chronische Hautkrank-heiten (pitta-Störungen) wirksame Pflanzen„kuṣṭaghna“
Antiallergische und gegen Nesselsucht wirksame Pflanzen„udarda praśamana“
Herz und Kreislauf
Kardiotonika„hṛdaya“
Kardiostimulantien„hṛdayottejaka“
Kardiodepressiva„hṛdayaavasādaka“
Antihypotonika bzw. blutdrucksteigernde Pflanzen„raktabhāravardhaka“
Antihypertonika bzw. blutdrucksenkende Pflanzen„raktabhāraśāmaka“
Durchblutungsfördernde Pflanzen„raktasrāvaka“
Atemwege
Auswurffördernde Drogen„śleṣmahara“
Schleimbildende Drogen„śleṣmajanana“
Hustenreizlindernde Drogen„kāsahara“
Antiasthmatische Drogen„śvāsahara“
Gegen Schluckauf wirksame Drogen„hikka-nigrahaṇa“
Für Rachen und Stimmbänder wohltuende Drogen„kaṇṭhya“
Verdauungssystem
Āma abbauende Pflanzen„āma pacana“
I. Wirkungen auf den Mund,„mukha“
Speichelflussanregende Pflanzen„lālāprasekajanana“
Speichelflusshemmende Pflanzen„lālāprasekaśamana“
Durststillende Pflanzen„tṛṣṇānigrahaṇa“
Gegen Mundgeruch wirksame Drogen„durgandha-naskana“
Mundreinigende Pflanzen„mukhavaiśadyakara“
Zahnreinigende Pflanzen„dantaśodhana“
Zahnfleischstärkende Pflanzen„danta-dadyekara“
II. Wirkungen auf den Magen und Zwölffingerdarm,„āmāśraya“
Gegen Völlegefühl wirksame Pflanzen„tṛptighna“
Appetitanregende und geschmacks- verbessernde Pflanzen„rocana“
Stomachische Pflanzen„dīpana“
Brennen hervorrufende Pflanzen„vidāhī“
Emetika bzw. Erbrechen hervorrufende Pflanzen„vamana“
Hilfsmittel bei der Therapie durch Erbrechen„vamanopaga“
Antiemetische bzw. brechreizlindernde Pflanzen„chardingrahaṇa“
III. Wirkungen auf den Darm„antara“
Pflanzen, die den Stuhlgang fördern„purīṣajanana“
Hilfsmittel bei der Abführtherapie„virecanopaga“
Antidiarrhoische Pflanzen„purīṣasaṁgrahaṇīya“
Pflanzen, welche die Farbe des Stuhls normalisieren„purīṣavirañjanīya“
Gegen Kolik - spasmolytisch wirksame Pflanzen„śūlapraśamana“
Pflanzen, deren Abkochungen für Einläufe geeignet sind„āsthāpana“
Hilfsmittel bei den Abkochungseinläufen„āsthāpanopaga“
Pflanzen, deren Öle für Einläufe geeignet sind„anurasan“
Hilfsmittel bei den Öl-Einläufen„anurasanopaga“
Pflanzen, die erbrechend und abführend wirken„ubhayatobhāgahara“oder„saṁśodhana“
Anthelminthika bzw. gegen Würmer wirksame Pflanzen„kṛmighna“
Pflanzen, welche den Leberstoffwechsel beeinflussen
Gegen Hämorrhoiden wirksame Pflanzen„arśoghna“
Pflanzen, die gegen Schwellungen der Milz wirken„plīhāvṛdhikara“
Nieren und Harnwege
Diuretische bzw. harntreibende Pflanzen„mūtravirecanīya“
Gegen pitta-Störungen des Harntrakts wirksame bzw. die Farbe des Urins normalisierende Pflanzen„mūtravirañjanīya“
Lithotriptische bzw. steinbrechende Pflanzen„aśmarībhedana“
Antidiuretische Pflanzen„mūtrasaṁgrahaṇīya“
Antidiabetische Pflanzen„madhumehahara“
Fortpflanzungsorgane
Antiabortive bzw. uterustonische Pflanzen„prajāsthāpana“
Kontrazeptive und abortive Pflanzen„garbhārodhaka“
Menstruationsfördernde Pflanzen bzw. Emmenagoga„ārtavajanana“
Menstruationshemmende Pflanzen„ārtavasaṁgrahaṇīya“oderārtavaśamana“
Milchbildende Pflanzen„stanyajanana“
Milchreinigende Pflanzen„stanyaśodhana“
Aphrodisiaka„vājīkaraṇa“
Antiaphrodisiaka„kāmasādaka“
Abwehrsystem, Körpertemperatur und Fieber
Antipyretische bzw. fiebersenkende Pflanzen„jvarahara“oder„jvaraghna“
Drogen, die Fieber zu bestimmten Jahreszeiten lindern
Āma abbauende Drogen„āma pacana“
Antiperiodika bzw. gegen chronisches Wechselfieber wirksame Pflanzen„viṣamajvaraghna“
Gegen Hitzeempfindung wirksame Pflanzen„dāhapraśamana“
Gegen Kälteempfindung wirksame Drogen„śitapraśamana“
Antiseptika„kothapraśamana“
Desinfizierende Pflanzen„rakṣoghna“
Gegen Schwellungen und Entzündungen wirksame Pflanzen„śothahara“
Abwehrsteigernde Pflanzen„vyādhikṣamatva“
Allgemeine Wirkungen
Nährende Pflanzen„jīvanīya“
Tonische bzw. stärkende Pflanzen„balya“
Ojas vermehrende Pflanzen„ojovardhaka“
Verjüngende Pflanzen bzw. Medikamente„rasāyana“
Entgiftende bzw. antitoxische Pflanzen„viṣaghna“
Wirkungen auf die einzelnen Gewebe,„dhātus“,und Körperkanäle,„śrotas“
Pflanzen, die das Plasmagewebe vermehren„rasavardhana“
Pflanzen, die das Blut vermehren„raktavardhana“
Blutungsstillende Drogen„raktastambhana“
Blutreinigende und umstimmende Drogen„raktaśodhana“oder „raktaprasādana“
Pflanzen, die das Muskelgewebe vermehren„bṛmhaṇa“
Pflanzen, die das Muskelgewebe vermindern„langhana“oder„lekhana“
Gegen Erschöpfung wirksame Pflanzen„śramahara“
Gegen Muskelschmerzen wirksame Pflanzen„aṅgamardapraśamana“
Wundheilende Pflanzen„vraṇaropaṇa, utsādana, saṁdhānīya“
Pflanzen, die das Fettgewebe vermehren„medovardhana“
Pflanzen, die das Fettgewebe vermindern„medaśapana“
Pflanzen, die das Knochengewebe vermehren„asthivardhana“
Pflanzen, die das Fortpflanzungsgewebe vermehren oder vermindern„śukravardhana“
Pflanzen, welche die Körperkanäle (śrotas) öffnen„pramāthi“
Wirkung auf die einzelnen doṣas
Vāta vermehrende Pflanzen„vātakopana“
Vāta verringernde Pflanzen„vātaśamana“
Pitta vermehrende Pflanzen„pittakopana“
Pitta verringernde Pflanzen„pittaśamana“
Kapha vermehrende Pflanzen„kaphakopana“
Kapha verringernde Pflanzen„kaphaśamana“
Pflanzen, welche die drei doṣas ins Gleichgewicht bringen„saṁṣamanaw
Die Heilpflanzen
Abelmoschus moschatus Medik.
Abies spectabilis (D. Don) Spach
Acacia catechu (L. f.) Willd.
Achyranthes aspera L.
Aconitum ferox Wall. ex Ser.
Aconitum heterophyllum Wall.
Acorus calamus L.
Aegle marmelos (L.) Corrêa
Ailanthus excelsa Roxb.
Alangium salviifolium (L. f.)
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Allium cepa L.
Allium sativum L.
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don
Aloe vera (L.) Burm. f.
Alpinia galanga (L.) Willd.
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Althaea officinalis L.
Anacyclus pyrethrum (L.) Link
Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
Anethum graveolens L.
Aquilaria agallocha (Lour.)
Areca catechu L.
Argemone mexicana L.
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer
Aristolochia indica L.
Artemisia maritima L.
Artemisia vulgaris L.
Asparagus adscendens Roxb.
Asparagus racemosus Willd.
Asteracantha longifolia (L.) Nees
Atropa belladonna L.
Ayapana triplinervis (Vahl)
Azadirachta indica A. Juss.
Bacopa monnieri (L.) Pennell
Baliospermum montanum (Willd.).
Bambusa bambos (L.) Voss
Bauhinia variegata L.
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Berberis aristata DC.
Bergenia ciliata (Haw.) Sternb.
Boerhavia diffusa L.
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.
Brassica juncea (L.) Czern.
Brassica rapa L. subsp. campestris
Buchanania lanzan Spreng.
Butea monosperma (Lam.) Taub.
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
Callicarpa macrophylla Vahl
Calophyllum inophyllum L.
Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton
Cannabis sativa L.
Capsicum annuum L.
Carica papaya L.
Carum carvi L.
Cassia angustifolia Vahl
Cassia fistula L.
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Catunaregam spinosa (Thunb.)
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don)
Celastrus paniculatus Willd.
Centella asiatica (L.) Urb.
Chamaecrista absus (L.)
Chrysopogon zizanioides (L.)
Cichorium intybus L.
Cinchona officinalis L.
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl
Cinnamomum verum J. Presl
Cissampelos pareira L.
Cissus quadrangularis L.
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Citrus limon (L.) Burm. f.
Coccinia grandis (L.) Voigt
Cocos nucifera L
Colchicum luteum Baker
Commiphora myrrha (Nees) Engl.
Commiphora wightii (Arn.) Bhandari
Convolvulus pluricaulis Choisy
Coptis teeta Wall.
Cordia dichotoma G. Forst.
Coriandrum sativum L.
Costus speciosus (J. Koenig) Sm.
Crateva religiosa G. Forst.
Crinum asiaticum L.
Crocus sativus L.
Croton tiglium L.
Cucumis sativus L.
Cuminum cyminum L.
Curcuma longa L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus rotundus L.
Datura metel L.
Delphinium denudatum Wall.
Desmodium gangeticum (L.) DC.
Diospyros peregrina Gürke
Eclipta prostrata (L.) L.
Elettaria cardamomum (L.) Maton
Embelia ribes Burm. f.
Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf
Erythrina variegata L.
Eucalyptus globulus Labill.
Euphorbia neriifolia L.
Euryale ferox Salisb.
Ferula assa-foetida L.
Ficus benghalensis L.
Ficus carica L.
Ficus racemosa L.
Ficus religiosa L.
Foeniculum vulgare Mill.
Gentiana kurroo Royle
Glycyrrhiza glabra L.
Gmelina arborea Roxb.
Gossypium herbaceum L.
Gymnema sylvestre (Retz.) Schult.
Hedychium spicatum Buch.-Ham.
Helicteres isora L.
Hemidesmus indicus (L.) W. T. Aiton
Hibiscus rosa-sinensis L.
Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don
Hydnocarpus pentandrus Oken
Hyoscyamus niger L.
Hyssopus officinalis L.
Indigofera tinctoria L.
Inula helenium L.
Justicia adhatoda L.
Lavandula stoechas L.
Lawsonia inermis L.
Lepidium sativum L.
Linum usitatissimum L.
Luffa echinata Roxb.
Mallotus philippensis (Lam.)
Mangifera indica L.
Melia azedarach L.
Mesua ferrea L.
Mimosa pudica L.
Momordica charantia L.
Moringa oleifera Lam.
Mucuna pruriens (L.) DC.
Myristica fragrans Houtt.
Nardostachys jatamansi (D.Don) DC.
Nelumbo nucifera Gaertn.
Nerium oleander L.
Nigella sativa L.
Ocimum basilicum L.
Ocimum tenuiflorum L.
Onosma bracteata Wall.
Operculina turpethum (L.)
Origanum majorana L.
Oroxylum indicum (L.) Vent.
Paeonia officinalis L.
Papaver somniferum L.
Peganum harmala L.
Phyllanthus emblica L.
Picrorhiza kurrooa Royle ex Benth.
Pinus roxburghii Sarg.
Piper betle L.
Piper cubeba L. f.
Piper longum L.
Piper nigrum L.
Plantago ovata Forssk.
Pluchea lanceolata (DC.) Oliv. & Hiern
Plumbago zeylanica L.
Pongamia pinnata (L.) Merr.
Premna serratifolia L.
Psoralea corylifolia L.
Pterocarpus marsupium Roxb.
Pterocarpus santalinus L. f.
Pterospermum suberifolium (L.) Willd.
Punica granatum L.
Putranjiva roxburghii Wall.
Quercus infectoria G. Olivier
Ranunculus sceleratus L.
Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
Rheum australe D. Don
Ricinus communis L.
Rosa centifolia L.
Rubia cordifolia L.
Ruta graveolens L.
Saccharum officinarum L.
Salix caprea L.
Santalum album L.
Sapindus trifoliatus L.
Saraca asoca (Roxb.) De Wilde
Saussurea costus (Falc.) Lipsch.
Senna sophera (L.) Roxb.
Senna tora (L.) Roxb.
Sesbania grandiflora (L.) Pers.
Sida cordifolia (L.)
Smilax china (L.)
Solanum anguivi Lam.
Solanum nigrum L.
Solanum virginianum L.
Stereospermum suaveolens DC.
Strychnos nux-vomica L.
Strychnos potatorum L. f.
Styrax benzoin Dryand.
Swertia chirayita (Roxb.) H. Karst.
Symplocos racemosa Roxb.
Syzygium aromaticum (L.)
Taraxacum officinale F. H. Wigg.
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.)
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Terminalia chebula Retz.
Tinospora cordifolia (Willd.) Miers
Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze
Trachyspermum ammi (L.) Sprague
Trapa natans L.
Tribulus terrestris L.
Trichosanthes dioica Roxb.
Trigonella foenum-graecum L.
Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC.
Urginea maritima (L.) Baker
Valeriana jatamansi Jones
Vernonia cinerea (L.) Less.
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Viola odorata L.
Vitex negundo L.
Vitis vinifera L.
Withania somnifera (L.) Dunal
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz
Zingiber officinale Roscoe
Die Zubereitungsarten im Überblick
Die fünf grundlegenden Zubereitungsarten
Svarasa – Saft
Kalka oder Lepa – Paste
Kvātha – Abkochung (Dekokt)
Hima – Kaltauszug (Mazerat)
Phāṇṭha – Warmer Auszug (Infus)
Ölige Zubereitungen
Ghṛta – Medizinisches Butterschmalz
Taila – Öl
Vergorene Zubereitungen
Āsava und Ariṣṭa – Kräuterweine
Sūra und vāruṇī
Arka
Sukta – Essig
Trockene Zubereitungen
Cūrṇa – Pulver
Vaṭī/ Vaṭikā /Guṭī/ Guṭikā – Pillen
Süße Zubereitungen
Leha oder Avaleha – Konfitüre
Modaka
Guḍaka
Pāka
Pānaka – Sirup
Zubereitung mit Harz
Guggulu – Harze
Flüssige Zubereitungsformen
Kṣīrapāka – Medizinische Milch
Pānīya – Heilkräftiges Wasser
Uṣṇodaka – Gekochtes Wasser
Tāṇḍūlodaka – Reiswasser
Zubereitungen in einer geschlossenen Form
Pūṭapākva – Geschlossenes Erhitzen
Allgemeine Aspekte bei der Zubereitung von Heilpflanzen
Rezepturen
Svarasas - Die frischen Pflanzensäfte
Kalkas - Die Pasten
Kvāthas - Die Abkochungen (Dekokte)
Himas - Die Kaltauszüge (Mazerate)
Phāṇṭhas - Die Warmauszüge (Mazerate)
Tailas - Die medizinischen Öle
Ghṛtas - Die arzneilichen Butterschmalz-Zubereitungen
Āsavas und Ariṣṭas - Die fermentierten Kräuterweine
Cūrṇas - Die pflanzlichen Pulver
Sattva - Die festen Pflanzenessenzen
Vaṭī, Vaṭikā, Guṭī und Guṭikā - Pillen und Tabletten
Leha, Avaleha, Pāka, Khaṇḍa -Medizinische Konfitüren
Pānakas - Die Sirup-Zubereitungen
Guggulus - Die Harze
Lavaṇas - Die Salze
Die wichtigsten Komplexmittel nach Suśruta
Die fünf großen Wurzeln„bṛhat pañcamūla“
Die zehn Wurzeln„daśamūla“
Die fünf leichten Wurzeln„laghu pañcamūla“
Die fünf Herben„pañcakaṣāya“
Die fünf Scharfen„pañcakola“
Die fünf milchigen Bäume „pañcakṣīrivṛkṣa“
Die fünf Magenbitteren„pañcatikta 1“
Die fünf Bitteren„pañcatikta 2“
Die fünf Bitteren„pañcatikta 3“
Die fünf Gräserwurzeln„pañcatṛnamūla“
Die drei Aromatischen„trijāta“
Die drei „Hochmütigen“„trimada“
Die drei Scharfen„trikaṭu“
Die drei Früchte„triphalā“
Kayacikitsa
Pathologische Begriffe im Sanskrit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Pflanzennamen Deutsch
Pflanzennamen Sanskrit
Pflanzennamen Latein
Pflanzennamen Hindi
Rezeptverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Übersicht
Nervensystem 15 – 23
Sinnesorgane 24 – 41
Herz und Kreislauf 42 – 47
Atemwege 48 – 53
Verdauungssystem 54 – 80
Nieren und Harnwege 81 – 86
Fortpflanzungsorgane 87 – 94
Abwehrsystem, Körpertemperatur und Fieber 95 – 109
Allgemeine Wirkungen 110 – 124
Wirkung auf die einzelnen doṣas 125 – 133
Die Heilpflanzen 134 – 647
Zubereitungsarten im Überblick 648 – 651
Allgemeine Aspekte bei der Zubereitung 652 – 699
Die wichtigsten Komplexmittel 700 – 706
Pathologische Begriffe im Sanskrit 707 – 712
Geleitwort
von Prof. Dr. Subhash Ranade
Ayurveda ist die Wissenschaft vom Leben. Wahrscheinlich ist es zugleich das älteste Heilsystem der Welt, das heute noch praktiziert wird. Nicht nur die gut eine Milliarde Einwohner zählende Bevölkerung Indiens, sondern auch Menschen in Sri Lanka, Nepal, Bangladesh und Indonesien, ja selbst in Australien, Japan, Europa und den USA wenden die ayurvedische Medizin an, um gesund zu bleiben, länger zu leben, Krankheiten zu verhüten und Beschwerden zu behandeln.
Ayurveda lehrt, dass man Gesundheit nicht in der Apotheke kaufen kann, sondern sich durch eine Änderung des Lebensstils aktiv darum bemühen muss. Richtige Ernährung und Bewegung und die Anpassung an Tages- und Jahreszeiten gehören genauso dazu wie eine ethische Lebensweise und Meditation. Denn die ayurvedische Medizin fasst das Leben als Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele auf.
Indien gehört zu den Ländern mit der größten biologischen Vielfalt. Es gibt dort 16 landwirtschaftliche und Klimazonen, 10 Vegetationszonen und über 400 ökologische Lebensräume. Die niederschlagsreichsten Gebiete der Erde liegen ebenso in diesem Land wie Gegenden, in denen es jahrelang überhaupt nicht regnet; mancherorts sind Minusgrade die Regel, an anderen Stellen klettert das Thermometer auch einmal über 50 Grad Celsius. Zweimal im Jahr herrscht im Süden des Subkontinents der Monsun. Zugleich gibt es in Indien riesige Wüsten und die höchste Bergkette der Welt, den mächtigen Himalaja. Deshalb kennt man in unserem Land über 45.000 Pflanzenarten, von denen rund 20.000 für die Medizin nützlich sind. Von alters her werden Kräuter verwendet, um gesund zu bleiben und Krankheiten zu heilen. Fast alle heiligen Lehrschriften Indiens haben für diesen Zweck verschiedene Pflanzen erwähnt. Diese „Veden“ wurden zwischen 4500 und 1500 vor Christus niedergeschrieben.
Jedes Land der Welt hat seine eigene Tradition des Gebrauchs von Heilkräutern. So habe ich bei einem Besuch des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt ein Kräuterbüchlein aus dem Jahr 1557 mit schönen Farbabbildungen gesehen. Leider hat sich dieses Wissen jedoch in den wenigsten Ländern erhalten; was jetzt noch davon übriggeblieben ist, beschränkt sich meist auf die Behandlung von Symptomen.
Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass Ayurveda die Heilkräuter anders versteht als andere Traditionen. Um diesen Unterschied zu begreifen, muss man einige Grundzüge der ayurvedischen Medizin kennen. Nach ihrer Auffassung ist der Mensch ein Miniaturabbild der Natur. Die Bestandteile der Natur sind also auch im Menschen vorhanden und umgekehrt. Nach der ayurvedischen Lehre besteht alle Substanz im Weltall aus fünf Urelementen – aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Natürlich sind auch alle Heilkräuter aus diesen fünf Urelementen zusammengesetzt. Ihre vielfältigen Kombinationen erzeugen den Geschmack und verursachen die kühlende oder erhitzende Wirkung sowie spezielle Heileffekte. Ebenso wichtig ist es auch zu verstehen, welche der 20 Eigenschaften eine Heilpflanze besitzt. Aufgrund dieser Eigenschaften wirkt sie auf die drei biologischen Kräfte, die Gewebe, Abfallprodukte und Körperkanäle. Das Verständnis dieser Prinzipien ist die Voraussetzung dafür, dass die Wirkung einer Heilpflanze richtig eingeschätzt wird.
Ayurvedische Heilpflanzen haben vielfältige Effekte. Sie reichen von der Einstellung des doṣa-Gleichgewichts bis zur Immunmodulation; man findet antioxidative genauso wie antibakteriell wirksame Kräuter. Andere zerstören Giftstoffe im Körper, kurbeln die Verdauung an, sie korrigieren Stoffwechselstörungen oder stärken speziell ein Gewebe, Organ oder Kanalsystem. Um all diese wohltuenden Wirkungen hervorzurufen, empfiehlt die ayurvedische Medizin die Verwendung der gesamten Droge. Es entspricht nicht ihrem Prinzip, die aktiven Wirkstoffe zu isolieren. Die antiken pharmazeutischen Schriften des Ayurveda führen zwar einige Methoden auf, um wasserlösliche Substanzen zu gewinnen; dabei erwähnen sie aber auch, dass nicht nur die erwünschten, sondern auch die Nebenwirkungen zunehmen. Deshalb haben sie von diesen Methoden Abstand genommen.
Beide Autoren dieses Buches, Frau Andrea Zoller und Herr Dr. Hellmuth Nordwig, kenne ich schon seit längerer Zeit. Herr Nordwig hat mein Buch „Ayurveda – Wesen und Methodik“ ins Deutsche übersetzt; seit dieser Zeit haben wir engen Kontakt. Die beiden Autoren haben den schönen Text dieses Buches mit sehr viel Mühe erstellt. Es wird nicht nur für Laien, sondern auch für Ärzte nützlich sein.
Ich komme seit 1980 regelmäßig nach Deutschland und halte dort Vorträge bei Heilpraktikerschulen, Universitäten und privaten Institutionen. Ein erstes Ergebnis dieser häufigen Besuche war die Veröffentlichung des Buches „Fundamental Principles of Ayurveda“ im Jahr 1984. Da es jedoch in englischer Sprache herausgegeben wurde, blieb es weitgehend unbeachtet. Zu jener Zeit war Ayurveda auch noch nicht sehr populär. Die indische Medizin ist jedoch auf der ganzen Welt zunehmend gefragt, und Deutschland ist da keine Ausnahme. Im Jahr 1994, als die erwähnte Übersetzung erschien, gab es bereits fast 40 Ayurveda-Bücher auf dem Markt.
Die Wissenschaft des „Dravya-guṇa-vijñana“ ist ein spezieller Zweig des Ayurveda, der die Eigenschaften und Wirkungen verschiedener Substanzen beschreibt. Dazu gehört die Materia Medica und die Pharmakologie der ayurvedischen Medizin. Bis heute sind in Deutschland nur wenige Bücher über ayurvedische Heilpflanzen erhältlich. Das vorliegende Werk ist in vielerlei Hinsicht herausragend: Beide Autoren haben sich mit der Materie eingehend befasst und über 200 wichtige Heilpflanzen erläutert. Für jede Pflanze werden die Namen in Sanskrit, die Eigenschaften, der Geschmack und die Wirkung nach der Verdauung aufgeführt. Ferner wird dargestellt, ob sie erhitzend oder kühlend wirkt, bei welchen Indikationen und in welchen Darreichungsformen sie anzuwenden ist.
Die Besonderheit dieses Buches ist, dass die Autoren die Heilpflanzen in rund 100 Wirkungsgruppen eingeteilt haben. Es ist wohl das einzige Buch, das so viele Wirkungen detailliert beschreibt. Für den praktischen Gebrauch ist diese Darstellung von großem Nutzen. Besonders wertvoll ist dieses Buch auch deshalb, weil es das Werk des hochangese-henen indischen Gelehrten Prof. P. V. Sharma zur Grundlage hat.
Ich habe diesem Buch nur hier und da wenige Punkte hinzugefügt. Auch konnte ich den Autoren – die ja keine Ayurveda-Ärzte sind – einige besonders differenzierte Konzepte über die Wirkungen von Heilpflanzen bei bestimmten Krankheiten vermitteln. Ich hoffe, dass diese Beiträge den Wert des Buches noch steigern.
Seine Veröffentlichung fällt in eine Zeit, in der in Deutschland das Bedürfnis nach einem tieferen Verständnis der ayurvedischen Medizin wächst. Einrichtungen wie die Münchner „Seva-Akademie“ richten Ayurveda-Fortbildungskurse für Heilpraktiker und Ärzte aus. Es entsteht deshalb ein Bedarf an ausführlichen Darstellungen verschiedener Teilbereiche des Ayurveda: Die Menschen möchten die Physiologie, die Pathologie oder die Reinigungsmethoden des pañcakarma im Detail kennenlernen. Was die Wirkungen und den Gebrauch von Heilpflanzen angeht, so bin ich sicher, dass das vorliegende Buch den Wissensdurst der Leser stillen wird.
Schließlich bete ich zum Gott Dhanvantari, dass dieses Buch für all diejenigen wertvoll werden möge, die sich um ein Verständnis der alten Heilkunde Ayurveda bemühen.
Prof. Dr. Subhash Ranade
B. A. M. & Sc.; M. A. Sc.; Ph. D.
Mitglied der Fachgesellschaften
F. N. A. I. M.; F. I. S. C. A.; F. I. C. A.
Chairman der International
Academy of Ayurved
Rajbharati, 367 Sahakar Nagar 1,
Pune 411 009, Indien
http://www.ayurved-int.com
Vorwort der Autoren
von Andrea Zoller & Hellmuth Nordwig
Andrea Zoller
In der westlichen Welt ist das Gesundheitssystem an einem Wendepunkt angelangt. Viele Menschen sind nicht mehr bereit, die Verantwortung für ihre Gesundheit in die Hände eines anderen abzugeben. Sie wollen aktiv an ihrem Wohlbefinden mitwirken. Heilpflanzen spielen dabei eine zentrale Rolle. Es werden wieder Kräutergärten angelegt oder Wildpflanzen gesammelt. Apotheker verkaufen nicht nur Produkte der pharmazeutischen Industrie, sondern sind zugleich Ratgeber für Teezubereitungen und andere Naturheilpräparate.
Hellmuth Nordwig
Die Achtung vor den Pflanzen unserer Umgebung war ein Anstoß für uns, das Material für dieses Buch zusammenzustellen. Dass es nicht um hiesige, sonderen um indische Heilpflanzen geht, ist dennoch kein Zufall. Denn in Indien ist das Bewusstsein für die Kraft der Natur noch sehr viel gegenwärtiger als hierzulande. Wir haben beide die ayurvedische Medizin als ein Gesundheitssystem kennengelernt, dessen Ziel es ist, das individuelle Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu finden und zu erhalten. Nur dadurch entsteht auch das Gefühl innerer Sättigung und Zufriedenheit. So werden im Ayurveda auch Krankheiten geheilt, indem der Mensch seine inneren Selbstheilungskräfte freisetzt, um wieder in sein Gleichgewicht zu gelangen. Mit den Energien der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther können Heilpflanzen diesen Prozess unterstützen. Schön war auch wahrzunehmen, dass uns die intensive Beschäftigung mit diesem ganzheitlichen System eine neue Achtung vor unserer Umwelt vermittelt hat.
Wir, die beiden Autoren, sind mit dem Ayurveda auf unterschiedliche Weise in Kontakt gekommen. Andrea Zoller hat sich schon früh mit europäischen Heilpflanzen auseinandergesetzt. Diese Kenntnisse konnte sie bei einem mehrjährigen Indienaufenthalt durch die Beschäftigung mit dem Ayurveda erweitern. Wie es der Tradition des Landes entspricht, wurde ihr das Wissen mündlich weitergegeben; durch den Ayurveda-Arzt Dr. S. K. Saini. Die Basis war dabei das Buch „Dravyaguṇa“ von P. V. Sharma, einem der anerkanntesten Ayurveda-Professoren Indiens. Diese Essenz des vorliegenden Buches wurde ergänzt durch die Informationen anderer Ärzte, Heiler, Hebammen und die unschätzbaren Kenntnisse der Menschen Indiens. Für Hellmuth Nordwig war die langjährige Beschäftigung mit Yoga der Grund, sich – ebenfalls in Indien – mit Ayurveda zu befassen. Eines der Ergebnisse war die Übersetzung des Buches „Ayurveda – Wesen und Methodik“ von S. B. Ranade.
In enger Zusammenarbeit der beiden Autoren, in ungezählten Briefen und Telefongesprächen, ist aus dem zunächst handgeschriebenen Manuskript dieses Buch entstanden. Gegenseitige Achtung und der Sinn für Humor waren unerlässliche Voraussetzungen für das Gelingen dieses Buches.
Am Entstehen dieses Buches haben viele mitgewirkt, denen wir herzlich danken wollen: Dr. S. K. Saini, der das Wissen über den Ayurveda einer Europäerin zugänglich gemacht hat, Dr. Narvin Sharma für Hilfe bei Übersetzungen aus dem Sanskrit, Dr. Tripathi für die Möglichkeit, am Moolchand Hospital in New Delhi die ayurvedische Medizin praktisch kennenzulernen, und Dr. Claus Peter Zoller für die Umschrift und die Übersetzung der Fachausdrücke aus dem Sanskrit. Prof. S. B. Ranade, Universität Poona, hat letzte Fragen geklärt und die Abbildungen zur Verfügung gestellt. Schließlich danken wir noch Herrn Rolf Lenzen, der uns für das Projekt dieses Buches zusammengeführt, und es von Anfang an geduldig unterstützt hat.
Schriesheim und Pöcking, im Frühjahr 1996
Fast 15 Jahre sind seit dem Erscheinen des Buchs vergangen. Die 1. Auflage, im Haug Verlag Heidelberg erschienen, wird nicht nachgedruckt. Dennoch wurden wir durch viele am Ayurveda Interessierte ermutigt, das Wissen um die Heilpflanzen der indischen Medizin weiterhin zugänglich zu machen. So haben wir uns zu einer grundlegend überarbeiteten und erweiterten Neuauflage entschlossen. Wir danken dem Narayana Verlag in Kandern dafür, dass er sie in seine neue Buchreihe über Ayurveda aufgenommen hat. Gerne denken wir an die Gastfreundschaft am Verlagssitz im Südschwarzwald zurück.
15 Jahre – das ist nur ein Hauch in der langen Geschichte des Ayurveda. Doch die Technik hat sich in dieser Zeit spürbar weiterentwickelt. Textdateien, die Mitte der 1990er Jahre entstanden sind, in eine heute lesbare Form zu bringen, war keineswegs einfach. So mancher Sonntag, den ich lieber mit meiner Familie verbracht hätte, ist dieser Aufgabe zum Opfer gefallen.
Das Internet bietet heute jedoch auch Recherchemöglichkeiten, die damals undenkbar waren. Insbesondere konnten wir die lateinischen Bezeichnungen der Pflanzen auf den aktuellen Stand der botanischen Nomenklatur bringen. Viele Heilpflanzen sind nun unter einem anderen Namen zu finden als in der ersten Auflage; die früher gebräuchlichen sind als Synonyme aufgeführt. Ein Problem besteht nach wie vor: In den authentischen Quellen werden die Sanskrit-Namen der Pflanzen benutzt. Um welche botanische Art es sich dabei handelt, darüber streiten die Gelehrten aber nicht selten. So bezeichnet Rāsnā in Indien je nach Region und Ayurveda-Schule ein halbes Dutzend völlig unterschiedlicher Heilpflanzen, darunter einen Korbblütler, eine Orchideenart und ein Ingwergewächs. Wir haben uns im Zweifelsfall an der nordindischen Tradition orientiert.
Als wertvolle Ergänzung für Praktiker empfinden wir die „Erfahrungsberichte aus der westlichen Praxis“ von Dr. Christa Dandekar und Dr. Madhura Dixit aus Wasserburg am Bodensee (www.dandekar-dixit.de). Danke für die spontane Bereitschaft zur Mitarbeit. Wesentlich bereichert wurde das Buch durch einen völlig neu recherchierten Teil über die gängigen Zubereitungsformen und Komplexpräparate. Auch diese werden wie die Heilpflanzen in ihrer Wirkung aus ayurvedischer Sicht beschrieben. Nur gut dokumentierte Anwendungsbeispiele wurden aufgenommen; sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andrea Zoller hat weder Zeit noch Mühe gescheut und ist eigens nach Indien gereist, um auch diesen Wissensschatz für unsere Leser zugänglich zu machen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Dieses zusätzliche Kapitel konnte nur mit Hilfe vieler helfender Hände geschrieben werden. Mein erster Dank gilt meinen drei Kindern, dass sie mir so viel Arbeit im Haus und Garten abgenommen haben. Heike Seegebarth, die eine Tagesklinik am Bodensee, das Ayurveda-Haus an der alten Linde (www.traditionelles-ayurveda.de), leitet, sei für ihre fachliche Kompetenz ein ganz großer Dank ausgesprochen. Dr. Ashish Sharma und Dr. Richa Bhardwaj vom Ayurveda and Tibbia Hospital in New Delhi, Indien, sei Dank für die intensive Einführung und Hospitanz in die pañcakarma-Kur bei oft schwerstkranken Menschen. Dem ganzen Team der „nishtha“-Klinik für Ayurveda, Homöopathie, Akupunktur und Allopathie in Sidhbari in der Nähe von Dharamsala, Indien, geleitet von Frau Dr. Nath-Wiser, sei ein Dank ausgesprochen für die herzliche Aufnahme und vollste Unterstützung, besonders von Frau Dr. Kusum. Ebenso meinem Mitautor Hellmuth Nordwig, der viele andere Arbeiten für die Neuauflage übernommen hat. Ohne ihn wäre das Buch jetzt noch eine ganze Weile nicht auf dem Markt. Danke dafür. „Last but not least“ danke ich für das häufige Korrekturlesen, und nicht nur das, meinem Mann Claus Peter Zoller. Dankbarkeit dafür, dass es so geworden ist, wie es ist.
Sidhbari, Indien, im November 2010
Andrea Zoller
Fürstenfeldbruck, im Dezember 2010
Hellmuth Nordwig
Die Absicht dieses Buches
Zunächst einmal: Wir stellen uns nicht vor, dass Sie als Therapeut Ihre gesamten Behandlungsverfahren sofort auf ayurvedische Heilpflanzen umstellen. Dazu ist auch für einen indischen vaidya jahrelange Erfahrung erforderlich. Optimal wäre es natürlich, wenn Sie diese Erfahrung bei einem qualifizierten Therapeuten sammeln könnten. Wir möchten jedenfalls ausdrücklich davon abraten, die angegebenen Zubereitungen ohne Weiteres nachzuahmen und einem Patienten zu verabreichen. Obwohl es in der Regel heißt, „Nebenwirkungen: Keine bekannt“, werden doch gelegentlich unerwünschte Effekte beobachtet, vor allem allergische Reaktionen. Von einigen Pflanzen ist auch bekannt, dass sie giftig sind; wirkungslos ist keine von ihnen. Seien Sie also äußerst vorsichtig bei der Anwendung Ihnen unbekannter Präparate.
Wenn Sie sich jedoch einmal genauer mit den Eigenschaften auch nur der wichtigsten ayurvedischen Drogen beschäftigen, werden Sie merken, dass hier ein Schatz von äußerst wirksamen und (in aller Regel) gut verträglichen Pflanzen schlummert. Wir möchten Ärzte und Heilpraktiker dazu ermutigen, in geeigneten Fällen diese Kräfte der Natur behutsam für ihre Patienten zu nutzen.
Dabei stellt sich das Problem, wie Sie an die Pflanzen bzw. die Drogen herankommen. Sie werden finden, dass hierzulande die wenigsten verbreitet sind; nur manche davon sind im Handel erhältlich. Einige von ihnen könnten aber durchaus in Europa wachsen, jedenfalls im Sommer (z. B. Withania somnifera und andere Nachtschattengewächse). Legen Sie sich also am besten einen eigenen Busch- und Kräutergarten an, versuchen Sie, aus Indien die Samen zu erhalten, und experimentieren Sie selbst. Sorgen Sie aber auch dafür, dass die Pflanze in Ihrem Garten bleibt und sich nicht wildwachsend unkontrolliert ausbreitet.
Viele Ärzte und Heilpraktiker wenden in ihrer Behandlung hiesige Pflanzen an und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Damit ist die europäische Phytotherapie im Wesentlichen eine Erfahrungsheilkunde. Dass die wichtigsten Wirksubstanzen isoliert und beschrieben wurden, ändert nichts daran. Denn die Gabe von Einzelsubstanzen ist zwar häufig wirksamer, aber weniger verträglich als die von pflanzlichen Präparaten, die denselben Wirkstoff enthalten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Acetylsalicylsäure (z. B. Aspirin®, siehe Salix caprea).
Wir möchten gerade die erfahrenen Phytotherapeuten mit diesem Buch ermuntern, sich mit der ayurvedischen Medizin zu beschäftigen. Denn sie bietet die Möglichkeit, Pflanzen nicht allein aufgrund der Erfahrung einzusetzen, sondern systematisch, nämlich entsprechend ihren Eigenschaften, dem Geschmack und ihrer Wirkung. Diese Kategorien sind mit den Sinnen leicht zu erfassen, und es ist deshalb ohne Weiteres möglich, auch die hier verbreiteten Medizinalpflanzen in das ayurvedische System einzubeziehen. Wir verweisen hier einerseits auf erste Versuche in der Literatur (Heyn und Lad/Frawley), möchten aber vor allem dazu ermutigen, dass Sie Kamille und Augentrost, Frauenmantel und Lindenblüten auch einmal mit einer ayurvedischen Zunge schmecken. Zusammen mit dem ayurvedischen System der Konstitutionsanalyse, der Anamnese und der klinischen Untersuchung (wie es z. B. Ranade beschreibt) werden Sie in der Lage sein, der Natur Ihrer Patienten durch eine maßgeschneiderte phytotherapeutische Behandlung gerecht zu werden. Erwähnt sei auch, dass die Homöopathie ebenfalls eine Reihe von Pflanzen aus diesem Buch verwendet. Auch Homöopathen können daher von einem Studium dieser Pflanzen nur gewinnen.
Einführung in die ayurvedische Medizin
Ayurveda ist eines der ältesten wissenschaftlichen Medizinsysteme der Welt. Seine Grundlagen werden bereits in den indischen Veden beschrieben, in Schriften also, die als unmittelbare göttliche Überlieferung gelten. Um die Zeitenwende entstehen zwei ausführliche Standardwerke zur ayurvedischen Medizin in Sanskrit: „Caraka Saṃhitā“ und „Suśruta Saṃhitā“. Ihre Kenntnis ist noch heute unverzichtbare Grundlage für jeden Ayurveda-Arzt, vaidya.
Wörtlich bedeutet Ayurveda das Wissen, veda, vom Leben, āyus. Damit wird bereits deutlich, dass Ayurveda eigentlich keine „Medizin“ ist, sondern sich in einem umfassenden Ansatz vor allem damit befasst, wie der Mensch gesund bleibt. Auch ist Ayurveda keine „Erfahrungsheilkunde“, sondern hat sich von Anfang an als Wissenschaft verstanden. Die wichtigsten Unterschiede zur westlichen Medizin sind:
Ayurveda hat seinen Schwerpunkt bei der Prävention von Krankheiten, insbesondere durch Regeln für ein gesundes Leben, die einfach zu befolgen sind.
Neben diesen allgemeinen Regeln gibt es auch individuelle Empfehlungen, die sich nach der Natur des Einzelnen richten, denn was dem Einen guttut, kann für einen Anderen schädlich sein.
Sollte dennoch eine Behandlung erforderlich werden, so richtet sich diese nicht allein nach dem Krankheitsbild, sondern wird individuell, entsprechend der Konstitution des Patienten gestaltet.
Die Therapie zielt darauf ab, diese Grundkonstitution zu stabilisieren, die Verdauung zu stärken und Gifte zu eliminieren – damit aktiviert sie die Selbstheilungskräfte des Körpers.
Die Behandlung arbeitet mit physikalischen Methoden (Massagen, Wärme, Bäder), mit pflanz- lichen und gereinigten mineralischen Präparaten und bezieht auch Meditation, Gebet, Yoga und Atemarbeit ein.
Eine ayurvedische Behandlung ist daher in der Regel nicht angezeigt für Notfälle und lebensbedrohliche Krankheitszustände, für viele Infektionskrankheiten sowie für aggressive Krankheiten wie Krebs oder AIDS. Jedoch kann Ayurveda durch die Stabilisierung der Grundkonstitution hier eine allopathische Behandlung unterstützen.
Sie ist dagegen bei vielen chronischen und degenerativen Erkrankungen anderen Behandlungsverfahren ebenbürtig oder eine wertvolle Ergänzung zu diesen, insbesondere auch bei einigen „Volkskrankheiten“ des Westens wie Herz-Kreislauf-Störungen, Rheumatismus (auch bei primär chronischer Polyarthritis), Gicht, Bronchialasthma, Verdauungsstörungen, Verstopfung, Allergien, Hautkrankheiten, Altersdiabetes, Unfruchtbarkeit, Depressionen sowie in der Schmerztherapie.
Sie ist für jedermann zugänglich und erschwinglich (wenigstens ist das die Idee in Indien).
In Indien, Nepal und Sri Lanka sind die westliche Medizin, die Homöopathie und Ayurveda als Heilsysteme gleichberechtigt. Ein Teil der Bevölkerung sucht dort im Krankheitsfall einen Ayurveda-Arzt, vaidya, auf, und dieser arbeitet sowohl präventiv als auch therapeutisch. Seinen Beruf darf er erst nach einem Universitätsstudium von sechs Jahren ausüben.
Auch in den westlichen Ländern hat Ayurveda seinen festen Platz gefunden. Hierzulande werden vorwiegend präventive Maßnahmen angeboten, wie pañcakarma-Kuren sowie Massagen und Wellness orientierte Erholungskuren. Eine Behandlung ist (anders als in Indien) keineswegs für jedermann finanzierbar, und die Therapeuten sind in der Regel nicht so qualifiziert wie die indischen vaidyas. In den letzten Jahren versuchen jedoch zahlreiche engagierte Institute, diese Lücke durch Ausbildungsangebote zu schließen.
Die fünf Elemente, mahābhūtas
Die Grundlage für das Verständnis der Heilpflanzen und ihrer Präparate ist die Lehre von den fünf „großen“ Elementen. Nach ihr ist die gesamte reale Welt – auch nichtmaterielle Dinge wie Gedanken – aus Erde, Wasser, Feuer (oder Licht), Luft und Raum (oder Äther) zusammengesetzt. Jedes dieser Elemente steht für einen Materiezustand zwischen absolut kompakter Festigkeit (Erde) und völlig beweglicher Feinstofflichkeit (Raum). Wer beispielsweise eine „feurige“ Pflanze isst, vermehrt damit auch das Element Feuer in seinem Körper und Geist. Im Körper manifestieren sich diese fünf Elemente in den „biologischen Faktoren“ (im Folgenden mit dem Sanskritbegriff als doṣa bezeichnet), den Geweben, dhaṭu, und den Abfallprodukten, mala.
Die drei „Verderber“, doṣas
Doṣa bedeutet wörtlich „Verderber“ oder „das, was krank macht“. Es handelt sich also um sehr wirksame Faktoren, welche die Prinzipien der Bewegung, vāta, der Umwandlung, pitta, und der Stabilität und des Zusammenhalts, kapha, symbolisieren. Jeder Mensch hat sein individuelles Verhältnis von vāta, pitta und kapha, das während des gesamten Lebens unveränderlich bleibt, sofern er gesund ist. Dieses Verhältnis heißt die „Konstitution“, prakṛti, und jede Form der Behandlung richtet sich nach ihm. Im Westen sind die meisten Menschen pitta-Charaktere, gefolgt von den pitta-vāta- und pitta-kapha-Mischtypen.
Die sieben Gewebe, dhaṭus
Die Gewebe, dhaṭus, werden im Ayurveda nach einem anderen System eingeteilt als in unserer Anatomie üblich. Das kommt daher, dass man sich ihre Entstehung anders erklärt als hierzulande. Die brauchbaren Teile der Nahrung werden zunächst umgewandelt in das Plasmagewebe, rasa, eine Flüssigkeit, die den gesamten Körper nährt und in der er „suspendiert“ ist. Ein Teil des Plasmas wird zu Blut umgewandelt, wiederum ein Teil des Blutes in Muskeln. Weiter geht es mit der Entstehung von Fett, Knochen, Knochenmark/Nervensystem und dem Fortpflanzungsgewebe. Jedes Gewebe geht aus dem zuvor genannten hervor; bei jeder Umwandlung wird Substanz und Lebensenergie konzentriert, so dass das Fortpflanzungsgewebe das gehaltvoll-ste und wertvollste Gewebe ist.
Die Essenz des Fortpflanzungsgewebes ist feinstofflich und wird ojas genannt. Ojas ist für uns am ehesten durch den Begriff „Ausstrahlung“ wiederzugeben. Sie zeigt sich also z. B. an der Beschaffenheit der Haut, am Blick, der Stimme und an der Wirkung auf andere. Diese konzentrierte Form der Lebensenergie bewirkt auch eine leistungsfähige Körperabwehr. Ein starkes ojas zeigt sich also daran, dass der Mensch gesund ist – körperlich, aber auch frei von beeinträchtigenden Bedürfnissen und Konflikten.
Das Verdauungsfeuer agni, die Abfallprodukte, mala, und das „Unverdaute“, āma
Die treibende Kraft all dieser Umwandlungen nennt die ayurvedische Medizin agni oder Verdauungsfeuer. Wesentlich ist das zentrale Verdauungsfeuer, jāṭharāgni, das im Magen-Darm-Trakt die Trennung der Nahrung in brauchbare Bestandteile und grobstoffliche Abfallprodukte, mala, bewirkt. Die malas – Stuhl, Urin und Schweiß – werden vom Körper ausgeschieden. Die Umwandlung der Gewebe ineinander wird jeweils von einem eigenen Gewebefeuer, dhātvāgni, bewerkstelligt. Dabei entstehen außer den Geweben feinstoffliche Abfallprodukte, kleda, die ebenfalls ausgeschieden werden, z. B. als „Augenbutter“ oder Smegma.
Arbeiten die Verdauungsfeuer „auf Sparflamme“, beispielsweise wenn jemand schwer Verdauliches isst, sich zu wenig bewegt oder Gifte aufnimmt, dann sammelt sich im Körper Unverdautes an. Dieses Unverdaute heißt im Ayurveda āma und gilt als eine der wichtigsten Krankheitsursachen: Āma ist extrem giftig (wird deshalb häufig auch als „Giftstoffe“ oder „Toxine“ übersetzt) und kann Körperkanäle verstopfen. Diese Kanäle, śrotas, versorgen den Körper mit Atem, fester Nahrung und Wasser; zudem hat jedes Gewebe und jedes Abfallprodukt seine eigenen Körperkanäle. Ein wesentliches Ziel der ayurvedischen Therapie ist es, zunächst die Verdauung, agni, zu stärken, damit āma abzubauen und die Körperkanäle wieder durchgängig zu machen.
Gesundheit und Krankheit
Nach der ayurvedischen Medizin ist ein Mensch gesund, solange alle Verdauungsfeuer gut arbeiten, also kein āma vorhanden ist, solange die Abfallprodukte ausgeschieden werden und solange seine doṣas in dem ihm gemäßen Verhältnis bleiben.
Jedes doṣa kann jedoch durch eine Reihe von Einflüssen vermehrt werden. Um nur die wichtigsten zu nennen (zu den Details sei auf die Fachliteratur verwiesen):
Vāta ist trocken und kalt und wird deshalb vermehrt durch trockenes Essen (Getreide, Toast, Müsli), bittere und herbe Speisen, durch einen sehr unruhigen Lebensstil (z. B. viele Termine und viele Reisen), Emotionen wie Angst und Unsicherheit sowie Kälte und Trockenheit;
Pitta ist durchdringend und heiß und nimmt zu durch saures und scharfes Essen, Alkohol und Nikotin, Überarbeitung und Nachtarbeit, den Umgang mit Lösemitteln und anderen Chemikalien, aggressives, jähzorniges Verhalten sowie durch Hitze;
Kapha schließlich ist feucht, schwer und kalt und steigt an durch kaltes, fettreiches und schwer verdauliches Essen, Süßigkeiten, zu viel Schlaf, Trägheit, Habgier und Anhänglichkeit sowie in kalten, feuchten Klimazonen. Der Lebensstil im Westen bringt es mit sich, dass vor allem vāta zunimmt, aber auch pitta. Die Grundkonstitution ist also häufig durch vāta und/oder pitta überlagert.
Wenn ein doṣa verstärkt wird, wirkt es in aggressiver Weise auf den Körper ein. Es „sucht sich“ dann diejenigen Gewebe, dhaṭus, oder Körperkanäle, śrotas, die am schwächsten ausgebildet und damit am anfälligsten sind. Ein weiterer Schwerpunkt der ayurvedischen Therapie ist daher die Stärkung der verschiedenen Körpergewebe, ein anderer die Zähmung des doṣa, das außer Kontrolle geraten ist. Um diese Effekte zu erreichen, werden die Pflanzen entsprechend ihrer Energetik eingesetzt. Diese bestimmt sich durch ihre Eigenschaften, guṇa, den Geschmack, rasa, den Geschmack nach der Verdauung, vipāka, sowie die kühlende bzw. erhitzende Wirkung, vīrya.
Die Energetik von Heilpflanzen
Die Eigenschaften, „guṇas“
Die Eigenschaften oder Qualitäten, guṇas, sind wiederum Grundbegriffe, mit denen alle Materie beschrieben wird. Die ayurvedische Medizin kennt 20 solcher Eigenschaften, die zehn Gegensatzpaare bilden. Die acht wichtigsten Eigenschaften, die im Allgemeinen zur Beschreibung hinreichen, sind:
schwer/leicht,
kalt/heiß,
ölig (zähflüssig)/trocken,
träge (stumpf)/spitz (scharf).
Daneben gibt es die Eigenschaften:
stabil/beweglich (fließend),
hart/weich,
schleimig/klar,
klebrig (sanft)/rau,
dicht (grobstofflich)/fein(stofflich),
dickflüssig (dicht)/wässrig (flüssig).
(Die aus verschiedenen Quellen stammenden Übersetzungen zeigen, dass diese Eigenschaften im Deutschen nicht immer mit einem einzigen Adjektiv beschrieben werden können.)
Die erstgenannten Eigenschaften sind jeweils aufbauend, beruhigend und nährend, die entgegengesetzten guṇas bauen Körpergewebe ab und aktivieren. Allgemein wird kapha eher durch die erste Eigenschaftsgruppe vermehrt, pitta und vāta durch die zweite. Einige Eigenschaften sind auch für spezielle therapeutische Effekte verantwortlich. So sind „spitze“ Pflanzen (z. B. Commiphora wightii) in der Lage, durch kapha oder Giftstoffe verstopfte Körperkanäle wieder durchlässig zu machen. „Feine“ Substanzen, z.B. Kampfer (Cinnamomum camphora), verteilen sich rasch im Körper und wirken entsprechend schnell. „Raue“ Pflanzen, z.B. Rotheca serrata, können kapha in den Atemwegen lockern und Abszesse aufbrechen. „Schleimige“ Drogen wie z. B. Cordia dichotoma wirken schleimbildend und deshalb einhüllend und lindernd in jeder Hinsicht, sei es auf Hustenreiz, Reizmagen und -darm oder auf trockene Hautkrankheiten. Pflanzen mit der Eigenschaft „klar“, z.B. Sapindus trifoliatus, wirken reinigend – sie sind emetisch und/oder purgativ, hauttherapeutisch, blutreinigend und entgiftend.
Der Geschmack, „rasa“
Für die sinnliche Wahrnehmung der Pflanzen ist ihr Geschmack, rasa, entscheidend. Ayurveda kennt dabei die Kategorien süß, salzig, scharf, sauer, herb und bitter. Für die ersten vier Geschmacksrichtungen hat die Physiologie auch eigens spezialisierte Wahrnehmungszellen auf der Zunge gefunden. Dass jedoch auch die beiden anderen zum menschlichen Erfahrungsbereich gehören, zeigen Redewendungen wie „Sie ist eine herbe Schönheit.“ oder „Das war eine bittere Erfahrung.“ Zugleich wird damit deutlich, dass die Empfindungen und körperlichen Reaktionen, die mit einem Geschmack einhergehen, nicht nur von Nahrungsmitteln hervorgerufen werden können. Wir alle kennen Situationen, in denen wir „scharf reagieren“, „sauer werden“, jemandem anderen „die Suppe versalzen“ und eine andere Person „süß finden“.
Die ayurvedische Medizin hat diese Wirkungen in ihrer Sprache beschrieben. Aus welchen Elementen ein Geschmack, rasa, besteht, welche Eigenschaften, guṇas, er aufweist, und wie er auf die doṣas wirkt, ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst (modifiziert nach Ranade):
Daraus ergibt sich auch, dass der süße Geschmack am ehesten stärkt und Körpergewebe aufbaut und der bittere auf die Dauer den Körper schwächt und Gewebe abbaut.
Der Geschmack nach der Verdauung, „vipāka“
Das Stoffwechselprodukt, das nach der Verdauung eines Nahrungsmittels entsteht, kann anders schmecken als die Ausgangssubstanz. Dieser „Geschmack nach der Verdauung“, vipāka, ist sub tiler als der eigentliche Geschmack und kann daher nicht unmittelbar wahrgenommen werden. Er beschreibt, wie die Nahrung im Inneren des Körpers „schmeckt“, bei Heilpflanzen vor allem in den Geweben und Organen, in denen sie wirken. Es gibt drei solcher vipākas:
süß (kapha vermehrend),
sauer (pitta vermehrend) und
scharf (vāta vermehrend).
Vielfach ist der vipāka dann süß, wenn die Pflanze bereits im Mund süß schmeckt; die meisten bitteren, scharfen und herben Pflanzen haben einen scharfen vipāka. Es gibt aber auch Ausnahmen, gerade bei Heilpflanzen mit einem breiten Indikationsspektrum. So ist der vipāka von guḍūcī (Tinospora cordifolia) süß, obwohl die Pflanze bitter und herb schmeckt; der lange Pfeffer (Piper longum) schmeckt scharf und hat ebenfalls einen süßen vipāka, ebenso wie die herb schmeckende Terminalia bellirica. Der saure vipāka ist bei Heilpflanzen und Nahrungsmitteln sehr selten, denn pitta ist ja während der Verdauung am wirksamsten und soll nicht anschließend noch weiter gesteigert werden. In diesem Buch hat allein die Zitrone (Citrus limon) einen sauren vipāka.
Die Wirkung auf den Körper, „vīrya“
Schließlich ist für die Auswahl einer Heilpflanze sehr wesentlich, ob sie den Körper erhitzt oder kühlt. Diese Wirkung wird vīrya genannt. Erhitzende Pflanzen aktivieren den Körper, fördern die Verdauung, vermehren pitta, wirken schweißtreibend und beruhigen vāta und kapha. Kühlende Pflanzen wirken nährend, anregend (vermehren vāta), sie befeuchten und schmieren den Körper (vermehren kapha) und beruhigen pitta. Erhitzende Pflanzen haben häufig einen scharfen vipāka und sind leicht, trocken und/oder spitz. Pflanzen mit einem süßen vipāka, die schwer, ölig und/oder träge sind, wirken im Allgemeinen kühlend. Doch gibt es auch hier Ausnahmen, und wiederum kennzeichnen sie besonders wertvolle Heilpflanzen: Der aśoka-Baum (Saraca asoca) – eingesetzt vor allem gegen Blutungen außerhalb der Menstruation – ist leicht und trocken, schmeckt bitter und herb, sein vipāka ist scharf und die Wirkung dennoch kühlend. Das Gleiche gilt für den nim-Baum (Azadirachta indica). Aśvagandhā (Withania somnifera), eine „verjüngend“ wirkende Nachtschattenpflanze, ist leicht und ölig, schmeckt scharf, bitter und süß, der vipāka ist süß, und die Wirkung insgesamt erhitzend. Die bereits erwähnte guḍūcī (Tinospora cordifolia) hat ebenfalls einen süßen vipāka, wirkt aber erhitzend.
Außergewöhnliche Wirkungen, „prabhāva“
Der Begriff prabhāva steht für Wirkungen einer Pflanze, die außergewöhnlich und stark ausgeprägt sind und sich nicht aus ihren Eigenschaften oder dem Geschmack erklären lassen. Ein Beispiel ist die entgiftende Wirkung von śirīṣa (Albizia lebbeck).
Nervensystem
Einleitung
Nach der ayurvedischen Medizin bedarf jede Handlung des Menschen des vollen Zusammenwirkens zwischen dem Herzen und dem Gehirn. Sie sagt deshalb, dass der Geist seinen Sitz im Herzen hat, während sein Wirkungsort das Gehirn ist. Die beiden Organe sind durch ein eigenes System von Körperkanälen miteinander verbunden („sajya vaha śrotas“). Störungen des Nervensystems betreffen diese Kanäle und damit das Zusammenspiel von Wünschen und Handlungen. Die ayurvedische Medizin unterscheidet deshalb auch nicht zwischen psychischen und somatischen Störungen. Alle Nervenkrankheiten sind also nach unserem Sprachgebrauch grundsätzlich psychosomatisch.
Solche Störungen werden durch zwei geistige Prinzipien, guṇas, verursacht: durch rajas (Prinzip der Veränderung) und tamas (Prinzip der Trägheit). Folgende zwölf Grundkrankheiten haben mit rajas und tamas zu tun: Unersättlichkeit, Zorn, Gier, Wahnzustände, Eifersucht, Stolz, Neurosen, Depressionen, Kummer, Furcht, Angst und Euphorie. Diese Zustände manifestieren sich u. a. in mangelndem Selbstbewusstsein, Geisteskrankheiten und Persönlichkeitsstörungen.
Wenn außer den guṇas auch die doṣas beteiligt sind, werden außerdem beobachtet: Psychosen, Epilepsie, Hysterie, Zwangsvorstellungen, Schwindel, Ohnmacht, Schläfrigkeit, Nervenschwäche, Neurosen, Koma, Phobien, Alkoholismus und Hypochondrie. Hierher gehören auch die Störungen, die als psychosomatisch bezeichnet werden wie chronische Durchfälle, Rheuma, Arthritis (vāta-Störungen), chronisches Fieber ohne zugrunde liegende Infektion (pitta) und Bronchialasthma (kapha). Je nach dem gestörten doṣa richtet sich auch die Behandlung (siehe „Allgemeine Wirkungen“).
Hirntonika „medhya“
Solche Drogen verstärken die geistigen Kräfte des Menschen, also Verstand (Intelligenz), Auffassungsgabe, Ausdrucksfähigkeit, Gedächtnis und Bewertungsvermögen. Entscheidend für alle wichtigen Aufgaben des Gehirns ist vāta: prāna vāta für die Aufnahme des Wissens und udāna vāta für seine Wiedergabe. Ferner trennt vāta das unbrauchbare vom brauchbaren Wissen und ordnet dieses dem Kurz- oder dem Langzeitgedächtnis zu. Es ist auch für das Kurzzeitgedächtnis selbst zuständig. Kapha hat ebenfalls Eigenschaften, die dem Gehirn selbst ähnlich sind: Festigkeit und Kompaktheit. Tarpaka kapha hat die Aufgabe, Gehirn und Wirbelsäule zu nähren, zu schmieren und zu schützen. Das Langzeitgedächtnis hat unmittelbar mit dem kapha-Prinzip des Zusammenhalts zu tun. Einige Hirntonika sind deshalb kühlend und vermehren damit vāta und kapha. Zugleich wirken sie als Sedativa:
Die meisten Hirntonika wirken zugleich tonisch für das gesamte Nervensystem. Ein Tonikum speziell für das Rückenmark ist
Für den intelligenten Umgang mit dem Wissen, vor allem für das Verstehen, die Anwendung und für Kreativität, ist sadhaka pitta verantwortlich. Deshalb sind einige der Hirntonika erhitzend und vermehren daher pitta:
Narkotika „madakāri“
Diese Drogen stören das Wahrnehmungsvermögen, das Verstehen und das Gleichgewicht des Gehirns. In geringen Dosen rufen sie geistiges und körperliches Wohlbefinden hervor: Die Wahrnehmung wird überdeutlich, die Gefühle „high“, der Verstand schärfer, die Vorstellungskraft lebhafter und der Bewegungsdrang ausgeprägter. Bei größeren Mengen wird vāta doṣa zunehmend gestört bis hin zum Delirium oder zum Tod. Der langfristige Effekt ist also eine Hemmung der Hirnfunktion. Umstritten ist, ob die Nervenzellen zunächst wirklich stimuliert werden, oder ob die anfängliche Stimulation bereits das Ergebnis einer Hemmung von Kontrollbereichen ist. Die Wirkung hängt auch von der Umgebung und von der inneren Einstellung ab.
Narkotika sind hauptsächlich aus den Elementen Luft und Feuer zusammengesetzt und haben daher die Eigenschaften leicht, trocken, spitz, klar und fein, schmecken scharf und/oder bitter und wirken erhitzend. Sie wirken damit nicht aufbauend, mindern ojas und damit letztlich auch die geistigen Fähigkeiten. Beispiele sind Alkohol und folgende Pflanzen:
Antinarkotika/Anregende Drogen „saṁjñāsthāpana“
Sie holen ohnmächtige Patienten ins Bewusstsein zurück. Ohnmacht kann nach der ayurvedischen Medizin zwei Ursachen haben:
- eine zu geringe Durchblutung des Gehirns (pitta zu schwach, das Gehirn ist dann durch tamas „verdunkelt“);
- der Ausfall bestimmter Hirnzentren durch „Überhitzung“ (zu viel pitta).
Dementsprechend ist eine Gruppe der Drogen scharf und erhitzend; sie vermehren pitta und verringern tamas. Diese Pflanzen wirken erhitzend, haben die Eigenschaft leicht und spitz und stimulieren deshalb den Kreislauf. Sie werden z. B. gegen Ohnmacht, Koma (auch diabetisches) und Schläfrigkeit eingesetzt. Nardostachys jatamansi dagegen wirkt kühlend, verringert pitta und rajas. Diese Pflanze wird dann eingesetzt, wenn übermäßige Hitze die Ursache einer Ohnmacht ist, also bei Hitzschlag, Unterzucker, zu hohem Kalziumspiegel, hepatischem Koma und fiebrigen Infektionen (Meningitis, Enzephalitis).
Hypnotika „nidrājanana“
Sie versetzen den Patienten in Schlaf, der sich dann einstellt, wenn vāta gering ist und die psychologische Qualität tamas überwiegt. Hypnotika verringern also vāta wie z. B.
Wachhaltende Drogen und Stimulantien „nidrāśamana“
Sie verringern tamas und vermehren sattva und wirken deshalb schlafhemmend. Diese Pflanzen verringern zwar ebenfalls vāta, dennoch wirken sie wegen ihres scharfen Geschmacks und/oder vipāka ganz allgemein stimulierend. Dazu gehören neben Fasten und Aderlass als therapeutischen Maßnahmen auch folgende Pflanzen:
Analgetika „vedanāsthāpana“
Analgetika sind schmerzlindernde Drogen. Das Wort „vedana“ bedeutet „Gefühl“ und bezeichnet sowohl Glück und Wohlbefinden als auch Trauer und Schmerz. Für das Schmerzempfinden ist in der ayurvedischen Medizin vāta verantwortlich, und erhöhtes vāta ist ein Symptom bei Schmerzen. Reine vāta-Schmerzen sind die bei Migräne, Steinleiden, Osteoarthritis und Neuralgien. Neben vāta ist pitta die Ursache von Schmerzen, wenn diese von Entzündungen hervorgerufen werden, also bei Gicht, Infektionen, em Fieber, Entzündungen innerer Organe, viralen Infektionen, Nervenentzündungen und Angina pectoris.
Analgetika sind daher erhitzende Pflanzen, die vāta allein oder vāta und pitta verringern. Sie können entweder ölig (und damit zugleich einschläfernd) oder trocken sein, was die Gefahr von Krämpfen birgt.
Der Mechanismus der Schmerzlinderung ist unterschiedlich; in der Regel wirken sie direkt aufs Zentralnervensystem (Schmerzverarbeitung im Gehirn). Viele von ihnen können auch lokal angewandt werden. Beispiele sind:
Krampferzeugende Drogen „ākṣepajanana“
Sie wirken auf das Rückenmark und stören dort die Koordination der Bewegungen. Ein Beispiel ist:
Es enthält zwei wichtige Alkaloide:
- Strychnin, es ist „spitz“, vermehrt vāta und kann daher zur Behandlung von Lähmungen usw. eingesetzt werden, bei denen vāta zu gering vorhanden ist;
- Brucin, es ist in größerer Menge vorhanden, wirkt analgetisch und verringert vāta. Es wirkt in geringer Dosis gut, in höherer Dosis kann es zu schweren Krämpfen bis hin zum Tod führen. Gegenmittel sind Kuhmilch, Butterschmalz, ghee und Eier.
Strychnos nux-vomica L.
Krampflösende Drogen „ākṣepaśamana“
Ihre Wirkung beruht auf der Verringerung von vāta im Rückenmark und im Gehirn; sie sind damit wirksam gegen alle Arten von Krämpfen, auch gegen epileptische Anfälle. Beispiele sind:
Paeonia officinalis L.
Sinnesorgane
Einleitung
„Die Sinne sind die Verbindung zur Außenwelt, und unsere Beziehung zu ihr kann daran gemessen werden, wie wir sie gebrauchen. Wir dürfen nicht allein der Umwelt die Schuld an Krankheiten geben, sondern müssen auch beobachten, wie wir uns ihr mit unseren Sinnen öffnen.“ (S. B. Ranade)
Wenn einer unserer Sinne ein Objekt wahrnimmt, so findet nach dem ayurvedischen Verständnis eine Umwandlung statt: Aus der feinstofflichen Energie des Objekts wird eine Wahrnehmung. Für diese Umwandlung ist alocaka pitta verantwortlich. Es wirkt abbauend wie jede Art von pitta; ein Übermaß an pitta ist damit schädlich für die Funktion aller Sinnesorgane. Die Sinnesorgane werden von kapha, dem aufbauenden Prinzip, gestärkt; zu viel kapha ist aber ebenfalls schädlich, da es die Wirkung des alocaka pitta behindert. Für ein richtiges Arbeiten der Sinnesorgane ist also vor allem ein ausgewogenes Verhältnis von pitta und kapha entscheidend.
Augentonika „cakṣuṣya“
Auch der Gesichtssinn kann durch pitta- und kapha-Störungen beeinträchtigt sein. Zu viel pitta führt zu brennenden, trockenen oder entzündeten Augen mit Konjunktivitis. In diesem Fall sind pitta verringernde, meist kühlende Pflanzen angebracht, z.B. Rosenwasser oder:
Ein Übermaß an kapha führt nicht nur zu verklebten und geschwollenen Augen (auch durch Infektionen bedingt), sondern auch zum grauen Star, nach ayurvedischem Verständnis eine Ablagerung von kapha in der Augenlinse. Vorbeugend ist in Indien die regelmäßige Augenpflege mit Kollyrium verbreitet, einer Paste aus Berberis aristata, Süßholz und triphalā cūrṇa mit Honig. Auch gibt es „Kajal-Stifte“ mit Ruß als Hauptbestandteil, der aus der Flamme einer Butterlampe abgeschieden wird. Heilpflanzen für kapha-Störungen der Augen sind folgende, meist scharf schmeckende „leichte“ und „spitze“ Drogen mit abbauender Wirkung:
Pupillen erweiternde/verengende Drogen
Ferner gibt es für den Augenarzt noch spezielle Drogen, welche die Pupillen erweitern bzw. zusammenziehen, wobei vāta beeinflusst wird. Man verwendet sie entweder zur Untersuchung der Augen oder zur Steuerung des Augeninnendrucks.
Pupillen erweiternd wirken:
Pupillen verengend wirkt:
Ohrentonika „karṇa“
Unter diesem Oberbegriff werden Heilpflanzen mit folgenden Wirkungen zusammengefasst:
Ohrenschmalz erweichende
Ablagerungen entfernende
gegen Ohrensausen/Tinnitus (eine vāta-Erkrankung)
gegen Schwerhörigkeit
gegen Ohrenentzündungen und Ohrenschmerzen
Nasentonika/„nasya“-medikamente „śirovirecana“
Diese Heilpflanzen stärken den Geruchssinn, indem sie kapha aus dem Kopf und Nackenbereich über die Nasenöffnungen entfernen. Sie sind also bei allen Krankheiten anzuwenden, bei denen kapha im Kopf vermehrt ist und bei denen zugleich die Sinne beeinträchtigt sind, wie bei Erkältung mit starkem Schnupfen, Stirn- und Nebenhöhlenentzündung, Stimmverlust und Schwere im Kopf. Gemeinsam ist ihnen fast allen eine erhitzende und damit kapha verringernde Wirkung; die Eigenschaften leicht und spitz sind häufig vertreten. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr differenziert und bei den einzelnen Pflanzen nachzulesen.
Haut und Haare
Auch die Haut gehört zu den Sinnesorganen; sie beherbergt den Tastsinn. Nach der ayurvedischen Medizin nimmt sie das Element Luft wahr. Zugleich hängt sie mit dem Gewebetyp (dhaṭu) der Muskeln zusammen, denn sie ist deren „sekundäres Gewebe“ (upadhātu) und zeigt die Tauglichkeit der Muskeln an. Zum Muskelgewebe gehören die „māṁsavaha śrotas“, deren Störungen (hauptsächlich Verstopfung durch kapha) auf der Haut sichtbar sind.
Schweißtreibende Drogen „svedajanana“
Schweiß ist im Ayurveda eines der Abfallprodukte (mala); es wird dem Fettgewebe zugeordnet. Mit ihm sondert der Körper Wasser, Salze, Stickstoffverbindungen und Fettsäuren ab. Nach der Lehre der fünf Elemente bestehen diese aus Wasser und Feuer; deshalb sind Drogen, die diese beiden Elemente enthalten, schweißtreibend. Dabei wird die Schweißproduktion selbst von „wässrigen“ Pflanzen angefacht, während die „feurigen“ zum Öffnen der Poren beitragen. Insgesamt sind schweißtreibende Pflanzen erhitzend; sie haben die Eigenschaften spitz und fein. Die anderen Eigenschaften können variieren; so gibt es ölige und raue, feste und bewegliche, „dickflüssige“ und „wässrige“ schweißtreibende Drogen.
Das Wort „sveda“ bezeichnet im Ayurveda sowohl den Schweiß als auch die Hitzeempfindung auf der Haut, die durch erhitzende Umschläge hervorgerufen wird. Diese Therapieform wird angewandt, um Schwere, Kühle und Steifigkeit im Körper zu bekämpfen. Innerlich werden schweißtreibende Drogen zur Bekämpfung von vāta- und kapha-Überschüssen für folgende Anwendungen gegeben:
- zur Bekämpfung von Fieber,
- gegen kapha- und vāta-Krankheiten im Kopf, Nacken und den Atemwegen (Schluckauf, Lähmungen, Neuralgien, Verspannungen, Gelenkschmerzen, Verschleimungen von Nase, Nebenhöhlen, Stirnhöhle, Rachen, Bronchien),
- gegen Ödeme (kapha-Ansammlungen unter der Haut oder im Bauchraum),
- bei Nierenunterfunktion (sie führt zur Ansammlung von kapha im Harntrakt),
- zur Förderung der Durchblutung sowie des Reifens und Abheilens schon länger bestehender entzündlicher Hauterkrankungen wie Abszessen, Ekzemen usw.
Schweisstreibende Drogen sind:
Schweißhemmende Drogen „svedāpanayana“
Sie gehören zur größeren Gruppe der „zusammenziehenden“ (stambhana) Pflanzen. Sie enthalten das Element Luft, das den Schweiß trocknet. Sie hemmen allgemein die übermäßige Sekretion der Körperflüssigkeiten. Zu dieser Gruppe gehören:
Haarwuchsfördernde Drogen „romasaṁjanana“
Vorzeitiger Haarausfall kann durch Störungen aller drei doṣas sowie durch Blutunreinheiten bedingt sein: Kapha verstopft die Haarfollikel und vāta sowie pitta führen zur Ablösung des Haares. Die folgenden Präparate mit erhitzender Wirkung werden z. B. bei einer Glatze angewandt:
„Haartherapeutische“ Drogen „keśavardhana“
Sie nähren das Haar und verhindern so, dass es brüchig und matt wird oder ausfällt. Dabei werden die folgenden pitta senkenden Drogen eingesetzt:
Drogen gegen vorzeitiges Ergrauen der Haare „keśarañjana“
Frühzeitiges Ergrauen der Haare ist auf erhöhtes pitta zurückzuführen. Die folgenden Pflanzen schmecken herb, sind trocken und verringern deshalb pitta:
Enthaarende Drogen „romaśātana“
Sie sind erhitzend, spitz und hautreizend und werden daher meist mit öligen Präparaten angewandt.
Ein Beispiel ist:
Hautreizende Drogen „vidāhī“
Sie werden angewandt, um innerliche Entzündungen zu hemmen – pitta wird „an die Körperoberfläche gezogen“. Beispiele sind Entzündungen von Gelenken, Muskeln, Lungen, oder Rippenfell. Tief sitzendes vāta wird ebenfalls ausgestoßen, z. B. bei Neuralgieschmerzen, Hysterie oder Osteoarthritis. Sie regen außerdem den Herzschlag und die Atmung an und werden daher angewandt bei Bradykardie, Bluthochdruck und verlangsamter Atmung.
Hautreizende Pflanzen wirken lokal durchblutungsfördernd und verursachen Rötung der Haut, Brennen, Schmerzen und Blasenbildung. Sie sind erhitzend und spitz. Je nach der Hauptwirkung unterscheidet man:
hautrötende Drogen, „raktotklesaka“
blasenbildende Drogen, „sphotajanana“
ätzende (kaustische) Drogen, „dāhaka“, die Aschen von
Entzündungshemmende Pflanzen „vimlapana“
Sie werden bei Entzündungen der Haut verwendet und bringen diese ohne Nebenwirkungen zum Stillstand. Dazu gehören:
Abszessreifende Pflanzen „pācana“
Sie lassen wegen ihrer erhitzenden Wirkung Entzündungen und Abszesse reifen, z. B.:
Abszessaufbrechende Pflanzen „dāraṇa“
Sie bestehen aus den Elementen Erde und Feuer. Erde ist trocken, wodurch die Zellen sich voneinander lösen; Feuer ist spitz und bricht sie auseinander. Ein Beispiel ist:
Öle für die Ölungstherapie „snehana“
Unter „snehana“ werden Öle und Fette verstanden, die kühlend wirken und den Körper ölig, wässrig, feucht und weich machen. Sie können äußerlich für die ayurvedische Ganzkörpermassage mit warmen Kräuterölen, abhyaṅga, angewandt oder innerlich verabreicht werden, auch als Einlauf, vasti. Die wichtigsten Öle, die im Ayurveda verwendet werden, stammen von Sesam, Erdnuss und Kokosnuss:
Hilfsdrogen für die Ölungstherapie „snehopaga“
Sie fördern die Aufnahme von Ölen und Salben, machen die Haut also für sie „durchlässiger“ und wirken einhüllend und lindernd auf die Haut. Sie sind selbst ein wenig ölig und feucht.
Dazu gehören:
Pigmentbildende Pflanzen „varṇya“
Sie werden bei Pigmentstörungen, z. B. Leukoderma oder Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) eingesetzt, aber auch allgemein hauttherapeutisch. Sie wirken kühlend und beruhigen dadurch bhrajaka pitta, das Temperatur und Farbe der Haut regelt; bei einer Störung nimmt die Haut eine bläuliche, gelbliche oder rötliche Färbung an. In Verbindung mit kapha-Störungen verfärbt sich die Haut weiß und in Verbindung mit vāta-Störungen bläulich oder rötlich. Auch schlechte Durchblutung führt zu gelb-weißer Haut, und Verunreinigungen des Blutes können die Haut ebenfalls verfärben. „Varṇya“-Drogen wirken also zugleich blutreinigend. Beispiele sind:
Juckreizlindernde Drogen „kaṇḍūghna“
Juckreiz wird nach der ayurvedischen Medizin durch übermäßiges kapha in der Haut hervorgerufen. Alle juckreizlindernden Drogen sind also kapha verringernd; es gibt dabei kühlende und erhitzende Pflanzen:
Gegen Lepra und chronische Hautkrankheiten (pitta-Störungen) wirksame Pflanzen „kuṣṭaghna“
„Kuṣṭha“ bezeichnet im Sanskrit hartnäckige Hautkrankheiten einschließlich Lepra. Sie können von allen drei doṣas hervorgerufen werden, wenn sie im Übermaß im Blut, den Muskeln, der Lymphe oder der Haut vorhanden sind; hauptsächlich ist aber zu viel pitta in der Haut die Ursache. „Kuṣṭaghna“-Pflanzen verringern also meist alle drei doṣas und sind zugleich blutreinigend. Folgende kühlende Drogen wirken hauttherapeutisch:
Ferner gibt es noch die folgenden erhitzenden Hauttherapeutika:
Antiallergische und gegen Nesselsucht wirksame Pflanzen „udarda praśamana“
Die Ursache von Nesselsucht und Allergien ist nach der Ayurvedischen Medizin der Kontakt von vāta mit der Haut. Diese Krankheiten sind durch eine Vermehrung von vāta und kapha gekennzeichnet, was sich am Entstehen wässriger Pusteln auf der Haut zeigt. Entsprechend sind die Pflanzen vāta und/oder kapha verringernd:
Herz und Kreislauf
Einleitung
Neben seiner Funktion als Organ des Blutkreislaufs wird das Herz im Ayurveda auch als der Sitz von „ojas“ angesehen, der Abwehrkraft, die für das Leben unverzichtbar ist. In ihm sind alle drei doṣas angesiedelt:
- Vyāna vāta, das Bewegungen von der Körpermitte zur Peripherie bewerkstelligt, also auch den Blutkreislauf, und deshalb für die Herzfunktion am wichtigsten ist;
- prāna vāta, das dafür sorgt, dass die Lebensenergie „prāna“ in Form von Atemluft über die Lunge in den Blutkreislauf und damit in den Körper gelangt;
- sādhaka pitta (vgl. Nervensystem), welches das Herz nährt, seinen Stoffwechsel besorgt und wie vāta an der Kontraktion des Herzmuskels (Systole) beteiligt ist;
- avalambaka kapha: Es schmiert das Herz und schützt es bei seinen unzähligen Kontraktionen vor Verschleiß. Außerdem ist es für das Erschlaffen des Herzmuskels (Diastole) verantwortlich.
Störungen dieser doṣas führen zu folgenden Herzkrankheiten:
- Vāta: Ist an Herzerkrankungen immer beteiligt, da das Herz ein Organ ist, das sich ständig bewegt. Zuviel „herbe“ und „spitze“ Einflüsse vermehren vāta und können zum Verlust der Elastizität und zur Verkrampfung der koronaren Blutgefäße führen. Symptomatisch macht sich vāta durch Schmerzen bemerkbar bei Krankheiten wie Angina pectoris, Herzinfarkt, Myokardinsuffizienz und Koronarinsuffizienz. Indirekt ist gestörtes vāta auch an Arteriosklerose und Endokarditis beteiligt.
- Pitta: Gestörtes pitta im Herzen führt zu einem brennenden Gefühl, starkem Durst und Schwitzen. Erkrankungen sind Entzündungen des Myokards und des Endokards.
- Kapha: Zu viel Fettgewebe und „schwere“ Einflüsse können zu Ablagerungen in den Blutgefäßen führen, letztlich also zu Arteriosklerose. Symptome sind ein Gefühl der Schwere, vermehrter Speichelfluss und süßer Geschmack im Mund sowie starke Übelkeit.
Kardiotonika „hṛdaya“
Diese Pflanzen stärken das Herz, vor allem avalambaka kapha, und vermehren ojas. Die meisten davon wirken kühlend und geben dem Herzen Energie durch Stabilität; sie werden beim Altersherz eingesetzt. Einige sind aber auch erhitzend und führen dem Herzen erwärmende Energie zu; sie sind bei einer Herzmuskelschwäche angezeigt. Beispiele sind:





























