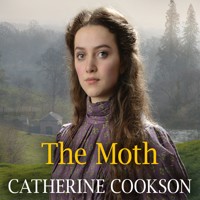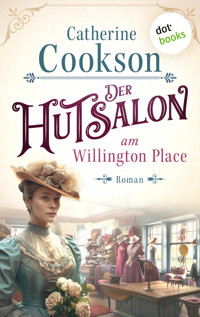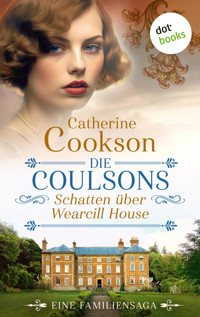5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die zweiundzwanzigjährige Rosie trägt seit dem frühen Tod ihrer Mutter die Verantwortung für ihre Schwester Jennifer und ihren Vater, einen alkoholabhängigen Silberschmied. Nun scheint sie endlich ihr Glück gefunden zu haben: Ihr neuer Nachbar Michael, der kurz zuvor durch eine unverhoffte Erbschaft ein ansehnliches Vermögen erlangt hat, macht ihr einen Heiratsantrag. Doch nicht jeder gönnt den beiden ihre glückliche Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Sammlungen
Ähnliche
CATHERINE COOKSON
HeimlicheHochzeit
Roman
Aus dem Englischenvon Imke Walsh-Araya
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Das Buch
Die zweiundzwanzigjährige Rosie hat es nicht leicht. Seit dem frühen Tod ihrer Mutter kümmert sie sich aufopferungsvoll um sämtliche Belange der Familie. Nach entbehrungsreichen Jahren des Herumreisens lässt sie sich zusammen mit ihrer älteren Schwester Jennifer und ihrem alkoholabhängigen Vater in einer Windmühle inmitten einer wilden, abgeschiedenen Moorlandschaft nieder. Während Jennifer dem tristen Landleben entfliehen will, fühlt sich Rosie in der Windmühle wohl und verliebt sich in ihren wilden und oft aufbrausenden Nachbarn Michael. Als er unverhofft durch eine Erbschaft zu einem ansehnlichen Vermögen kommt, bittet er sie, seine Frau zu werden. Doch da kommt es zu einer unheimlichen Begegnung im Moor.
Die Autorin
Catherine Cookson (1906–1998) wurde in Nordengland geboren und wuchs, wie viele ihrer Romanfiguren, in einfachsten Verhältnissen auf. Bereits als 16jährige schrieb sie Kurzgeschichten, der Durchbruch als Autorin kam 1950. Seitdem hat sie fast 90 Romane veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Durch ihre treue Leserschaft ist sie eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Welt. 1985 wurde sie mit den Orden des Britischen Königreichs ausgezeichnet und 1993 von Königin Elizabeth II. in den Stand einer »Dame of the British Empire« erhoben.
Die Originalausgabe THE FEN TIGER erschien 1979 bei Transworld Publishers Ltd
Vollständige Deutsche Taschenbuchausgabe 05/2006 Copyright © 1963 by Catherine Marchant Coypright © 2006 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration: © Eric Crichton/CORBIS Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: hanseatenSatz-bremen, Bremen
eISBN 978-3-641-18101-7V001
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
1
Rosamund Morley träumte. In ihrem Traum unterschrieb sie ein Dokument, und in diesem Schriftstück ging es um die Mühle Heron Mill. Sie wurde ihr von ihrem Onkel als Geschenk überschrieben. Manchmal vollzog in ihrem Traum auch ihr Cousin Clifford diese Schenkung, und dann bekam sie nicht nur das Haus, sondern auch Clifford mit dazu – freilich als Gatten. Diesen Teil des Traumes genoss sie immer besonders.
Der Traum war ihr ebenso vertraut wie der Raum, in dem sie schlief. Normalerweise kam er zu einem frühen Zeitpunkt ihres Schlafes zu ihr. Wäre Rosamund eines Morgens aufgewacht und hätte feststellen müssen, dass sie ihn nicht geträumt hätte, wäre sie überrascht und wohl auch ein wenig beunruhigt gewesen. Denn sie träumte ihn praktisch immer.
Auch in dieser Nacht verlief der Traum anfangs nach seinem üblichen Muster, doch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Rosamund unterschrieb das Dokument, küsste ihren Onkel, wirbelte herum und lief aus dem Wohnzimmer, durch die niedrige Diele hinaus auf die oberste Stufe der Treppe vor ihrer Haustür. Vor ihren Augen breitete sich der Garten aus, welcher das Haus vom Flussufer trennte. An dieser Stelle war der Fluss sehr schmal, kaum breiter als ein Seitenarm, der seinen mäandernden Weg vom Brandon Creek nahm. Dennoch brauchte es eine Fähre, um hinüberzusetzen. Sie konnte das kleine rote Boot am Ufer nicht sehen, aber die Sonne, welche die Ketten glänzen ließ, verriet die Anlegestellen auf beiden Seiten des Flussufers. Noch immer hielt sich der Traum an das gewohnte Muster. Eben noch stand Rosamund auf den Stufen des Hauses, doch im nächsten Augenblick stieg sie ins Mühlhaus der alten Entwässerungsmühle. Als sie oben ankam, lief sie auf den etwas baufälligen Balkon und blieb kurz vor den verrottenden Latten eines der Segel stehen, warf den Kopf in den Nacken und lachte ihre Freude hinaus. Von diesem Punkt aus konnte sie ihre ganze Welt sehen. Bis auf das Wäldchen jenseits des Flusses, das auf dem Land der Thornbys lag, war die ganze Gegend flach, so weit das Auge blicken konnte. Gelbe, rote und braune Landstriche wurden von schwarzen Flecken unterbrochen, und all diese Farben säumten silbern glitzernde Bänder, die Flüsse. Links von ihr wurde das Wasser durch die hohen Schilfufer des Brandon Creek unterbrochen. Rechts von ihr, weit in der Ferne, schimmerte der Fluss nur noch sehr schwach, denn die Böschungen des Wissey waren sehr hoch und oftmals sogar bewaldet. Gegenüber von ihr auf der rechten Seite lag Great Ouse. Der Brandon strömte nur in sechs Meilen Luftlinie weiter zum Meer. Man sah ihn, wenn man den Blick über das Thornby House schweifen ließ, doch mit dem Boot dauerte die Fahrt zwei Stunden. Der Hauptfluss wurde auf seinem Weg nur von der Denver Sluice umgeleitet.
An diesem Punkt ihres Traumes riss sie gewöhnlich den Blick von der Landschaft los und rief laut: »Hallo, Andrew!«, ob sie ihn sah oder nicht. Auf ihren Ruf hin erschien Andrew dann wie auf ein Stichwort. Er saß auf seinem Traktor mitten auf einem seiner Felder und erwiderte ihren Gruß. »Hallo, Rosie!«, würde er rufen.
Obwohl das nächste Feld von Andrew Gordons Land eine Meile vom Gebiet der Mühle entfernt lag, wo es an das Land der Thornbys grenzte, erschien Andrew auf seinem Traktor in ihrem Traum immer direkt unter ihr. Sie beugte sich durch die verrotteten Latten des Rades der alten Mühle und lachte zu Andrew hinab. Aber dann war er schon nicht mehr allein, denn ihre Schwester Jennifer hockte auf dem Radkasten neben ihm. Rosamund winkte ihnen zu, bevor sie sich herumdrehte und die baufällige Treppe hinablief. Dabei wurde sie von einem Glücksgefühl durchströmt, das selbst im Traum beinahe überwältigend war. Jennifer hatte ihren Andrew, und sie, sie hatte Heron Mill.
Wenn sie den Fuß der Treppe erreichte, wurde sie schon von ihrem Vater erwartet. Sie schwenkte die Schenkungsurkunde fröhlich über ihrem Kopf. Auch diesmal wurde sie in ihrem Traum von ihrem Vater begrüßt, doch dann veränderte sich das Muster des Traumes. Nicht sie hielt die Urkunde in ihrer Hand, sondern ihr Vater. Er hielt ein brennendes Streichholz an eine Ecke des Pergaments, und als das dicke Papier knisternd Feuer fing, verbarg der dichte Qualm ihn vor ihrem Blick. »Nicht!«, hörte sie sich rufen. »Oh, Vater, nicht! Tu das nicht! Du weißt ja nicht, was du tust!« Im nächsten Moment rang sie mit ihm um die Reste des verkohlten Dokumentes.
»Rosie! Rosie, wach auf! Hörst du?«
Sie wachte auf, in ihrem Bett sitzend, in den Armen von Jennifer, die sie heftig schüttelte, während sie selbst sich an den Schultern ihrer Schwester festklammerte.
»Was … Was ist denn los?«
»Wach auf! Rasch, steh auf! Oh, Rosie, wach auf, bitte, ich flehe dich an! Das Haus steht gleich in Flammen!«
Rosamund sprang aus dem Bett. »Wo … Wo brennt es denn?«
»Vater … Sein Bett schwelt. Ich habe versucht, ihn zu wecken, aber ich wäre beinahe in dem Qualm erstickt. Ich habe ihn nicht wach bekommen!«
Rosamund erreichte noch vor Jennifer den Treppenabsatz, wo ihr eine dichte Rauchwolke entgegenschlug, die aus der geöffneten Tür am anderen Ende des kurzen Flures quoll.
Wie einige Minuten zuvor in ihrem Traum tastete sie durch eine Rauchwolke nach ihrem Vater, nur war es diesmal ganz real.
»Vater! Vater, wach auf! Wach …!« Sie hustete und keuchte, als der beißende Rauch in ihre Lungen drang. Sie winkte Jennifer mit der Hand zu sich. »Zieh ihn hoch!«, stieß sie hervor.
Zusammen zerrten sie die schwere, reglose Gestalt aus dem Bett auf den Boden und anschließend rückwärts zur Tür. Schließlich schafften sie es bis auf den Treppenabsatz.
Rosamund kniete sich neben ihren Vater und hielt seinen Kopf mit dem zerzausten grauen Haar zwischen den Händen. Sie schickte ein Stoßgebet zum Himmel, als sie in sein kalkweißes Gesicht sah. »Wach auf! Vater! Vater! Wach auf!« Sie warf ihrer Schwester einen hastigen Blick zu. »Er atmet wenigstens … Sieh doch!« Sie deutete auf die Tür seines Schlafgemachs. »Mach sie zu. Nein, warte!« Sanft ließ sie den Kopf ihres Vaters zu Boden gleiten. »Die Matratze! Wir müssen sie hinauswerfen!«
Während sie die schwere Matratze vom Bett rissen und zum Fenster schleppten, wunderte sich Rosamund, dass sie nicht lichterloh brannte, denn sie schien in ihren Händen zu glühen. Das Fenster war sehr schmal, und obwohl es nur eine schmale Matratze war, kostete es sie sehr viel Mühe, sie hindurchzuzwängen. Sie schrieen beide vor Entsetzen auf, als die Matratze beim ersten Luftzug sofort in Flammen aufging.
»Oh Gott! Es hätte …!« Rosamund schloss einen Moment die Augen, bevor sie herumwirbelte und zum Treppenabsatz zurücklief.
Henry Morley hatte sich noch immer nicht gerührt, und die beiden Mädchen blickten hilflos auf ihn hinunter.
»Soll er doch sterben!«, stieß Jennifer hervor.
»Ach, sei still!«, fuhr Rosamund ihr scharf über den Mund.
»Was sollen wir denn tun? Hochheben können wir ihn nicht!«
»Wir müssen es versuchen. Nimm du ihn an den Beinen.«
Rosamund schlang ihre Arme unter den Achselhöhlen ihres Vaters hindurch und versuchte, ihn anzuheben, während Jennifer sich mit seinen Beinen abmühte, aber es wurde ihnen bald klar, dass sie ihn nur über den Boden schleifen konnten.
»Es geht nicht.«
Nein, es ging wirklich nicht. Rosamund ließ ihren Vater wieder zu Boden gleiten. »Wir müssen jedenfalls etwas unternehmen. Ich laufe rasch zu Andrew. Von dort aus kann ich den Arzt anrufen, und Andrew kommt mit mir zurück. Das heißt, falls er schon von der Viehschau zurückgekommen ist. Hoffentlich ist er zu Hause!«
»Verdammt sei dieses Bein!«
Diese Verwünschung hatte zwar keinerlei Bezug zu ihrer Situation, aber Jennifer sagte sie immer, wenn es kritisch wurde. »Hör auf damit!«, wies Rosamund sie barsch zurecht. Sie redete, als wäre sie die Ältere der beiden, dabei war sie zwei Jahre jünger als ihre Schwester. Aber sie hatte schon seit vielen Jahren die Rolle des Familienoberhauptes in ihrer kleinen Familie übernommen. Außerdem wusste sie, dass Jennifer auch ohne ihre Behinderung, ein kaum merkliches Humpeln, wie man zugeben musste, keine Lust gehabt hätte, in der Nacht durch das Moor zu laufen. »Hol ein paar Decken aus dem Schrank«, befahl sie rasch. »Es ist zwar warm, aber man kann nie wissen. Ich nehme die Tilley mit.« Über einem Tisch in der Nähe der Wand brannte eine Tilley-Laterne. Sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, diese Laterne immer brennen zu lassen, um für einen Notfall wie diesen gerüstet zu sein. Manchmal war Rosamund zwar versucht gewesen, das Öl zu sparen, aber jetzt war sie froh, dass ihre Sparsamkeit sie nicht zu diesem Fehler verleitet hatte.
Sie lief in ihr Zimmer zurück, hielt sich nicht lange damit auf, ihren Pyjama abzulegen, sondern zog einfach eine Hose darüber und schlüpfte in ihre Schuhe. Als sie wieder zum Treppenabsatz zurückrannte und die Laterne vom Haken nehmen wollte, fiel ihr ein, dass Jennifer nun im Dunkeln zurückbleiben würde. Dann hatte sie gewiss ebenso große Angst, wie wenn sie des Nachts durch die Moore hätte laufen müssen. Aber Rosamund konnte keine Zeit damit verschwenden, erst noch eine andere Laterne zu entzünden. »Ich brauche die Laterne nicht«, erklärte sie hastig. »Es ist ja bereits fast taghell draußen.«
»Wenn du zurückkommst, habe ich alle Lampen angezündet, Rosie.« Die Erleichterung in Jennifers Stimme war unüberhörbar. »Aber beeil dich, bitte! Mach nur schnell!«
Ohne ein weiteres Wort hastete Rosamund nach unten in den dunklen Flur. Geschickt ging sie um den Tisch herum, auf dem Messingschalen standen, öffnete die Tür des Schranks, nahm einen kurzen Mantel heraus und steckte eine Hand in den Ärmel, während sie mit der anderen den Riegel der Haustür zurückschob.
Sie hatte kein Auge für die sonst so geliebte Szenerie vor ihrer Tür, die vom hellen Mondlicht in silbriges Licht getaucht wurde. Stattdessen ärgerte sie sich plötzlich und ihr fielen die Worte ihrer Schwester ein. Was nützte all diese ländliche Schönheit, wenn man nicht einmal ein Telefon, elektrisches Licht oder irgendwelche elektrischen Hausgeräte betreiben konnte? Und was war schön an einer Idylle ohne fließendes Wasser? Sie mussten ihr Trinkwasser aus einer Zisterne holen, und es schmeckte verdächtig nach Flusswasser. Wenn sie ein heißes Bad nehmen wollten, mussten sie das Wasser in Eimern vom Fluss zu dem alten, mit Reet gedeckten Badehaus an der Rückseite des Hauses schleppen. Jennifer hatte ganz Recht mit ihrer Kritik.
Rosamund stieg in das kleine Fährboot und zog sich hastig an der Kette hinüber. Das Wasser war kalt und es schoss ihr trotz ihres Ärgers durch den Kopf, wie schön es wäre, jetzt zu schwimmen. Als sie das andere Flussufer erreicht hatte und den Pfad zwischen dem hohen Schilf auf der Uferböschung hinaufhastete, hatte sie sich wieder beruhigt und schalt sich für ihre Unzufriedenheit. Hör auf und danke Gott für das, was wir haben! Das tat sie auch, wahrlich, das tat sie. Sie dankte Gott jeden Tag für ihr Leben in Heron Mill. Sie fürchtete nur, dass sie die Mühle eines Tages würden verlassen müssen. Diese Furcht wallte auch jetzt in ihr hoch, und sie wäre beinahe gestolpert. Denn dieser Tag konnte unmittelbar bevorstehen. Sollte ihrem Vater etwas zustoßen, bedeutete dies das Ende. Mit ihm würde auch Heron Mill sterben, und sie hätten gar kein Heim mehr, weder mit noch ohne Elektrizität. Jennifer würde leicht eine neue Heimat finden. Denn in einer solchen Situation wäre Jennifer gewiss bereit, Andrews Werben zu erhören. Sollte dies eintreten, konnte Rosamund das tun, was sie für einen solchen Notfall schon lange geplant hatte. Sie würde sich als Hausmädchen verpflichten. Denn Hausarbeit beherrschte sie besser als alles andere.
Sie beschleunigte ihre Schritte und rannte förmlich, während sie dachte: Oh, gnädiger Gott, lass ihn nicht sterben … Ihr Gebet war nicht ganz uneigennützig, denn sollte es erhört werden, würde sie einen persönlichen Vorteil daraus ziehen. So sehr sie ihren Vater auch liebte, und das tat sie, wenn vielleicht auch nicht so wie eine Tochter ihren Vater, sondern eher wie eine Mutter ihr unberechenbares Kind, so sehr liebte sie auch das Mühlhaus. Heron Mill war ihre erste wahre und einzige Heimat geworden. Rosamund fühlte sich dort so geborgen und sicher wie noch nie irgendwo zuvor. In den letzten sechs Jahren hatte sie sich fast jeden Tag gesagt, dass sie vom Leben nur ein Heim und Sicherheit erwartete.
Sie rannte über das Feld zu dem kleinen Wald. Dort wollte sie bis zum oberen Ende laufen und über den Graben springen, obwohl ihr diese Gräben unheimlich waren. Diese tiefen, mit Schlick gefüllten Risse in der schwarzen, sumpfigen Erde waren für dieses Land, das weit unter dem Meeresspiegel lag, so wichtig wie die Adern für den Körper. Trotzdem flößten sie Rosamund eine merkwürdige Furcht ein. Selbst am helllichten Tage schüttelte es sie, wenn sie aus irgendeinem Grund in einen Graben hinabblicken musste. Sie malte sich aus, wie es wäre, wenn sie in einen hineinfiel und sich mühen musste, wieder herauszukommen. Ein normaler Graben hatte geneigte Ränder, aber die Seiten der meisten Abwassergräben gingen steil, fast senkrecht hinab. Es erfüllte sie mit Entsetzen, wenn sie sich die schier unmögliche Aufgabe vorstellte, aus dem weichen Schlick eines dieser Gräben zu klettern.
Sie hatte den Wald erreicht und schlug den Pfad nach links ein, der sie zum Gänseteich bringen würde. Diesen Namen hatte man einer Verbreiterung des Grabens gegeben, die eher einem kleinen Weiher glich als einem Teich. Die gegenüberliegende Seite des Teichs markierte die Grenze zwischen der Willow Wold Farm, Andrews Besitz, und dem Land von Thornby House. Sie verlief über die alte, fast verrottete Holzbrücke, die den Graben direkt hinter dem Teich überspannte.
Seit Jahren schon benutzten sie diesen Pfad durch den Wald der Thornbys als Abkürzung zu Andrews Bauernhof. Denn wären sie an ihrer Seite des Flussufers nur bis zum Gänseteich entlanggegangen, hätten sie wegen des mäandernden Flusses dreimal so lange für den Weg gebraucht.
Es war nicht wirklich dunkel im Wald, jedenfalls nicht an diesem Ende, denn die Bäume waren hoch und standen weit auseinander. Zum Fluss hin jedoch bildeten die jungen Weiden ein dichtes Unterholz, und dort war es weit finsterer. Doch Rosamund kannte den Wald beinahe so gut wie jeden Zentimeter Grund der Mühle. Deshalb war diese Dunkelheit für sie kein Problem und sie flößte ihr schon gar keine Angst ein. Im Moor konnte man meilenweit laufen, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Stieß man dennoch auf jemanden, war es fast immer ein Bekannter. Denn selbst in der Ferienzeit wagten sich die motorisierten Besucher nur höchst selten in diese Sumpfgebiete.
Aus diesem Grund war die unerwartete Begegnung noch erschreckender.
Rosamund näherte sich dem Rand des Wäldchens. Sie war etwas außer Atem und hatte Seitenstiche vom angestrengten Laufen, als plötzlich eine Gestalt vor ihr auftauchte. Einen Wimpernschlag lang glaubte sie, dass eines der Rinder von Andrews Weide sich hierher verirrt hatte. Das geschah manchmal trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die Andrew ergriff. Doch im nächsten Moment packte jemand sie mit einem eisernen Griff, und Rosamund stieß einen markerschütternden Schrei aus. Gleichzeitig holte sie mit dem Fuß aus und trat nach ihrem Angreifer. Offenbar traf sie sein Schienbein, denn der Mann fluchte und riss sein Bein zurück.
»Was zum Teufel soll das? Was hast du vor, los, rede!« Sie wurde geschüttelt wie eine Ratte. »Antworte! Was wolltest du hier?«
»Lassen … lassen Sie mich sofort los!«
In dem plötzlichen Schweigen, das nun folgte, hörte sie auf, sich zu wehren, und der Mann lockerte seinen Griff, ohne sie jedoch gänzlich loszulassen. Sie konnte sein Gesicht nicht erkennen, weil sie zu dicht vor ihm stand, aber sie fühlte sein grobes Tweedjackett und roch, dass er rauchte. Sie erkannte die Tabakmischung. Es war dieselbe, die auch ihr Vater bevorzugte. Eigenartigerweise beruhigte sie dieser vertraute Geruch. Sie wollte den Fremden gerade barsch nach seinem Namen fragen, weil sie sicher war, dass er nicht in diesen Mooren lebte, als sie grob an der Schulter weitergezogen wurde. Bevor sie auch nur protestieren konnte, hatte er sie zum Waldrand und hinaus in das offene Gelände gezerrt. Dort blieben sie beide stehen und musterten sich eine Weile schweigend.
Ihr Häscher war kräftig, fast untersetzt, wäre er nicht so groß gewesen. Aber im Mondlicht erkannte Rosamund, dass vor allem seine breiten Schultern ihm dieses untersetzte Aussehen verliehen, denn er war immerhin um die ein Meter achtzig groß. Er trug keine Kopfbedeckung und seine Gesichtszüge waren in dem silbrigen Licht deutlich zu erkennen. Er hatte markante Wangenknochen, eine dünne, gerade Nase und schmale Lippen. Sein breites Kinn wirkte knochig. Im Gegensatz zu seinem dichten, schwarzen Haar waren seine Brauen dünn, nicht buschig, wie man es bei der dunklen Mähne auf seinem Kopf und dem Bartwuchs auf seinen Wangen hätte erwarten können. Im Gegenteil, sie waren schmal und fein geschwungen und verliehen seinem Gesicht eine Vornehmheit, zu der seine markanten Gesichtszüge in eklatantem Widerspruch standen. Seine Augen konnte sie nicht erkennen, denn obwohl die Brauen sie nicht schützten, lagen sie tief in ihren Höhlen, und der Mann hatte sie zudem zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen, während er Rosamund betrachtete.
Sie konnte zwar seine Miene nicht enträtseln, aber ihre Einschätzung von sich selbst sagte ihr genau, was er sah. Ein dünnes, kleines Ding, mit einem ovalen Gesicht und einem viel zu großen Mund, einer ganz netten Nase, kupferfarbenem Haar und Augen … Sie hatte sie wie er zusammengekniffen, also konnte er sie nicht richtig sehen. Ihre Farbe wechselte von Braun zu Grau, je nach Stimmung, und wenn sie wütend war, funkelten sie auch schon einmal in einem meergrünen Farbton. Wie vermutlich genau in diesem Moment. Jetzt sah sie auch die Verblüffung in seiner Miene, die vermutlich daher rührte, dass er ihr Geschlecht erkannte, was er mit seinen nächsten Worten auch sogleich bestätigte.
»Was fällt Ihnen ein, wie eine Verrückte zu rennen? Ich dachte, Sie wären … Wer sind Sie?«
Wer sie war? Wer war er? Diese Frage sollte gestellt werden. »Was geht Sie das an?« Ihre Stimme war schrill und vibrierte trotz ihrer Empörung ein wenig vor Angst.
»Sie befinden sich unerlaubterweise auf meinem Land! Damit dürfte es mich wohl mit Recht etwas angehen!«
»Ihr Land?« Sie sah ihn mit großen Augen an und öffnete unwillkürlich den Mund vor Staunen. Sie klappte ihn rasch wieder zu, schluckte und sagte: »Sie sind …?«
»Ja, bin ich.«
»Mr. Bradshaw?«
»Ganz recht.«
»Ich dachte … Ich wusste nicht, dass Sie zurückgekehrt sind … Sie waren jahrelang weg … und haben sich hier nie blicken lassen.«
»Ich habe meinen Besitz seit drei Tagen wieder bezogen.«
Das klang ziemlich förmlich, und unter anderen Umständen hätte Rosamund gelacht, aber jetzt dachte sie nur: Seit drei Tagen schon, und wir haben es nicht gewusst!
Allerdings kam sie dem Thornby House auch nur selten so nah. Andrew hätte es gewusst, wäre er nicht in den letzten drei Tagen auf der Viehschau gewesen.
»Das … das tut mir Leid«, stammelte Rosamund etwas lahm. »Ich wäre vorbeigekommen, wenn ich das gewusst hätte.«
»Ich erwarte keine Besucher!«
»Oh.« Sein Ton verstimmte sie etwas, aber sie war viel zu verwirrt, um sich jetzt darüber aufzuregen. »Wie Sie meinen.« Sie nickte noch einmal, bevor sie sich ab wandte.
»Warten Sie! Wer sind Sie?«
»Ich bin Rosamund Morley von Heron’s Mill.«
Sie hatte ihre Antwort über die Schulter zurückgeworfen und war weitergegangen und merkte jetzt, dass er ihr folgte.
»Wohin wollen Sie denn um diese nachtschlafende Zeit?«
»Ich will zur Willow Wold Farm, zum Besitz von Mr. Gordon. Ich muss einen Arzt verständigen.«
»Ist jemand bei Ihnen krank?« Mittlerweile hatte er sie eingeholt und ging neben ihr.
Sie sah starr geradeaus, als sie antwortete. »Mein Vater. Er hat im Bett geraucht und die Matratze in Brand gesetzt.«
»Ist er schlimm verbrannt?«
»Soweit ich gesehen habe, hat er keine Brandwunden davongetragen. Die Matratze hat kein Feuer gefangen, bis wir sie aus dem Fenster geworfen haben … meine Schwester und ich. Aber er hat viel Rauch eingeatmet und wir können ihn nicht wachbekommen.«
»Warten Sie!« Er streckte die Hand aus und hielt sie fest. Rosamund schüttelte zwar seine Hand ab, blieb aber stehen und drehte sich zu ihm herum.
»Falls die Straße zu diesem Bauernhof sich nicht in einem besseren Zustand befindet als vor zwölf Jahren und der Arzt diesen Weg nehmen muss«, er deutete auf den Pfad, »dauert es eine Stunde, vielleicht sogar zwei, bis er eintrifft. Ihr … Ihr Vater sollte so schnell wie möglich den Rauch aus den Lungen bekommen, falls es nicht schon zu spät ist.«
Sie erschauerte bei seinen brutalen Worten.
»Wo haben Sie ihn hingebracht? An die frische Luft?«
»Nein. Er ist sehr groß, und wir konnten ihn nicht bewegen. Er liegt auf dem Treppenabsatz. Ich wollte Andrew holen, Andrew Gordon, damit er uns hilft.«
»Kommen Sie mit.« Seine Stimme klang jetzt ruhig und normal, und sie sah ihm nach, als er in den Wald zurückging.
»Sind Sie Arzt?«, rief sie ihm nach.
Erneut veränderte sich die Stimme, als er über die Schulter zurückwarf: »Nein, ich bin kein Arzt.«
Rosamund zögerte. Sie hatte die Hände vor den Mund gehoben und ihre Finger zitterten. Andrew war ebenfalls kein Arzt und er hätte ihren Vater auch nur auf ein Bett legen können. Aber von Andrews Haus aus hätte sie einen Arzt anrufen können. Außerdem mochte sie diesen Mann nicht. Doch wenn er etwas für ihren Vater tun konnte …
Er war bereits vorausgelaufen, und seine Stimme klang unbeteiligt. »Ich werde jedenfalls einen Blick auf ihn werfen.«
Rosamund schüttelte ihre Benommenheit ab und murmelte vernehmlich: »Ich muss trotzdem einen Arzt rufen!« Damit drehte sie sich um und ging ein paar Schritte weiter, bis sie wie angewurzelt stehen blieb. Im nächsten Moment wirbelte sie herum und rannte hinter dem Mann her. Falls er einfach so in ihr Haus stürmte, und genau das würde er tun, wenn sie seinem bisherigen barschen Verhalten trauen konnte, würde Jennifer einen Anfall bekommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Rosamund konnte sie fast schon schreien hören. Jennifer vertraute dem Moor und seinen Bewohnern nicht so wie Rosamund es tat. Deshalb verriegelten sie ihre Türen bei Nacht, obwohl sie manchmal wochenlang niemanden sahen bis auf Andrew und die Arbeiter auf den entlegenen Feldern. Einmal waren Dinghis die Gräben und Kanäle entlanggefahren, als diese noch vom Schilf freigehalten wurden. Es waren Vergnügungsboote, die am Brandon Creek ankerten. Aber jetzt war das dichte Schilf vom Ufer weiter in die Gräben gewandert und bildete unüberwindliche Barrieren bis hin zur Mühle.
»Warten Sie … warten Sie eine Minute!« Sie keuchte, als sie ihn endlich einholte. »Meine … Sie würden meine Schwester überraschen, wenn Sie einfach ins Haus marschierten … wenn Sie alleine hineingingen. Ich muss Sie begleiten … Aber ich muss auch einen Arzt holen.«
»Wie lange leben Sie schon in der Mühle?«
Sie trottete hinter ihm her. »Sechs Jahre.«
»Was ist aus den Talfords geworden?«
»Die kenne ich nicht. Mein Onkel hat die Mühle von einem alten Ehepaar erworben, das ist alles, was ich weiß.«
»Und was machen Sie dort? Betreiben Sie Landwirtschaft?«
»Nein. Wir besitzen nur einen Morgen Land. Mr. Brown, der weiter da hinten lebt, hat alles Land bis dicht an die Mühle aufgekauft. Wir … wir fertigen Schmuck an.«
»Was?« Er blieb stehen und sah sie über die Schulter hinweg an.
»Mein Vater war Silberschmied«, erwiderte sie würdevoll. »Er ist es noch.«
»Ah. Ein merkwürdiger Beruf für diesen Flecken Erde.«
»Ich wüsste nicht, warum«, erwiderte Rosamund etwas gereizt.
»Ich würde annehmen, dass man einem solchen Beruf besser in der Stadt nachgeht.«
»Was in den Geschäften feilgeboten wird, muss ja irgendwo hergestellt werden … und wir fertigen diesen Schmuck an.« Jedenfalls haben wir das getan, schränkte sie wehmütig ein.
Sie hatten den Wald mittlerweile verlassen und sahen das schimmernde Band des Flusses. Als sie zur Fähre kamen, musterte der Mann das kleine rote Boot verächtlich.
»Pah!« Allein sein Tonfall verriet seine Missbilligung und seine Worte verstärkten dies nur noch. »Eine weitere Neuerung. Was ist aus dem alten Punt geworden?«
»Woher soll ich das wissen?«, fuhr sie ihn schnippisch an und hasste sich selbst dafür. Aber der herablassende Ton dieses Mannes ging ihr gegen den Strich.
»Wahrscheinlich liegt es kieloben irgendwo flussabwärts am Ufer.«
»Ganz recht.«
»Sagten Sie nicht eben, Sie wüssten nicht, was mit dem Punt passiert ist?«
»Ich wusste nicht, dass dieses Wrack als Fähre benutzt worden ist. Hinter dieser Biegung liegt tatsächlich ein altes Punt am Ufer, falls Sie dieses Ding meinten.«
»Mit etwas Pflege hätte es noch gut weitere dreißig Jahre seinen Zweck erfüllt. Ich habe es instand gehalten, als ich noch ein Junge war.«
Sie musste ihn nicht fragen, ob er in seiner Kindheit hier gelebt hatte. Von dem wenigen Tratsch, den sie über den Besitzer von Thornby House gehört hatte, wusste sie nur, dass er dort geboren worden war und es vor etwa zwölf Jahren verlassen hatte.
Als sie den kleinen Bootssteg auf der anderen Seite erreichten, half er ihr nicht aus dem Boot, sondern stieg allein die Böschung hinauf und betrachtete die Mühle. Erst als sie neben ihm stand, sprach er. »Sie wird bald neue Stelzen brauchen. Das Land muss mindestens einen Fuß gesunken sein, seit ich es zum letzten Mal gesehen habe. Haben Sie die Treppe um eine weitere Stufe erhöht?«
»Nein.« Sie ging an ihm vorbei. »Die Stufen sind noch dieselben wie bei unserer Ankunft. Ich gehe besser zuerst hinein und kündige Sie bei meiner Schwester an.« Sie lief die fünf Stufen hinauf und in den Flur. »Jennifer?«, rief sie leise. »Jennifer?«
»Ja?« Jennifer trat mit der Lampe in der Hand in die Diele. »Du kannst doch unmöglich so schnell wieder hier sein! Was …?«
»Hör zu, ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Ich habe Mr. Bradshaw von Thornby House getroffen. Er ist wieder zurück und will sich unseren Vater ansehen.«
»Mr. …? Aber wo denn?«
»Sch! Das erkläre ich dir später.«
Als sie sich umdrehte, trat der Mann in die Diele. Er ging noch einen Schritt weiter und blieb wie angewurzelt stehen. Er blickte an ihr vorbei und Rosamund lächelte zynisch. Sie wusste, was ihn so überrascht hatte: Der Anblick von Jennifer mit ihrem strohblonden Haar, das weich über ihre Schultern fiel, in ihrem gerüschten Nachthemd, das unter ihrem dreiviertellangen Morgenmantel hervorlugte, und ihr Gesicht, das so vollendet feminin und anrührend war. Die großen blauen Augen, die geschwungenen Lippen, die leichte Stupsnase und die helle Haut, die im Licht der Lampe schimmerte. Wahrhaftig die Lady mit der Lampe, dachte Rosamund ohne jede Häme, denn obwohl sie das glatte Gegenteil ihrer Schwester war, liebte sie sie und war in diesem Moment auch sehr stolz auf sie. Denn Jennifer verfehlte ihre Wirkung offenbar nicht einmal auf so grobschlächtige Mannsbilder wie dieses Exemplar hier.
»Das ist Mr. Bradshaw … Meine Schwester Jennifer.« Sie begleitete die Vorstellung mit einem eher ungeduldigen Winken ihrer Hand. »Ist er zu sich gekommen?«, fragte sie ihre Schwester.
»Nein.«
Jennifer starrte den Mann immer noch an, während er Rosamund die Treppe hinauf folgte.
Als sie sich dann neben ihren Vater hockte, sah sie den Besucher an, der auf der anderen Seite in die Knie gegangen war. »Es scheint ihm besser zu gehen, denn er atmet ruhiger.« Sie sah zu, wie der Mann die Augenlider ihres Vater zurückschob und dann sein Ohr auf dessen Brust legte. Danach hob er langsam den Kopf und starrte dem älteren Mann ins Gesicht.
»Geht es … Wird er wieder gesund?«, fragte sie.
»Ja. Ja, ich würde sagen, es geht ihm gut. Jedenfalls, wenn er sich ausgeschlafen hat. Ich richte ihn jetzt auf.« Allein seine Stimme scheuchte Rosamund zur Seite. Er bückte sich und zu ihrer Überraschung hob er die schwere Gestalt ihres Vaters so mühelos vom Boden, als hätte er sie, Rosamund, in die Arme genommen.
»Zeigen Sie mir sein Zimmer.«
»Hier entlang.«
Rosamund riss die Tilley-Laterne von dem kleinen Beistelltisch, als sie hastig in ihr Schlafgemach ging. Dort stellte sie die Laterne auf die Kommode, zog das zerwühlte Laken zurück und trat zur Seite, als der Mann ihren Vater auf ihr Bett legte.
»Er wird sich erholen. Decken Sie ihn zu.«
Rosamund gefiel sein Ton überhaupt nicht. Es schien ihr, als würde er die ganze Sache als bedeutungslos oder zumindest doch unwichtig abtun.
»Ich hole trotzdem den Arzt.«
»Diesen Weg können Sie sich sparen. Außerdem wird sich der Arzt bestimmt für diesen überflüssigen Gang bedanken.«
»Was wollen Sie damit sagen?« Jennifer war unbemerkt ebenfalls in das Zimmer getreten.
Mr. Bradshaw drehte sich um und betrachtete sie einen Augenblick, bevor er antwortete. Ihre Schönheit beeindruckte ihn allerdings wohl nicht so sehr, dass er seine brutalen Worte etwas gemäßigt hätte.
»Ihr Vater ist sinnlos betrunken.«
Jennifer starrte ihn an. Sie war zu entsetzt, um das abstreiten zu können. Aber Rosamund nicht. »Nein!«, erwiderte sie barsch. »Das kann nicht sein!«
»Ich fürchte, es kann sehr gut sein, denn er ist es.« Er schaute sie über die Schulter hinweg an.
»Es war der Rauch. Er ist nicht betrunken!«
Jetzt drehte sich der Mann ganz herum und musterte sie, während sie am Kopfende des Bettes stehen blieb.
»Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber er wird nicht an einer Rauchvergiftung sterben. Er hat höchstens etwas unter dem Qualm gelitten.« Er hob seine vornehmen Brauen. »Sie scheinen überrascht zu sein … Kennen Sie denn den Geruch von Whisky nicht?«
Ob sie den Geruch von Whisky nicht kannte? Solange Rosamund zurückdenken konnte, hatte sie diesen Geruch gehasst. O ja, sie kannte den Gestank von Whisky, denn waren sie nicht eben deshalb in dieser Mühle eingesperrt, wie Jennifer sagte? Wegen des Whiskys? Aber sie hatte keine Whiskyfahne an ihrem Vater gerochen, als sie ihn aus dem Bett gezogen hatte. Er hatte seit drei Monaten keinen Tropfen angerührt und er hatte die Mühle bis gestern nicht einmal verlassen. Gestern waren sie in Ely gewesen, aber entweder sie oder Jennifer hatten ihn ständig im Auge behalten. Da konnte er sich unmöglich Whisky besorgt haben. Und doch hatte er es geschafft. Auch wenn Rosamund den Mann, der ihr gegenüberstand, bis aufs Mark verabscheute, wurde ihr klar, dass er die Wahrheit sagte. Sein Geruchssinn war offenbar schärfer ausgeprägt als ihrer, aber unabhängig davon gab es andere Anzeichen, die ihm verraten haben sollten, dass ihr Vater im Delirium lag. Sie kannte diese Trunkenheitszustände ihres Vaters, und sie hätte auch diesen sofort erkannt, wäre sie nicht so in Panik wegen des qualmenden Bettes geraten. Sie hatte keinen Augenblick daran gedacht, dass er betrunken sein könnte. Jetzt senkte sie den Kopf, als hätte sie persönlich diese Schande zu verantworten. Als sie sich dessen bewusst wurde, hob sie beinahe trotzig das Kinn und blickte den Mann vor sich an. »Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe«, sagte sie fast ein wenig spröde.
Er erwiderte schweigend ihren Blick. Wahrscheinlich hält er mich für eine vollkommene Närrin, dachte Rosamund, weil ich mitten in der Nacht durch die Moore laufe, um für einen Säufer einen Arzt zu holen. In diesem Moment hätte sie sich für ihre Dummheit ohrfeigen mögen.
Der Mann drehte sich um und verließ ohne ein Wort zu sagen den Raum. Rosamund wich einen Schritt zur Wand zurück, als hätte er sie zurückgestoßen, nicht mit der Hand, sondern nur mit seinem verächtlichen Blick, der ihr deutlich sagte: »Du kleine Närrin!«
Rosamund sah Jennifer an. Ihre Schwester hatte vor Entsetzen die Augen weit aufgerissen. Sie presste ihre Finger gegen eine Wange und sagte kein Wort, bis die Haustür mit einem vernehmlichen Knall zugeschlagen wurde. Dann sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus. »Oh, wie schrecklich, wie demütigend! Was ist in dich gefahren, diesen Kerl herzubringen? Wäre es Andrew gewesen, hätte das nichts ausgemacht! Außerdem glaube ich ihm nicht, ich glaube ihm einfach nicht. Vater kann sich gestern nichts gekauft haben. Hast du ihn allein gelassen?«
»Ich ihn allein gelassen?« Rosamund schüttelte den Kopf. »Glaubst du das wirklich? Ich könnte dir dieselbe Frage stellen. Hast du ihn aus den Augen gelassen?«
»Nein, natürlich nicht. Nur …«
»Nur was?«
»Er hat mich ein paar Minuten verlassen, in diesem Café, als du Lötmittel gekauft hast und all diese Dinge. Er wollte zu den Waschräumen … Du weißt schon … Du erinnerst dich, sie lagen hinter der Trennwand vor der Eingangstür des Cafés … Oh!« Sie schlug die Hand vor den Mund. »Er muss heimlich hinausgeschlüpft sein. Jetzt fällt mir auch wieder ein, was für ein Geschäft nebenan war. Lebensmittel und Weine. Es hätte ihn nur eine Minute gekostet … Ach, Rosie!«
»Sei’s drum, es ist passiert. Aber warum haben wir es nicht gerochen? Er«, sie deutete mit einem Nicken auf die Stelle, an welcher der Mann eben noch gestanden hatte, »konnte es offenbar riechen.«
Rosamund blickte auf ihren Vater hinunter. Er atmete schwer, und sein Gesicht war jetzt gerötet. Warum hatte sie die Anzeichen nur nicht erkannt? Langsam verließ sie ihr Zimmer, ging über den kurzen Flur in das Gemach ihres Vaters und ließ sich auf Hände und Knie hinunter. Sie schaute unter das Bett, konnte jedoch keine Spur einer Flasche finden. Danach durchsuchte sie den Kleiderschrank. Auch hier wurde sie nicht fündig. Währenddessen durchwühlte Jennifer bereits die Kommode.
»Hier ist nichts. Irgendwie kann ich es einfach nicht glauben.«
»Vielleicht ist er ja gar nicht in das Geschäft gegangen, Rosie. Es ist nur eine Annahme von mir. Wahrscheinlich hat dieser Mann auch nur eine Vermutung geäußert.«
»Er hat es nicht vermutet, sondern er wusste es. Genauso wie wir es wissen«, erwiderte Rosamund tonlos. »Ich selbst hätte es zweifellos ebenfalls bemerkt, wäre ich nicht wegen des Feuers in Panik geraten. Nun, hier ist jedenfalls nichts zu finden, aber er muss die Flasche irgendwo versteckt haben. Warte!« Sie zog einen Stuhl heran, stieg hinauf und hob den Deckel der Aufsatzkommode auf dem Schrank an, die als Wäschefach genutzt wurde. Als sie darin herumtastete, stießen ihre Finger auf das, was sie suchte. Sie förderte nicht nur eine, sondern vier flache Whiskyflaschen zutage.
»Vier!« Jennifer betrachtete die leeren Flaschen angewidert. »Dabei hatte er es uns versprochen! Was nützt es?«
»Es hat keinen Sinn, weiter zu lamentieren. Wie du ganz richtig sagst, was nützt es?«
»Aber er hat es versprochen!«
»Du erinnerst dich ja wohl daran, dass er dasselbe schon früher versprochen hat. Komm, wir gehen nach unten und machen einen Tee.«
»Ich begreife nicht, wie du das so ruhig aufnehmen kannst, so gelassen!«, sagte Jennifer zu Rosamund, als sie die Treppe hinuntergingen. »Und morgen wird er es wieder bereuen! Es ist einfach widerlich!«
»Und wir werden es ihm verzeihen, wie wir es früher schon immer getan haben.«
»Ich nicht, das habe ich ihm letztes Mal gesagt. Ich verzeihe es ihm diesmal nicht!«
»Nun, du solltest Andrew heiraten. Dann kannst du das alles hinter dir lassen.«
»Sprich nicht so leichtfertig darüber, Rosie.«
Rosamund wollte gerade in die Küche gehen, doch nach dieser Bemerkung ihrer Schwester blieb sie stehen und fuhr beinahe wütend herum. »Leichfertig? Du meinst, ich sehe das leichtfertig?«
»Es tut mir Leid, aber so hast du geklungen.«
»Wie soll ich das deiner Meinung nach denn sonst aufnehmen? Soll ich mir die Haare raufen? Damit habe ich schon vor Jahren aufgehört!«
Rosamund klang fast wie eine alte Frau, nicht wie die Zweiundzwanzigjährige, die sie war, und in diesem Moment fühlte sie sich auch nicht so. Auf ihren Schultern lastete immer schon die Bürde eines schwachen, charmanten Trunkenboldes, der ihr Vater war. Langsam ging sie zu dem offenen Kamin, in dem noch die Glut brannte, und warf einige Holzscheite hinein. Dann trat sie an den Ölofen, entzündete ihn, und als die Flamme loderte, stellte sie den Wasserkessel darauf.
Jennifer saß am Tisch und stützte ihr Kinn in die Hand. Rosamund hatte sich in den Armstuhl neben dem Kamin verzogen. Keine der beiden Schwestern sprach. Sie verschmolzen mit dem Schweigen des Hauses, dem Schweigen, das seit diesen immer häufiger wiederkehrenden Vorfällen im Laufe der Jahre auf dem Haus lastete. Wie immer, wenn sie über ihren Vater sprachen, kamen die beiden Schwestern an einen Punkt, an dem sie nichts mehr zu sagen vermochten, weil der Schmerz zu stark war. Rosamund erinnerte sich noch an das erste Mal, als dieses Schweigen sich über sie gelegt hatte. Damals lebte ihre Mutter noch. Rosamund war neun gewesen, Jennifer elf und ihr Vater war so merkwürdig … blass gewesen. »Nein, Liebes, geh nicht zu Vater ins Zimmer. Er hat sehr starke Kopfschmerzen und ist ein bisschen blass.« Jennifer war gerade von einer Ballettstunde zurückgekommen, war mit ihren Ballerinas aus dem Raum getanzt und hatte die Tür laut hinter sich zugeschlagen. Rosamund war ihr in ihr Schlafzimmer nachgelaufen, um ihr zu sagen, wie gemein sie wäre, weil sie die Tür schlug, wo Vater doch so starke Kopfschmerzen hatte. Doch Jennifer hatte sie böse angefaucht. »Fang du nicht auch damit an, sonst ohrfeige ich dich! Ich habe es satt, hörst du? Blass! Warum lügt Mammi nur immer noch? Ich habe diese Heuchelei satt! Er ist betrunken, deshalb ist er blass. Er ist einfach nur betrunken!«
»Oh, sei nicht so gemein! Du bist schrecklich, Jennifer. Unser Vater ist nicht betrunken!«
»Sei nicht so kindisch!« Jennifers Tonfall war jetzt anders, ruhiger und hoffnungslos.
Rosamund hatte sich neben ihre Schwester auf das Bett gesetzt und sie hatten geschwiegen. Sie wusste, dass Jennifer Recht hatte. Die Kopfschmerzen und die Blässe ihres Vaters waren ihr immer schon irgendwie merkwürdig vorgekommen. Und in diesem Moment hatte sie vieles begriffen, vor allem, warum die Verwandten ihrer Mutter nichts mehr mit ihnen zu schaffen haben wollten. Ihre Mutter war eine geborene Monkton, und selbst ihr Vater sagte manchmal: »Vergesst nie, dass eure Mutter eine Monkton ist, etwas Besseres.« Die »Blässe«-Episoden schienen irgendwie mit dieser Bemerkung zu tun zu haben. »Eure Mutter ist eine Monkton, etwas Besseres.« Erst viele Jahre später begriff Rosamund, warum ihr Vater so redete. Er wollte damit weniger sagen, dass ihre Mutter von vornehmer Herkunft war, sondern meinte das eher als Vorwurf. Dennoch hatte er ihre Mutter geliebt, wie sie auch ihn. Trotz seiner »Blässe«-Episoden herrschte zwischen ihnen eine herzliche Leidenschaft, die bis zu dem Tag andauerte, an dem Rosamunds Mutter starb. Es hatte oft Streit gegeben, und meistens folgte einem Streit ein Umzug in eine andere Stadt. Dort arbeitete ihr Vater dann für jemanden, der seine Arbeit zu schätzen wusste. Er sagte, er würde von vorn anfangen und alles würde gut werden. Was auch durchaus im Bereich des Möglichen lag, denn Henry Morley war ein Silberschmied, ein guter obendrein. Als Junge hatte er angefangen für die Monktons zu arbeiten und bei ihren besten Handwerkern gelernt. Die Monktons waren eine berühmte Familie von Silberschmieden und Juwelieren, und sie behandelten die Männer, die für sie arbeiteten, gut. Wenn es die richtigen Männer waren. Und sie begriffen sehr schnell, dass Henry Morley der richtige Mann war. Er hatte geschickte Finger, die gut für die Feinarbeit geeignet waren, und ein Auge für Linien und Design. Er war noch jung, Anfang dreißig, als sie ihn zum Leiter einer neuen Werkstatt machten, aber die Monktons hielten ihn für den geeigneten Mann. Mit dem angemessenen Maß an Herablassung teilte ihm Arnold Monkton, das Familienoberhaupt, seine Entscheidung mit. Drei Tage später schwebte Henry Morley immer noch im siebten Himmel, als er Arnold Monktons einzige Tochter Jennifer zum ersten Mal traf. Er hatte sie zwar schon von weitem erblickt, aber sie hatten sich nicht einmal angesehen, geschweige denn, sich auch nur die Hand gegeben. Als sie sich dann zum ersten Mal begrüßten, durchfuhr es beide wie ein Blitzschlag, und das Ergebnis war ebenso katastrophal, als hätte der Blitz sie tatsächlich beide getroffen. Arnold Monkton war keineswegs ein verständnisvoller Vater, sondern er zwang seine Tochter, sich zwischen ihm und dem Emporkömmling Morley zu entscheiden.
Der Emporkömmling Morley machte sich daran, dem alten Mann zu zeigen, was er wert war, musste jedoch bald feststellen, dass dieses Vorhaben keineswegs so leicht war, wie er es sich, angespornt von Liebe und Ehrgeiz, vorgestellt hatte. Er fand zwar Arbeit, aber nur als einfacher Arbeiter in einer Werkstatt. Die Männer, die sich in diesem Gewerbe emporgearbeitet hatten, verteidigten ihre Positionen und förderten niemanden ihrer Untergebenen, der glaubte, er wüsste es besser als sie. Nachdem Henry Morley fünf Jahre lang für drei verschiedene Firmen gearbeitet hatte und sich vergeblich bemüht hatte, ihnen zu zeigen, wie gut er war, gelangte er zu der Überzeugung, dass er eine Stärkung brauchte. Er hatte schon vorher ab und zu gern einen getrunken, wenn er es sich leisten konnte, und sein Lieblingsgetränk war Whisky.
Im sechsten Jahr ihrer Ehe schenkte Jennifer ihm eine Tochter. Sie nannten das Kind nach der Mutter. Zwei Jahre später wurde ein zweites Mädchen geboren, Rosamund.
In jener schicksalhaften Nacht vor langer Zeit hatte das Schweigen irgendwann geendet. Rosamund hatte auf Jennifers Bett gesessen und zugesehen, wie ihre Schwester ihre Ballettschuhe zerfetzte, weil sie die nicht mehr brauchte. Sie hatte ihr zugehört und zu ihrem Erstaunen erfahren, dass sie seit ihrer Geburt in sieben verschiedenen Städten gewohnt hatten. Voller Entsetzen hatte ihre ältere Schwester ihr erklärt, dass ihr Vater an eben diesem Tag wieder einmal seine Arbeit verloren hatte und es bis auf weiteres keine Ballettstunden mehr geben würde. Schweigend hatte sie mitangesehen, wie Jennifer ihre zerrissenen Schuhe in die Zimmerecke geschleudert und sich anschließend aufs Bett geworfen hatte, wo sie in Tränen ausgebrochen war.
Vielleicht hatte Rosamund in diesem Moment die Verantwortung für ihre Familie übernommen, zumindest war sie in diesem Augenblick erwachsen geworden. Das musste wohl so gewesen sein, denn wie sonst hätte sie beschließen können, ihrer Mutter zu sagen, dass sie die wahre Natur der »Blässe« kannte?
Als Rosamund vierzehn war, starb ihre Mutter, und an diesem Schicksalsschlag schien Henry Morley vollkommen zu zerbrechen. Jennifer war damals sechzehn und ging von der Schule ab. Sie verkündete, sie wollte am Theater vorsprechen, und tat das auch. Immerhin bemühte sie sich um eine Arbeit. Auf dem Rückweg, vollkommen außer sich vor Freude, dass sie angenommen worden war, geschah es. Sie wurde von einem Bus angefahren. Wie sich herausstellte, war es ganz allein ihre Schuld gewesen. Die Freude, Schauspielerin werden zu können, hatte sie blind für die Umgebung gemacht und sie war direkt vor das Fahrzeug gelaufen. Sie konnte von Glück reden, dass sie ihr Bein nicht verloren hatte, aber sie musste nach dem Unfall mehrere Monate in einem Krankenhaus liegen.
Henry Morley verkam in dieser Zeit zu einer bedauernswerten oder verachtenswerten Erscheinung. Welche von beiden er war, hing jeweils davon ab, wie seine beiden Töchter ihn sahen. Für Rosamund war er eine bedauernswerte Figur, Jennifer dagegen verachtete ihn, und das nicht ohne Grund. Denn als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte sie nur an Krücken laufen und musste feststellen, dass sie schon wieder umgezogen waren. Diesmal in zwei heruntergekommene Souterrainzimmer.
Zu der entscheidenden Krise kam es in der Woche, in der Rosamund selbst die Schule verließ. Sie hatte ihre neue Arbeitsstelle drei Tage zuvor angetreten, als Aushilfskraft in einem Kindergarten, als Henry Morley von einer Erkältung niedergestreckt wurde, die sich zu einer doppelseitigen Lungenentzündung auswuchs. Und Jennifer war durch die Behinderung ihres lahmen Beines und des fragilen nervlichen Zustandes, den diese Erkrankung bei ihr verursachte, nicht in der Lage, sich um jemanden zu kümmern, nicht einmal um sich selbst.
Da die kleine Familie ständig von Stadt zu Stadt zog, hatten sie praktisch keine Freunde. Der Arzt, der ihren Vater behandelte, hätte ihre Lage vielleicht verbessern können. Er wollte seinen Patienten ins Krankenhaus verlegen, aber Henry Morley überzeugte ihn mit seiner überheblichen Haltung, an die er sich selbst im Fieberwahn noch klammerte, dass seine Töchter sehr wohl in der Lage wären, ihn zu pflegen und den Haushalt zu führen. Der Arzt sollte nicht erfahren, dass sich das Vermögen der Familie auf insgesamt drei Pfund Sterling belief, und dass keine Aussicht darauf bestand, wie sie diese Summe in absehbarer Zeit vergrößern könnten.