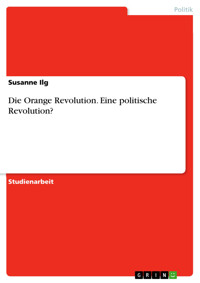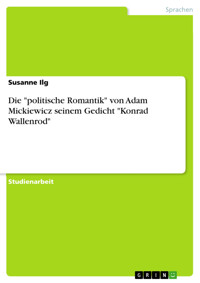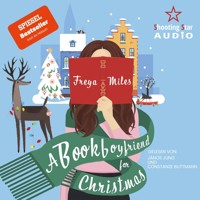Heirat und Bestattung im Judentum. Religionsanthropologische Untersuchung nach Arnold van Gennep und Victor Turner E-Book
Susanne Ilg
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Soziologie - Religion, Note: 5 (Schweizer Notengebung), Université de Fribourg - Universität Freiburg (Schweiz), Sprache: Deutsch, Abstract: Rituale begleiten die Menschen durch ihr gesamtes Leben. In ihnen spiegeln sich die Wertevorstellungen einer Gesellschaft wieder. Riten haben abhängig von ihrer Verwendungsweise verschiedene Funktionen. Ritualwissenschaftler, wie zum Beispiel Stanley Tambiah, haben differenzierte Komponenten und Funktionen als Merkmale für Rituale definiert: Das symbolische Handeln, Wiederholung, Tradition, Selbstpräsentation, Ausseralltäglichkeit, Sichtbarkeit von Wertevorstellungen, Motivation und Wirkung. Luckmann vertritt die These, dass Rituale die Handlungsform von Symbolen sind. Sie verweisen somit auf etwas, das nicht anwesend ist und sie verbindet. Rituale stellen bewährte Handlungsmuster zur Verfügung und signalisieren somit Normalität. Weiter bewahrt die Teilnahme an Ritualen vor sozialen Sanktionen und Isolation. Zum Beispiel bei einer verweigerten Initiation oder einer abgelehnten Hochzeitseinladung. Desweiteren helfen Rituale über Unsicherheiten hinweg und bieten Schutz. Es ist nicht bekannt, was den Menschen nach dem Tod erwartet. Viele Totenriten sollen den Toten helfen ihren Weg ins Jenseits zu finden und stellen sicher, dass die Hinterbliebenen vor allfälligen Rachehandlungen des Verstorbenen geschützt sind. Rituale sind auch eng mit der Tradition verbunden und bestätigen sie somit als bestehende Richtlinie. Einige Riten begleiten uns von einem Lebensabschnitt in den anderen. Diese Rituale bezeichnet Arnold van Gennep als Übergangsrituale. Mit ihnen treten wir von einem Status in den Nächsten. Nach van Gennep lösen wir uns zuerst mit Trennungsriten vom alten Status ab, dann folgen die Übergangriten und am Schluss die Angliederungsriten, die uns helfen an den neuen Status anzuknüpfen. Victor Turner entwickelt die Theorie von van Gennep weiter und legt seinen Schwerpunkt auf die Übergangsphase. Im Folgenden wird die jüdische Hochzeit und Beerdigung hinsichtlich der Theorien von Arnold van Gennep und Victor Turner analysiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Übergangsriten nach Arnold van Gennep
1.1. Heirat und Verlobung
1.2. Bestattung
2. Schwellenzustand nach Victor Turner
2.1. Communitas
2.2. Eigenschaften der Schwellenwesen
2.3. Gefahr und Macht der Schwachen
2.4. Millenarische Bewegungen
3. Jüdisches Brauchtum
3.1. Die jüdische Hochzeit
3.2. Die Bestattung
4. Auswertung
5. Bibliographie
Einleitung
Rituale begleiten die Menschen durch ihr gesamtes Leben. Ihn ihnen spiegeln sich die Wertevorstellungen einer Gesellschaft wieder.[1] Riten haben abhängig von ihrer Verwendungsweise verschiedene Funktionen. Ritualwissenschaftler, wie zum Beispiel Stanley Tambiah, haben differenzierte Komponenten und Funktionen als Merkmale für Rituale definiert: Das symbolische Handeln, Wiederholung, Tradition, Selbstpräsentation, Ausseralltäglichkeit, Sichtbarkeit von Wertevorstellungen, Motivation und Wirkung. Luckmann vertritt die These, dass Rituale die Handlungsform von Symbolen sind. Sie verweisen somit auf etwas, das nicht anwesend ist und sie verbindet. Rituale stellen bewährte Handlungsmuster zur Verfügung und signalisieren somit Normalität. Weiter bewahrt die Teilnahme an Ritualen vor sozialen Sanktionen und Isolation. Zum Beispiel bei einer verweigerten Initiation oder einer abgelehnten Hochzeitseinladung. Des Weiteren helfen Rituale über Unsicherheiten hinweg und bieten Schutz. Es ist nicht bekannt, was den Menschen nach dem Tod erwartet. Viele Totenriten sollen den Toten helfen ihren Weg ins Jenseits zu finden und stellen sicher, dass die Hinterbliebenen vor allfälligen Rachehandlungen des Verstorbenen geschützt sind. Rituale sind auch eng mit der Tradition verbunden und bestätigen sie somit als bestehende Richtlinie.[2] Emile Durkheim betonte die integrative Funktion von Ritualen. Viele richten sich an eine oder mehrere Gottheiten und diese sind ein Ausdruck der Gesellschaft. Somit integrieren die Riten einzelne Individuen in die Gesellschaft und stärken die Gruppenidentität. Die Menschen verehren somit ihre eigenen Werte, Normen und Ordnung.[3] Einige Riten begleiten uns von einem Lebensabschnitt in den anderen. Diese Rituale bezeichnet Arnold van Gennep als Übergangsrituale. Mit ihnen treten wir von einem Status in den Nächsten. Nach van Gennep lösen wir uns zuerst mit Trennungsriten von alten Status ab, dann folgen die Übergangriten und am Schluss die Angliederungsriten, die uns helfen an den neuen Status anzuknüpfen. Victor Turner entwickelt die Theorie von van Gennep weiter und legt seinen Schwerpunkt auf die Übergangsphase.[4] Im Folgenden wird die jüdische Hochzeit und Beerdigung analysiert hinsichtlich der Theorien von Arnold van Gennep und Victor Turner.
1. Übergangsriten nach Arnold van Gennep
Übergangsriten sind nach Arnold van Gennep Riten, die den Übergang von einem sozialen Zustand in einen anderen begleiten. Als Beispiel nennt er die Heirat oder die Taufe. Innerhalb dieser Ritengruppe lassen sich drei Unterkategorien feststellen: Trennungsriten, Schwellen- bzw. Umwandlungsriten und Angliederungsriten. Alle Übergangsriten durchlaufen also nach van Gennep diese drei Phasen. Die Trennungsriten stehen für die Ablösung von dem alten Status. Die Schwellen- bzw. Umwandlungsphase ist ein Zwischenstadium, wobei die Schwellenriten sich auf einen Raumwechsel beziehen und die Umwandlungsriten auf einen Zustandswechsel. Die Angliederungsriten führen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft beziehungsweise zum Erlangen des neuen Status. Diese Phasen sind nicht in jeder Gesellschaft gleich ausgebildet und nicht in jeder Zeremonie gleich gewichtet. Für Van Gennep ist jedoch klar, dass zum Beispiel in einer Hochzeit nicht ausschliesslich Übergangsriten vorhanden sind. In einer Hochzeitszeremonie sind oft Fruchtbarkeitsriten enthalten und in Geburtszeremonien Schutz- und Divinationsriten. Alle diese Riten treten in Verbindung mit Übergangsriten auf und sind häufig so eng mit ihnen verflochten, dass die Unterscheidung zwischen Trennungs- und Schutzritus schwierig sein kann.[5]
1.1. Heirat und Verlobung
Die Heirat stellt den wichtigsten Übergang von einem sozialen Status in einen anderen dar, weil hiermit ein Familien-, Klan- und vielleicht sogar ein Dorfwechsel verbunden ist. Wenn ein Ortwechsel notwendig ist, wird dies in der Hochzeitszeremonie durch Trennungsriten zum Ausdruck gebracht, die auf den räumlichen Übergang Bezug nehmen. Da bei einer Hochzeit viele Gruppen betroffen sind, ist verständlich, dass vorher eine Übergangszeit besteht, die Verlobung. Bei vielen Völkern ist die Verlobung ein selbständiger und wichtiger Teil der Hochzeitszeremonie und umfasst ein komplexes Gebilde aus verschiedenen Trennungs-, Umwandlungs- und Angliederungsriten. Die danach folgende Hochzeit besteht dann im Wesentlichen nur noch aus Angliederungsriten.