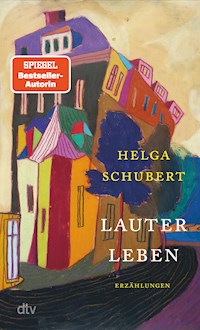16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bücher meines Lebens
- Sprache: Deutsch
Wie hilft uns Literatur in den dunkelsten und einsamsten Momenten des Lebens? Und wie schreibe ich selbst über den Schmerz ohne Pathos, einfach und klar? Helga Schubert hat so viel bei Anton Tschechow gelernt. Über das Leben und das Schreiben. Helga Schubert erzählt in diesem persönlichen, traurig-schönen Buch von ihrer ersten Begegnung mit Tschechow, ihrer ersten Lektüre seiner Erzählung »Gram«, die sie erschüttert und gerettet hat. Sie schaut genau: Wie hat er das gemacht? Was ist die Kunst seines Schreibens, wie funktioniert sein Handwerk? Sie berichtet von seinem Leben, davon, wie er als Arzt für seine Patienten, wie er als Familienmensch für seine Eltern und Geschwister da war. Wie er die Gesellschaft anderer brauchte für seine Geschichten, und wie sie ihn vom Arbeiten abhielt. Es war ein Leben zwischen Überforderung und Mitleid mit allen, mit den Menschen, den Tieren, der Kreatur. Helga Schubert war auf Spurensuche in Jalta auf der Krim, in Moskau und in ihrem eigenen Leben und Schreiben. Entstanden ist ein unglaublich intensives, literarisches Porträt ihres Tschechows.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Helga Schubert
Helga Schubert über Anton Tschechow
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Helga Schubert
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Helga Schubert
Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, studierte an der Humboldt-Universität Psychologie. Sie arbeitete als Psychotherapeutin und freie Schriftstellerin in der DDR und bereitete als Pressesprecherin des Zentralen Runden Tisches die ersten freien Wahlen mit vor. Nach zahlreichen Buchveröffentlichungen zog sie sich aus der literarischen Öffentlichkeit zurück, bis sie 2020 mit der Geschichte ›Vom Aufstehen‹ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann.
Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Heidelberg und Berlin. Er war Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ist seit 2015 Autor beim SPIEGEL und Gastgeber des »Literarischen Quartetts« im ZDF. Zuletzt erschien von ihm »Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft« und »Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen« über die Münchner Räterepublik.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wie hilft uns Literatur in den dunkelsten und einsamsten Momenten des Lebens? Und wie schreibe ich selbst über den Schmerz ohne Pathos, einfach und klar? Helga Schubert hat so viel bei Anton Tschechow gelernt. Über das Leben und das Schreiben.
Helga Schubert erzählt in diesem persönlichen, traurig-schönen Buch von ihrer ersten Begegnung mit Tschechow, ihrer ersten Lektüre seiner Erzählung »Gram«, die sie erschüttert und gerettet hat. Sie schaut genau: Wie hat er das gemacht? Was ist die Kunst seines Schreibens, wie funktioniert sein Handwerk? Sie berichtet von seinem Leben, davon, wie er als Arzt für seine Patienten, wie er als Familienmensch für seine Eltern und Geschwister da war.
Wie er die Gesellschaft anderer brauchte für seine Geschichten, und wie sie ihn vom Arbeiten abhielt. Es war ein Leben zwischen Überforderung und Mitleid mit allen, mit den Menschen, den Tieren, der Kreatur. Helga Schubert war auf Spurensuche in Jalta auf der Krim, in Moskau und in ihrem eigenen Leben und Schreiben. Entstanden ist ein unglaublich intensives, literarisches Porträt ihres Tschechows.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © André Gilden/Alamy Stock Foto
ISBN978-3-462-31073-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Eine Brücke zu Anton Pawlowitsch Tschechow
Ein Nachsatz
Lebensdaten
Vorwort
Im Grunde geht es nur um den einen Schritt, den wir nicht gehen. Davon erzählt Helga Schubert auf den hier folgenden Seiten. Von dem einen Schritt in den Abgrund, den sie nicht gegangen ist. Stattdessen wählte sie den anderen, den lebensrettenden Schritt zurück. Das vermag Literatur zu bewirken.
Das vermochte in Helga Schuberts Fall eine besonders kurze, eine, wie ich finde, besonders traurige Geschichte, die Anton Tschechow schrieb. Sie heißt »Gram« und Sie werden gleich von ihr lesen. Sie handelt von der Eile der Menschen, von unserer Gleichgültigkeit und einem Schmerz, der nicht auszuhalten ist. Es sei denn, wir können davon erzählen.
Helga Schubert hat viele Stunden in ihrem Leben zugehört. Während ihrer Berufszeit als klinische Psychologin hörte sie Geschichten über Geschichten. Und musste sie alle für sich behalten. Schweigepflicht. Berufsgeheimnisse in schier endloser Zahl. Was macht ein Mensch mit all dem Schweigen? Helga Schubert haben die Geschichten geholfen, die Menschen zu verstehen. Und sich selbst.
»Ein Leben lang habe ich Menschen ein Haus gebaut«, sagt sie. Dabei laufe man Gefahr, sich selbst zu vergessen. Irgendwann finde man um sich herum lauter Häuser und sei selbst schutzlos der Natur ausgeliefert.
In ihrem Buch »Vom Aufstehen« berichtete Helga Schubert von ihrer Vergangenheit und wie sie oft Sätze voller Missgunst denken musste, Sätze, die sie »wie eine Giftwolke« umwehten. Im Alter, fügte sie hinzu, sei das anders. Sie habe über Jahrzehnte Gutes eingesammelt, Erinnerungen, Fantasien, Liebe, Wärme, Bilder und Sonaten. Das ist ihr Schatz. Das ist das Haus, das sie sich gebaut hat.
Wer Helga Schuberts Bücher gelesen hat oder gar das Glück hatte, sie persönlich kennenzulernen, der weiß um die Kraft dieses Schatzes, ihren Willen zum Glück, die ganze gute Energie, die sie in sich trägt und weitergibt. Es wirkt bei ihr oft so, als wäre das ganz leicht. Einfach der Anweisung jener afrikanischen Weisheit folgend, die als Postkarte lange Jahre auf ihrem Schreibtisch stand: »Wende dein Gesicht der Sonne zu, so fallen die Schatten hinter dich.«
Helga Schuberts Buch über ihren Tschechow erzählt von alldem – ihrem Lesen, ihren Spurensuchen und den Ermutigungen, die sie aus den alten Texten gewann. Und von dem Moment, in dem sie beschloss, in ihren Geschichten all das zu erzählen, was ihr in den Berichten ihrer Patienten und in ihrem eigenen Leben als absurd oder veränderbar erschien.
Denn darauf kommt es an – durch Hören, Lesen und Erzählen –, die Veränderbarkeit der inneren Welt, die Veränderbarkeit unseres Lebens zu erfahren.
Volker Weidermann
Eine Brücke zu Anton Pawlowitsch Tschechow
Ganz kalt soll man sein beim Schreiben, mahnte er, beim Schreiben von Literatur wohlgemerkt, denn beim Schreiben seiner Liebesbriefe war er nicht kalt: Anton Pawlowitsch Tschechow.
Von 1860 bis 1904 hat er gelebt, in Russland, im zaristischen Russland, nur 44 Jahre.
Nur 44 Lebensjahre. So, als ob ich schon 1984 gestorben wäre: Erst fünf Jahre später die Maueröffnung, ein Jahr danach das Ende der DDR mit ihrem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland, das Ende des Kalten Krieges und der Friedensnobelpreis für Michail Sergejewitsch Gorbatschow, den letzten Staatspräsidenten der Sowjetunion, und dann 1991, die Auflösung der Sowjetunion (Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen stand zu DDR-Zeiten in weißer Schrift auf den roten Transparenten an Häuserwänden oder bei der Maidemonstration) und im selben Jahr die Unabhängigkeit der Republik Ukraine, das alles hätte ich nicht erlebt, wenn ich wie Tschechow mit 44 Jahren gestorben wäre. Und ich hätte auch nicht erlebt, dass 38 Jahre nach meinem Tod Russland einen Krieg mit der Ukraine beginnt.
Eigentlich war ich im Schreiben eines ganz anderen Buches gefangen, als ich gefragt wurde, ob ich in einer neuen Buchreihe, in der Schriftsteller über ihren liebsten Schriftsteller nachdenken, auch ein kleines Buch schreiben möchte, ein ganz kleines.
Mir fiel sofort dieser russische Schriftsteller ein.
Und ich sagte Ja, ohne zu überlegen. In dem Moment begann mein Fremdgehen beim Schreiben. Zum ersten Mal, denn sonst grüble ich immer nur an einem Text herum. Ich bekam ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Buch, an dem ich bis dahin arbeitete. Ich könnte ja am Tag über Tschechow schreiben und in der Nacht an meinem Buch über Liebe und Tod. Das kleinere Buch über Tschechow wird eine Huldigung, nahm ich mir vor, ich erzähle einfach, was ich diesem Autor an Verständnis für Disziplin und Technik und das Verhältnis vom ersten zum letzten Satz verdanke, erzähle von meinem Besuch in den Gedenkstätten noch zu Sowjetunion-Zeiten, auf der Krim, in Moskau und in Melichowo.
Tschechow schrieb auch an verschiedenen Texten gleichzeitig, beruhigte ich mich. Zum Beispiel berichtete er in einem Brief vom 27. Mai 1891 an den Zeitungsredakteur Alexej Sergejewitsch Suworin: Montags, dienstags und mittwochs schreibe ich an dem Buch über Sachalin, an den übrigen Tagen, mit Ausnahme von Sonntag, an dem Roman, und sonntags kleine Erzählungen.Ich arbeite mit Lust …[1]
Das klang doch organisiert.
Aber schon 17 Tage später schrieb er ihm: In meiner literarischen Arbeit herrscht ein solches Drunter und Drüber, dass selbst der Teufel sich darin ein Bein brechen würde. Ich hatte mit einer Novelle angefangen – da kam das Ausland dazwischen; die Novelle weiterzuschreiben habe ich jetzt nicht die Zeit – ich habe Sachalin am Hals.[2]
Drei Tage später besuchte ihn dieser Redakteur, zwei Wochen später eine Freundin. Tschechow schickte am 16. Juni die Erzählung »Weiber« an den Redakteur mit den Worten: Von der Sachalinarbeit haben mich nicht die Muse der Rache und des Kummers und nicht der Durst der süßen Klänge fortgerissen … Ich sitze buchstäblich ohne einen Groschen da.[3]
Bereits am 25. Juni erschien die Erzählung in der Tageszeitung »Nowoje wremja« (Neue Zeit), und Tschechow erhielt sein bescheidenes Zeilenhonorar. Kurz darauf erhöhte der Redakteur dieses Honorar sogar um fünf Kopeken, und Tschechow arbeitete an der nächsten Erzählung »Das Duell«. Doch es kam wieder eine andere Dame zu Besuch.
Immer ist es der Tschechow der anderen, dachte ich.
Alle haben ein Bild von ihm:
Der Autor mit dem gütigen Blick unter dem Kneifer.
Der Arzt, der Cholerabaracken und Schulen für Arme baute.
Der Russland aufrüttelte durch seinen Bericht über die Sträflingsinsel Sachalin, sodass sogar eine Regierungsdelegation dorthin aufbrach.
Seine Stücke als Vorläufer des absurden Theaters.
Seine Kurzgeschichten, Erzählungen und Dramen gehören zu dem Schönsten und Vollkommensten in der russischen Literaturheißt es auf dem Lesezeichen im Buch.
… und wir können nur auf ihn blicken, steht auch auf dem Lesezeichen, und das ist ein Ausspruch von Sean O’Casey, und seiner sanften Stimme lauschen, in der die Musik der Barmherzigkeit und der Wahrheit klingt.
Nie war es also mein Tschechow, immer der der anderen. Ich kam mir vor wie ein Eindringling in den Kreis Erwachsener: Thomas Mann, Natalia Ginzburg und auch Peter Urban standen um ihn.
Vor allem Peter Urban, der alle Werke Tschechows ins Deutsche neu übersetzte, die Briefe in fünf Bänden herausgab und dann eine Lebenschronik, Tag für Tag, verfasste.