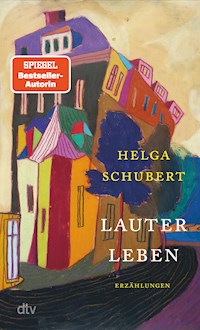9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Diktatur ist die Täterin." Judas als Frau, Frauen als Verräterinnen – in ihrem dokumentarischen Werk erzählt Helga Schubert von zehn Frauen, die im Dritten Reich zu Denunziantinnen geworden sind. Aus Gerichtsakten rekonstruiert die Autorin die tödliche Beziehung der Verräterinnen zu ihren Opfern, geht mit den Mitteln der Literatur auf eine Spurensuche nach weiblicher Täterschaft und destilliert daraus irritierende Parabeln des Verrats. Diesen Verrat hat Helga Schubert »aufgehoben wie ein verwelktes Blatt. Und wie unter einem Mikroskop sah ich eine Struktur, die sich immer und immer und immer wiederholt.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Helga Schubert
Judasfrauen
Zehn Fallgeschichten weiblicher Denunziation im Dritten Reich
Mit einem aktualisierten Vorwort der Autorin
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Die Diktatur ist die Täterin oder Nicht in meinem Namen
Vor einiger Zeit erreichte mich der Brief einer Leserin, die fragte, was aus der Verräterin des Pianisten Karlrobert Kreiten geworden sei. Eine der zehn Judasfrauen aus diesem Band also. Das erfuhr ich tatsächlich, auf einer Lesung …
Dieses Buch erschien zuerst im Frühling 1990, in diesem wunderbaren politischen Frühling, im Westen. Im Westen und nicht im Osten, wo ich es schon zwei Jahre zuvor beim Aufbau-Verlag abgegeben hatte. Recherchiert und geschrieben und daraus vorgelesen in Studentengemeinden der evangelischen Kirche innerhalb der geschlossenen DDR habe ich die Erzählungen 1984 bis 1988. Das erste Vorwort schrieb ich im August 1989. Da gab es die DDR noch, da gab es die Mauer noch, da gab es die Zensur, das System der Druckgenehmigung, die Diktatur der herrschenden Partei SED mit ihrem sogenannten Schild und Schwert, dem Staatsicherheitsdienst, aber auch die Besetzung der DDR-Botschaft in Prag durch DDR-Bürger, die für immer aus diesem Land ausreisen wollten, weil sie genau so nicht mehr leben wollten.
Spitzel und Verräter aus der DDR-Zeit konnte ich ja nicht beschreiben, denn deren Akten waren erst nach dem Ende der DDR zugänglich. Und dieses baldige Ende war im August 1989 noch nicht absehbar.
Dass ich mich entschieden hatte, von Denunziationen der NS-Zeit zu erzählen, hatte drei künstlerische Vorteile:
Mit den Einzelheiten aus den Gerichtsakten konnte ich ein politisches Terror-System in der deutschen Geschichte in seinen Alltagsbezügen erzählen, das schon nach zwölf Jahren moralisch am Ende war, ausgelöscht, nachdem es einen Weltkrieg verschuldet und Millionen Opfer gefordert hatte. Ich konnte die Rolle der Geheimpolizei schildern und den Verrat im Persönlichen. Und zweitens konnte ich schildern, dass sich Täter in einer Diktatur gar nicht so sicher sein können, dass sie nicht doch einmal vor einem weltlichen Gericht angeklagt und verurteilt werden, wenn die Macht, der sie dienen, bankrott ist. Drittens reizte mich diese strenge Form der Darstellung, die sich an die Fakten des Verrats hält, aber exemplarisch menschliche Tragik und Verwicklung und Ambivalenz darstellen kann.
Unter den Hunderten Akten der Gerichtsverfahren gegen männliche Täter fand ich die wenigen Verfahren gegen Frauen. Warum nahm ich sie, werde ich immer wieder gefragt. Weil ich an ihrem Schicksal die Unmenschlichkeit der totalitären Gesellschaft noch deutlicher beweisen konnte: Sie mussten es nicht tun. Es war so leicht, kein Gericht, keine Zeitung erfuhr es. Es war im Sinne der Autorität. Gerade von Frauen erwartet niemand diese Gefahr.
Judas ist der Mensch, den ich beim Schreiben vor Augen hatte: der sein Opfer liebt, der es verrät, der einen Lohn dafür erhält, der sich erhängt, als er Christus sterben sieht. Den Frauen in diesem Buch tat es vielleicht auch leid, dass der Vater, der Ehemann, der unerreichbare abweisende verehrte Mann nach ihrem Verrat starben. Spätestens kam die Reue, als sie vor dem Nachkriegsgericht standen. Es steht mir nicht zu, die beschriebenen Frauen zu verurteilen. Ich glaube, dass auch sie Opfer der Diktatur waren. In demokratischen Verhältnissen hätten sie für andere Menschen nicht todbringend werden können. Sie konnten der Versuchung zum Verrat nicht widerstehen. Ich habe ihren Verrat nur aufgehoben wie ein verwelktes Blatt. Und wie unter einem Mikroskop sah ich eine Struktur, die sich immer und immer und immer wiederholt.
Aber ich sah auch bei jedem neuen Verrat eine Variante, entdeckte Menschen, die den Verrat nicht unterstützten, ihn sogar insgeheim verhindern wollten.
Manchmal entdeckte ich eine tragische Verstrickung der Verräterin, hatte Mitleid mit ihr.
Jedes Mal grübelte ich wie vor einem Rätsel und war erst erleichtert, wenn ich die Lösung gefunden hatte. Das Leben dieser Frauen und der Tod ihrer Opfer sind unlösbar miteinander verbunden. Ich habe Beispiele erzählt, Parabeln über verständliche Motive und unlautere Mittel.
Die Namen der Frauen und auch der meisten Opfer habe ich unkenntlich gemacht. Nur drei der Opfer nenne ich mit ihrem wirklichen Namen, den Pianisten Karlrobert Kreiten, den katholischen Pater Dr. Max Josef Metzger und den Politiker Dr. Carl Goerdeler, stellvertretend für die andern, die in einer Diktatur auf deutschem Boden ihre Menschlichkeit oder ihre skeptische demokratische Grundhaltung bewahrten.
Gerade heute, 2021, also ungefähr achtzig Jahre, nachdem diese Geschichten spielen, sollten wir uns von ihnen emotional angreifen lassen. Weil die Diktatur eine furchtbare, eine Grauen erregende, eine verführerische, Leben zerstörende Täterin ist, weil sie sich tarnt, weil es so viele potenzielle Untertanen gibt, die sich das Leben unter ihrer Herrschaft einfacher vorstellen, weil es Menschen in Deutschland gibt, die die offene Gesellschaft nicht schätzen, die sie verkennen in ihrem transparenten Bemühen, unterschiedliche Interessen auszugleichen.
Nicht in meinem Namen, möchte ich mit diesem Buch sagen. Wenn ihr die offene Gesellschaft, in der wir alle mehr davor geschützt sind als in der Diktatur, zu Tätern zu werden, weil die Gerichte angerufen werden können und die Presse darüber berichtet, wenn ihr diese offene Gesellschaft verächtlich macht, dann sage ich:
Nicht in meinem Namen.
Nach einer Lesung im Jahr 1990, also nicht in der öffentlichen Diskussion in der Buchhandlung, nahm mich eine ältere Dame zur Seite und vertraute mir an, dass die Verräterin des jungen Pianisten Kreiten, die Freundin seiner Mutter, in ein brennendes Haus lief und dort verbrannte, als sie von seiner Hinrichtung erfahren hatte.
Also ein weiblicher Judas, eine Judasfrau, im wahrsten Sinne des Wortes, die sich selbst richtete, so wie der Jünger Judas aus dem Neuen Testament, nachdem er seinen Herrn verraten hatte und seine Kreuzigung sah.
Eine Frau, die leibhaftig sah, was sie angerichtet hatte, die sich vielleicht schämte und der es vielleicht leidtat.
So wie allen Frauen in diesem Buch.
Neu Meteln im Sommer 2021 Helga Schubert
Spitzel und Verräter
Ein Spitzel verhält sich zum Verräter wie ein Mörder zum Totschläger.
Wie der Mörder handelt der Spitzel mit Vorsatz: Er will über seinen Nächsten berichten. Er muss es, darum sieht er ihn so aufmerksam an.
Ein Verräter dagegen erzählt einem interessierten Behördenangestellten, was er vielleicht schon länger weiß. Er hat es bisher für sich behalten. Jetzt will er sich rächen, oder er wird zur Aussage gezwungen.
Vielleicht ist er durch Zufall zu seinem gefährlichen Wissen gekommen?
Wenn ich das nicht anzeige, sagt sich der Verräter womöglich, wird es auch für mich selbst zur Gefahr.
Oder er fürchtet sich vor Demütigung, vor körperlichem Schmerz, davor, dass er geschlagen werden könnte beim Verhör, wenn er nicht verrät, was er weiß.
Ich darf zurück ins Dunkle, ins Ruhige, wenn ich jetzt verrate, sagt er sich und verrät.
Oder er bleibt standhaft bis zur Androhung der Folter.
Oder er bleibt standhaft, bis sie ihn foltern. Und wird dann schwach.
Wer wirft den ersten Stein?
Der Spitzel dagegen verstellt sich. Niemand würde ihm sonst etwas anvertrauen. Der Spitzel muss sich verstellen: eine andere Meinung vortäuschen, über einen verbotenen Witz lachen, selbst einen erzählen. Er muss einen Köder legen.
Aber vielleicht hat der Spitzel gar keine andere Meinung als sein Opfer? Vielleicht ist er darum so überzeugend, gleich gesinnt und kritisch? Vielleicht lacht er deshalb so vergnügt über den Witz? Nur seine schnellen beobachtenden Augen dabei:
Wer hat den Witz erzählt? Von wem hat er den Witz? Wer lacht? Wer will ihn wem weitererzählen?
Wer soll noch darüber gelacht haben?
Wer hat einen ähnlichen Witz wo wann wem erzählt?
Der Spitzel muss nüchtern bleiben, darf sich nicht vergessen, nicht überlassen. Er darf seine Opfer nicht lieben. Ganz innen muss er immerzu hinhören, hinhören. Spöttische Blicke muss er bemerken.
Der Spitzel muss registrieren:
Wer sagt nichts?
Wer sagt an welcher Stelle nichts? Wer sieht einen anderen belustigt an? Bei welcher Gelegenheit? Wie sieht der andere zurück? Wen sieht er noch an? Wer senkt die Augen?
Wer könnte den Spitzel erkennen, ertappen bei einem beobachtenden Blick? Wer könnte misstrauisch werden? Wer könnte die andern warnen? Wer könnte sich später erinnern an das heutige gefährliche Gespräch, an alle Beteiligten und an den Spitzel, der als erster, als einziger aus dem Gefängnis entlassen wurde?
Ein Spitzel muss wachsam sein. Seine Feinde sind seine Auftraggeber. Seine Feinde sind seine Opfer. Und seine Feinde sind die, die später herausfinden, dass er dabei war und nicht bestraft wurde.
Das Später, das Nachher ist die Gefahr für den Spitzel. Er muss sich für das Nachher rüsten, muss alle Schuldbeweise vermeiden, einen Decknamen führen in den Aktenvermerken der Polizei.
Aber wenn der Beamte der Geheimen Polizei sich später vor Gericht erinnert? Ganz genau erinnert an ihn, den Spitzel? Und das beschwört?
Ein Nachher gibt es nämlich immer, jede Ära hat ein Ende. Und wehe ihren Spitzeln, wenn sie nicht vorsorgen. Denn sie wissen doch, oft sogar von ihren Opfern – die überzeugenden Argumente erscheinen immer wieder in den Berichten –, dass es ein Nachher gibt. Und nur dafür, nur für die genauen Berichte mit den überzeugenden Argumenten, gibt es die Belohnung: Geld oder etwas Wertvolleres als Geld, einen Reisepass, eine Ausnahme, die Erfüllung eines Wunsches, die Villa, das Automobil, die Wohnung, die Straferleichterung, die vorzeitige Begnadigung.
Aber warum lässt sich das Opfer von seinem Spitzel beobachten? Warum bittet es ihn in seine Wohnung? Warum besucht es ihn? Warum vertraut es ihm ein gefährliches Geheimnis an?
Was für ein Mensch ist das Opfer? Ein vertrauensvoller? Ein in sich gekehrter? Einer ohne schlechte Erfahrungen? Einer, der endlich einmal nicht mehr misstrauen will? Endlich vertrauen? Müde vom aufmerksamen Sichern? (Sprich leise, sprich bitte von etwas anderm, sieh dich vor, woher kennst du den, den du gestern mitbrachtest?)
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, heißt das achte Gebot. Aber Spitzel und Verräter sagen doch die Wahrheit?
»Ein Verleumder verrät, was er heimlich weiß. Aber, wer eines getreuen Herzens ist, verbirgt es«, steht in den Sprüchen Salomos.
»Der Verräter offenbart des Nächsten Heimlichkeit«, heißt es in den Katechesen über den kleinen Katechismus Luthers von einem Herrn Pastor Albrecht in Recknitz. Drucken ließ er das Buch 1894 in Güstrow. Delila sei zur Verräterin an ihrem Mann geworden, denn sie habe den Philistern gesagt, worin seine Kraft lag. Das wollte Simson natürlich geheim gehalten haben.
Und Judas verriet den Hohepriestern, wo sie Jesus gefangen nehmen konnten. Dass er sich erhängte, als er seinen Herrn gekreuzigt sah, habe ich erst als erwachsene Frau wahrgenommen. Im Religionsunterricht, in der Kirche, in der Osterzeit, im Konfirmandenunterricht, beim Anblick des Gekreuzigten am Altar oder als Kruzifix an goldener Kette am Hals einer Frau dachte ich nie an die Schuld des Judas, war vielmehr traurig, hatte Mitleid mit Jesus, weil sein Vater ihn verlassen hatte. Judas hielt ich schon immer für eine Nebenfigur, eine austauschbare. Ein Verräter findet sich immer, rausgekommen wäre es doch, wo Jesus war, dachte ich, zumal er ja selbst gar nichts tat, um sich zu verbergen.
Aber dass sein Vater ihn nicht bewahrte.
Geborgenheit, so denke ich auch heute, ist nicht von Dauer, kann entzogen werden. Man kann verraten werden und alleingelassen. Von heute auf morgen.
Aber, fragte der Pastor vor fast einhundert Jahren in seinem Buch, und das war fünfzig Jahre vor den Prozessen am Volksgerichtshof: »In welchem Fall darf und muss ich sogar sagen, was ich von meinem Nächsten heimlich weiß, zumal wenn es Böses ist?«
Fett gedruckt steht als Antwort: »Wenn die Obrigkeit, oder die mir sonst vorgesetzt sind, es befehlen.«
»Ja, es gibt Fälle«, schreibt der Pastor, »wo man des Nächsten Heimlichkeit offenbaren muss, ohne dass und ehe noch die Vorgesetzten es befehlen: Wenn du zum Beispiel erfährst, dass dein Nächster irgendetwas Böses tun will, sollst du das ruhig geschehen lassen?
Nein, ich soll ihn ernstlich und freundlich davon abmahnen. Was willst du aber tun, wenn er sich nicht abmahnen lässt?
So will ich es der Obrigkeit, oder denen, die ihm sonst vorgesetzt sind, anzeigen.«
Aber es gibt doch notwendige Anzeigen. Stell dir vor, du erkennst einen Menschen von einem Fahndungsfoto wieder, er sitzt mit dir im gleichen Zugabteil. Und in der Zeitung hat die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung gebeten.
Es käme darauf an, weshalb sie ihn suchen. Wenn es dabeistünde?
Könntest du dir denn etwa einen andern Grund denken, als dass die Gesellschaft, auch du, vor ihm geschützt werden muss? Es ist in deinem ureigensten Interesse, dass er gefangen wird.
Warum fragst du, warum siehst du mich so an?
Judasfrauen
Von Frauen verraten.
Von Männern verhaftet, von Männern verhört, von Männern verurteilt, von Männern geköpft. Aber von Frauen verraten.
Ein leiser Verrat.
Ein heimlicher und sauberer Verrat. Kein Blut an den zarten Händen, das Blut klebte am Fallbeil.
Frauen, die andere Menschen durch ihren Verrat töteten. Was waren das für Frauen?
Fühlst du dich denn überhaupt befugt, über so etwas zu schreiben? Das sollen doch die machen, die das miterlebt haben, die im KZ waren oder in der Emigration.
Du bist ja nicht einmal die Tochter von Betroffenen. Du bist kein Kind jüdischer Eltern, und deine Mutter war keine Politische im Zuchthaus.
Schreib über das, was dich selbst betrifft: die Flucht aus Hinterpommern.
Schreib über die Mütter, die damals mit euch geflohen sind. In den Trecks, in den Lkws am Ostseestrand, ohne Scheinwerfer, und auf der Straße oben das drohende Gebrumm der russischen Panzer. Diesen Frauen müsstest du ein Denkmal setzen.
Ja, du hast recht, antwortete ich meiner Mutter. Aber ich bin auch eine Deutsche, und ich bin auch eine Frau. Was bewog diese Frauen zum Verrat? Sie wussten doch, dass er tödlich ist.
Ist das nicht gefährlich – du musst dich mit dem Leben dieser Frauen beschäftigen, um sie beschreiben zu können. Am Ende bekommst du noch so etwas wie Verständnis für diese Subjekte. Ein anständiger Mensch hat doch eine natürliche Hemmschwelle und denunziert nicht.
Ja. Aber wo liegt der Unterschied zwischen der Frau, die über diese Hemmschwelle springt, und der, die davor stehen bleibt? Könnte ich an ihrer Stelle sein?
Warum sprichst du eigentlich dauernd von Frauen? Als ob es nicht auch unter den Männern Denunzianten gäbe. Willst du deinen Geschlechtsgenossinnen eins auswischen?
Mich stört die Frauenveredelung: So sensibel, so zart, so kooperativ, so mütterlich, so mitleidig, so kreativ, so authentisch sind wir nicht. Wir sind auch böse und auch gefährlich, auf unsere Weise. Sobald ein Mensch auf einem Sockel steht, möchte ich den Sockel zerschlagen.
Mich müssen Sie nicht fragen, sagte die Historikerin. Ich bin keine gute lebende Quelle für Sie, weil ich historisch denke und alles, was ich erlebt habe, historisch einordne.
Zum Beispiel werde ich skeptisch, wenn Leute von ihren mutigen Handlungen berichten: Sie erzählen nicht die ganze Wahrheit, bauschen auf, verschweigen, und das ist ja auch verständlich. Ich würde an Ihrer Stelle nicht alles glauben.
Außerdem fragen Sie nicht die richtigen Leute. Sie bekommen Antworten von Leuten, die auf der falschen Seite stehen. Die haben gar nichts gemacht gegen Hitler, diese Leute nicht.
Sehen Sie, ich habe vor dem Kriegsende als Sekretärin bei einem Mann gearbeitet, der war in die Pläne um den 20. Juli 1944 eingeweiht. Ich habe das erst nach dem Krieg erfahren und frage mich noch heute: Warum hatte er kein Vertrauen zu mir? Er hätte mich doch einweihen können.
Gehen Sie zum Vorsitzenden der Hausgemeinschaftsleitung: Er nennt Ihnen die alten Antifaschisten, die hier in der Nähe wohnen. Dann brauchen Sie nicht beim Fahrstuhlfahren die alten Frauen so unsystematisch zu befragen. Warum schreiben Sie eigentlich nicht über die Trümmerfrauen? Hier im Haus wohnt eine.
Müssen Sie das lesen? Oder lesen Sie das freiwillig?, fragte mich meine Nachbarin im Wartezimmer des Frauenarztes, nachdem sie den Titel des Buches registriert hatte, das ich gerade las: ›Frauen unterm Hakenkreuz‹.
Beides, antwortete ich.
Möchten Sie weiterlesen, oder möchten Sie sich ein wenig mit mir unterhalten?, fragte sie da.
Ich legte das Buch auf den Schoß und sah sie an.
Sie sei Mitverfasserin des Weißbuchs über Globke gewesen – jetzt sei sie ja Rentnerin – und habe Unterschriften von Nazigrößen überprüft. Dann erkundigte sie sich nach meiner Arbeit.
Ich berichtete von meinem Interesse an politischen Denunziantinnen. Sie überlegte: In meinem Hochhaus wohnen einige interessante alte Genossen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein Gespräch mit einer Genossin vermitteln, die bei Hitler im Zuchthaus saß als KPD-Kassiererin und nach dem Krieg bei uns lange Jahre Richterin war.
Auch in der Stalinzeit?, fragte ich.
Sie habe ohne Unterbrechung gearbeitet.
Und ist sie denunziert worden? Oder hat sie jemanden verraten?
Beides nicht. Aber sie könnte Ihnen erklären, wie Sie die damalige Zeit zu verstehen haben.
Seitdem ich wusste, dass auch in der DDR Akten des Volksgerichtshofs aufgehoben sind – denn alles wurde geteilt in Deutschland nach dem letzten Krieg –, und seitdem ich wusste, in welchem Archiv sie lagern und wo sich das Archiv befindet, nämlich in Berlin-Mitte, hatte ich vor, dorthin zu gehen und die Todesurteile zu lesen.
Polizei stand davor. Wie sollte ich hineinkommen?
Aussichtslos, sagte mir eine zweite Historikerin, ihr sei es auch nicht erlaubt worden. Man brauche dafür eine Genehmigung höheren Ortes.
Ich stellte einen schriftlichen Antrag und bekam einen Termin für den höheren Ort.
Pünktlich eine halbe Stunde vor dem Termin ging ich in das Besucherbüro des höheren Ortes. Man suchte und fand meinen Namen auf der Liste der angemeldeten Besucher, ich bekam einen Passierschein, sollte sagen, wie viele Taschen ich mit mir führe, sagte, dass es eine sei, ging mit der Tasche und dem Passierschein um die Ecke des dickmaurigen Gebäudes, zeigte zwei Offizieren meinen Passierschein und meinen Personalausweis, wies meine Tasche vor (in die ich im Besucherbüro vor der Frage nach der Zahl der Taschen die zweite kleinere gesteckt hatte, um nicht mit zwei Taschen beladen, unordentlich und verdächtig, herumzulaufen), ging in die marmorne Eingangshalle, stieg in den seitlichen Paternoster und fuhr, an dem Flur mit Teppichbelag vorbei, der zum Höchsten führte und von einem neben dem Paternoster postierten Offizier überwacht wurde, höher und höher bis zu der auf dem Passierschein angegebenen Zimmernummer.
Hinter der Zimmertür wurde ich von einer verantwortlichen Frau erwartet, die nach der Begrüßung wieder an ihrem Schreibtisch Platz nahm und mich an den quer stehenden Konferenztisch mit acht Stühlen wies. Sie fragte nach meinem Anliegen.
Ich erklärte es ihr noch einmal mündlich: Dass ich diejenigen Volksgerichtshofakten lesen möchte, in denen nach Denunziation durch Frauen ein Todesurteil erfolgte. Dabei interessiere mich besonders der Alltag der Diktatur und die spezifische Situation, ich vermute Ohnmacht, der Frau, die sie vielleicht zu diesem Verbrechen getrieben habe. Die Genehmigung zum Lesen dieser Akten bedürfe einer Fürsprache, hätte ich gehört, sagte ich der verantwortlichen Frau. Und um diese Fürsprache zu erbitten, sei ich gekommen.
Wir begrüßen es, dass Sie sich als Schriftstellerin mit der Zeit des Faschismus in Deutschland auseinandersetzen wollen, antwortete sie mir. Bitte widmen Sie sich dabei besonders dem Widerstand der Kommunistinnen. Unsere Analysen haben ergeben, dass wir ihnen im Vergleich zu ihren männlichen Genossen in der Literatur noch besser gerecht werden müssten.
Ich entgegnete, dass mich die Versuchung zum Verrat interessiere, in einer Gesellschaftsordnung, in der es möglich sei, private Konflikte sozusagen mittels Staatsgewalt zu lösen.
Was wollen Sie mit diesem abgeschlossenen Kapitel, fragte sie mich. Sie vermute, ich habe die Absicht, dem Kleinbürgertum seine Vergangenheit vorzuwerfen. Das ist nicht in unserem Interesse, sagte sie, es sind unsere Bündnispartner.
Sie schlug mir vor, mich stattdessen um etwas historisch Relevanteres und Positiveres zu kümmern. Aber sie machte sich Notizen, und nach einiger Zeit erhielt ich die schriftliche Erlaubnis für die Arbeit im Archiv mit Angabe einer Telefonnummer, unter der ich einen Termin vereinbaren sollte.
Am Telefon bekam ich einen Termin für ein »Quellengrundlagen-Gespräch« mit einer Wissenschaftlerin, Spezialistin auf dem Gebiet »Frau und Faschismus«.
Als ich fünf Minuten vor dem vereinbarten Termin am Eingang des Archivs anlangte, suchte der Polizist meinen Namen auf der Liste der angemeldeten Besucher, ließ sich meinen Personalausweis zeigen und stellte mir einen Passierschein aus. Der Polizist, der aus einer Entfernung von drei Metern zugesehen hatte, prüfte den Passierschein, verglich ihn mit meinem Personalausweis, ließ mich passieren.
Ich fand die Wissenschaftlerin in ihrem Arbeitszimmer, dessen eine Wand ein Fenster zum Nachbarraum, offensichtlich einem Lesesaal, hatte. Sie schrieb sich mein Anliegen auf und fragte: Warum beschäftigen Sie sich denn bloß mit so etwas Negativem?
Sie ließ mich unterschreiben, dass ich in diesem Archiv nicht das Recht habe, Suchkarteien zu benutzen, nur das lesen dürfe, was sie mir zuteile, und ohne die Erlaubnis des Archivs keine Einzelheiten veröffentlichen werde.
Dann gab sie mir einen Termin für den ersten Lesetag im Archiv.
An diesem ersten Lesetag zeigte ich am Eingang des Archivs wieder meinen Personalausweis, bekam einen Passierschein, weil mein Name auf der Liste der erwarteten Leser stand, zeigte den Passierschein dem wenige Meter entfernt im Innern stehenden Polizisten, der alles noch einmal prüfte, und fuhr im Fahrstuhl in die Etage mit dem angegebenen Lesesaal.
Ich ging hinein und meldete mich bei dem in diesem Lesesaal Aufsicht führenden Archivangestellten. Er sah in die Liste der erwarteten Leser, fand meinen Namen und bat mich, meine Sachen draußen vor der Tür in ein Schließfach einzuschließen.
Ich schloss meine Sachen bis auf einen Kugelschreiber und Papier ein und ging mit dem Schlüssel des Schließfachs, dem Papier und dem Kugelschreiber in den Lesesaal zurück. Der Aufsichtführende gab mir nun einen zweiten Schlüssel mit einer Nummer und führte mich in den Nachbarraum zu einem andern Schließfach mit meiner Schlüsselnummer, schloss auf und zeigte mir die Akten, die ich lesen durfte. In jeder Akte lag ein Laufzettel. Er sagte mir, dass ich jedes Mal, wenn ich in einer Akte gelesen habe, auf dem Laufzettel mit Datumsangabe unterschreiben müsse.
Ich nahm alle Akten, schloss ab und ging mit den beiden Schlüsseln, dem Papier und dem Kugelschreiber zu einem Sitzplatz, den ich mir selbst wählen durfte. In der Rückwand des kleinen Lesesaals befand sich das große Fenster, das ich schon kannte. Dahinter sah ich die Wissenschaftlerin arbeiten, und sie sah mich. Draußen hörte ich die Straßenbahn kreischen und die Vögel auf dem Dach tschilpen. Über vier Jahrzehnte kein Krieg mehr in Deutschland, das es so wie in diesen Akten gar nicht mehr gibt, dachte ich und tauchte ein in die Welt der Angst, des Verrats und der gnadenlosen Verfolgung.
Vieles wusste ich nicht. Vieles wusste ich anders.
Nun weiß ich mehr, als jene Menschen vor mehr als einem halben Jahrhundert wissen konnten, 1933 oder 1940