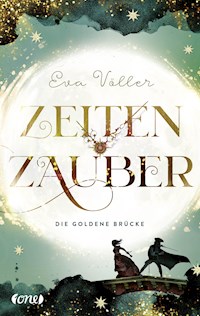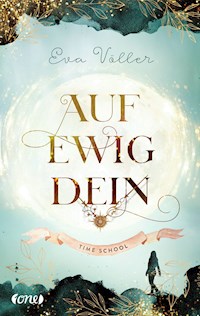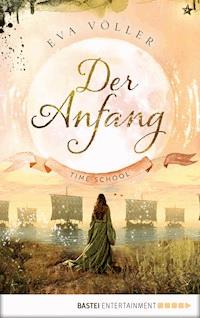9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalinspektor Carl Bruns
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die sich in der Nachkriegszeit einen Platz im Leben erkämpft, ein Mann, der gegen das Unrecht kämpft und ein historischer Kriminalfall, der auf Tatsachen beruht. Der erste große Spannungsroman der SPIEGEL-Bestsellerautorin Eva Völler – authentisch, aufwühlend und packend. Ruhrgebiet, 1948. Der Kriminalbeamte Carl Bruns arbeitet für die Abteilung Kapitalverbrechen im Essener Polizeipräsidium, nachdem er während der Nazizeit seinen Beruf nicht ausüben konnte. Im Zuge von Mordermittlungen erfährt er von einer grauenvollen Bluttat, die sich drei Jahre zuvor gegen Kriegsende ereignet hat. Während er dem flüchtigen Täter von damals nachspürt, geschehen weitere Morde. Erst allmählich erkennt Carl Bruns, dass sie Teile eines tödlichen Puzzles sind. Nicht nur er selbst gerät dabei ins Fadenkreuz des Mörders, sondern auch die Frau, die er liebt – die verwitwete Krankenschwester Anne, die verzweifelt an eine bessere Zukunft für sich und ihre Schwestern glaubt. Doch Anne hütet ein düsteres Geheimnis, von dem auch Carl nichts ahnt … Ein spannender historischer Krimi der Nachkriegszeit Ein historischer Kriminalfall mit einem charismatischen Ermittler vor dem Hintergrund des in Trümmern liegenden Ruhrgebiets. Der Krimi spielt im Jahr 1948 zu einer Zeit, als die Verantwortung für Polizei und Justiz langsam wieder in die Hände der deutschen Behörden zurückgelangt. Doch entnazifiziert sind diese noch lange nicht. »Nach dem zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Ämter in Justiz und Verwaltung wieder mit ehemaligen Nazis besetzt. Als Juristin wollte ich wissen, wie es dazu kommen konnte; noch mehr aber, wie davon Betroffene - sowohl Täter als auch Opfer - einander später in ihrem Alltag begegnet sind.« Eva Völler über Helle Tage, dunkle Schuld Der Spannungsroman beruht in Teilen auf einem wahren Fall und ist der Auftakt zu einer Krimi-Reihe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eva Völler
Helle Tage, dunkle Schuld
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ruhrgebiet, 1948. Der Kriminalbeamte Carl arbeitet für die Abteilung Kapitalverbrechen im Essener Polizeipräsidium, nachdem er während der Nazizeit seinen Beruf nicht ausüben konnte. Im Zuge von Mordermittlungen erfährt er von einer grauenvollen Bluttat, die sich drei Jahre zuvor gegen Kriegsende ereignet hat. Während er dem flüchtigen Täter von damals nachspürt, geschehen weitere Morde. Erst allmählich erkennt Carl, dass sie Teile eines tödlichen Puzzles sind. Nicht nur er selbst gerät dabei ins Fadenkreuz des Mörders, sondern auch die Frau, die er liebt – die verwitwete Krankenschwester Anne, die verzweifelt an eine bessere Zukunft für sich und ihre Schwestern glaubt. Doch Anne hütet ein düsteres Geheimnis, von dem auch Carl nichts ahnt …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Nachwort
Für Konrad
»Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.«
George Santayana
Prolog
Der fünfzehnjährige Junge, der an einem verregneten Nachmittag Ende April 1945 in Essen-Rüttenscheid mit dem Rad von der Arbeit heimfuhr, beugte sich tief über den Lenker. Es war eine Art Reflex, er war machtlos dagegen. Ihn überkam zwischendurch immer wieder die Angst vor den Stukas, obwohl schon seit Wochen keine mehr flogen. Der Krieg war endlich vorbei, jedenfalls hier im Westen, trotzdem ließ die Angst sich nicht abschütteln.
Davon abgesehen war der Junge heilfroh, den ganzen Mist überlebt zu haben. Zuletzt waren immer mehr aus seinem Jahrgang als Flakhelfer eingezogen worden, er hatte einige gekannt. Reihenweise waren sie von den tödlichen Artilleriegeschossen der Alliierten in Stücke gerissen worden. Wie die hätte er auch enden können, als letztes Kanonenfutter für Adolf Hitler, doch der hatte zum Glück nichts mehr zu melden. Jetzt konnte man wieder nach vorne schauen, zumindest sagten das alle.
Dankbar war der Junge auch für den alten Drahtesel, mit dem er zur Arbeit fahren konnte. Er hatte seit Kurzem eine Lehrstelle, und zu Fuß hätte er hin und zurück Stunden gebraucht. Auch mit dem Rad war es wegen der Steigungen oft beschwerlich, aber er kriegte es jedes Mal hin. Da, wo es nötig war, trat er ordentlich in die Pedale, und auch bei den steilsten Stellen strampelte er sich lieber im Stehen ab, als vom Rad zu steigen und zu schieben. Das war für ihn Ehrensache. Außerdem ging es überall dort, wo er sich bei der Hinfahrt plagen musste, zum Ausgleich auf dem Heimweg in einem Affenzahn bergab, dann machte das Fahren richtig Spaß.
An diesem Nachmittag nieselte es in einer Tour. Der Junge fuhr mit eingezogenem Kopf, als könnte er so verhindern, allzu sehr durchnässt zu werden. Während er in Richtung Margarethenhöhe radelte, wurde der Regen stärker und peitschte ihm ins Gesicht, weshalb er fast in eine Gruppe von Männern hineingerast wäre. Er konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen.
Die Männer brüllten durcheinander, sie schrien ihn an, obwohl doch überhaupt nichts passiert war. Einer baute sich drohend vor ihm auf, einen Knüppel in der Hand. Ein anderer richtete ein Gewehr auf ihn. Einige von ihnen waren Polen, das erkannte der Junge an ihrer Sprache. Die Stadt war voll von befreiten Zwangsarbeitern aus dem Osten, allesamt abgerissen, zerlumpt und verhärmt, manche halb verhungert. Neulich erst war ein Pole bei ihnen zu Hause aufgetaucht, er hatte um Essen gebettelt und dabei geweint. Die Mutter hatte ihm einen Teller Suppe gegeben, und der Mann hatte ihr auf Knien gedankt. Eine unerklärliche, brennende Scham hatte den Jungen bei dem Anblick erfüllt, fast so, als hätte er irgendwas Schlimmes angestellt. Etwas, für das er persönlich geradestehen musste, obwohl es nicht seine Schuld war.
An dieses Gefühl musste er denken, als er auf Geheiß eines der Polen sein Rad am Straßenrand ablegte. Halb und halb erwartete er, dass sie ihn nun davonjagten, aber dazu kam es nicht. Anscheinend hatten sie es gar nicht auf sein Fahrrad abgesehen. Sie führten irgendwas anderes im Schilde. Der Junge bekam es mit der Angst zu tun.
Die Männer scheuchten ihn unter barschen Befehlen und einigen rüden Schubsern vorwärts, weg von der Straße und hinab in eine bewaldete Senke. Dort hatten sich, zusammengetrieben von weiteren bewaffneten Polen, auch schon andere Zivilisten eingefunden, ein Häuflein verängstigt wirkender Männer unterschiedlichen Alters.
Panik stieg in ihm auf, als er sah, was sie dort taten: Sie hoben Gräber aus. Manche mit Schaufeln, die meisten jedoch mit bloßen Händen.
Einer der Polen stieß ihn vorwärts und befahl ihm mit einer unmissverständlichen Geste, ebenfalls zu graben. Der Junge verharrte, starr vor Schreck und außerstande, auch nur einen Finger zu rühren, woraufhin der Pole ihm schweigend den Gewehrlauf gegen die Stirn drückte. Augenblicklich ging der Junge in die Hocke und begann, mit beiden Händen Lehmbrocken aufzuklauben und zur Seite zu werfen, davon überzeugt, dass er und die anderen Deutschen sich hier buchstäblich ihr eigenes Grab schaufeln mussten. In einer Aufwallung von selbstmörderischem Trotz überlegte er, einfach wegzurennen, dann würden die Polen ihn gleich abknallen, so konnte er sich wenigstens das Graben sparen und hätte sofort alles hinter sich.
Von den anderen Deutschen schien allerdings noch keiner auf diese Idee gekommen zu sein. Sie gruben und schaufelten ohne Unterlass. Einige von ihnen weinten und schluchzten dabei zum Gotterbarmen. Reden durften sie nicht. Sobald einer aufbegehren wollte, setzte es Knüppelhiebe.
Der Junge fühlte sich wie in einem Albtraum gefangen, er konnte nichts anderes tun, als zu graben, immer nur zu graben. Seine Finger bluteten, wiederholt riss er sich die Haut an scharfkantigen Steinen auf.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er bereits dort gehockt hatte, den Blick fest auf seine wühlenden, blutenden, verdreckten Hände geheftet, bevor er endlich aufschaute und dabei bemerkte, dass nicht alle Deutschen um ihn herum mit dem Ausheben von Gräbern beschäftigt waren. Schaufeln und buddeln mussten alle, vielleicht war es ihm deshalb nicht gleich aufgefallen. Ein Teil der Männer, die ein Stück abseits von ihm beschäftigt waren, gruben … etwas aus. Nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren. Verteilt über die ganze Senke, die nach Form und Ausdehnung nur ein zugeschütteter Bombentrichter sein konnte.
Als er erkannte, was die Männer da aus der Erde holten, kam es ihm hoch. Plötzlich konnte er auch den grauenhaften Gestank zuordnen, der trotz des Regens immer stärker geworden war. Und dann fing auch er an zu weinen.
Er hatte schon viele Tote gesehen. Nach schlimmen Bombennächten hatten sie überall inmitten der Trümmer gelegen, zerfetzt, verbrannt, von manchen nur Körperteile übrig.
Doch die Menschen, die man hier ausgrub, waren nicht bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Man hatte sie erschossen, mit auf dem Rücken gefesselten Händen.
»Die verdammten Polacken, jetzt wollen sie uns diesen Mist anhängen!«, hörte er einen der Deutschen laut sagen.
Dafür setzte es einen weiteren Knüppelhieb, gefolgt von einer erneuten Salve aus einer MP, die dicht über die Köpfe der Deutschen hinwegfegte. Danach sagte lange niemand mehr ein Wort.
Die Männer gruben Stunde um Stunde. Um achtzehn Uhr hätten eigentlich alle daheim sein müssen, ab da galt für die Zivilisten Sperrstunde, doch die Arbeiten gingen weiter. Ein Leichnam nach dem anderem wurde aus dem Morast geborgen und am Rand der Grube abgelegt. Es waren Dutzende. Der Gestank, der von den verwesten, schlammbedeckten Körpern aufstieg, war unbeschreiblich. Der Junge, der mittlerweile seinen gesamten Mageninhalt von sich gegeben hatte, konnte nicht aufhören zu würgen, obwohl er sich, dem Beispiel einiger anderer Männer folgend, sein Taschentuch vor Mund und Nase gebunden hatte.
Eine der Leichen war eine Frau, er entnahm es dem Raunen, das durch die Reihen der Deutschen ging, und wieder musste er weinen. Inzwischen war ihm klar, dass die Gräber, die er hier zusammen mit den anderen Männern aushob, für diese Toten bestimmt waren. Wenn man nach dem Zorn der Polen ging, konnte es sich bei den erschossenen Menschen nur um Zwangsarbeiter handeln. Ihre Landsleute und Leidensgenossen, die man hier umgebracht und wie Tiere verscharrt hatte.
Der Junge hätte wütend sein können, weil er unter vorgehaltener Waffe so eine Drecksarbeit verrichten musste, obwohl er doch mit diesem Schlamassel überhaupt nichts zu tun hatte, genauso wenig wie die anderen hier. Doch er fühlte nur Erschöpfung und Trauer. Und eine ähnliche Scham wie neulich, als seine Mutter dem hungernden Polen die Suppe gegeben und der Mann zum Dank auf die Knie gefallen war.
In diesem Moment begriff der Junge, was es mit dieser Scham auf sich hatte. Was für ein Gefühl es in Wahrheit war. Schuld.
Er dachte darüber nach, wieso er sich schuldig fühlte, obwohl er selbst doch gar nichts getan hatte, und die ganze Zeit musste er weinen. Manchen der Männer schien es ebenso zu ergehen wie ihm, in ihren Zügen nahm er dieselbe entsetzte Betroffenheit über den Tod dieser Menschen wahr, die auch er verspürte.
Doch in den Gesichtern von mindestens ebenso vielen spiegelte sich nur die verbissene Wut über das Unrecht wider, das sie hier erlitten.
Erst bei Einbruch der Dunkelheit durften die Deutschen nach Hause gehen, verbunden mit dem Befehl, am nächsten Tag wiederzukommen und weiterzumachen. Die persönlichen Gegenstände, die man ihnen vor der Arbeit weggenommen hatte, wurden einbehalten. So wollten die Polen sicherstellen, dass die Deutschen dem Befehl Folge leisteten.
Der Junge hatte keine Brieftasche und keinen Ausweis dabeigehabt, nur das Rad. Als er endlich spätabends müde und verstört heimkam, brach seine Mutter vor Erleichterung in Tränen aus. Nachdem er alles berichtet hatte, verbot sie ihm kategorisch, zu dem Massengrab zurückzukehren. In gewisser Weise war er froh, weil ihm so die Entscheidung darüber abgenommen wurde, auch wenn das fortan elendig lange Fußwege bedeutete.
Tatsächlich sah er sein Rad nie wieder. Vielleicht, so überlegte er später, war auch das eine Form von Buße. So wie das Graben. Jedenfalls half es ihm, sich weniger schuldig zu fühlen. Zugleich keimte auf unbestimmte Art die Gewissheit in ihm auf, dass die nach dem Krieg zurückgebliebene Schuld in ihrer Gesamtheit so gewaltig war, dass nichts und niemand sie jemals wiedergutmachen konnte.
Kapitel 1
Carl ging mehrmals um die Tote herum und betrachtete sie aus jedem nur möglichen Blickwinkel. Zwischendurch begab er sich auch in die Hocke, um manche Stellen näher in Augenschein nehmen zu können. Der Polizeifotograf machte auf seine Anweisung hin einige Fotos.
Die Frau hieß Adelheid Hoffmann. Weibliche Leiche, hatte Carl in den ihm eigenen unleserlichen Kürzeln in sein abgewetztes Notizbuch gekritzelt. Alter zwischen 60 und 70. Fenstersturz.
Sie war in der Nacht von Mietern ihres Hauses gefunden worden, offenbar kurz nachdem sie gestorben war. Die Leichenstarre war mittlerweile weit fortgeschritten, das Blut auf den Steinen fast vollständig getrocknet. Der Polizeiarzt war bereits vor Ort gewesen und hatte Carls vorläufige Einschätzung bestätigt. Carl wartete nur noch auf den Bestatter, der die Tote abholen sollte.
Das Grundstück der Verstorbenen lag in Essen-Rüttenscheid. Das Haus, hinter dem man ihre Leiche entdeckt hatte, ragte in seltsamer Unversehrtheit als einziges der näheren Umgebung aus einer Trümmerlandschaft hervor, mit drei intakten Stockwerken und einem unbeschädigten Dach. Die benachbarte Umgebung war verwüstet, nur dieses Haus hatte den Sturm der Vernichtung überstanden. Lediglich der hinterm Haus befindliche Garten war zerstört; er lag immer noch unter einem Berg von Schutt begraben – den Hinterlassenschaften eines Gebäudes in der dahinter verlaufenden Parallelstraße.
Die Fenster des Hauses waren wohl bei einer der vielen Bombardierungen zersprungen; die Scheiben sahen noch ziemlich neu aus. Der Rest des Hauses wirkte dagegen verwittert und teilweise verwahrlost, mit abgeplatztem Putz und dunklen Einfärbungen vom allgegenwärtigen Essener Kohlenstaub. Auch der Schriftzug auf dem großen Schild über der Eingangstür war stark in die Jahre gekommen.
Zur grünen Linde stand dort; früher war hier eine Kneipe betrieben worden, doch die war inzwischen geschlossen. Das Haus war bis in den letzten Winkel belegt, teilweise mit regulären Mietern, teilweise mit ehemaligen Zwangsarbeitern, Vertriebenen aus dem Osten und anderen Displaced Persons, darunter auch Kinder.
Ein gutes Dutzend der Bewohner hatte sich in der Nähe der Toten versammelt, und Carl hatte den deutlichen Eindruck, dass keiner der Anwesenden der alten Frau auch nur eine Träne nachweinte. Im Gegenteil, der eine oder andere schien es ganz in Ordnung zu finden, wie sie da lag, mit geborstenem Schädel und in einer Lache aus gestocktem Blut.
Carl blickte zu dem offenen Fenster im ersten Obergeschoss hoch. Wäre sie auf einer Wiese gelandet, hätte sie den Sturz mit einigem Glück überleben können, aber sie war mit dem Hinterkopf direkt auf einem großen, kantigen Mauerbrocken aufgeschlagen.
Carls Kollege Werner gesellte sich zu ihm. Wie Carl war er achtunddreißig, wirkte aber um einiges älter und erschöpfter. Das Leben hatte ihm übel mitgespielt, er hatte in den letzten Wochen des Krieges seine ganze Familie bei einem Bombenangriff verloren. Frau und zwei Kinder, alle in derselben Nacht gestorben. Damals war sein Haar in nur wenigen Tagen so grau geworden wie Asche. Heute, über drei Jahre später, litt er immer noch wie ein Hund. Die Arbeit war das Einzige in seinem Leben, das ihn aufrecht hielt. Seine Gesundheit war ihm gleichgültig. Er betrank sich regelmäßig und rauchte zu viel; in ihrer Abteilung argwöhnte man hinter vorgehaltener Hand, dass Werner sich zur Befriedigung seiner Sucht ab und zu bei den beschlagnahmten Asservaten aus den Schwarzmarktrazzien bediente. Auf legalem Weg kam heutzutage niemand mehr an Alkohol und Zigaretten, jedenfalls nicht in solchen Mengen, wie Werner sie verbrauchte.
An diesem Tag wirkte er besonders mitgenommen. Die Jacke schlotterte um seine mageren Schultern, die Augen lagen tief in den Höhlen. Seine rechte Wange war dick geschwollen, ein entzündeter Weisheitszahn, der ihm schon seit Wochen zu schaffen machte.
»Wolltest du heute nicht endlich zum Zahnarzt?«, fragte Carl ihn.
»Vorhin erledigt. Das Biest ist draußen.«
»Du siehst fertig aus.« Carl betrachtete ihn besorgt. »Wieso hast du dich nicht krankschreiben lassen?«
»Hab ich ja.«
»Und weshalb kommst du dann her?«
»Weil ich die Frau kenne.«
Carl sah ihn erstaunt an. »Du kennst sie?«
»Ja. Das heißt, nicht persönlich. Aber dafür ihren Sohn. Sie ist – war – die Mutter von Arnold Hoffmann.«
Arnold Hoffmann. Carl durchforstete sein Gedächtnis, bis er das passende Bild vor sich hatte. Ein großer, gut aussehender Bursche, vielleicht sechs oder sieben Jahre jünger als er. Sie waren sich im Präsidium in der Büscherstraße nur sporadisch über den Weg gelaufen, weil sie in unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet hatten.
»Ich entsinne mich dunkel«, sagte er. »Der hat vierunddreißig angefangen, oder? Muss ein paar Monate vor meinem Rausschmiss gewesen sein.«
Wie immer, wenn er darüber sprach, musste er gegen den alten Groll ankämpfen. Elf Jahre seines Lebens. So viel hatte ihn dieser beschissene Ariernachweis gekostet, den er nicht hatte liefern können. Elf verfluchte Jahre unter Tage auf dem Pütt. Bis die Alliierten ihn wieder eingestellt und gleichzeitig viele andere rausgeworfen hatten, die zu braun für einen Persilschein gewesen waren.
Carl vermutete, dass auch Arnold Hoffmann dieses Schicksal widerfahren war. »Was ist aus dem Kerl geworden?«, erkundigte er sich bei Werner.
»Der hat Karriere bei der SS gemacht und ist kurz vor Kriegsende untergetaucht. Wurde später von einem britischen Militärgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt.«
»Was hat er angestellt?«
»Drei Dutzend Zwangsarbeiter umgebracht, bei einer Gestapo-Sonderaktion. Das war im März fünfundvierzig, kurz vor dem Einmarsch der Alliierten. Das Massengrab wurde ein paar Wochen später entdeckt, von Polen und anderen Ostarbeitern. Die haben dann wahllos ein paar Deutsche auf der Straße aufgegriffen und sie gezwungen, die Leichen auszubuddeln. Stand damals in allen Zeitungen, hast du nicht davon gehört? Kam sogar im Radio.«
»Natürlich hab ich davon gehört. Aber Arnold Hoffmanns Name wurde dabei nicht erwähnt.«
»Dass er bei der Ausführung der eigentliche Haupttäter war, kam ja auch erst später raus, durch die Zeugenaussagen im Prozess. Der Kerl wird von den Tommys immer noch mit Hochdruck gesucht. Und von uns auch. Auf den Revieren hängt sogar ein Steckbrief von ihm.« Werner grinste ein bisschen schief. »Es ist eine Belohnung für seine Ergreifung ausgesetzt. Fünftausend Mark.«
Das kommentierte Carl nicht weiter. Die Wände aller Essener Reviere waren deckenhoch mit Steckbriefen tapeziert, doch die Belohnungen lockten keinen mehr hinterm Ofen hervor. Es existierte praktisch nur noch eine einzige solide und überall akzeptierte Währung: Zigaretten, vorzugsweise amerikanische.
»Und das ist also Arnold Hoffmanns Mutter?« Carl blickte auf die Tote, die hingestreckt in den Trümmern lag. Eine unscheinbare, schmale Person mit faltigem Gesicht und spitzem Kinn, doch sogar die vom Alter verkniffenen Züge ließen noch erahnen, dass sie in jungen Jahren wohl eine Schönheit gewesen war. Das nun fahle Haar einst glänzend blond, die im Tod gebrochenen Augen von einem klaren Blau, die Gestalt angenehm proportioniert. Ihre Kleidung wirkte solide, jedenfalls weit hochwertiger als die ihrer zahlreichen Mitbewohner. Sie war auch nicht so abgemagert wie alle Übrigen hier. Es schien, als hätte sie trotz der elenden Umstände in den letzten paar Jahren ihr Auskommen gehabt.
Werner musterte die Leiche. »Ich frage mich, ob Arnold es schon weiß.«
»Das würde voraussetzen, dass er wiederaufgetaucht ist.«
»Das trifft anscheinend zu.«
Carl nahm es überrascht zur Kenntnis. »Woher weißt du das?«
»Er wurde hier in der Gegend gesichtet. Irgendwer war gestern wohl auf der Wache und hat’s erzählt. Hab davon erfahren, als ich vorhin meine Krankmeldung abgegeben habe. Deshalb bin ich ja auch gleich hergekommen, statt nach Hause zu gehen.« Werner warf einen Blick auf den Polizeifotografen, dann deutete er auf die Leiche. »Wieso sieht es eigentlich für dich nach Mord aus? Könnte es nicht auch ein Unfall gewesen sein? Beim Fensterputzen? Kommt häufig vor. Gerade bei älteren Frauen.«
»Ich war oben in ihrer Wohnung. Kein Putzeimer am Fenster, kein Stuhl zum Draufsteigen, nichts von dem, was man zum Fensterputzen so braucht. Und sieh dir an, was sie in der Hand hat. Es ist kein Wischlappen, falls du das angenommen hast.«
Werner beugte sich über die Leiche. »Ein Kartoffelsack«, stellte er fest. »Ist aber nur noch eine Kartoffel drin. Wo der Rest wohl ist?« Er blickte zu Carl hoch. »Ein Raubmord? Manche Leute bringen sich ja für weniger als ein paar Kartoffeln gegenseitig um.« Er hielt inne und dachte kurz nach. »Vielleicht wurde die eine Kartoffel auch nur übersehen«, mutmaßte er. »Von denen, die die Frau als Erste entdeckt und die restlichen Kartoffeln eingesammelt haben.«
»Verdenken könnte man’s sicher niemandem.« Carl sah zu den Schaulustigen hinüber, von denen keiner den Eindruck machte, als hätte er genug zu essen.
Einige tuschelten miteinander. Zwei Kinder kletterten voller Neugier auf eine benachbarte Schutthalde, um die Tote besser betrachten zu können. Eine Frau unter den Zuschauern rief sie mit scharfen Worten in schlesischer Mundart zurück. Die Leute, die dort herumstanden, stammten aus den unterschiedlichsten Gegenden, wie Carl vorhin bei der Aufnahme der Personalien festgestellt hatte. So, wie sie redeten, kam die Hälfte vielleicht von hier, der Rest war zugezogen. Oder genauer: geflohen, entwurzelt, gestrandet. Wenn sie so wie jetzt beisammenstanden und sich grüppchenweise unterhielten, tönte es an sein Ohr wie babylonisches Sprachengewirr. Osteuropäische Landstriche waren ebenso vertreten wie diverse deutsche Mundarten, und zwischendurch immer wieder das vertraute Platt aus dem Ruhrgebiet. Ein Teil der Menschen wohnte im Haus, andere in den Ruinen der Nachbarschaft, wieder andere waren einfach nur Passanten.
Werner war seinem Blick gefolgt. »Denkst du, dass einer von denen …?«
Carl hob die Schultern. »Bisher gibt’s dafür noch keine Anhaltspunkte. Direkt bezeugen kann keiner was, ich habe schon mit allen kurz gesprochen.«
»Sonst irgendwas Verwertbares an Spuren?«
»In der Wohnung lag ein Fahrschein für die Straßenbahn auf dem Fußboden, den habe ich vorsorglich sichergestellt. Vielleicht sind brauchbare Abdrücke drauf.«
»Würde mich nicht wundern, wenn es die von Arnold wären. Ist schon seltsam, dass er plötzlich wiederauftaucht, und am nächsten Morgen ist seine Mutter tot.«
Carl pflichtete ihm bei. »Zumal es in ihrer Wohnung passiert ist. Was darauf hindeutet, dass sie den Täter kannte, sonst hätte sie ihn wohl kaum reingelassen.«
»Das sehe ich auch so«, stimmte Werner zu. »Sicher ist Arnold unser Mann. Vielleicht hat ihn ja jemand aus dem Haus oder in der Nachbarschaft gestern hier gesehen, man sollte den Leuten noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Soll ich einen Teil der Befragungen übernehmen?«
»Gerne, aber nicht heute. Geh nach Hause und leg dich hin. Hier kippst du mir bloß aus den Latschen.«
»Du hast recht, ich war schon besser in Form«, stimmte Werner zu. Seine Backe war mittlerweile noch stärker angeschwollen, er konnte nur noch nuschelnd sprechen und hatte ersichtlich Schmerzen. Trotzdem hielt ihn das nicht davon ab, eine zerdrückte Zigarette aus der Jackentasche zu nesteln und sie anzuzünden. In tiefen Zügen inhalierend, ging er davon. Dabei fasste er noch einmal die herumstehenden Menschen ins Auge, als könnte er auf diese Weise den Täter dingfest machen. Was nicht einmal fernlag. Es war eine bekannte Tatsache, dass es Mörder oft zurück an den Tatort zog, sogar – oder erst recht – wenn gerade die Polizei da war. Ein Grund, warum Carl die Leute nicht weggeschickt, sondern an Ort und Stelle ihre Namen notiert hatte. Seither hatte auch er immer wieder unauffällig seine Blicke über die Schar der Beobachter schweifen lassen. Hatte Gesichter fixiert und auf Regungen geachtet. Dabei waren ihm drei Männer aufgefallen. Sie standen dicht beieinander und unterhielten sich leise, zwei jüngere, die einander glichen wie ein Ei dem anderen, und ein älterer mit schlohweißem Haar – er war einer von den Mietern, die den Leichnam entdeckt hatten. Sie wohnten alle drei im Haus der Verstorbenen. Ab und zu schaute einer von ihnen zu Carl herüber, nur um sofort wieder wegzusehen, wenn er den Blick erwiderte.
Diese drei würde er sich auf jeden Fall gleich als Erstes vornehmen.
Der Bestatter traf ein, um die Leiche abzuholen. Carl vervollständigte seine Notizen und schickte den Fotografen weg. Dann ging er hinüber zu den Schaulustigen.
Er wollte gerade mit den Befragungen anfangen, als er Werner vorm Haus stehen und mit einem Mann reden sah, den Carl erst auf den zweiten Blick als seinen früheren Vorgesetzten wiedererkannte – nicht etwa, weil ihre letzte Begegnung so lange zurücklag, sondern weil der Mann sich stark verändert hatte. Einst kräftig, beinahe rundlich, war er jetzt fast genauso hager wie Werner. Das Haar, schon früher recht schütter, zog sich nur noch als spärlicher Halbkranz um seine spiegelnde Glatze. Die asketischen Gesichtszüge und die scharfen Falten um Mund und Nase zeugten von jahrelanger Entbehrung. Doch seine Körperhaltung war straff und aufrecht wie ehedem.
Der unerwartete Anblick dieses Mannes traf Carl wie ein Schlag in den Magen. Eben hatte er noch daran gedacht, wie viele Polizeibeamte mit NS-Vergangenheit vor drei Jahren von den Alliierten aus dem Dienst entfernt worden waren, und auf einmal stand dort einer von denen.
Schneider war ein glühender Anhänger von Adolf Hitler gewesen und hatte keinen Hehl daraus gemacht. Nie war er ohne sein Parteiabzeichen am Revers zur Arbeit erschienen. Das überdimensionierte Bild des von ihm verehrten Führers an der Wand hinter seinem Schreibtisch hatte einen förmlich erschlagen, wenn man den Raum betrat. Er hatte jeden angeraunzt, der nicht vorschriftsmäßig den Arm zum Hitlergruß hochriss.
Trotzdem hatte Carl damals nicht damit gerechnet, dass ihm so viel kalte Verachtung entgegenschlagen würde, als er Schneider von seinem jüdischen Großvater erzählt hatte. Schließlich hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon fast acht Jahre lang zusammengearbeitet. Schneider war sein Ausbilder gewesen. Sie hatten einander geduzt, so wie die meisten auf der Dienststelle es taten. Privat hatten sie nichts miteinander zu tun gehabt, aber dienstlich war Carl immer einigermaßen mit Schneider zurechtgekommen. Bis zu jenem Tag, an dem alles vorbei gewesen war. Von Schneider gab es kein Mitleid, kein Bedauern, kein freundliches Wort zum Abschied. Für diesen Mann waren die Rassegesetze nicht nur irgendwelche bürokratischen Vorschriften, sondern heilige Gebote.
Die Alliierten hatten ihn direkt nach Kriegsende eingebuchtet; es hieß, dass er bei einem Teil der Judentransporte, die vom Essener Hauptbahnhof abgingen, die Aufsicht geführt hatte. Wegen guter Führung war er vorzeitig freigekommen, hatte aber seither keine neue Anstellung gefunden und lebte von der Hand in den Mund. Jetzt war er Anfang fünfzig und beruflich erledigt. Ohne Bezüge oder anderweitiges Einkommen hauste er bei seiner verwitweten Schwester in einem teilweise zerbombten und völlig heruntergekommenen Haus. Eine verkrachte Existenz.
Bei dem Gedanken verspürte Carl eine Aufwallung rachsüchtiger Genugtuung, und es lag ihm fern, sich für dieses Gefühl zu schämen. All die Jahre hatte er Kohlenstaub geschluckt, hatte seine Ehe scheitern und auch sonst alles den Bach runtergehen sehen, und dann hatte er auf einmal seinen Posten wiedergehabt, inklusive Beförderung außer der Reihe. Und das alles nur ein paar Monate, nachdem Schneider seinen Schreibtisch im Polizeipräsidium mit einer Zelle im Knast getauscht hatte.
»Es gibt wohl doch noch so was wie ausgleichende Gerechtigkeit«, hatte Werner bei Carls Rückkehr gemeint, und darauf hatten sie zusammen einen getrunken.
Werner stand mit dem Rücken zu Carl, doch er schien zu spüren, dass Carl ihn und Schneider beobachtete, denn im nächsten Moment blickte er über die Schulter zurück. Es war nicht zu übersehen, wie unbehaglich er sich in Schneiders Gegenwart fühlte. Carl nahm den stummen Hilferuf wahr und setzte sich in Bewegung.
»Warten Sie bitte hier«, sagte er im Vorbeigehen zu den drei Männern. »Es dauert nicht lange. Ich möchte gleich noch mit Ihnen reden.«
Er stellte sich neben Werner, den Blick unverwandt auf seinen einstigen Vorgesetzten gerichtet.
»Tag, Bruns«, sagte Schneider erstaunlich zuvorkommend. »Gratulation auch noch zum Obermeister!«
»Inspektor«, korrigierte Carl ihn, ohne den Gruß zu erwidern. Vor zwei Monaten war er erneut befördert worden, diesmal ganz regulär nach bestandenem Lehrgang, auch wenn er sich dafür nicht viel kaufen konnte. Aber was Schneider betraf, so ging es ums Prinzip. Sieh her, ich bin drin, und du bist raus.
Werner räusperte sich und errötete dabei ein wenig. »Schneider war übrigens derjenige, der gestern auf der Wache war, weil er Hoffmann gesehen hat. Hat er mir gerade erzählt.«
»Hast du Arnold Hoffmann nur gesehen oder auch mit ihm gesprochen?«, fragte Carl seinen früheren Chef geradeheraus. Er hatte einen Fall zu lösen, und Schneider war vielleicht ein Zeuge.
»Nur gesehen«, sagte Schneider verbindlich. »Am Rüttenscheider Stern. Er hat sofort Fersengeld gegeben, als er mich erkannt hat.«
»Wirklich?«, fragte Carl mit unverhohlenem Sarkasmus. »Wart ihr nicht mal ganz enge Parteifreunde?«
»Das ist lange her«, versetzte Schneider. Carls Bemerkung schien an ihm abzuperlen. »Der Mann ist ein Mörder.«
»Das wissen wir noch gar nicht.«
»Ich rede nicht von seiner toten Mutter, sondern von dem Massenmord im März fünfundvierzig. Wenn ich dazu beitragen kann, dass er geschnappt wird, ist das Ehrensache. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Tommys für jeden noch so kleinen Hinweis auf Hoffmanns Verbleib dankbar sind.«
Darauf ging Carl nicht ein. Er wollte einfach nur, dass Schneider Leine zog. Doch der war noch nicht fertig.
Er sah Carl direkt an. »Ich hätte das, was damals mit dir geschehen ist, nicht verhindern können, das weißt du. Es gab Dienstvorschriften, die mussten befolgt werden. Du warst ja auch nicht der Einzige, der seinerzeit gehen musste. Und jetzt bist du wieder am Ruder, stimmt’s? So ist das Leben. Mal haben die einen Oberwasser, mal die anderen. Ich hoffe, du trägst mir nichts nach.«
»Warum sagst du das nicht den Familien der Menschen, die unter deiner Mitwirkung umgebracht wurden?«
Damit brachte Carl ihn endlich zum Schweigen. Schneider nickte Werner kurz zu, dann wandte er sich ab und schlenderte davon.
»Ich wollte überhaupt nicht mit ihm reden«, erklärte Werner ein wenig kleinlaut. »Er hat mich aufgehalten und vollgequatscht.«
»Wollte er was Bestimmtes?«
»Schneider interessiert sich für den Fall.« Werner verzog das Gesicht. »Er will sich dahinterklemmen, sagt er.«
»Was zum Teufel meint er damit?«
»Er will sich rehabilitieren. Weil er wieder zurückwill.«
»Du meinst, in den Polizeidienst?«
Werner nickte. »Er hat sich ernsthaft in den Kopf gesetzt, Hoffmann auf eigene Faust zu schnappen. Damit die Briten ihm die Marke zurückgeben. Er sagt, das wäre sowieso nur eine Frage der Zeit. Wenn er denen Hoffmann präsentiert, geht’s seiner Meinung nach bloß ein bisschen schneller.«
Carl runzelte die Stirn. »Er war im Knast!«
Werner zuckte mit den Schultern. »Nur ein paar Monate. Und sie haben ihn auf Bewährung wieder rausgelassen. Es wird gemunkelt, dass es demnächst offiziell Wiedereinstellungen geben soll, egal, ob einer in der Partei war. Kommt wohl immer ganz drauf an.« Er schüttelte den Kopf und stöhnte dann leise auf. Vorsichtig betastete er seine geschwollene Wange und gab erneut einen schmerzerfüllten Laut von sich. »Mist, jetzt tut es richtig weh.« Mit unerwarteter Entschiedenheit fügte er hinzu: »Schneider kann sich noch so sehr anstrengen. Der kommt nicht zurück. Für ihn ist der Zug abgefahren, darauf gehe ich jede Wette ein.«
Carl hätte es nur zu gerne geglaubt.
Er ging zurück zu den drei Männern, die wartend dastanden. Ihr Gesichtsausdruck war schwer zu deuten, aber Carl war in der Auslegung unterdrückter Regungen nicht unerfahren. Er fing diffuse Gefühle von Sorge auf, vielleicht sogar Furcht. Doch das musste nichts heißen. Es herrschten raue Zeiten, jeder hielt sich irgendwie über Wasser und tat dabei Dinge, die gesetzlich verboten waren, Schwarzhandel und Kohlenklau inbegriffen. Die meisten Leute hatten in ihrem Privatleben irgendwelche Leichen im Keller und wurden nervös, wenn die Polizei aufkreuzte, auch wenn es in einer anderen Angelegenheit war.
Die beiden jüngeren Männer waren Zwillingsbrüder, was aufgrund ihrer frappierenden Ähnlichkeit nicht zu übersehen war. Auf den ersten Blick waren sie nicht zu unterscheiden. Beide hatten das gleiche rote Haar, wasserhelle Augen und leicht abstehende Ohren. Sie waren vierundzwanzig Jahre alt und hießen Aleksandr und Borjan Drewin.
Carl erfuhr bei der weiteren Befragung, dass sie als Siebzehnjährige von den Nazis aus dem Baltikum nach Deutschland verschleppt worden waren. Während des Kriegs hatten sie im Zwangsarbeiterlager gelebt, später eine Zeit lang auf der Straße. Seit zweieinhalb Jahren wohnten sie in Adelheid Hoffmanns Haus, das Logis war ihnen durch die Besatzungsbehörde zugewiesen worden. Beide arbeiteten als Hauer auf Zollverein, so wie früher Carl. Ihr Deutsch war nahezu perfekt; nur vereinzelt klang noch ein schwacher slawischer Akzent durch.
Der ältere Mann hieß Gustav Keitel und war fünfundsechzig Jahre alt. Von Beruf war er Cellist und spielte bei den Essener Philharmonikern. Keitel wohnte schon seit fast zehn Jahren im Haus und war regulärer Mieter.
Nein, sie hatten letzte Nacht nichts mitbekommen, alle drei hatten sie tief und fest geschlafen. Die beiden jungen Balten im Hinterzimmer der ehemaligen Gastwirtschaft, wo sie ihr Schlaflager hatten, und Keitel in seinem Mansardenkämmerchen unterm Dach. Und nein, den Sohn der Eigentümerin hatten sie auch nicht in der Gegend gesehen. Aleksandr und Borjan kannten ihn ihrer Aussage nach überhaupt nicht, sie waren erst nach seinem Verschwinden hier eingezogen.
Keitel hingegen war ihm früher gelegentlich über den Weg gelaufen, kannte ihn aber nicht näher. »Persönlich hatte ich nichts mit ihm zu tun. Er war bei der SS und ständig auf Achse.«
»Hatte er Ihrer Meinung nach einen Hang zur Gewalt?«
Keitel hob unschlüssig die Schultern, nickte dann aber.
»Worin hat sich das geäußert?«, fragte Carl.
Keitel zögerte erneut, ehe er antwortete. »Jeder hier im Haus weiß doch über das furchtbare Massaker Bescheid, und unter uns Mietern hat sich auch rumgesprochen, dass der Sohn von Frau Hoffmann der Haupttäter dieses Gemetzels war.«
»Also denken Sie, er könnte auch seine Mutter umgebracht haben?«
»Vermutlich schon.«
»Käme aus Ihrer Sicht sonst noch jemand infrage? Gibt es jemanden im Haus oder aus Frau Hoffmanns Bekanntenkreis, mit dem sie sich öfters gestritten hat?«
»Na ja. Sie kam mit niemandem gut klar.«
Fragend wandte sich Carl an die beiden Balten. »Was meinen Sie dazu?«
Aleksandr und Borjan Drewin zuckten nur in einer seltsam simultan anmutenden Geste die Achseln, bevor sich einer der beiden – Carl war sich nicht sicher, ob es Aleksandr oder Borjan war – zu einer richtigen Antwort bequemte. »Eigentlich konnte keiner sie gut leiden.«
»Wissen Sie, ob die Frau sonst noch Familie hatte? Irgendwelche Verwandten?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sagte Keitel.
Die Zwillingsbrüder antworteten abermals mit einem gleichzeitigen Achselzucken.
Carl kritzelte die Informationen mit seinem immer stumpfer werdenden Bleistiftstummel in sein Notizbuch. Er spürte, dass die Männer ihm nur einen Teil der Wahrheit offenbarten. Die Aufklärung dieses Falles würde sich nicht so einfach gestalten, wie es auf den ersten Blick ausgesehen hatte.
Kapitel 2
Anne blieb wie angewurzelt stehen und blinzelte, weil sie im ersten Moment glaubte, eine Art Fata Morgana vor sich zu haben. Sie hatte seit mindestens zwanzig Stunden nicht geschlafen, vielleicht kam die Sinnestäuschung daher. Die wunderschöne junge Frau, die dort drüben inmitten einer trostlosen Ruine stand, lächelte mit einer Strahlkraft, als hätte sie den Hauptgewinn in einer Lotterie gezogen. Und was angesichts des kühlen Wetters noch bemerkenswerter war: Bis auf ein seidenes Nichts von Unterwäsche war sie völlig nackt. Abgesehen von den feinen, mit neckischen Bommeln versehenen Pantöffelchen, die Anne erst bei genauerem Hinsehen auffielen.
Anne blinzelte ein zweites Mal, aber die junge Frau war real. Strahlend stand sie in ihren feinen, rüschenbesetzten Dessous da, um sie herum nur Zerstörung. Kein persönlicher Gegenstand, kein Kleidungsstück, weder Tisch noch Stuhl. Nichts.
Ein klarer Fall. Anne erlebte oft solche widersinnigen Verhaltensformen, um nicht zu sagen Verrücktheiten. Ihr Beruf als Krankenschwester brachte das unweigerlich mit sich. Sie kannte eine Frau, die sich zwanghaft die Haare ausriss und sie aß. Nicht etwa aus Hunger, sondern weil sie an einer geistigen Störung litt. So wie viele in diesen Zeiten, was sicher vorwiegend mit dem Krieg zusammenhing. Und mit dem Hunger und der Kälte. Oder es kam alles zusammen, wer konnte das schon mit Gewissheit sagen. Manche Menschen hatten komplett ihren Realitätssinn verloren, andere nur ein bisschen.
Annes fünfzehnjährige Schwester Lotti war das beste Beispiel. Lotti hatte Visionen von Jesus Christus, der sogar persönlich mit ihr sprach. Nicht ständig, aber oft genug, um Anne und ihre andere Schwester Frieda zur Verzweiflung zu treiben.
Wenigstens kam Lotti während ihrer Visionen nicht auf die Idee, sich bis auf die Unterwäsche zu entkleiden. Sie lief auch nicht mit entrücktem Lächeln in den Ruinen herum, sondern behielt ihren direkten Draht zu Jesus für sich. Lotti wusste sehr wohl, dass man sie sonst für geisteskrank halten würde. So gesehen war sie längst nicht so verwirrt wie die junge Frau dort in der Ruine. Im Gegenteil, Lotti war sogar überdurchschnittlich intelligent. Auf dem Lyzeum erzielte sie durchweg exzellente Noten, und bislang hatten Anne und Frieda ihr zum Glück erfolgreich ausreden können, in ein Kloster einzutreten.
Die junge Frau in dem Seidennegligé hörte abrupt auf zu lächeln. Ihr perfekt geschminktes Gesicht nahm einen konzentrierten Ausdruck an, während sie auf ihren Pantöffelchen vorsichtig über die herumliegenden Trümmerstücke hinwegstakste und sich in eine andere Ecke des Zimmers begab – oder genauer: in die Ecke dessen, was von dem einstigen Zimmer noch übrig geblieben war, zwei geborstene Wände eines von Schutt übersäten Erdgeschosses ohne Decke. Von den drei Obergeschossen war nur noch die rückwärtige Außenwand vorhanden. Hier und da ragte ein Eisenträger heraus, an einer Stelle hing noch ein Ofenrohr. Es spross aus dem Mauerwerk wie der Rüssel eines urzeitlichen Mammuts, starr ins Leere gereckt und dem nagenden Rost preisgegeben.
An ihrem neuen Standort schien es der jungen Frau besser zu gefallen, sie strahlte wieder.
»Das ist gut«, hörte Anne eine Männerstimme sagen. »Da ist das Licht schöner.«
Als Nächstes war das Klicken einer Kamera zu vernehmen, und gleich darauf tauchte auch der Fotograf in Annes Blickfeld auf. Er suchte sich eine andere Position und knipste drauflos.
»Mir ist kalt«, maulte die junge Frau.
»Nur eine Minute noch. Mach mal ein bisschen was mit deinen Armen.«
Die junge Frau breitete in einer unbestimmten Geste die Arme aus, dann stemmte sie die Hände in die Hüfte und schob in sinnlicher Pose das Becken nach vorn. »So ungefähr?«
»Ja, sehr gut!«
Anne ging weiter. Hier brauchte niemand ihre Hilfe, im Gegenteil. Die junge Frau erfreute sich bester Gesundheit. Außerdem musste sie gute Beziehungen haben, sehr gute sogar, denn sie hatte üppige Rundungen vorzuweisen. Bei Leuten ohne Beziehungen konnte man die Rippen zählen, da stachen die Knochen förmlich heraus. Anne sah fast jeden Tag hungernde, ausgemergelte Menschen, sowohl im Krankenhaus als auch bei ihren Hausbesuchen, mit denen sie sich ein bisschen was dazuverdiente. Manchmal schämte sie sich fast, weil sie selbst nicht so klapperdürr war wie viele ihrer Patienten. Was sie jedoch zweifellos gewesen wäre, wenn sie nicht Frieda gehabt hätte, die pausenlos auf Hamsterfahrt ging.
Während Anne die Ruine passierte, die ehemals ein stattliches Geschäftshaus gewesen war, hörte sie immer noch die Anweisungen des Fotografen. Menschen mit Kameras waren in diesen Tagen kein seltener Anblick. Das Trümmermeer rund um den Kölner Dom schien sie magisch anzuziehen, mittlerweile anscheinend auch als Kulisse für Modeaufnahmen. War das die neue Normalität? Trümmer und Seidenhemdchen, zu einem Bild verschmolzen, mit einer überheblichen, fast schon rotzigen Aussage: Wer immer auch unter diesen Schuttbergen gestorben ist – wir stehen jetzt hier in neuem Schick.
Nein, dachte Anne. Normal war das nicht. Höchstens Kunst.
Sie besann sich: Es war doch normal, denn Kunst durfte viel. Kunst war – endlich wieder – frei. So wie sie alle.
Anne konnte nicht umhin zu lächeln. Für sie schloss sich bei diesen Gedanken ein Kreis, denn soeben war ihr in den Sinn gekommen, was man der Kunst nachsagte. Dass sie oft brotlos sei.
Ebenfalls wie sie alle.
Die Ausbeute von Friedas Hamsterfahrt lag ausgebreitet auf dem Tisch, als Anne heimkam: ein großes Kastenbrot, ein ordentliches Stück Dauerwurst, zwei Dosen Kondensmilch, drei Büchsen Corned Beef, ein gutes Dutzend Äpfel und fünf Briketts. Das Kastenbrot bestand überwiegend aus Kastanienmehl, aber mit der Wurst in der Pfanne geröstet würde es königlich schmecken. Die Äpfel waren verschrumpelt und vereinzelt wurmstichig, aber für Obst in jeder erdenklichen Form konnte man nur dankbar sein. Und die Dosenmilch war ein seltener Fang, steif geschlagen war sie eine wahre Köstlichkeit. Ganz zu schweigen von dem Corned Beef, das hatten sie lange nicht mehr gehabt. Anne lief bereits das Wasser im Mund zusammen. Für den Rest der Woche hatten sie satt zu essen.
Es hätte sogar noch mehr sein können, ein Dutzend Eier und eine große Speckschwarte, aber die hatte Frieda verloren, weil sie sich mit einem anderen Hamsterfahrer um einen Platz im Waggon des Zuges hatte prügeln müssen. Die Eier waren im Gedränge mitsamt Karton auf dem Boden des Waggons zertrampelt und die Speckschwarte unterdessen von irgendwem heimlich geklaut worden.
Zurückbehalten hatte Frieda ein blaues Auge und eine geschwollene, blutverkrustete Nase.
Anne besah sich mit geschultem Blick das schillernde Veilchen und tastete vorsichtig den Nasenknochen ab.
Frieda ertrug es ohne einen Mucks, jedoch mit zusammengebissenen Zähnen.
»Tut es sehr weh?«, fragte Anne teilnahmsvoll.
»Es geht. Ist die Nase gebrochen?«
»Soweit ich es beurteilen kann, nicht.«
Es war nicht die erste Hamsterfahrt, von der Frieda verletzt zurückkehrte. Einmal hatte sie zwei Fingernägel verloren. Ein Mann hatte ihr den Sack mit den Kohlen entrissen, die sie kurz vorher erbeutet hatte. Frieda hatte den Sack eisern festgehalten, doch der Mann war stärker gewesen. Ein anderes Mal hatte sie sich eine Platzwunde am Hinterkopf zugezogen, weil sie vom Trittbrett eines fahrenden Zuges gestürzt war. Viele mussten auf den Trittbrettern der Hamsterzüge mitfahren, etliche sogar auf den Puffern und Dächern, weil die Leute in den Waggons schon so eng zusammengepfercht standen, dass kaum noch einer richtig atmen konnte.
Anne lebte in der beständigen Sorge, dass Frieda bei diesen halsbrecherischen Unternehmungen ernsthaft zu Schaden kam. Wer auf Hamsterfahrt ging, musste mit allem rechnen. Es wurde gerangelt, geboxt, geschubst und nicht selten auch geraubt. Rücksicht konnte niemand erwarten. Für die Allermeisten ging es buchstäblich ums Überleben, jeder kämpfte verzweifelt für sich allein. Zu Hause warteten die Familien auf jeden noch so kleinen Bissen Nahrung. Kinder mit aufgetriebenen Bäuchen, werdende Mütter mit tief eingesunkenen Augen in spitzen Gesichtern, alte Menschen mit Hungerödemen. Anne begegnete ihnen bei ihrer Arbeit beinahe täglich.
Sie tupfte ihrer Schwester das getrocknete Blut unter der Nase mit Kölnisch Wasser ab. Davon hatte sie immer ein Fläschchen vorrätig; eine ihrer Patientinnen hatte Beziehungen zu 4711. Mit dem Rest der Flüssigkeit tränkte sie ein Taschentuch und reichte es Frieda als Kompresse für das lädierte Auge.
Frieda drückte sich das nasse Taschentuch nachlässig auf ihr Veilchen, dann stand sie auf und reckte sich. Sie war schmutzig vom Kohlenstaub und hatte überall blaue Flecken, aber ihr Unternehmungsgeist war ungebrochen.
»Soll ich gleich die Briketts eintauschen gehen?«
»Nein, darum kümmere ich mich«, erklärte Anne. »Du wäschst dich jetzt erst mal, und dann ruhst du dich ein bisschen aus.«
»Du siehst aber aus, als wärst du mindestens genauso kaputt wie ich. Wie lange bist du auf den Beinen? Warst du überhaupt seit gestern zwischendurch zu Hause oder hattest du wieder eine Doppelschicht? Du darfst dich nicht immer so ausbeuten lassen!«
Anne zuckte mit den Schultern. »Es geht schon. Ein bisschen was auf dem Schwarzmarkt zu besorgen, kriege ich noch hin.«
»Na gut. Aber lass dich nicht bescheißen.«
»Ich gebe mein Bestes«, versprach Anne, wie immer nicht ganz überzeugt, ob sie dieser Anforderung gerecht werden konnte. Ihren beruflichen Fähigkeiten vertraute sie blind, doch in der Welt des Schwarzhandels fühlte sie sich alles andere als heimisch. Im Gegensatz zu Frieda, der lag es gleichsam im Blut. Schon als junges Mädchen war sie in die Schattenwelt des Schwarzmarkts eingetaucht, hatte sich darin so traumwandlerisch sicher bewegt wie ein Fisch im Wasser. Nur ein einziges Mal war sie verhaftet worden, damals, als sie alle noch in Essen gelebt hatten. Von Arnold …
Sofort befahl Anne sich, nicht weiter an Arnold zu denken. Ginge es nach ihr, würde sie nie wieder an ihn denken. Was aber wohl bis ans Ende ihrer Tage ein frommer Wunsch bleiben würde. Hätte sie wie ihre jüngste Schwester mit Jesus sprechen können, hätte der ihr wahrscheinlich mitgeteilt, das durch Arnold verursachte Leid sei das Kreuz, welches sie nun mal tragen müsse.
Auf ihrem Weg zum Schwarzmarkt sah sie ihren Neffen Emil in einer benachbarten Ruine auf einer mindestens drei Meter hohen Mauer entlangbalancieren. Unten standen seine kleinen Freunde und feuerten ihn an. Mit angehaltenem Atem beobachtete Anne, wie Emil sich, beide Arme ausgebreitet, Schritt für Schritt bis zum Ende der Mauer vorwärtsbewegte und triumphierend auflachte, als er endlich sicheren Boden erreichte – soweit man dieses von Schrapnellen durchlöcherte erste Stockwerk überhaupt als sicher bezeichnen konnte. Die Treppe bestand nur noch aus Fragmenten von Stufen, die vereinzelt und in unregelmäßigen Abständen aus der Wand ragten wie Tasten eines zerschlagenen Klaviers.
Emil hüpfte diese Stufenreste leichtfüßig hinab, er war erst sechs, aber unerschrocken und wendig wie ein Zirkusartist. Erst als er unter dem lautstarken Beifall der übrigen Kinder unten angekommen war, wagte Anne, ihn zu sich zu rufen.
»Du sollst doch nicht so weit oben herumklettern, da kann sonst was passieren«, schalt sie ihn, obwohl sie wusste, dass er sich kaum darum scherte.
»Komm mal her.« Anne drückte ihren Neffen fest an sich, während ihr das Herz vor Zuneigung überströmte. »Deine Mutter ist wieder zurück«, teilte sie dem Kleinen mit.
»Ich weiß, hab sie vorhin schon gesehen.«
»Hast du dir heute Mittag Schwedenspeise geholt?«
Emil hob die Schultern, was bedeutete, dass es wieder Eintopf gegeben hatte, eine undefinierbare Pampe aus allerlei Resten und gerade genug Erbsen, um es grünlich aussehen zu lassen. Emil verabscheute Erbseneintopf, sowohl die Farbe als auch den Geruch. Irgendwer hatte ihm mal weisgemacht, es handle sich um aufgewärmte Kotze, und weder Argumente noch Hunger hatten ihn seither dazu bewegen können, davon zu essen.
Im Wechsel zum Gemüseeintopf wurde an den Suppenküchen auch süßer Brei ausgeteilt, den verschlang Emil wie alle Kinder mit Begeisterung, aber die Erbsenpampe verschmähte er hartnäckig. Das wiederum erforderte zusätzliche Beschaffungen von Essbarem, um die entfallenden Mahlzeiten zu ersetzen. Außerdem mussten sowohl Anne als auch Frieda bei Tisch sorgsam darauf achten, dass Lotti in ihrer frommen Selbstlosigkeit nicht Teile ihrer eigenen Rationen abzwackte und aufhob, um Emil zwischendurch was zustecken zu können. Oder um im Wetteifer mit dem heiligen Franziskus streunende Tiere durchzufüttern. Das Mädchen war eine wandelnde Lichtgestalt, aber auch bald nur noch ein Strich in der Landschaft.
Es traf sich gut, dass sie noch genug Kohlen hatten, so konnte Anne für die von Frieda organisierten Briketts Milch besorgen, sofern es welche gab. Vielleicht ließen sich damit sogar ein paar von den Eiern ersetzen, die Frieda im Zug verloren hatte. Regulär hatten sie schon lange keine Eier mehr bekommen, da halfen einem weder Geld noch Lebensmittelmarken. Brot und Margarine in armseligen Portionen, das war in den Läden seit Wochen das Höchste der Gefühle, aber auch nur dann, wenn man schon im Morgengrauen loszog, um sich früh genug anstellen zu können.
»Wo gehst du hin, Tante Anne?«, erkundigte sich Emil.
»Einkaufen.«
»Bringst du mir was mit?«
»Na klar.« Anne strich ihrem Neffen über die widerspenstigen Locken, dann klemmte sie sich die in Zeitungspapier eingewickelten Briketts fester unter den Arm und setzte ihren Weg zum Schwarzmarkt fort.
Kapitel 3
Zwei Wochen nach dem Tod von Adelheid Hoffmann fuhr Carl mit dem Zug nach Köln. Es gab ein notariell hinterlegtes Testament, und der Inhalt war für alle in der Abteilung eine ziemliche Überraschung gewesen. Grund genug, sich auf die Socken zu machen und der Sache nachzugehen. Eine Ermittlungsregel bei Mordfällen lautete: Folge der Spur des Geldes.
Er hatte eine Sitzplatzreservierung in der zweiten Klasse, was eindeutig von Vorteil war, denn der Zug war restlos überfüllt von Hamsterfahrern. Die meisten von ihnen drängten sich in der Holzklasse und in den Stehwaggons zusammen, aber weil es so viele waren, rückten sie notgedrungen auch in die übrigen Abteile vor, bis sie auch dort standen wie die Ölsardinen in der Büchse. Der Schaffner versuchte vergeblich, sich durch die Reihen zu kämpfen, und Carl konnte seinen Sitzplatz auch nur deshalb einnehmen, weil er zusätzlich zur Reservierung seine Polizeimarke vorzeigte. Der streitlustige junge Bursche, der sich dort mitsamt seinem Rucksack niedergelassen hatte, hätte sich sonst bestimmt nicht wegbequemt. Er beäugte die Marke voller Misstrauen und räumte nur unter Flüchen das Feld. Auf der Suche nach einem akzeptablen anderen Standort rempelte er sich rücksichtslos den Weg durch den Gang frei.
Carl ließ sich nieder und blickte müßig aus dem Fenster, das halb heruntergeschoben war und den Fahrtwind hereinließ. Es war ein sommerlich warmer Tag, die Sonne schien von einem wolkenlos blauen Himmel und tauchte die Landschaft in goldenes Licht. Wenn man nicht genau hinsah, gewann man den Eindruck einer reinen Idylle. Schafe, die auf Blumenwiesen weideten, Bäume in frischem Frühlingsgrün, Bauernhäuser inmitten gelb leuchtender Rapsfelder, hier und da wie hingetupft weiß und lila blühender Flieder. Alles völlig friedlich und unberührt.
Bei näherer Betrachtung waren jedoch auch die Hinterlassenschaften des Krieges zu erkennen. Die von Unkraut zugewucherten Bombenkrater. Abgeknickte Strommasten. Ausgebrannte Scheunen. Und überall dort, wo sich Ortschaften befanden, reihenweise Ruinen und Trümmerberge.
Man hätte denken können, dass drei Jahre mehr als genug Zeit waren, um all die Trümmer wegzuräumen, erst recht, wenn ein ganzes Volk mit nahezu nichts anderem beschäftigt war. Doch die schiere Menge des gesamten Schutts war von ihren Dimensionen her so gewaltig, dass selbst übermenschliche Anstrengungen nicht ausreichten, um alles auf einmal aus den Städten zu schaffen. In Essen, so hatte Carl unlängst in der Zeitung gelesen, hatte bisher nur etwa ein Zehntel der Trümmer beseitigt werden können. Kreuz und quer durch die Stadt verliefen behelfsmäßig verlegte Schienen, über die ohne Unterlass schwankende Loren ratterten, allesamt bis zum Rand mit Schutt beladen.
Carl hatte selbst nach seiner Wiedereinstellung über Monate hinweg mit anpacken müssen, so wie alle Kollegen, vom Anwärter bis zum Oberrat. Das Präsidiumsgebäude war durch die Luftangriffe stark beschädigt worden, der Seitenflügel in der Virchowstraße vollständig niedergebrannt. Ungezählte Stunden hatte er nach Feierabend zusammen mit Werner und vielen anderen Kollegen die Trümmer weggeräumt, oft bis zum Einbruch der Dunkelheit, und doch war es ihnen eine Ewigkeit lang so vorgekommen, als würden die Schuttberge niemals kleiner.
Zugleich hatte diese gemeinsame Arbeit das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt, nicht zuletzt bei Carl, der sich nach seinem Neueinstieg zuerst fremd und unsicher gefühlt hatte. Wie ein Berserker hatte er malocht, hatte es allen gezeigt. Er, der Kohlehauer, der Kumpel, dem Staub und Dreck nichts ausmachten. Der genau wusste, wie man eine Schaufel hielt und Gesteinsbrocken fortschaffte.
Bis zum Umfallen hatte er geschippt und geräumt und dabei viel von seiner Wut wegarbeiten können. Irgendwann hatte er gewusst, dass er wieder dazugehörte. Jetzt, drei Jahre später, war es fast so, als sei er nur kurz weg gewesen. Aber eben nur fast, wie ihm bei Schneiders plötzlichem Auftauchen am Tatort bewusst geworden war. Manche Dinge brauchten eben länger.
So wie in Essen war auch die Innenstadt von Köln immer noch ein einziges Trümmermeer. Eine Ruine reihte sich an die nächste, obwohl auch hier die Aufräumarbeiten seit Jahren in vollem Gange waren. Ein Teil der Straßenbahnen fuhr bereits wieder, es gab Strom und Wasser, zumindest in Teilen der Stadt, und auch die Müllabfuhr sorgte regelmäßig dafür, dass die Kölner Bürger nicht an ihrem Unrat erstickten. Über eine halbe Million Menschen lebten wieder in der Stadt, zehnmal mehr als gegen Kriegsende, und es kamen immer noch weitere dazu.
Erst vor wenigen Tagen war die beschädigte Hohenzollernbrücke wieder dem Verkehr übergeben worden. Während der Zug langsam über die Brücke rollte, hatte Carl einen freien Blick über den Rhein und das angrenzende Ufer. Zwischen den Ruinen und Trümmerbergen erhob sich majestätisch eine große alte Kirche – nicht der Kölner Dom, der befand sich geradeaus in Richtung Bahnhof und war deshalb nicht zu sehen, sondern irgendein anderes der unzähligen Kölner Gotteshäuser. Die Stadt war durch und durch katholisch, und ihr berühmt gewordener Kirchenoberer hielt es mit den Armen: Nach der vorletzten Silvesterpredigt des Kölner Erzbischofs Frings hatte sich im ganzen Land ein neues Wort für Kohlenklau eingebürgert: fringsen. Das Stehlen aus schierer Not war seither gleichsam mit kirchlichem Segen erlaubt. Kriminalstatistiken zufolge war die Anzahl der Kohlendiebstähle seither rasant gestiegen.
Am Kölner Hauptbahnhof herrschte ein ähnlicher Andrang wie bei Carls Abfahrt in Essen – auf den Bahnsteigen eine unaufhaltsam in Bewegung befindliche Menschenmenge, jeder Einzelne auf dem Sprung, den einlaufenden Zug zu entern und sich einen der raren Sitzplätze zu erkämpfen.
Carl wich den herandrängenden Massen so gut es ging aus und bahnte sich mit einigem Ellbogeneinsatz seinen Weg bis zum Ausgang, wo er sich zunächst zurechtfinden musste. Er war lange nicht in Köln gewesen, das letzte Mal irgendwann vor dem Krieg, und entsprechend ungewohnt wirkte die Umgebung auf ihn. Der Kölner Dom war einer der wenigen markanten Orientierungspunkte inmitten der weitflächigen Zerstörung.
Zu seiner Erleichterung entdeckte Carl nach kurzer Suche ein Straßenschild, das ihm den Weg wies. Etliche der Ruinen waren sogar mit Hausnummern versehen, meist aufgemalt oder eingeritzt, aber teilweise hatte man sogar wieder emaillierte Schilder angebracht. Überall hatten die Bewohner sich behelfsmäßig eingerichtet, unterhielten ihren Hausstand hinter bröckelnden Giebeln und löchrigen Mauern, deren scheibenlose Fensteröffnungen mit Tüchern zugehängt waren, um einen Rest Privatsphäre zu bewahren. Zwischen rostigen Eisenrohren waren Wäscheleinen aufgespannt, und kaputte Badewannen hatte man mit Erde angefüllt, um darin Gemüse oder Tabak zu ziehen.
Auf einer geborstenen Betonplatte, die früher mal eine Terrasse gewesen war, befand sich ein alter Kohleherd mit einem frei in die Luft ragenden, qualmenden Ofenrohr, und davor stand eine Frau und briet etwas Undefinierbares in einer Pfanne. Es roch fürchterlich, aber sicherlich würde irgendwer es runterschlingen, sobald es fertig war.
Überall in den Ruinen wuselten Kinder herum, lachend, lärmend, unbekümmert. Für sie war die Trümmerlandschaft ein einziger großer Spielplatz.
Carl gelangte zu dem Haus, das er suchte. Das einst vierstöckige Gebäude war ebenfalls nur noch in kläglichen Resten erhalten. In eine halbwegs intakte Mauerecke vom Parterre hatte sich jemand eine Hütte gezimmert, ein Konglomerat aus Teerpappe, Wellblech und angesengten Holzbrettern. Auch im Keller schien jemand zu wohnen. Steile Stufen führten von der Straße hinab in ein fensterloses Untergeschoss. Ein blonder Junge kam gerade die Treppe hoch. Ein schmales kleines Kerlchen, gekleidet in ein kariertes Hemd und eine abgewetzte kurze Lederhose. Die nackten Füße steckten in Sandalen aus Gummi, das jemand aus alten Autoreifen passend zurechtgeschnitten hatte. Die Rillen des Profils waren noch gut zu erkennen.
Obwohl der Junge kaum was auf den Rippen hatte, wirkte er sehnig und robust. Das helle Haar war zu kurzen Locken gestutzt, die Nase von Sommersprossen gesprenkelt. Die Ähnlichkeit mit Arnold Hoffmann war unverkennbar.
Carl sprach ihn an. »Wohnst du hier? Du heißt Emil, nicht wahr?«
Der Junge gab keine Antwort. Carl streckte ihm die Hand entgegen. »Guten Tag. Mein Name ist Carl. Ich komme aus Essen.«
Der Junge starrte seine Hand an, als könnte sie beißen. Im nächsten Moment drehte er sich auf dem Absatz herum und rannte die Treppe runter, zurück in den Keller.
»Tante Anne, Tante Anne, ein fremder Mann aus Essen!«, hörte Carl ihn kreischen.
Von unten drangen weitere aufgeregte Stimmen nach oben, sie stammten von zwei Frauen. Gleich darauf tauchte eine von beiden auf der Treppe auf. Ob es an dem anmutigen Gleichmaß ihrer Schritte lag oder dem offenen, in Wellen herabfallenden Haar – Carl hatte zwei Atemzüge lang den Eindruck, als stiege vor seinen Augen ein Engel aus der Unterwelt empor.
Gleich darauf hatte sie ihr Haar mit raschen Bewegungen im Nacken zusammengesteckt und sich von einem Engel in eine übermüdet wirkende Blondine Mitte dreißig verwandelt, die ihn argwöhnisch musterte. Sie trug ein schlichtes, klein gemustertes Kittelkleid, war mittelgroß und zierlich und auch sonst von recht irdischem Äußeren. Sie war nicht auf engelhafte Weise lieblich, sondern eher auf eine etwas herbe Weise gut aussehend. Manch einer hätte ihr Kinn vielleicht zu kantig und die Nase eine Spur zu lang gefunden, zumindest auf den ersten Blick. Der zweite schien etwas viel Wichtigeres zu offenbaren. Sie war es wirklich. Es war tatsächlich Anne.
Anne dachte später viel über diese Begegnung nach. In den Sekunden davor war da nichts gewesen außer purer Angst. Das Hochschießen ihres Pulses, als Emil die Worte Ein fremder Mann aus Essen gesagt hatte. »Ihr rührt euch nicht vom Fleck, ich gehe allein raus«, hatte sie Lotti und Emil befohlen. Zum Glück war Frieda nicht da, das hätte Mord und Totschlag geben können!
Dann die Erlösung, wie bei einem unter Druck stehenden Ballon, aus dem schlagartig alle Luft entweicht: Der Mann aus Essen war nicht Arnold!
Danach gleich die nächste aufwühlende Regung: Misstrauen. Wer war der Kerl, was wollte er? Aber der eigentlich entscheidende und wichtigste Augenblick kam erst, als Anne ihm zum ersten Mal ins Gesicht sah. Und stutzte. Das war doch …
»Carl?«, fragte sie sicherheitshalber. »Carl Bruns?«
Wie lange war es her? Zwanzig Jahre? Sie rechnete kurz. Ja, fast. Es war in dem Sommer gewesen, als sie sechzehn wurde. Eigentlich war es ein Wunder, dass sie ihn überhaupt wiedererkannte, obwohl er auf unbestimmte Weise beinahe so aussah wie damals in den kurzen drei Monaten, die sie miteinander gegangen waren. Er hatte ein schmales Gesicht und sandfarbenes Haar und trug einen verknitterten alten Anzug, viel mehr hätte Anne zu seinem Äußeren momentan kaum sagen können. Es war offensichtlich, dass er sie ebenfalls wiedererkannte.
»Anne«, sagte er. Und schluckte, nachdem er ihren Namen ausgesprochen hatte. »Du hast dich kaum verändert«, entfuhr es ihm.
Sie musste lachen, denn sie wusste, wie sie aussah, vor allem nach der hinter ihr liegenden schlaflosen, aufreibenden Nacht: ungewaschen, ungekämmt und bis auf die Knochen erschöpft.
Davon abgesehen hatte sie sich ohnehin nie als besonders reizvoll empfunden. Ihre beiden Schwestern waren die Schönheiten; es war fast so, als hätten die Eltern erst üben müssen und sich bei jeder Tochter gesteigert: Anne, die Älteste, war deutlich kleiner und unscheinbarer geraten als Frieda, die zehn Jahre nach ihr auf die Welt gekommen war und von Geburt an als die Hübschere galt. Bis weitere zehn Jahre später das Nesthäkchen Lotti auf den Plan getreten war. Mit ihrem hohen Wuchs und dem elfenhaften Antlitz stellte Lotti die perfekte spätgeborene Vollendung der elterlichen Fortpflanzungsbemühungen dar, gleichsam die Krönung der familiären Evolution. Schon als Baby war sie der unumstrittene Sonnenschein aller gewesen, ein Püppchen wie aus dem Bilderbuch.
Ein Püppchen war Lotti jetzt nicht mehr, im Gegenteil, inzwischen war sie aufgeschossen und dünn wie ein Blumenstängel, sie wirkte insgesamt noch ein wenig unfertig, aber die künftige Grazie schimmerte schon durch. Bald würden ihr die Jungs hinterherhecheln, da konnte sie noch so fromm sein.
»Was tust du in Köln?«, wollte Anne wissen, voller Neugier, was ihn hergeführt hatte. »Oder bist du rein zufällig hier?«
»Nicht direkt.« Um seine Mundwinkel huschte ein Lächeln, und Anne spürte ihre innere Unruhe wachsen, erst recht, als sie die dargebotene Hand ergriff.
»Ich komme von der Kripo Essen, Abteilung Kapitalverbrechen«, erklärte Carl. »Ich ermittle in einem Todesfall.« Er zog eine Dienstmarke aus der Innentasche seiner Anzugjacke und zeigte sie Anne. »Ich würde gern mit deiner Schwester sprechen. Ist sie da?«
Anne schüttelte stumm und erschrocken den Kopf.
»Sie wohnt aber hier mit dir zusammen, oder?«
»Ja, sie ist nur gerade nicht da«, antwortete Anne reserviert. »Worum geht es denn?«
Er stellte eine Gegenfrage. »Wann kommt sie zurück?«
»Jetzt im Moment«, sagte Anne und zeigte in die entsprechende Richtung.
Frieda kam die Schildergasse herunterspaziert, als gehörte die Straße ihr. So kam sie immer daher – mit ausgreifenden Schritten, erhobenem Kopf und durchgedrückten Schultern. Der Platz, den sie dabei einnahm, schien immer etwas heller zu sein als die Umgebung, das war die Wirkung, die sie auf Menschen ausübte.
»Frieda, das ist Carl Bruns von der Kripo Essen«, stellte Anne ihn ihrer Schwester vor, bevor Carl selbst etwas sagen konnte. »Er ermittelt in einem Todesfall.«
»Carl?« Frieda entwich ein Laut des Erstaunens. »Ist das etwa der Carl? Dein allererster Freund? Und der ist jetzt bei der Kripo? Mein lieber Herr Gesangsverein!« Sie grinste Anne an. »Hast du jemanden umgebracht?«
»Er will eigentlich mit dir sprechen.«
»Reine Routine«, warf Carl ein. Seine Stimme klang freundlich, aber Anne war sich bewusst, dass seinem aufmerksamen Blick nichts entging. Er reichte auch Frieda die Hand zur Begrüßung, ehe er fortfuhr: »Vor zwei Wochen wurde in Essen-Rüttenscheid eine Frau namens Adelheid Hoffmann tot aufgefunden, allem Anschein nach ermordet. Deine Schwiegermutter, Frieda.«
Anne fühlte sich bei seinen letzten Worten von einer jähen, rachelüsternen Befriedigung durchflutet, und nicht ohne Sorge fragte sie sich, ob Carl es ihr wohl ansah. In dem Bemühen, ihren Gesichtsausdruck zu kontrollieren, riskierte sie einen Seitenblick zu Frieda. Auch ihre Schwester hatte eine unbewegte Miene aufgesetzt, doch Anne spürte mit allen Sinnen, dass Frieda ebenso aufgewühlt war wie sie.
»Es gibt eine letztwillige Verfügung. Frieda, dein Sohn Emil ist demnach der Enkel von Adelheid Hoffmann. Deswegen bin ich hier. Sie hat den Jungen testamentarisch als Alleinerben eingesetzt.«
»Sie hat was?«, platzte Frieda heraus. Die Verblüffung stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Adelheid Hoffmann hat laut amtlich eröffnetem Testament ihr gesamtes Vermögen deinem Sohn vererbt. Einschließlich des Hauses, in dem sie gewohnt hat.«
»Und was ist mit Arnold – wäre nicht eigentlich er der gesetzliche Erbe?«, erkundigte sich Anne. Die Frage kam ihr nur mühsam über die Lippen. Den Namen ihres Schwagers auszusprechen fühlte sich fast so widerwärtig an wie damals seine Berührungen.
»Theoretisch wäre er pflichtteilsberechtigt, aber es ist kaum zu erwarten, dass er Ansprüche geltend macht. Er wird wegen Massenmords gesucht.«
»Was?«, entfuhr es Frieda und Anne gleichzeitig.
Entgeistert sahen sie zuerst einander und dann Carl an.
Und dann hörten beide in schockiertem Schweigen zu, was er ihnen zu berichten hatte, über die Ermordung mehrerer Dutzend Zwangsarbeiter, die Entdeckung des Massengrabs, die laufende Fahndung. Und das Todesurteil, das gegen Arnold ergangen war.
»Ihr wisst nicht zufällig, wo er sich aufhält, oder?«, fragte Carl, nachdem er mit seiner Schilderung fertig war.
»Wir haben ihn seit Jahren nicht gesehen«, erklärte Anne. »Und seine Mutter auch nicht.«
»Bist du extra deswegen nach Köln gekommen?«, fragte Frieda. »Um uns zu fragen, wo er ist?« Sie hielt inne und schüttelte den Kopf. »Sicher nicht. Also was genau willst du hier?«
»Wie ich schon sagte: Ich ermittle in dieser Angelegenheit, da ein Verbrechen vorliegen könnte.«
Mit Verbrechen meinte er logischerweise Mord. Anne hatte genug Kriminalromane gelesen, um das Unausgesprochene herauszuhören. Bei einem Mord erhob sich stets die Frage nach dem Motiv. Zum Beispiel Rache oder Hass. Und natürlich Geld. Das Testament hatte sofort in eine bestimmte Richtung gewiesen – hierher nach Köln, zu ihnen in die Schildergasse. Sie waren diejenigen, die von Adelheids Tod profitierten. Genau deshalb war er hergekommen: um ihnen ins Gesicht sehen und ihre Reaktionen beobachten zu können, während er ihnen diese Botschaft überbrachte. Er hatte sie unvorbereitet antreffen wollen, sodass sich vorher niemand seine Aussage zurechtlegen konnte.
Frieda kleidete Annes Gedanken in Worte. »Stehen wir unter Verdacht?«, fragte sie Carl geradeheraus.