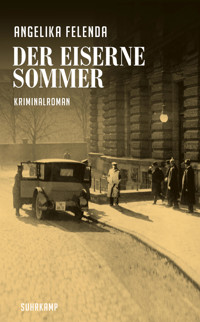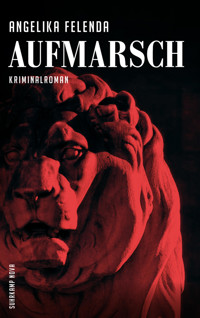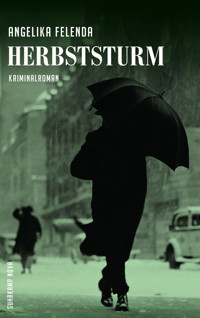
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissär-Reitmeyer-Serie
- Sprache: Deutsch
Ermittlungen in zwei Mordfällen führen den unerschrockenen Münchner Kommissär Reitmeyer in die Kreise russischer Exil-Monarchisten, die sich nach der Oktoberrevolution in der Stadt niedergelassen haben. In ebenjene Kreise, in denen sein bester Freund, der Rechtsanwalt Sepp Leitner, die Tochter einer illustren russischen Adeligen suchen lässt, um sein Salär aufzubessern. Doch was hat das Verschwinden der Anna Kusnezowa mit den beiden toten Männern zu tun?
München, 1922. Die Inflation galoppiert, wegen der Reparationsforderungen werden Anschläge auf die Französische Gesandtschaft verübt und in der Stadt marodieren Mitglieder der inzwischen verbotenen Freikorps. Kommissär Reitmeyer hingegen könnte es eigentlich gutgehen – immerhin hat sich die Beziehung zu seiner Jugendfreundin Caroline deutlich entspannt. Doch seine Ermittlungen zwischen gestrandeten Ex-Militärs und zwielichtigen russischen Damen erweisen sich schwieriger als gedacht – zumal sich der Verdacht erhärtet, dass sein schlimmster Widersacher in den eigenen Reihen sitzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Angelika Felenda
Herbststurm
Kriminalroman
Suhrkamp
»… bis in den späten Nachmittag hinein, wo ich diese Zeilen schreibe, tobt buchstäblich eine donnernde Schlacht. Ein ganzes Fliegergeschwader kreuzt über München, das Feuer lenkend, selber beschossen, Leuchtkugeln abwerfend; bald ferner, bald näher, aber immerfort krachen Minen und Granaten, daß die Häuser beben, ein Sturzregen aus Maschinengewehren folgt den Einschlägen, Infanteriefeuer knattert dazwischen. Und dabei marschieren, fahren, reiten immer neue Truppen mit Minenwerfern, Geschützen, Fouragewagen, Feldküchen durch die Ludwigstraße, bisweilen mit Musik, und am Siegestor hält eine Sanitätskolonne, und in alle Straßen verteilen sich starke Patrouillen und Abteilungen verschiedner Waffen, und an allen Ecken, wo man gedeckt ist und doch Ausblick hat, drängt sich das Publikum, häufig das Opernglas in der Hand.«
Victor Klemperer über das Einrücken der Truppen bei der Zerschlagung der Räterepublik in München Anfang Mai 1919.
Victor Klemperer, Man möchte immer weinen und lachen in einem
Prolog
Sich mittags zu verabreden, war nicht mehr möglich. Mittags hatte so gut wie keiner mehr Zeit. Da musste man zur Bank. Denn zwischen halb eins und eins wurden die neuen Kurse verkündet.
Sepp blickte aus dem Fenster seiner Kanzlei auf die täglich wiederkehrende Prozession hinab, die über den Odeonsplatz in Richtung Zentrum marschierte. Herren in feinem Zwirn und Damen in schicken Mänteln, Männer in Arbeitskluft und Frauen mit Umschlagtüchern. Das Spekulationsfieber hatte alle gepackt, egal ob Hausbesitzer oder Beamter, ob Künstler, Buchhalterin oder Chauffeur. Alle hetzten und hasteten vorbei, um schnell noch eine Order zu platzieren, um irgendwelche Papiere abzustoßen oder sich neue zu sichern, immer getrieben von der Hoffnung, der angeblich bombensichere Tipp eines Börsenkenners bringe den ersehnten Profit. Keiner der rastlos Dahineilenden fand einen Augenblick Muße, um diesen Herbsttag zu genießen, keiner blieb stehen und hielt das Gesicht in die Sonne oder warf einen Blick in den seidenblauen Himmel.
Von hier oben sahen die Berge wie zum Greifen nah aus, was natürlich nur eine optische Täuschung war, die immer dann eintrat, wenn der Föhn die Luft klärte und so die Fernsicht verbesserte. Das Gehirn gaukelte einem aber vor, die Alpen seien tatsächlich näher gerückt. Sepp drehte sich um und blickte auf das Bündel Geldscheine auf seinem Schreibtisch, das sein Mandant als Anzahlung zurückgelassen hatte. Warum nur, dachte er, funktionierte der Trick in dem Fall nicht? Warum gaukelte ihm angesichts der Tausendmarkscheine sein Gehirn nicht vor, er sei reich und müsse sich keine Sorgen machen. Aber das Räderwerk in seinem Kopf funktionierte mit gnadenloser Präzision und rechnete aus, dass er an dem Prozess nichts mehr verdienen würde. Er würde seine Rechnung stellen, und die Mandanten hätten keine Eile mit dem Bezahlen, denn dank der immer schneller Fahrt aufnehmenden Inflation wäre die Summe ein paar Wochen später nur noch den Bruchteil dessen wert, was er gefordert hatte. Wenn er nicht ein paar Ausländer als Mandanten hätte, die seine Honorare in Devisen zahlten, müsste er seine Angestellten entlassen und sein Glück ebenfalls an der Börse versuchen.
Doch so weit war es noch nicht. Der Dollar stand zwar bei über viertausend Mark, aber mit den Fällen seiner Schweizer und amerikanischen Klienten würde er noch eine Weile durchhalten. Im Übrigen hatte er jetzt Mittagspause, vielleicht blieb ihm sogar noch Zeit für ein paar Schritte durch den Hofgarten.
»Ich geh dann mal kurz weg«, rief er durch die angelehnte Tür zu seiner Sekretärin hinüber und griff nach seinem Mantel an der Garderobe.
»Das ist jetzt vielleicht schlecht«, antwortete Fräulein Kupfmüller.
»Wieso?«
Die Miene seiner Sekretärin, die gleich darauf in seinem Büro erschien, beantwortete die Frage. Sie sah ihn schuldbewusst an, wie immer, wenn sie zwischen zwei Termine noch einen dritten gequetscht oder gleich seine Mittagszeit verplant hatte. Meistens ging es um irgendwelche Leute in »ausweglosen Situationen«, die sie beschwatzt und an ihr Mitleid appelliert hatten, weil sie angeblich sonst nirgendwo Hilfe fanden. Nicht zuletzt deswegen, weil sie fast durchweg über keinerlei Mittel verfügten, um einen Anwalt zu bezahlen.
»Das ist mir wirklich unangenehm, Herr Dr. Leitner.« Sie nestelte an der Brosche an ihrer hochgeschlossenen Bluse und strich über den langen dunklen Rock. Von ihrem Äußeren hätte kaum jemand auf ein weiches Herz geschlossen. Sie erinnerte eher an den Typ strenge Gouvernante, die sich nicht so leicht einwickeln ließ.
»Aber verstehen Sie. Die arme Frau ist schon mehrmals da gewesen, und ich hab’s einfach nicht über mich gebracht, sie nochmal wegzuschicken. Und in der nächsten Woche sind wir ja auch schon voll.«
»Also das passt mir jetzt wirklich gar nicht, Fräulein Kupfmüller«, sagte Sepp und schlüpfte in seinen Mantel. »Ich brauch schließlich auch mal eine Stunde, um auszuspannen.«
Aber sie ließ nicht locker. »Später hat jemand abgesagt. Ihre Pause würde sich ja bloß verschieben, und man müsste der Frau nicht erklären, dass sie nochmal …«
Widerstrebend nahm Sepp die Visitenkarte, die sie ihm beharrlich entgegenstreckte. Maria Alexandrowna Kusnezowa las er. »Eine Russin?«
»Ja, aus St. Petersburg. Ursprünglich. Sie lebt aber schon seit zwei Jahren in München. Und spricht fließend deutsch. Weil sie in Riga geboren ist. Eine Deutschbaltin, verstehen Sie.«
»Aha.« Sepp blickte wieder auf die Visitenkarte. Mit den russischen Emigranten in der Stadt hatte er noch nie zu tun gehabt. Wahrscheinlich, weil es sich fast ausschließlich um Angehörige der ehemaligen zaristischen Oberschicht handelte, um Adlige, hohe Beamte und Militärs, die sich kaum an einen Anwalt wandten, der politisch eher dem linken Spektrum zuzurechnen war. »Und hat sie Ihnen auch erzählt, was sie will?«
»Nichts Genaues. Aber sie wirkt ziemlich verzweifelt. Und ich hab den Eindruck«, die Sekretärin senkte die Stimme und beugte sich näher, »dass ihr irgendwas peinlich ist. Worum es geht, will sie nur Ihnen persönlich sagen. Wenn Sie mich fragen, handelt es sich um was Familiäres.«
»Ist das wieder eine Ihrer Ahnungen, die Sie Ihrem untrüglichen Instinkt zuschreiben?«
Fräulein Kupfmüller richtete sich auf und rückte die Brille zurecht. »Ich hab mich selten getäuscht. Nach so vielen Jahren in meinem Beruf merkt man, was im Busch ist. Da hat man ein Gespür.«
»Hat sie denn angedeutet, wie sie ausgerechnet auf mich gekommen ist?«
Die Sekretärin zuckte die Achseln. »Das hab ich nicht aus ihr rausgekriegt.«
Sepp sah noch einmal durch das offene Fenster in den strahlenden Himmel hinaus, zögerte kurz und zog seinen Mantel wieder aus. »Na dann, in Gottes Namen«, sagte er schließlich. »Dann seh ich eben mal nach ihr.« Er ging den Gang zum Wartezimmer hinunter.
Durch die Tür sah er eine sehr ausladende und sehr winterlich gekleidete Gestalt am Tisch in der Mitte des Raums, die in ihrer Handtasche wühlte. Als er eintrat, zuckte sie zusammen und drehte sich ruckartig um. Vom Gesicht der Frau war nicht viel zu erkennen, weil sie einen altmodischen, breitrandigen Hut trug, der Stirn und Augen verdeckte. Man sah nur einen leicht nach unten gebogenen Mund und Wangenpartien, die bleich und etwas teigig wirkten.
»Frau Kusnezowa?«
Sie nickte, nahm ihre Tasche und machte einen Schritt auf ihn zu. Als Sepp ihr die Hand schütteln wollte, streckte sie die ihre so aus, als erwarte sie einen Handkuss. Er erwischte nur ihre Fingerspitzen, die sie ihm schnell wieder entzog.
Sepp ließ sich nicht irritieren von der verunglückten Begrüßung. »Darf ich Sie in mein Büro bitten, Frau Kusnezowa?«
»Danke, dass Sie mich empfangen«, sagte sie mit heiserer Stimme. »Und nennen Sie mich Maria Alexandrowna.«
Sepp unterdrückte ein Grinsen, weil er sich einen Moment lang vorkam, als redete er mit einer Figur aus einem russischen Roman. Dazu passte auch die Aufmachung der Dame: Trotz der milden Temperaturen trug sie einen fast bodenlangen Mantel aus glattem Fell und um die Schultern eine breite Silberfuchsstola, als ginge es auf eine Schlittenfahrt.
»Möchten Sie vielleicht ablegen?«, fragte Sepp, als er in seinem Büro auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch deutete.
Maria Alexandrowa schien zu überlegen, warf aber nur die Stola über die Lehne, bevor sie sich niederließ. Dann zog sie eine lange Nadel aus dem mit schwarzen Kreppbändern verzierten Ungetüm auf ihrem Kopf, setzte den Hut ab und legte ihn auf den Tisch. Mit einer raschen Bewegung befestigte sie ein paar graue Strähnen, die ihrer straffen Knotenfrisur entkommen waren, und sah ihn mit verblüffend blauen Augen an. Sie muss einmal schön gewesen sein, dachte Sepp, bevor ihr Gesicht so aufgedunsen und ihr Körper so aus der Form gegangen war. Gleichzeitig vermittelte sie den Eindruck, als wären nicht Genuss und Wohlleben der Grund für die Leibesfülle. Er tippte eher auf Kummer und Sorgen.
»Nun, was führt Sie zu mir?«, fragte er und nahm ebenfalls Platz.
Sie zerrte ein Taschentuch aus dem Ärmel, tupfte winzige Schweißperlen von der Oberlippe und holte Luft. »Ich brauche Hilfe«, begann sie. »Ich habe meinen Mann und mein Land verloren. Und jetzt sieht es so aus, als würde ich auch noch das Kostbarste verlieren, was ich je besessen habe.« Sie schluchzte trocken auf. »Meine Tochter.«
»Was ist mit Ihrer Tochter?«
»Sie ist verschwunden.«
»Seit wann?«
»Seit vier Tagen.«
Sepp wartete, während sie sich die Augen abtupfte. »Meine Tochter wollte nach Baden-Baden«, fuhr sie nach einer Weile fort. »Um eine Freundin zu besuchen. Aber sie ist nie angekommen, niemand hat etwas gehört oder gesehen von ihr. Ich habe überall nachgefragt, überall angerufen. Aber nichts.«
»Tja, ich weiß nicht recht, Frau … ähm … Maria Alexandrowna.« Sepp schüttelte den Kopf. Er musste seiner Sekretärin unbedingt einbläuen, dass er keinen ihrer »Schützlinge« mehr vorließ, wenn sie nicht Auskunft gaben, in welcher Angelegenheit sie Rat suchten. »Ich bin Anwalt, verstehen Sie. Ich glaube, ich bin die falsche Adresse für Ihren Fall. Sie sollten sich vielleicht besser an die Polizei wenden und eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
»Bei der Polizei? Da war ich doch bereits!«, rief sie.
»Ja, und?«
»Der Beamte hat mir erklärt, dass ich abwarten solle, dass vier Tage kein Zeitraum sei, bei dem man sich Sorgen machen müsse. Meine Tochter sei achtundzwanzig, eine erwachsene Person … Die Polizei«, sie spuckte das Wort förmlich aus und rang nach Atem. »Die Polizei tut gar nichts!«
Sepp goss aus der Karaffe auf dem Schreibtisch ein Glas Wasser ein und schob es ihr hinüber. Sie trank einen Schluck, behielt das Glas in der Hand und sah ihn mit der Miene einer Tragödin an, die am Nationaltheater die Medea gab. Hoffentlich neigte sie nicht zu entsprechenden Ausbrüchen, dachte er besorgt.
»Ich verstehe natürlich Ihre Beunruhigung«, begann er vorsichtig. »Ich will es Ihnen mal so erklären. Die Polizei geht vermutlich davon aus, dass Ihre Tochter irgendwohin gefahren sein könnte, ohne sich bei Ihnen abzumelden. Vielleicht zu Verwandten oder zu Freunden. Ich meine, ich kenne die Gepflogenheiten Ihrer Tochter nicht, aber junge Frauen führen heute oft ein etwas«, er machte eine vage Geste, »ein etwas unabhängigeres Leben, als es für ihre Mütter noch üblich war.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte sie empört und stellte das Glas ab. Die steile Falte zwischen ihren Augen vertiefte sich.
»Ich wollte nur …«
»Was glauben Sie denn, wer wir sind?«, unterbrach sie ihn. »Mein Mann war Minister im Zarenreich! Meine Tochter fährt nicht irgendwohin. Wie hört sich denn das an? Als wäre sie ein Dienstmädchen, das mit dem Chauffeur durchbrennt. Oder Tänzerin beim Varieté!«
Sepp beobachtete, wie sie den Kragen ihres Mantels zurückschlug und nach einem silbernen Kreuz um ihren Hals griff. Ihr Körper schien zu beben vor Entrüstung. Offenbar hatte er einen Nerv getroffen.
»Bitte missverstehen Sie mich nicht, ich wollte nur darauf hinweisen …«
Aber sie ging gar nicht ein auf seine Worte, sondern riss die Handtasche in ihrem Schoß auf, kramte hektisch darin herum und förderte ein Bündel Fotografien zutage. Sepp machte ein paar abwehrende Handbewegungen, aber sie ließ sich nicht aufhalten und begann, die Bilder auf dem Schreibtisch auszubreiten.
»Sehen Sie her, das war unser Haus in Zarskoje Selo«, verkündete sie. »Das ist ein Vorort von St. Petersburg. Dort befindet sich auch der Sommersitz der Zarenfamilie. Und das ist meine Tochter.« Sie klopfte mit dem Zeigefinger auf eines der Fotos. »Beim Spiel mit den Zarentöchtern.«
Sepp schnaufte auf. »Also wissen Sie, Frau … Maria …«
Als sie erneut auf das Bild klopfte und ihn mit starren Pupillen fixierte, warf er schließlich doch einen Blick auf die Fotos. Sie zeigten einen Garten, im Hintergrund die Terrasse eines großen Anwesens, im Vordergrund eine Gruppe von kleinen Mädchen in weißen Kleidern. Manche vergnügten sich auf einer Schaukel, andere rannten Hunden hinterher. Ob es sich dabei um die Töchter des Zaren handelte, ließ sich nicht sagen. Es war ihm auch ziemlich egal. Doch darauf kam es auch nicht an. Die Frau wollte ihm einfach demonstrieren, dass sie vor der Revolution in ihrem Land zu den Spitzen der Gesellschaft gehört und großes Ansehen genossen hatte. Und daraus sollte sich wohl ableiten, dass ihre Tochter über einen untadeligen Ruf verfügte.
»Und diese beiden wurden letztes Jahr in Bad Reichenhall aufgenommen.« Sie schob ihm zwei weitere Fotos hin. Auf einem sah man eine junge Frau in modischem Kleid auf einer Parkbank sitzen, auf dem anderen stand sie neben einem Herrn vor einem Hoteleingang. Die Fotos waren ziemlich klein, aber so viel ließ sich erkennen, dass diese junge Frau ausnehmend hübsch war.
»Letztes Jahr, sagen Sie? Im Frühjahr 21? Auf dem monarchistischen Kongress?«
Sepp erinnerte sich gut, weil die Tagung große Aufmerksamkeit in der Presse gefunden hatte. Allerdings wurde der Versuch der russischen Monarchisten, sich neu zu organisieren und ihre Spaltungen zu überwinden, nicht durchweg wohlwollend aufgenommen. Mit Ausnahme der rechten und nationalistischen Blätter fanden die meisten, dass die Zaristen ihre Träume von der Wiederherstellung des alten Regimes endgültig begraben sollten.
Maria Alexandrowna nickte nur kurz auf seine Frage und reichte ihm ein weiteres Bild. Diesmal eine postkartengroße Porträtaufnahme der jungen Frau, die er schon von den Reichenhaller Fotos kannte. Hier sah man deutlich, dass sie nicht bloß hübsch, sondern eine wahre Schönheit war. Ein zartes Gesicht mit hohen Wangenknochen von dunklem Haar umrahmt. Eine Haut so glatt und schimmernd wie Biskuitporzellan, die Augen hell, wie die ihrer Mutter. Der aufgeworfene Mund jedoch, den sie nicht von ihrer Mutter hatte, schien auf einen gewissen Eigensinn hinzudeuten. Die ordnet sich nicht brav unter, schoss ihm durch den Kopf. Die wartete nicht in München, bis in Russland die alten Eliten wieder die Oberhand gewonnen hatten. Die war sicher längst an der Côte d’Azur oder sonst einem Badeort, wo sich die reichen Emigranten vergnügten und wo man ihre exquisiten Reize zu schätzen wusste. Ganz ähnliche Gedanken mochten dem Beamten bei der Vermisstenstelle gekommen sein. Er legte das Foto neben die anderen auf den Tisch. Sein Gegenüber sah in erwartungsvoll an.
»Ja nun, was soll ich sagen, Maria Alexandrowna … Ich weiß einfach nicht, wie ich Ihnen helfen könnte.«
»Aber Sie haben doch schon in vielen aussichtslosen Fällen geholfen.«
»Das mag ja sein, aber als Anwalt, als juristischer Beistand, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Ich kann bezahlen«, erwiderte sie unvermittelt und zog eine kleine viereckige Schatulle aus der Handtasche. Sie klappte den Deckel hoch. Ein goldener Ring mit einem blauen Stein blitzte im Sonnenlicht. Dann griff sie erneut in die Tasche und legte einen Zwanzigdollarschein neben den Schmuck.
»Ich bitte Sie, es ist doch keine Frage von Geld«, sagte Sepp und klappte die Schatulle wieder zu. »Aber ich betreibe nun mal keine Vermisstenstelle und suche keine Leute, die verschwunden sind. Ich kann Ihnen nur raten, sich nochmals an die Polizei zu wenden, vielleicht mit einiger Unterstützung. Sie haben doch gute Kontakte.« Er deutete auf die Fotos aus Reichenhall. »Sie kennen doch Leute, die über Einfluss verfügen und gute Beziehungen zu den hiesigen Behörden pflegen. Das würde Ihrer Sache sicher Nachdruck verleihen.«
Maria Alexandrowna blickte eine Weile nicht auf. Ein resigniertes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Wie sind Sie denn überhaupt auf meine Kanzlei gekommen?«, fragte Sepp.
Sie antwortete nicht gleich. »Ach … Jemand hat Sie empfohlen«, sagte sie schließlich.
»Darf ich fragen, wer das war?«
»Jemand in einem Lokal.«
»In einem Lokal?«
»Ja. In einem Café. Im Café Iris.«
»In der Schraudolphstraße?«
Den Besitzer hatte er vor einiger Zeit in einer Erbschaftsangelegenheit vertreten. Und jetzt erinnerte er sich, dass der damals russische Emigranten erwähnt hatte, die sein Etablissement als Treffpunkt nutzten, weil die meisten in Pensionen in der Umgebung wohnten.
»Also im Café Iris?«, fragte er noch einmal.
Maria Alexandrowna nickte nur, ließ sich jedoch zu keinen näheren Erklärungen herab. Sepp sah die Frau an, die seinen Blick nicht erwiderte. Wenn sie sich an einen Kaffeehausbetreiber wenden musste, um Rat und Hilfe zu bekommen, war es mit ihren guten Beziehungen in der russischen Kolonie nicht weit her. Oder wollte sie in diesen Kreisen nichts verlauten lassen vom Verschwinden ihrer Tochter? Die ganze Sache war einigermaßen mysteriös.
Maria Alexandrowna nahm das Schmuckkästchen und steckte es wieder in die Tasche. »Ich verstehe«, sagte sie. »Sie wollen den Ring nicht. Aber das hier …« Sie deutete auf den Geldschein. »Das war nur als Anzahlung gedacht. Und die kann ich erhöhen. Falls Sie Mittel brauchen, um Leute zu engagieren für die Suche nach meiner Tochter.« Damit zog sie einen Hundertdollarschein heraus, den sie ebenfalls auf den Tisch legte. »Und wenn Sie meine Anna finden …« Sie machte eine Pause und sah ihn eindringlich an. »Wenn Sie meine Tochter finden, biete ich Ihnen ein Erfolgshonorar von dreihundert Dollar.«
Sepp lehnte sich zurück und starrte auf das Geld. Mit über vierhundert Dollar wäre seine Kanzlei auf Monate saniert. Er müsste sich nicht mehr sorgen, wie er seine Miete und seine Angestellten bezahlte. Er müsste nicht mehr ständig rechnen, wie viel die Inflation ihm von den Honoraren wegfraß, bevor sie auf seinem Konto landeten. Selbst Extraausgaben wie die Reparatur seines Autos wären kein Problem mehr. Kurzum, es war ein Angebot, das er nicht ausschlagen konnte.
»Wenn ich Hilfskräfte einsetzen könnte«, begann er zögernd, »sähe die Sache natürlich günstiger aus …«
Maria Alexandrowna nickte. »Engagieren Sie so viele, wie Sie brauchen. Sie haben doch sicher entsprechende Personen an der Hand?«
Sepp überlegte einen Moment. Dann stand er auf, ging zur Garderobe und durchsuchte die Taschen seines Mantels. »Ah«, sagte er und hielt eine Karte hoch. »Ich kenne tatsächlich jemanden, der genau der richtige Mann für uns wäre. Er war früher Offizier in der kaiserlichen Armee und betreibt jetzt eine Detektei.«
Der Ausdruck »kaiserliche Armee« schien eine magische Wirkung auf Maria Alexandrowna auszuüben. Ihre Miene hellte sich schlagartig auf. »Ich wusste doch, dass Sie mir helfen können!«, sagte sie und schlug sich auf die Brust.
»Ich kann Ihnen natürlich nichts versprechen.« Sepp ging zum Schreibtisch zurück und notierte sich die Telefonnummer auf der Karte, bevor er sie über den Tisch schob. »Ich setze mich sofort mit dem Mann in Verbindung, und er sucht Sie so schnell wie möglich auf. Dieses Foto Ihrer Tochter«, er zeigte auf die postkartengroße Aufnahme, »würde ich gern behalten. Sie bekommen es natürlich wieder zurück.«
Wie neu belebt erhob sich Maria Alexandrowna, nahm ihren Hut vom Tisch und griff nach der Karte. Sepp reichte ihr die Stola und begleitete sie zur Tür. Dort blieb sie stehen und drückte seine Hand. »Ich danke Ihnen«, sagte sie. »Ich danke Ihnen von Herzen.«
Mit etwas zwiespältigen Gefühlen ging Sepp zu seinem Schreibtisch zurück. Vielleicht hätte er der Frau nicht solche Hoffnungen machen dürfen. Schließlich kannte er diesen Detektiv so gut wie gar nicht. Der Mann hatte ihn angesprochen, weil er am Tresen eines Lokals mitbekommen hatte, dass Sepp Rechtsanwalt war. Er sei ehemaliger Offizier, hatte er erklärt, und versuche, sich eine neue Existenz aufzubauen. Möglicherweise könnte er einem Anwalt einmal von Nutzen sein. Man könne ja nie wissen. Sepp hatte die Karte schließlich nur genommen, weil er den Menschen rasch loswerden wollte.
Als er sich setzte, sah er wieder auf das Geld. Wenn er diesem Detektiv sagte, dass ihm Dollars winkten, würde der sich mächtig ins Zeug legen und nicht lockerlassen. Wann käme der schon an einen Auftrag, der in Devisen bezahlt wurde? Aber zuerst müsste er sich den Mann natürlich ansehen. Dass er früher einmal Offizier gewesen war, bedeutete für Sepp keinen Vertrauensvorschuss. Eher im Gegenteil. Andererseits konnte man davon ausgehen, dass dieser Mensch über ein Auftreten und Benehmen verfügte, das man bei anderen Vertretern seiner Zunft nicht voraussetzen durfte. Jedenfalls wüsste er sich in den Kreisen von Maria Alexandrowna zu bewegen, ohne gleich als windiger Schnüffler abgetan zu werden.
Sepps Blick fiel wieder auf das Foto der schönen Tochter. Wenn ihr nun wirklich etwas zugestoßen war, dachte er plötzlich. Wenn sich seine Vermutung, dass sie sich an irgendwelchen mondänen Orten herumtrieb, nur den Vorurteilen verdankte, die er bestimmten Russen gegenüber hegte. Weil er einfach keine Sympathien aufbrachte für Leute, die ein reaktionäres System verklärten und eine Unrechtsherrschaft zurückwünschten.
Sepp trat ans Fenster und sah auf den sonnigen Platz hinab. Vielleicht müsste er doch irgendwann die Polizei einschalten? Und was wäre dann mit seinem »Erfolgshonorar«? Das könnte er dann in den Wind schreiben. Wie ließe sich das verhindern? Er ging eine Weile auf und ab. Dann kam ihm eine Idee. Er griff zum Telefon.
1
Reitmeyer legte die Akte auf den Schreibtisch und sah sein Gegenüber an. Es gab nicht viele, die es schafften, für einen längeren Zeitraum derart dreist zu lügen, ohne sich irgendwann in Widersprüche zu verwickeln und einzuknicken. Doch in der Unschuldsmiene des Mannes zuckte kein Muskel, sein Blick irrte nie ab, nie fuhr er sich nervös durchs Haar oder machte andere fahrige Gesten. Er war ein zäher Hund, das musste man ihm lassen.
»Sie bleiben also dabei, dass Sie nichts gesehen oder gehört haben? Absolut gar nichts?«
»Gar nix, Herr Kommissär«, erwiderte er ungerührt. »Ich weiß überhaupt nicht, wie die Person auf so was kommt.«
»Also nochmal. Bei der Person handelt es sich um die Dolmetscherin der hiesigen französischen Gesandtschaft, und sie hat Anzeige erstattet, weil sie vom Trittbrett Ihrer Straßenbahn gestoßen wurde. Dabei hat sie sich einen Bruch des Fußgelenks und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Vorausgegangen sei eine Rangelei im Innern des Wagens, bei der ihr Mantel und ihre Tasche beschädigt wurden. Ich finde es schon sehr merkwürdig, dass Sie als Schaffner in diesem Wagen davon nichts mitbekommen haben wollen.«
Der Schaffner zuckte die Achseln und machte eine Handbewegung, als wollte er bedeuten, dass er sehr gern behilflich wäre, wenn er denn könnte. »Tja, tut mir leid, Herr Kommissär.«
»Und Sie?« Reitmeyer wandte sich an den Mann, der neben dem Schaffner vor seinem Schreibtisch saß. »Sie waren doch der Fahrer dieser Tram. Ist Ihnen auch rein ›gar nix‹ aufgefallen?«
Der Mann wand sich ein bisschen und rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Offensichtlich war er nicht so abgebrüht wie sein Kollege, und blanke Lügen gingen ihm weniger leicht über die Lippen. »Also ich …«, begann er und verstummte wieder.
»Ich höre«, sagte Reitmeyer und klopfte ungeduldig mit seinem Stift auf die Tischplatte.
»Da is … da is …«, begann der Mann wieder und wich Reitmeyers Blick aus. Wie jemand, der ein randvolles Glas nicht verschütten wollte, bemühte er sich angestrengt, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. »Da is … immer viel los … in meiner Linie zum Marienplatz«, presste er schließlich heraus. »Viel Trubel.«
»Aber wenn Fahrgäste zwei Frauen angreifen, angeblich deshalb, weil sie sich auf Französisch unterhalten haben, und eine dieser Frauen vom Trittbrett gestoßen wird, dann lässt sich das doch nicht als der übliche ›Trubel‹ beschreiben.«
»Fran… französisch …?«, stammelte der Fahrer, inzwischen hochrot im Gesicht.
»Wir können kein Französisch«, sagte der Schaffner.
»Jetzt reicht’s mir aber!«, rief Reitmeyer und warf den Stift auf die Schreibtischplatte. »Sie meinen wohl, Sie könnten mich für dumm verkaufen. Schließlich gibt’s noch die Aussage von der anderen Frau. Und es haben ja noch weitere Personen in dieser Tram gesessen!«
Das spöttisch überlegene Grinsen, das sich der Schaffner jetzt doch nicht mehr verkneifen konnte, bestätigte nur, was Reitmeyer schon wusste: Die anderen Fahrgäste würden ebenfalls nichts gesehen oder gehört haben. Wie immer, wenn es zu Pöbeleien oder zu tätlichen Angriffen auf Mitarbeiter der französischen Gesandtschaft kam. Ihnen schlug überall nur blanker Hass entgegen, und alle waren sich einig, dass sie so schnell wie möglich aus der Stadt verschwinden sollten. Sie wurden nicht bedient in den Geschäften, bekamen keine Plätze in Restaurants und keine Karten für Kinos und Theater. Und der Gesandte selbst konnte von Glück sagen, dass ihm in einem Nebenzimmer der Vier Jahreszeiten, fernab der anderen Gäste, überhaupt Essen serviert wurde. Notwendige Einkäufe für die Franzosen erledigte ein Münchener, wie man hörte, der ihnen auch seinen Wagen zur Verfügung stellte, weil sie sich mit einem französischen Kennzeichen nicht durch die Stadt zu fahren trauten.
»Können wir jetzt gehen, Herr Kommissär?«, fragte der Schaffner.
Reitmeyer nickte bloß und machte eine ärgerliche Handbewegung in Richtung Tür. Der Trambahnfahrer wischte schnell hinaus, der Schaffner ließ sich Zeit und wünschte übertrieben höflich einen guten Tag. »Auf Wiedersehen sag ich lieber nicht«, erklärte er dem Polizeiassistenten Brunner, der gerade zur Tür hereinkam.
Brunner blieb stehen und sah den beiden kopfschüttelnd nach. »Das waren doch die zwei, die von den Franzosenweibern angezeigt worden sind?« Er humpelte herein und pflanzte sich vor Reitmeyers Schreibtisch auf. »Das ist schon eine unverschämte Frechheit, was die sich trauen.«
»Die Trambahner?«
»Naa. Die Franzosen! Als hätt man nicht schon genug Scherereien mit dem Pack. Ihre Gesandtschaft muss man Tag und Nacht bewachen, obwohl uns überall das Personal fehlt. Zum Dank dafür zeigen’s dann unsere Mitbürger an. Wieso die überhaupt so eine Gesandtschaft bei uns aufmachen dürfen, das tät mich schon mal interessieren.«
Warum die Franzosen auch in München und nicht nur in der Hauptstadt eine Vertretung eröffnen durften, hatte Reitmeyer ihm gestern schon erklärt. Jetzt erneut den Versailler Vertrag zu erwähnen, der Frankreich dieses Recht gewährte, würde dem Mann bloß wieder eine Steilvorlage für seine Schimpftiraden über den »Schandvertrag« liefern, den diese »bolschewistischen Verbrecher« in Berlin unterschrieben hätten. Das Ganze endete dann meistens damit, dass bald mal einer kommen müsse, um diesen »Saustall« aufzuräumen. Auf eine weitere Portion von »Volkes Stimme« konnte Reitmeyer jetzt aber gut verzichten.
»Wo ist der Rattler?«, fragte er stattdessen.
»In der Spurensicherung«, antwortete sein Kollege Steiger, der ebenfalls ins Büro gekommen war. »Wie meistens. Ich find nicht, dass das so weitergeht.«
»Ja, selbstherrlich war der Rattler immer schon«, sagte Brunner. »So einem hätt man schon beizeiten mal die Flügel stutzen müssen. Soll ich ihn herbeordern?«
»Nein, ich geh selber rüber«, sagte Reitmeyer.
So ging es tatsächlich nicht mehr weiter, dachte Reitmeyer auf dem Weg durchs Präsidium. Die Sonderregelung, die man für ihren ehemaligen Polizeischüler getroffen hatte, funktionierte schlecht bis gar nicht. Nachdem er letztes Jahr, wie erwartet, seine Prüfung mit Auszeichnung bestanden hatte, hätte er eigentlich mit dem Streifendienst beginnen müssen. Was allerdings nur eingeschränkt möglich war, weil er nach einer Gasvergiftung an der Front an einem Lungenschaden litt. Dennoch hatte er im Frühjahr unbedingt an einem Einsatz teilnehmen wollen, bei dem von irgendwelchen rechten Randalierern eine Polizeikette gesprengt worden war. Im Lauf des anschließenden Gerangels hatte er dann so schwere Schläge abbekommen, dass er zwei Wochen lang das Bett hüten musste. Danach wurde beschlossen, ihn überhaupt nicht mehr draußen, sondern nur noch im Innendienst einzusetzen. Er sollte je zur Hälfte in Reitmeyers Kommissariat und in der Spurensicherung arbeiten. Doch ganz wie Reitmeyer befürchtet hatte, sah er ihn selten bei sich im Büro. Und es war anzunehmen, dass Rattler seinem Schöpfer für die Schläge dankte, die ihn so unvermutet in sein persönliches Paradies befördert hatten. In die Abteilung, die er am meisten bewunderte und die von Anfang an sein Traumziel gewesen war: die Spurensicherung. Wo nach »wissenschaftlichen« Methoden gearbeitet wurde und wo ihm kein Mensch genervt den Mund verbot, wenn er des Langen und Breiten seine Erkenntnisse aus Polizeihandbüchern und kriminaltechnischen Schriften zum Besten gab. Im Gegenteil. Kofler, sein Chef, unterstützte die Wissbegier des jungen Kriminalisten, ließ sich auf endlose Diskussionen über Artikel in Fachzeitschriften ein, lobte sein Engagement und rühmte seine Intelligenz. »Der ist ein heller Kopf«, sagte er immer, von dem sich mancher im Präsidium eine Scheibe abschneiden könnte.
Als Reitmeyer die Tür zu Koflers Büro öffnete, standen der Leiter der Spurensicherung und Rattler an einem Tisch und bemerkten gar nicht, dass er eingetreten war. Gemeinsam waren sie über ein Foto gebeugt, und Rattler deutete mit einem Stift auf eine Stelle des Bildes.
»Wenn man Genaueres wüsst über die Eiablage von Schmeißfliegen in den Körperöffnungen der Leichen und über die anschließende Metamorphose dieser Insekten, dann könnt man auch Näheres über den Todeszeitpunkt rauskriegen«, sagte er. »Ich hab gelesen, dass schon vor längerer Zeit ein französischer Biologe solche Untersuchungen gemacht hat, aber …«
»Ich störe ja nur ungern …«, sagte Reitmeyer sarkastisch.
Rattler fuhr herum. »Ah, Herr Kommissär. Gerad wollt’ ich zu Ihnen, weil der Bericht von der Gerichtsmedizin fertig ist. Ich hab ihn gleich heut früh abgeholt.«
»Und warum hast du ihn dann nicht gleich zu mir gebracht?«
»Weil ich den Rattler gebraucht hab«, sagte Kofler. »An der Maximiliansbrücke hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer ist von der Straße abgekommen und auf das Kiesbett runtergestürzt. Wir mussten versuchen, den Unfallhergang zu rekonstruieren.«
»Ich hätt den Rattler auch gebraucht. Schließlich war abgemacht, dass er zur Hälfte bei mir arbeitet, aber ich krieg ihn praktisch nie zu Gesicht.«
»Das war jetzt bloß eine Ausnahme, Herr Kommissär«, versicherte Rattler mit Blick auf Kofler, der zustimmend nickte. »Und ich hab auch vorgearbeitet, was die Leiche angeht, die wir letzte Woche an der Isar gefunden haben.« Er deutete auf das Foto auf dem Tisch.
»Was heißt ›vorgearbeitet‹?«
»Tja, Sie ham doch gesagt, dass wir uns in den umliegenden Gaststätten und Lokalen umhören sollten, die Beamten vom Mariahilfplatz-Revier und ich. Ob jemand den Mann kennt. Aber das war schwierig, weil wir ihn ja bloß beschreiben konnten. Ich meine, die Fotografien sind kein schöner Anblick. Die kann man schlecht herzeigen, weil dann die Leut ja gleich schreiend davonlaufen würden. Die kann man auch für einen Aushang im Revier nicht benutzen, wegen den Maden, dem Tierfraß und so …«
»Und herrichten für ein neues Foto«, sagte Kofler, »kannst den auch nicht mehr.«
»Ja, und?«
»Deshalb hab ich eine Zeichnung von dem Mann gemacht, verstehen S’, Herr Kommissär. Da tun sich die Leut viel leichter, als wenn ich sag, der war eins fünfundsiebzig, siebzig Kilo und braune Haar. Da fällt doch keinem was ein, das ruft doch keine Erinnerung wach. Und mit der Zeichnung geh ich am Abend nochmal in die Lokale. Vielleicht ergibt sich dann ja was.«
»Der Bub ist halt ein heller Kopf«, sagte Kofler.
Reitmeyer fand eher, dass man es wieder mit einer von Rattlers üblichen Finten zu tun hatte. Wenn er mit einem Donnerwetter rechnen durfte, verblüffte er mit einem Einfall, den man nur loben konnte. Und ein »Bub« war er längst auch nicht mehr, obwohl das schmächtige Bürschchen wahrscheinlich von keinem auf über zwanzig geschätzt worden wäre. Sein Kollege Steiger meinte neulich, es müsse an den langen Lazarettaufenthalten liegen, dass er noch immer wie ein Schüler aussah. Die hätten einen Stillstand bewirkt, weil er sich damals praktisch eine »Auszeit vom Leben« habe nehmen müssen.
»Kann ich die Zeichnung sehen?«
»Morgen, Herr Kommissär. Morgen bring ich sie Ihnen mit.«
»Und was sagt der Bericht von der Gerichtsmedizin?«
Rattlers Gesicht leuchtete auf. »Der Herr Professor Riedl hat alle meine Annahmen voll bestätigt. Über den Zeitpunkt des Todes lässt sich bloß sagen, dass er etwa achtundvierzig Stunden vor Auffinden der Leiche eingetreten sein muss, weil die Totenstarre vollkommen aufgelöst war und die Livores, die Totenflecken, sich nicht mehr wegdrücken lassen. Er könnte aber auch schon länger dort gelegen haben. Das ist ja das Problem dabei. Gerad hab ich zum Herrn Kofler gesagt, dass man die Sache mit den Schmeißfliegen …«
»Sonst noch was?«
»Ja, und das betrifft die Schusswunde am Kopf. Die zeigt die typische Erscheinung für einen aufgesetzten Schuss. Und es gibt keinerlei Anzeichen für eine Gegenwehr. Also kann man davon ausgehen, dass das Opfer den Täter gekannt hat.«
»Oder wenn er ihn nicht gekannt hat«, sagte Kofler, »hat er von der Person zumindest nichts Böses erwartet.«
»Aber der Mann muss den Täter doch gekannt haben, wenn er mit ihm bis zum Wasserrand der Isar gegangen ist, wo man die Leiche gefunden hat. Von irgendwelchen Schleifspuren war am Körper nichts zu sehen.«
Kofler zuckte die Achseln.
»Und dann gibt’s noch diese metallene Marke mit dem brüllenden Löwenkopf und den am Rand eingestanzten Doppellöchern, die wir in der Tasche des Toten gefunden haben.« Rattler schlug den Bericht auf und zeigte auf ein Bild. »Die hat der Professor Riedl auf Anhieb erkannt. Das sei das Abzeichen vom Freikorps Epp. Die Löcher hätten zum Annähen am Ärmel gedient.«
Reitmeyer sah auf den Löwenkopf mit dem aufgerissenen Maul. Wie viele Mitglieder hatte dieses Freikorps gehabt? Tausend? Zudem trug der Tote das Abzeichen nicht am Ärmel, sondern in der Tasche. Vielleicht war er gar kein Epp-Mann gewesen und hatte das Ding bloß gefunden oder war sonst irgendwie daran gekommen.
»Da wünsch ich euch viel Glück bei den Ermittlungen«, sagte Kofler, als hätte er Reitmeyers Gedanken gelesen. »Die Freikorps gibt’s nicht mehr, bis auf den Teil, der von der Reichswehr übernommen worden ist. Aber zu dem hat der sicher nicht gehört. Der hat’s nicht weit gebracht, wenn ich mir seine Kleider anschau. Die wirken nicht bloß ramponiert von der Liegezeit im Freien, die waren vorher schon ziemlich schäbig.«
»Zur Identifikation«, verkündete Rattler, »versprech ich mir einiges von meiner Zeichnung.«
»Und in der Zwischenzeit kommst du jetzt mit, bei mir wartet andere Arbeit auf dich.«
Rattler warf einen hilfesuchenden Blick zu Kofler hinüber.
»Das ist jetzt vielleicht nicht so günstig«, sagte Kofler. »Wir müssten noch das Motorrad von dem Verunglückten untersuchen. Da könnt ich ihm gleich beibringen, wie man da vorgeht, verstehen S’. Und dafür«, er hob die Hand und wehrte Reitmeyers Versuch eines Einspruchs ab, »dafür können Sie ihn morgen dann den ganzen Tag haben.«
»Also so geht das nicht, Kollege Kofler. Wir brauchen klare Verhältnisse, wann der Rattler bei Ihnen und wann er bei uns ist. Wie soll ich denn sonst planen und die Aufgaben verteilen?«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung«, erwiderte Kofler. »Wär’s Ihnen lieber, wenn wir einen wöchentlichen Turnus vereinbaren würden?«
»Wenn’s dabei dann auch bleibt.«
Reitmeyer sah ein bubenhaftes Grinsen über Rattlers Gesicht huschen, bevor er seine treuherzigste Miene aufsetzte. »Also an mir soll’s nicht scheitern, Herr Kommissär.«
2
Warum war er nicht gleich darauf gekommen, dachte Sepp, sich der Polizei inoffiziell zu bedienen. Schließlich war sein ältester Freund Kriminaler. Der kam problemlos an Meldedaten heran, konnte Halter von Autos feststellen und bekam Einblick in Akten, die Außenstehenden nicht zugänglich waren. Und hatte Sepp ihm nicht schon oftmals geholfen? Informationen eingeholt, an die Reitmeyer, gerade weil er Polizist war, überhaupt nicht herangekommen wäre. Er fand, dass sein alter Freund ihm etwas schuldete.
Sepp ging schneller, um Sebastian noch in der Mittagspause zu erreichen. Der Kommissär sei im Café Baumann gegenüber vom Präsidium, hatte der Mann an der Pforte gesagt. Aber nur bis circa ein Uhr.
Es war ohnehin an der Zeit, dass sie sich wieder einmal trafen. In den letzten Wochen hatte es bloß für ein paar Telefonate und einmal für ein schnelles Bier nach Dienstschluss gereicht, weil sie beide so eingespannt waren. Auch Caroline hatte sich beschwert, dass man sie beide nicht mehr zu Gesicht bekomme. Das sei eine Schande, meinte sie. Wenn sie so redete, hatte Sepp immer das Gefühl, als wollte sie eigentlich sagen, dass er und Sebastian das Andenken an ihren Bruder Lukas verrieten, der 1916 bei den furchtbaren Kämpfen an der Somme gefallen war. Seit ihren Schultagen waren sie ein eingeschworenes Quartett gewesen, hatten viel zusammen unternommen und alle Ferien gemeinsam verbracht, selbst als Lukas mit seiner Geige zum gefeierten Bühnenstar geworden war. Dann kam das schreckliche Ereignis, unter dem sie alle drei litten, Caroline aber ganz besonders, weil Lukas auch innerhalb ihrer Familie eine unersetzliche Stütze für sie gewesen war.
Als er in das Lokal trat, sah er seinen Freund gleich am vordersten Tisch in eine Zeitung vertieft mit einer Tasse Kaffee vor sich. »Tut mir leid, dass ich deine heilige Mittagspause störe«, sagte er. »Aber sonst hätte ich dich gar nicht erwischt.«
»Ah, Sepp«, sagte Sebastian und blickte auf die Uhr an der Wand. »Schade, dass du so spät kommst, weil ich in zehn Minuten schon wieder gehen muss.«
»Dann komm ich am besten gleich zur Sache. Ich hab dir doch neulich erzählt, dass es seit einigen Monaten nicht ganz einfach ist mit meiner Kanzlei. Finanziell, meine ich. Jetzt ist mir eine Tätigkeit angeboten worden, die eigentlich nicht direkt juristischer Natur ist. Eine Frau hat sich an mich gewandt, die ihre Tochter sucht. Eine Vermisstenanzeige wurde bislang nicht angenommen, weil man vier Tage Abwesenheit bei einer erwachsenen Person für keine ausreichende Zeitspanne hält. Aber die Mutter macht sich ernsthafte Sorgen und hat mich gebeten, die Suche zu übernehmen.«
»Und hast du dich darauf eingelassen?«
»Da ich Hilfskräfte einstellen kann, ja. Jedenfalls scheint Geld kein Problem zu sein. Mir wurde eine großzügige Anzahlung geleistet. In Devisen.«
»Aha.«
»Jetzt wollte ich dich fragen, ob du mir bei eventuell auftretenden Fragen behilflich sein kannst. Und da die Bezahlung nicht schlecht ist, könnten wir …«
»Die Beute teilen?«, unterbrach ihn sein Freund. »Hast du das gemeint?«
»Also …«
»Sepp, das geht nicht. Das wäre Korruption.«
»Ich weiß nicht, ob man da gleich die ganz großen Begriffe auspacken muss. Du verschaffst dir doch keine persönlichen Vorteile.«
»Wie würdest du das sonst nennen, wenn ich mein Wissen als Polizist gegen Geld verkaufe?«
»Es ist mir zwar unangenehm, aber vielleicht sollte ich dich mal daran erinnern, wie oft ich dir schon geholfen habe. Und dabei bist du nicht so pingelig gewesen, wenn ein paar Regeln übertreten wurden.«
»Und dafür bin ich dir auch dankbar. Aber versteh doch, in meinem Fall ist das was anderes. Ich kämpfe die ganze Zeit dafür, dass in meiner Behörde die Regeln befolgt werden …«
»Obwohl sich nicht mal deine Vorgesetzten daran halten?«, fragte Sepp erregt. »Oder wie nennst du es, wenn man wie dein letzter Präsident Mördern und Verbrechern falsche Pässe ausstellt, damit sie sich ins Ausland absetzen können?«
»Deswegen muss ich noch lange nicht anfangen, mich selber so zu verhalten. Jedenfalls kann ich nicht gegen Geld für dich tätig werden.«
»Und ohne Geld?«
Reitmeyer lachte. »Ganz allgemein kann ich dir natürlich mit Hinweisen und Rat zur Seite stehen. Aber ich kann dir nichts weitergeben, wenn mir das als Polizist verboten ist. Inhalt von Polizeiakten und dergleichen.«
Sepp merkte, dass es seinem Freund unangenehm war, ihn abzuweisen.
Reitmeyer legte die Hand auf seinen Arm. »Versteh doch, Sepp. Ich helfe dir, wo ich kann. Aber im Rahmen meiner Befugnisse.«
»Na schön«, sagte Sepp. »Ich hab ja gewusst, dass du ein korrekter Staatsdiener bist.«
»Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Lob.«
»Versteh mich halt auch. Ich bräuchte eben unter Umständen ein paar Informationen, die dich nicht gleich in große Bredouille bringen würden.«
Reitmeyer stand auf und klopfte ihm auf die Schulter. »Wir werden sehen, Sepp. Jetzt fang halt erst mal an mit deiner Suche.«
Sie gingen zusammen hinaus. Als sie sich verabschiedeten, fragte Sepp noch, ob Reitmeyer Caroline in letzter Zeit gesehen habe. Er begleite sie demnächst in den Salon Bruckmann, erwiderte Reitmeyer. »Nicht ganz freiwillig«, fügte er hinzu. »Aber ich konnte es ihr nicht abschlagen.«
»Zu den Bruckmanns?«, fragte Sepp. »Neuerdings hört man, dass die Dame des Hauses Adolf Hitler unter ihre Fittiche genommen hat.«
Sebastian seufzte. »Caroline war seit Jahren nicht mehr dort. Aber Elsa Bruckmann hat sie persönlich eingeladen, weil sie an Lukas erinnern will, der früher oft in ihrem Haus gespielt hat.«
»Heute würde er das ganz bestimmt nicht mehr tun.«
3
Reitmeyer hörte die Stimme des Mannes schon von Weitem, als er am nächsten Morgen die Löwengrube entlangfuhr. Ruppertus, der Wanderprediger, hatte wieder Stellung vor dem Präsidium bezogen. »Blut, Blut muss fließen«, brüllte er. »In allen Rinnsteinen wird das Blut sich stauen. Dann haben wir bald Metzelsuppe! Ein Schlachtfest, bei dem die Schweine in Menschengestalt abgeschlachtet werden!«
Vom Eingang in der Löwengrube hatten sich bereits zwei Wachleute in Richtung Ettstraße in Bewegung gesetzt. Reitmeyer trat in die Pedale, um den Propheten zu warnen, bevor er wieder festgenommen wurde. »Hau ab, Mann!«, rief er und deutete nach hinten.
Der magere Mensch mit den langen Haaren und dem fusseligen Bart sah ihn mit aufgerissenen Augen an und zögerte kurz. Dann packte er die Zeitschriften vom Boden, schürzte die härene Kutte und rannte in Richtung Neuhauser Straße davon. Die Polizisten erwischten ihn nicht mehr und gestikulierten ihm wütend nach.
»Der soll sich hier bloß nicht mehr blicken lassen«, sagte einer der beiden, als sie bei Reitmeyer angekommen waren. »An jedem Straßeneck schreit neuerdings so ein Messias rum. Erlösen wollen sie uns von dem Niedergang, die Tagediebe. Die sollen sich mal waschen und was arbeiten!«
Reitmeyer nickte bloß und stellte sein Fahrrad ab. Auf eine Diskussion über Kohlrabi-Apostel und sonstige »Inflationsheilige« ließ er sich jedenfalls nicht ein. Wozu auch? Nachdem die Revolutionäre erschossen waren oder im Zuchthaus saßen, schlug jetzt die Stunde der religiös angehauchten Weltverbesserer, der spirituellen Anarchisten. Das Ziel sei die Herrschaft der Seele über die Materie, hatte ihm Ruppertus erklärt, die »Überwindung der Gier und des verderbten Fleisches«. Gegen die Wurstsemmel, die Reitmeyer ihm manchmal schenkte, hatte er jedoch nichts einzuwenden.
Reitmeyer eilte zu seinem Büro hinauf, wo Rattler bereits an der Tür auf ihn wartete. Steiger saß an seinem Schreibtisch und hielt ein Blatt hoch. »Also, das musst du dir mal anschauen«, sagte er. »Das ist unglaublich.«
»Ist das die Zeichnung von dem Toten?«
Rattler nickte. »Wie versprochen.«
Reitmeyer nahm das Blatt, das ihm Steiger reichte. »Das hast du gemacht?«, fragte er verblüfft.
»Na ja.« Rattler trat von einem Bein aufs andere. »Sagen wir mal so, ich hab mir helfen lassen von meinem Freund Lothar. Der hat Zeichenunterricht gehabt und sich sogar mal überlegt, ob er Grafiker werden soll. Aber dann hat er Ökonomie studiert, weil ihn genau wie mich das Wissenschaftliche doch mehr interessiert hat.«
»Also der schaut einen an wie ein Lebendiger«, sagte Steiger kopfschüttelnd.
Reitmeyer blickte wieder auf das Bild. »Wirklich hervorragend«, sagte er. »Dein Freund ist ja ein echter Künstler. Und? Hat’s auch was gebracht?«
»Noch nicht. In den Lokalen in der Au hat den Toten niemand gekannt. Aber wir könnten ja ein Foto von der Zeichnung machen lassen und Abzüge in die Reviere hängen.«
»Gute Idee. Genauso machen wir’s. Und wenn sich nicht gleich darauf jemand meldet, gehst du mit dem Bild ins alte Kriegsministerium rüber. Vielleicht erkennt ihn jemand von den ehemaligen Freikorpsleuten.«
»Da wär noch was anderes«, sagte Rattler und deutete auf Reitmeyers Schreibtisch. »Die Akte hab ich vom Herrn Kofler mitgebracht. Es geht um den Unfall an der Maximiliansbrücke. Bei der Untersuchung des Motorrads hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich doch kein Unfall gewesen ist.«
»Sondern?«
»Der Vorderreifen von dem Motorrad war auf eine Art zerfetzt, dass das nicht bei dem Sturz passiert sein kann. Das hat von einem Schuss herrühren müssen, meint der Herr Kofler. Und tatsächlich hat er das Projektil dann auch gefunden in dem Reifen. Und das ist jetzt interessant. Es ist der gleiche Typ wie bei dem Opfer an der Isar. Der Herr Kofler hat sich mit einem Spezialisten unterhalten, und der meint, die könnten von einem Nagant-Revolver stammen. Den haben die Offiziere der zaristischen Armee benutzt.«
»Dann wären die zwei von einem zaristischen Offizier attackiert worden?«, fragte Steiger. »Das klingt ja ziemlich abenteuerlich.«
»Das muss kein echter Russe gewesen sein«, sagte Rattler. »An der Ostfront sind doch Tausende Russen in Gefangenschaft gekommen. Gut möglich, dass der Revolver so in deutsche Hände geraten ist. Aber für uns ist doch nur interessant, dass bei den zwei Opfern höchstwahrscheinlich die gleiche Waffe benutzt worden ist. Weil die Patronen von dem Nagant besonders sind. Einen Anhang über die Waffe und die Munition schreibt der Herr Kofler noch.«
»Das ist tatsächlich interessant. Hat der Fahrer denn Papiere dabeigehabt?«
»Nein. Wenn er eine Brieftasche gehabt hat, ist die vielleicht rausgefallen bei dem Sturz, und jemand, der vor uns am Unfallort war, hat sie geklaut. Ich hab die ganze Umgebung abgesucht und bloß ein Notizbuch gefunden. Aber das ist ziemlich unbrauchbar, weil die Seiten durch die Nässe zusammengeklebt sind und die Tintenschrift völlig verlaufen ist.«
»Na dann musst du eben über das Kennzeichen den Halter feststellen.«
»Ist schon passiert«, sagte Rattler und zog einen Zettel aus der Tasche. »Norbert Hofbauer. Sckellstraße 3. Die Schlüssel zu seiner Wohnung hab ich auch. Die waren in der Hosentasche.«
Reitmeyer setzte sich und blätterte die Akte durch. »Also gut. Wenn das kein Unfall war, dann muss der Tote in die Gerichtsmedizin. Steiger, veranlass das doch. Und am Nachmittag schauen wir uns seine Wohnung an. Bestell uns einen Wagen für zwei Uhr.«
Reitmeyer sah an dem Haus hinauf. Es war ein großes, dreistöckiges Mietshaus, ein eher vornehmes Gebäude im Stil der Neorenaissance, ganz ähnlich wie die anderen Häuser in der nur einseitig bebauten Straße entlang des Isarhochufers. Von einem oberen Stockwerk aus hätte man einen schönen Blick über den Fluss und auf die Stadt hinab. Ein Blick aufs Klingelschild jedoch besagte, dass Hofbauer nicht in der Beletage, sondern im Erdgeschoss gewohnt hatte. Reitmeyer klingelte. Als niemand öffnete, zog Rattler den Schlüssel heraus und sperrte auf. Reitmeyer und Steiger folgten ihm hinein.
Im Innern war es ziemlich dunkel, weil durch die Fenster im Treppenhaus nur wenig Licht in den Eingangsbereich fiel. Sie stiegen ein paar Steinstufen hinauf und überprüften alle Türen, bis sie im hinteren Teil des Hochparterres die gesuchte Wohnung fanden. Hofbauer stand handschriftlich auf einem Zettel, der zwischen den noch deutlich sichtbaren Umrissen eines früheren Namenschilds klebte. Anscheinend war er erst vor Kurzem eingezogen. Rattler klingelte noch einmal. Als sich wieder nichts rührte, schloss er die Wohnungstür auf.
Sie standen in einem engen Gang und blickten in eine spärlich möblierte Küche, die neben Herd und Spüle nur einen Tisch und einen Hocker enthielt. Auf einem Wandbord standen Gläser und ein paar Tassen, in einer Kiste auf dem Boden waren etwas Besteck und Kochgeschirr. Steiger öffnete die Tür zum Raum daneben. Es war das Wohn- oder Arbeitszimmer. Ein großer, ziemlich abgeschabter Schreibtisch stand vor dem Fenster, an einer Wand ein altes Kanapee mit einem Couchtisch und einem Sessel. Durch eine Schiebetür gelangte man ins Schlafzimmer, das ebenfalls nur das Nötigste enthielt. Ein Bett, einen Schrank, eine kleine Kommode und einen Stuhl. »Recht übersichtlich das Ganze«, sagte Rattler. »Wenigstens brauchen wir nicht lang, um alles zu durchsuchen.«
Reitmeyer lief durch die Zimmer und riss die Fenster auf. »Ich lass jetzt erst mal frische Luft in diese modrige Bude. Wie’s aussieht, hat der die Wohnung vom Vormieter übernommen, ohne zu streichen oder sonst irgendwas zu machen.« Er deutete auf die Umrisse, die von Bildern an den Wänden zurückgeblieben waren. »Und dieser Teppich hier«, er hob den Bodenbelag mit der Schuhspitze an, »stammt auch noch vom Vormieter. Mitsamt dem Staub vergangener Generationen.«
»Ja, wohlhabend war dieser Hofbauer nicht«, sagte Steiger und nahm eines der Fotos vom Schreibtisch. »Und wenn es sich hier um den Hausherrn handelt, dann war er Offizier.«
Reitmeyer zog eine Schublade des Schreibtischs auf. »Hier ist sein Militärpass. Da steht’s. Norbert Hofbauer, geboren am 3. 7. 1884 in Ingolstadt. Oberleutnant im 1. Königlich Bayerischen Leibregiment. Verwundetenabzeichen in Schwarz. Eisernes Kreuz 2. Klasse.« Reitmeyer schloss die Schublade und zog die mittlere auf. Er tastete darin herum und förderte schließlich einen Handschuh zutage. Als er ihn ausschüttelte, fiel ein Ring heraus.
»Der sieht wertvoll aus«, fand Steiger, als er ihn aufhob.
Reitmeyer öffnete die Seitentüren des Schreibtischs. »Es gibt überhaupt keine Unterlagen«, sagte er »Rein gar nix. Was hat dieser Mensch getan? Als hätt er hier gar nicht gewohnt. Hast du was gefunden?«, rief er zu Rattler ins Schlafzimmer hinüber, der dort den Schrank durchsuchte.
»Praktisch nix. Das hier war in einer Jackentasche.« Er reichte Reitmeyer einen Zettel. »Das ist eine Rechnung über Kaffee und Kuchen im Hotel Kaiserin Elisabeth in Feldafing am Starnberger See. Vom 8. Oktober. Und hinten drauf ist eine Adresse notiert. Theresienstraße 15. Kein Namen.«
»Ist das alles?«, fragte Reitmeyer. »Auch in der Kommode nichts?«
»Bloß das hier noch«, sagte Rattler und zeigte eine Porträtaufnahme von einer Frau. »Die hat in der Brusttasche von einem Jackett gesteckt.«
Steiger nahm das Bild. »Wer das wohl ist?«, fragte er, bevor er es an Reitmeyer weiterreichte. »Sehr hübsch. Seine Frau? Seine Freundin?«
»Kaum«, meinte Rattler. »Glauben Sie wirklich, dass sich so eine Frau mit einem einlässt, der in so einer Bruchbude mit lauter altem Gerümpel haust? Die hat doch andere Chancen.«
»Vielleicht kannten sie sich ja noch aus der Zeit, als er ein fescher Offizier beim Leibregiment war?«, sagte Reitmeyer. »Damals hat eine Uniform noch gereicht.«
Steiger ließ den Blick durch den Raum schweifen. »Schon ein Abstieg«, meinte er. »Für einen ehemaligen Leiber.«
»Wir sollten mal den Hausmeister fragen, ob der was weiß«, sagte Reitmeyer. »Rattler, geh doch mal runter ins Souterrain und hol den Mann her.«
Während Rattler die Wohnung verließ, überprüfte Reitmeyer die restlichen Schubladen, die alle leer waren. Dann stellte er sich ans offene Fenster. »Die Vorhänge sind ja noch älter, als das Kaiserreich geworden ist.« Er schob die linke Stoffbahn zurück. »Und voller Mottenfraß.«
Steiger nahm das andere Foto vom Schreibtisch und hielt es ins Licht. »Da steht er bei einer Maschinengewehreinheit. Für mich sieht das aus, als wär’s in München bei der Niederschlagung der Räterepublik aufgenommen worden. Im Mai 19.«
»Schon möglich«, sagte Reitmeyer. »Pack alles ein. Den Ring und die Bilder. Die sehen wir uns im Präsidium genauer an. Brunner ist schließlich Experte für die Rätezeit.«
»Und was er nicht weiß, müssen wir über Reichswehrleute im alten Kriegsministerium rauskriegen. Die sind aber meist nicht besonders auskunftsfreudig«, fügte Steiger hinzu. »Noch dazu, wenn’s um einen Mordanschlag geht.«
Reitmeyer schwieg und schaute zum Fenster hinaus. Nicht auskunftsfreudig war noch milde ausgedrückt, dachte er. In Kreisen der Militärs, der ehemaligen Freikorpskämpfer oder der Mitglieder rechter Verbände stieß die Polizei immer nur auf eine Mauer aus ehernem Schweigen. Oder die Oberen seiner Behörde steckten mit diesem Volk ohnehin unter einer Decke. Und die Lage hatte sich nicht verbessert seit letztem Jahr. Die Einwohnerwehr, der große paramilitärische Verband, hatte zwar auf Druck der Siegermächte aufgelöst werden müssen, und Kahr, der Ministerpräsident, war aus Protest dagegen zurückgetreten, aber verschwunden waren die Mitglieder dieser Organisation natürlich nicht. Sie gründeten unter anderen Namen einfach neue Verbände. Ohne die Unterstützung von Kahrs Regierung hatten die neuen Verbände allerdings erhebliche Mühe, sich zu finanzieren, und die Begeisterung für die monarchistischen Ziele einer konservativen Regierung ließ bei einigen Offizieren erheblich nach. Sie verfolgten jetzt andere Pläne, wenn auch keineswegs einträchtig. Ständig hörte man von Spaltungen und Zerwürfnissen innerhalb der Rechten, einzelne Gruppen strebten immer radikalere Ziele an, und es verging kein Tag, an dem nicht Gerüchte von einem unmittelbar bevorstehenden Putsch durch die Stadt schwirrten. Falls dieser Hofbauer und das Opfer von der Isar in irgendeine dieser Machenschaften verwickelt gewesen sein sollten, falls sie zwischen die Fronten rivalisierender Gruppen geraten und als »Verräter« liquidiert worden waren, stünde ein Kriminaler mit seinen Ermittlungen auf verlorenem Posten.
Reitmeyer drehte sich um, als Rattler wieder hereinkam. »Ist der Hausmeister nicht da?«
»Doch, schon. Aber er muss gerad weg und kommt morgen Vormittag ins Präsidium. Er hat allerdings bestätigt, was wir uns schon gedacht haben. Der Hofbauer hat vor drei Wochen die Wohnung von einem alten Mann übernommen, der zu seiner Tochter nach Freising gezogen ist. Der hat ihm auch ein paar von seinen Möbeln dagelassen. Woher die beiden sich gekannt haben, weiß der Hausmeister nicht. Er weiß auch sonst nicht viel, weil der Hofbauer angeblich kein besonders gesprächiger Mensch gewesen ist. Er erinnert sich bloß noch, dass er bei seinem Einzug gesagt hat, dass er jetzt da wohnt, wo er bei der Befreiung von München gekämpft hat. Bei der Sicherung des Ostufers der Isar durch das Freikorps Oberland.«
»Komisch«, sagte Steiger. »Die sind doch fast alle von der Reichswehr übernommen worden, er aber anscheinend nicht.«
»Tja«, sagte Reitmeyer. »Das hätte uns viel Arbeit erspart, wenn wir sein Umfeld hätten klarer eingrenzen können.«
Steiger sah sich noch einmal um. »Ich find, wir hätten dann alles. Wir können gehen. Die Fotografien vom Schreibtisch hab ich eingesteckt.«
»Rattler, wir gehen«, rief Reitmeyer ins Schlafzimmer, aus dem ein schabendes Geräusch herübertönte. Er ging hinüber und sah den jungen Kollegen vor dem Schrank knien, den er von der Wand wegzurücken versuchte. »Was machst du denn da?«, fragte er.
»Da schauen S’ her, Herr Kommissär. Da sind Kratzspuren am Boden, die mir erst jetzt aufgefallen sind. Der Schrank ist verschoben worden.«
»Das ist doch nix Besonderes bei einem Einzug«, sagte Steiger.
»Vielleicht nicht. Aber Nachschauen ist besser«, erwiderte Rattler und zerrte, hochrot im Gesicht, erneut an dem schweren Möbel.
»Ja, dann schauen wir halt nach. Aber lass dir halt helfen. Du sollst dich doch nicht so anstrengen mit deiner Lunge«, sagte Reitmeyer und schob den Schrank mit einem Ruck nach vorn.
»Ich hab meine Taschenlampe dabei«, sagte Rattler. Er zwängte sich in den Spalt und leuchtete die Rückseite des Schranks ab. »Da hängt was!«, rief er.
»Dann nimm’s ab.«
Mit einem großen braunen Umschlag, den er triumphierend in die Höhe hielt, zwängte sich Rattler wieder aus dem Spalt heraus. »Ich hab’s mir doch gedacht!«
Reitmeyer nahm ihm den Umschlag ab und machte ihn auf. »Da ist Geld drin.« Er ging zum Schreibtisch hinüber und legte die Scheine auf den Tisch. »Das sind fünfhundert Dollar«, sagte er verblüfft. »Ein Vermögen.«
Sie starrten auf die Banknoten.
»Wo der das herhat?«, sagte Steiger. »Legal ist das nicht erworben, wenn er’s hinterm Schrank versteckt hat.«
»Er muss Angst gehabt haben, dass jemand bei ihm einbricht. Also sind möglicherweise noch andere hinter dem Geld her«, sagte Rattler.
Reitmeyer schob die Dollars wieder in den Umschlag und steckte ihn ein. »Jetzt müssen wir erst mal rauskriegen, was dieser Hofbauer überhaupt so getrieben hat.« Er warf noch einmal einen Blick durch die Wohnung. »Könnt es noch weitere Verstecke geben?«
Rattler schüttelte den Kopf. »Ich glaub nicht. Ich hab alles genau durchsucht. Ich denk, wir sind fertig hier.«
Reitmeyer machte die Fenster wieder zu. »Wir könnten die Nachbarn ja mal fragen, ob die was mitbekommen haben«, sagte er und folgte den beiden nach draußen. Rattler sperrte ab, und Reitmeyer und Steiger klingelten an den Nachbarstüren. Aber niemand öffnete.
Gerade als sie das Haus verlassen wollten, ging plötzlich eine Tür auf, an der Steiger vergeblich geklingelt hatte. »Wollten Sie zu mir?«
Eine ältere Frau, ganz in Schwarz gekleidet, hantierte nervös mit einer Nadel, die sie in ihren Hut steckte. »Ich hab nicht gleich aufmachen können. Ich muss zu einer Beerdigung, verstehen S’, und hab mich gerad umgezogen. Was gibt’s denn?«
Steiger zeigte seine Marke. »Ihr Nachbar, der Herr Hofbauer, ist tödlich verunglückt. Haben Sie den Herrn gekannt?«
»Was?«, sagte die Frau und legte die Hand auf die Brust. »Ja, wie ist denn das passiert? Mit seinem Motorrad?«
Steiger nickte.
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ja so was.«
»Der Herr Hofbauer hat ja noch nicht lang hier gewohnt«, sagte Reitmeyer. »Haben Sie denn mal gesprochen mit ihm?«
»Ja, so richtig unterhalten hab ich mich nicht mit ihm. Man hat sich halt gegrüßt. Aber mein Sohn, der hat öfter mit ihm gesprochen, weil er sich für das Motorrad interessiert hat. So sind’s halt die jungen Burschen. Die interessieren sich für alles, was schnell fährt.«
»Und hat Ihr Sohn irgendwas erzählt über ihn?«
Sie überlegte einen Moment. »Ich weiß nicht mehr. Dass er sich einen neuen Beruf aufbauen will, glaub ich. Er war ja früher beim Militär. Aber entschuldigen S’, ich hab’s eilig. Ich müsst’ schon längst fort sein.« Sie zog die Tür hinter sich zu.
»Wir wollen Sie nicht aufhalten«, sagte Reitmeyer und ging mit ihr die Treppe hinunter. »Wissen Sie zufällig, was er sich aufbauen wollte?«
»Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Aber ich glaub, mein Sohn hat g’sagt, er ist Detektiv.«
4
Sepp machte Platz, um zwei Dienstmänner vorbeizulassen, die einen großen, schmalen Karton durch den Eingang des Vier Jahreszeiten transportierten. Es handelte sich offensichtlich um ein Gemälde, was bei genauerem Hinsehen ein Aufkleber der Kunsthandlung Goltz auch bestätigte. Sepp folgte den beiden zur Rezeption, wo sie das Bild neben ganzen Stapeln von Kisten und Schachteln abstellten. Hölzl, der Portier, wie immer makellos gekleidet und mit perfekt gestutztem Bart, stand hinter der Theke und studierte irgendwelche Papiere, bevor er einen Zettel quittierte, den ihm die beiden Männer reichten.
»Betreiben Sie jetzt eine Spedition?«, fragte Sepp lachend.
Der Portier blickte auf. »Ja, fast könnt man’s meinen. Aber das sind alles die Einkäufe von unseren Gästen. Es wird jeden Tag mehr, wie mir scheint«, sagte er. »Was führt Sie zu uns, Herr Dr. Leitner? Sind Sie verabredet?«
»Nein, heut nicht. Ich hätt Sie gern kurz gesprochen.«
»Ja …« Hölzl deutete auf eine Gruppe in Wanderkleidung, die auf die Rezeption zusteuerte. »Es dauert ein paar Minuten. Bei dem schönen Wetter wollen alle in die Berge. Nehmen Sie doch einen Moment Platz. Soll ich Ihnen was bringen lassen?«
»Nein, nein, danke.« Sepp ließ sich im Sessel einer Sitzgruppe nieder und beobachtete, wie Hölzl die ausländischen Gäste bediente. Er breitete Karten aus und erklärte Routen, dann verteilte er Broschüren und begutachtete die Ausrüstung einer Dame. Alles mit vollendeten Manieren und in dem fließenden Englisch, das er in seiner Jugend in einem großen Londoner Hotel gelernt hatte. Er war genau so, wie man sich den Portier eines ersten Hauses vorstellte: kompetent, weltläufig und diskret. Er konnte alles beschaffen und wusste alles. Vor allem kannte er jeden, soweit es die Oberschicht oder die Spitzen der Gesellschaft anbelangte. Und mit diesem Wissen hatte er Sepp schon mehrmals gedient, wenn er Informationen über bestimmte Personen brauchte. Sie kannten sich schon lange und schätzten und vertrauten einander.
Sepp sah sich gezwungen, selbst tätig zu werden, da er von dem Privatdetektiv schon länger nichts mehr gehört hatte und ihn auch nicht erreichte. Eigentlich hatte der Mann einen intelligenten und verlässlichen Eindruck auf ihn gemacht. Und die Aussicht auf ein paar Devisen hatte ihn zudem angespornt. Doch wenn er sich so verhielt, würde wohl nichts werden aus dem Geschäft.
Die Wandergruppe machte sich inzwischen auf den Weg nach draußen und stieg in einen wartenden Wagen. Hölzl kam hinter der Rezeption hervor und räumte noch ein paar Kisten beiseite, bevor er zu Sepp hinüberging. »Tja, der Dollar macht’s möglich«, sagte er. »Gestern hat mir einer unserer Gäste ein Tafelbesteck aus Sterlingsilber gezeigt und meinte, das habe ihn den Gegenwert von ein paar Flaschen Whisky gekostet.«
»Wenigstens florieren Ihr Hotel und die Kunst- und Antiquitätenläden.«
Hölzl lächelte vage. »Ehrlich gesagt, mach ich mir manchmal Sorgen, dass es zu Übergriffen auf unsere ausländischen Touristen kommt. Diejenigen, die nicht von ihnen profitieren, sind ihnen nicht gerade wohlgesinnt. Wie die Heuschrecken würden sie bei uns einfallen und alles kahlfressen, schreiben bestimmte Blätter.«
»Ja, mit dem alten weltoffenen München ist’s vorbei. Jetzt sucht man das Heil in der Abschottung. Alles Fremde ist plötzlich suspekt.«
Hölzl nickte. »Wie das alles weitergehen soll?«, sagte er und strich sich übers Gesicht. »Aber Sie wollten mich sprechen. Worum geht’s denn?«
Sepp griff in die Brusttasche seines Jacketts und zog einen Umschlag heraus. »Ich wollte Ihnen etwas zeigen. Könnten Sie vielleicht unauffällig einen Blick darauf werfen und mir sagen, ob Sie die Person kennen?«
Hölzl blickte sich um, bevor er den Umschlag nahm, dann zog er vorsichtig die Fotografie heraus, die darin steckte. Doch schon als er das Bild nur halb herausgezogen hatte, schob er es wieder hinein. »Tut mir leid, ich kenne die Dame nicht«, sagte er und reichte Sepp den Umschlag zurück.
Sepp sah den Portier an. Hölzl machte den Eindruck, als hätte er ihm eine heiße Kartoffel in die Hand gedrückt.
»Tja, schade«, sagte Sepp leichthin. »Ich bin halt davon ausgegangen, dass sie schon einmal in Ihrem Hotel gewesen ist. Bei einer Veranstaltung oder einer Einladung. Und da es sich um eine außergewöhnlich schöne Frau handelt, übersieht man sie nicht so leicht.«
Hölzl fühlte sich sichtlich unwohl. »Warum interessieren Sie sich denn für die Dame?«, fragte er schließlich.
»Nicht aus privaten Gründen, wie Sie vielleicht meinen. Ich persönlich möchte ihr nicht nahetreten, falls Sie das befürchten.«
»Das … das habe ich keineswegs damit ausdrücken wollen, Herr Dr. Leitner«, sagte Hölzl erschrocken. »Bitte entschuldigen Sie meine Frage.«