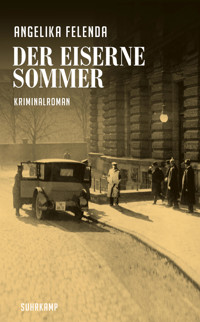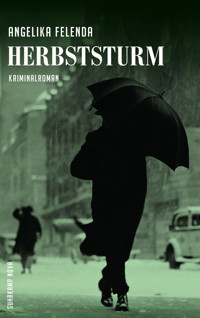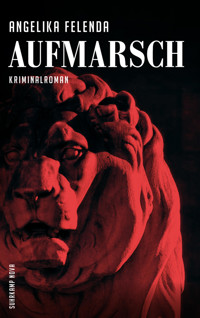10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissär-Reitmeyer-Serie
- Sprache: Deutsch
München 1920. Kommissär Reitmeyer ist aus dem Krieg zurückgekehrt, versucht die dort erlittenen Traumata vor seiner Umgebung zu verbergen und dämpft aufkommende Panikattacken mit Geigenspiel. Dabei hat die Polizei alle Hände voll zu tun: Nahrungsmangel und Geldentwertung haben dazu geführt, dass die Stadt von einer regelrechten »Diebstahlseuche« heimgesucht wird und Schieber und Schleichhändler dicke Geschäfte machen. Da wird die junge Cilly Ortlieb, Kleindarstellerin in schlüpfrigen Produktionen des Münchner Filmkonzerns Emelka, tot im Keller einer Gastwirtschaft gefunden. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord mit einer großen Menge Morphium.
Während die rechte Einwohnerwehr durch die Straßen Münchens marschiert, sucht Kommissär Reitmeyer – von seinen Vorgesetzten argwöhnisch beäugt – in illegalen Spielclubs, Bars und Geheimbordellen nach einem zweifachen Frauenmörder. Dabei begegnet er Gerti Blumfeld, die auf der Suche nach ihrer abgetauchten Schwester eines der Mordopfer kennengelernt hat und bald selbst auf die Todesliste des Täters gerät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kommissär Reitmeyer ist aus dem Krieg zurückgekehrt. Verzweifelt versucht er, die dort erlittenen Traumata und die immer wieder aufkommenden Panikattacken vor seiner Umgebung zu verbergen. Dabei hat die Polizei alle Hände voll zu tun: Nahrungsmangel und Geldentwertung haben dazu geführt, dass die Stadt von einer regelrechten »Diebstahlseuche« heimgesucht wird und Schieber und Schleichhändler dicke Geschäfte machen. Immerhin das Filmgeschäft boomt und viele junge Frauen wollen auf die große Leinwand. So auch die junge Cilly Ortlieb, die tot im Keller einer Gastwirtschaft gefunden wurde. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord mit einer großen Menge Morphium. Schon bald nimmt der Fall ungeahnte Ausmaße an.
Angelika Felenda hat Geschichte und Germanistik studiert und arbeitet als literarische Übersetzerin in München.
Bisher im Suhrkamp Verlag erschienen: Der eiserne Sommer, st 4713.
Angelika Felenda
WINTERGEWITTER
Reitmeyers zweiter Fall
Kriminalroman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4719.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Archive Photos/Getty Images
Umschlaggestaltung:
Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln
eISBN 978-3-518-74852-7
www.suhrkamp.de
»… denn alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat auf den Richtplätzen, in den Folterstuben, den Tollhäusern, den Operationssälen, unter den Brückenbögen im Nachherbst: alles das ist von einer zähen Unvergänglichkeit, alles das besteht auf sich und hängt, eifersüchtig auf alles Seiende, an einer schrecklichen Wirklichkeit.«
Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
PROLOG
Sie stand oben an der Treppe des Lokals und ließ den Blick über das brodelnde Treiben schweifen. War sie zu spät? An einem der Tische saß Cilly nicht, auch in dem hüpfenden Gewimmel auf der Tanzfläche war sie nicht auszumachen. Gerti hielt sich am Geländer fest, um nicht zu stolpern, als hinter ihr ein Pulk neuer Gäste zur Tür hereindrängte. Aber es nützte nichts. Sie wurde nach unten mitgerissen, mitten hinein ins Gewühl der hektisch Tanzenden, bis sie endlich eine Lücke fand und sich mit rudernden Armen zur Bar zurückkämpfte. Dort zwängte sie sich zwischen zwei Typen, schnaufte einmal tief durch und bestellte ein Mineralwasser. Der Blonde zu ihrer Linken ließ taxierend den Blick über sie gleiten, bevor er an ihren Schuhen hängenblieb. Dass ihre Satinpumps in dem Regenguss gelitten hatten, ließ sich nicht verbergen. Sie zuckte die Achseln. »Scheißwetter«, sagte sie und griff nach dem Glas, das ihr der Kellner hingestellt hatte.
»Vielleicht was Schärferes?«, schlug ihr Nebenmann vor. »Zum Aufwärmen.«
Sie musterte ihn kurz. Smoking, Schleife und ein überdimensioniertes Einstecktuch, roter Kummerbund, glänzende Lackstiefeletten. Nicht ganz comme il faut, aber die anderen Herrn, deren Aufzug dem dress code des Gentleman entsprach, wirkten auch nicht seriöser. Wie überall in den Bars und Lokalen, in denen es kein Dünnbier und Essen ohne Lebensmittelkarten gab. Sie nippte an ihrem Wasser.
Ihr Nebenmann deutete auf die Bühne, wo zu der laut hämmernden Musik ein paar Mädchen in kurzen Fransenkleidern wild zuckend die Gliedmaßen schwangen. »Den Shimmy hab ich schon besser getanzt gesehen«, sagte er und nahm einen Schluck aus seinem bauchigen Schwenker. »In Berlin.«
»Was Sie nicht sagen.«
Er schenkte ihr ein blasiertes Lächeln und winkte dem Barmann. »Cognac für die Dame.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bleib nicht lang. Ich warte bloß auf eine Freundin.«
Eine Freundin würde ihn nicht stören, meinte er großzügig. Man könne sich auch zu dritt prima amüsieren.
Von rechts drückte die Gästeschar und schob sie dem gewitzten Weltmann noch dichter an den Leib. Er raunte ihr etwas ins Ohr, was sie in dem Lärm nicht verstand. Aber das war auch nicht nötig. Seine Miene war beredt genug. Genauso wie seine Hand, die ihren Rücken südlich der Taille hinabwanderte. Mit einem Ruck fuhr sie zurück. Aus dem Schwenker schwappte braune Flüssigkeit auf sein Jackett.
»Blöde Schnalle«, stieß er hervor und wischte sich ab.
Sie entfernte sich ein paar Schritte. Was hatte sie erwartet? Sie war ohne Begleitung gekommen, also war sie ein Flittchen. Aber an seiner Einschätzung hätte sich vermutlich auch nichts geändert, wenn sie in Begleitung gekommen wäre. Das Boccaccio war kein Ort, wohin man Debütantinnen ausführte. Oder die Gattin.
Sie sah sich um. An einem der Tische hob ein Herr die Hand und deutete auf den freien Stuhl neben sich. Sie zögerte. Doch an einem Tisch fiel es wahrscheinlich leichter, Abstand zu wahren. Sie nickte, ging hinüber und nahm Platz. Ihr Gastgeber, ein junger Mann in tadelloser Abendgarderobe und exakt gescheiteltem Haar, hob eilfertig eine Flasche Champagner aus dem Kühler, füllte zwei Gläser und prostete ihr zu. Sie trank einen Schluck. Beim Blick auf die Kristallschale mit der Gänseleber spürte sie ein heftiges Ziehen in der Magengegend, kam aber der Aufforderung, sich zu bedienen, nicht nach. Selbst Hunger rechtfertigte nicht, mit Schleichhändlern, Schiebern und Kriegsgewinnlern zu tafeln, hätte ihr Vater gesagt. Sie ließ sich dann doch zu einem Scheibchen Weißbrot bewegen. Und auch der Butter, die goldglänzend auf einem kleinen Eisbett ruhte, vermochte sie nicht zu widerstehen. Ihr Gastgeber schien ihre Qualen zu genießen.
»So greifen Sie doch zu«, sagte er und bestrich diverse Schnittchen. »Nur immer zu. Der Dollar steigt. Wir lassen uns fallen. Warum sollten wir stabiler sein als unsere Währung?«
Sie kaute stumm.
Mit einem Mal gingen die Deckenkandelaber aus, nur ein paar Wandlampen brannten noch. Der Raum lag in dämmrigem Halbdunkel. Ein Moment der Stille. Dann setzte ein Schlagzeug ein, gefolgt vom spitzen Klang einer Klarinette und dem heiseren Gurgeln eines Saxophons. Auf der Bühne erschien ein Paar. Der Mann, die Augen schwarz umrandet und bis auf eine Art Lendenschurz nackt, wurde von seiner knienden Partnerin liebkost, die sich zu den verzehrenden Klängen der Bläser an seinem Schenkel hinaufschraubte. Ihr Kostüm war nicht wesentlich substantieller als das seine.
»Wie tröstlich«, flüsterte ihr Gastgeber. »Jetzt gibt es auch in München Tänze des Lasters und des Grauens. Das Reich vereint sich!«
Sie nickte abwesend. Wo Cilly nur blieb? Sie hatte doch fest versprochen, bis spätestens eins zu kommen. Es war schließlich dringend. Die Pension konnte sie nicht mehr bezahlen. Und ihr Versuch, ein günstigeres Zimmer zu finden, war heute Nachmittag erneut gescheitert, nachdem sie als Beruf »Doktorandin der Soziologie« angegeben hatte. Mit »Sozis« wolle sie nichts zu tun haben, meinte die Vermieterin. »So ein G’schwerl kommt bei mir nicht ins Haus.«
Sie warf einen Blick auf ihren Gastgeber, der gebannt die Darbietung verfolgte. Sie selbst war mehr vom Tun der Kellner in Bann geschlagen. Denn wie es schien, fanden die tatsächlichen Ausschweifungen weniger auf der Bühne als auf den Tellern statt, wenn beim Lüpfen silberner Hauben wahre Ungeheuerlichkeiten enthüllt wurden. Die schwarz Befrackten zeigten auch keinerlei Scheu, dies mit der schamlosesten Offenheit anzukündigen: »Einmal Kalbsbäckchen«, hörte sie. »Der Rehschlegel und die Perlhuhnbrust.«
Ihr schwindelte ein bisschen.
Ein Ober trat an ihren Tisch, nahm die Flasche aus dem Kühler und sah ihren Gastgeber fragend an. Der nickte, ohne den Blick von der Show zu wenden. Dann beugte sich der Ober zu ihr hinunter und sagte flüsternd, dass oben an der Treppe jemand auf sie warte. Sie drehte sich um. Unter den Leuten, die dort standen, war keine Cilly zu entdecken. Als sie den Ober fragen wollte, von wem die Nachricht stammte, war der schon mit der leeren Flasche abgezogen. Sie stand auf, schlängelte sich durch die Tischreihen und durch das Gedränge die Treppe hinauf.
»Hier«, rief jemand und winkte ihr von der Garderobe aus zu. Eine junge Frau, die sie nicht kannte. »Sie sind doch die Gerti Blumfeld. Ham Sie die Cilly gesehen?«, fragte sie gehetzt. Und auf ihr Kopfschütteln: »Das gibt’s doch nicht. Ich such sie schon den ganzen Abend.«
»Woher kennen Sie mich?«, fragte Gerti.
»Ich hab Sie mit der Cilly im Monachia oder im Kolosseum gesehen, ich weiß nicht mehr genau.« Sie sah sich nervös um. »Aber ist ja egal. Ich muss ihr unbedingt was geben.«
Gerti musterte die junge Frau. Blasses Gesicht, dunkelrot geschminkte Lippen. Unter dem halb geöffneten Mantel ein kurzes rotes Hängerkleidchen. »Die Cilly ist nicht da. Ich warte auch auf sie.«
Die Frau zog Gerti am Arm in eine dämmrige Ecke. »Verstehen Sie, ich hab da was.« Sie schlug den Mantel zurück und deutete auf eine Mappe, die sie an sich gedrückt hielt. »Die hat mir die Cilly heut gegeben, und ich muss sie ihr wiederbringen.«
»Ja, ich weiß nicht, dann nehmen Sie sie halt mit heim und geben sie ihr morgen.«
»Das geht nicht«, erwiderte die Frau und blickte ängstlich zur Tür, wo gerade zwei junge Männer hereinkamen. »Ich kann sie nicht behalten.«
»Was ist da drin? Geld?«
»Nein, nein, kein Geld. Bloß Papiere, bloß so Papiere.« Wieder blickte sie zu den beiden jungen Männern hinüber, die sich an der Garderobe zu schaffen machten. »Aber trotzdem …«
»Dann schauen wir halt nach, was das für Papiere sind.«
»Aber nicht hier«, erwiderte die Frau erschrocken und deutete auf die Toilettentür. »Das machen Sie da drin.« Sie reichte Gerti die Mappe.
Im Innern der Toilette zog Gerti ein paar mit Schreibmaschine beschriebene Blätter heraus und hielt sie ins Licht. Ein Vertrag. Über eine Verpachtung. Einige Seiten mit Namenslisten. Die Unterlagen eines Geschäftsmanns? Was wollte Cilly damit? Und woher stammte die Mappe überhaupt? Wahrscheinlich »gefunden«, wie Cilly und ihr Kreis es nannten, wenn ihnen ein Glücksfall etwas in die Hände spülte. Falls die Frau annahm, sie würde die Mappe übernehmen und aufbewahren, hatte sie sich getäuscht.
Sie solle aufpassen, hatte erst neulich Sepp, der Rechtsanwalt, gesagt. Es sei ja gut und schön, wenn sie ihre Studie über arbeitende Frauen auch in gewisse Grenzbereiche ausweite, aber sie solle sich von den Kleinkriminellen fernhalten. Das seien nicht die Schlimmsten, hatte sie erwidert. Die wirklichen Sauereien würden doch von den sogenannten »Großen« gemacht. Genau deswegen warne er sie ja auch. Die Bereiche der Großen würden sich oft mit denen der Kleinen überschneiden. Und dann könnte es gefährlich werden.
Sie überlegte einen Moment. Die Frau sollte die Mappe am besten dorthin zurückbringen, wo sie »gefunden« worden war. Und zwar auf dem schnellsten Weg.
Vorsichtig öffnete sie die Tür und sah hinaus. Die Frau stand nicht mehr in der Ecke. Auch im Vorraum nicht. Gerti ging zur Treppe und ließ den Blick übers Lokal schweifen. Die junge Frau war verschwunden.
1
Es war eines der Häuser am Fuß des Nockherbergs, das man wahrscheinlich abgerissen hätte, wenn der Krieg nicht dazwischengekommen wäre. Schief und krumm, auf einer Seite leicht abgesackt, klammerte es sich auf der anderen ans Nachbargebäude, um nicht im feuchtmodrigen Morast entlang des Auer Mühlbachs zu versinken. An den Ecken und Laibungen bröckelte der Putz, der Lack an den Fensterrahmen war abgesplittert, die Fassade zeigte noch Spuren eines früheren Anstrichs, ein schimmliges Grün, das sich im Grau der restlichen Fläche kränklich ausnahm.
Und so roch es auch, als Reitmeyer in den Hauseingang trat und die Stufen zu der Kellerwohnung hinunterstieg. Während er den düsteren Gang entlangging, wurde vor ihm eine Tür aufgerissen und eine Frau mit einem Kübel in der Hand trat heraus.
»Ich möcht zum Herrn Maikranz«, sagte er und hielt seine Polizeimarke hoch. »Ich bin hier doch richtig?«
Die Frau sah ihn mit leerem Blick an und nickte. Dann schlug sie den Türflügel zurück und machte eine Geste, dass er eintreten solle.
Auf der Schwelle zögerte Reitmeyer einen Moment, nicht nur wegen des Geruchs, sondern wegen der drangvollen Enge in dem länglichen Raum, wo zwischen Bettstatten und Kommoden, zwischen Tisch und Herd und ein paar Stühlen, die von Kindern besetzt waren, kein Platz für einen Besucher zu sein schien.
»Kommen S’ nur rein, Herr Kommissär«, hörte er eine Stimme aus einem der Betten. »Das ist aber schön, dass Sie nach mir schauen.« Ein Kopf mit einer dicken Bandage, die auch das rechte Auge bedeckte, tauchte auf.
»Herr Maikranz«, sagte Reitmeyer und bahnte sich den Weg durch das Gerümpel aus Möbeln und Hausrat. »Wie geht’s Ihnen jetzt?«
Der Mann rappelte sich schwerfällig hoch und schüttelte ihm die Hand. »Schon besser. Aber ob ich mein Augenlicht behalt, steht noch nicht fest, hat der Doktor im Krankenhaus gesagt. Wir hoffen halt das Beste.«
Da die Kinder ihn nur schweigend anstarrten und keine Anstalten machten, einen der Stühle zu räumen, überlegte Reitmeyer, ob er sich auf die Bettkante setzen sollte. Frau Maikranz, die auch wieder eingetreten war, scheuchte eines der Mädchen hoch und wischte schnell mit einem Lappen über den Hocker, bevor sie Reitmeyer bat, Platz zu nehmen. Dann stellte sie sich ans Fußende des Bettes. »Ham S’ die Saubande schon erwischt, die meinen Mann so zugerichtet hat?«, fragte sie.
»Deswegen bin ich da.« Reitmeyer zog ein Foto aus der Innentasche seines Mantels. »Das wollt ich Ihnen zeigen. Ob Sie den Mann erkennen?«
Maikranz hielt das Foto in das spärliche Licht, das durch das Kellerfenster einfiel, und studierte das Bild eingehend. »Ich glaub schon«, sagte er nach einer Weile. »Es war zwar schon spät, aber vom Schaufenster war genügend Licht. Das hab ich Ihnen ja schon gesagt. Die Kerle sind aus dem Pelzgeschäft rausgestürmt und zu ihrem Wagen gerannt. Der Letzte hat mir einen Schwinger versetzt, dass ich mit dem Kopf gegen den Mauervorsprung gestürzt bin. Aber sein Gesicht hab ich genau gesehen. Das vergess ich mein Lebtag nicht mehr.« Er gab das Foto zurück. »Das ist der Kerl.« Er ließ sich auf das Kissen sinken. »Wie sind Sie auf den gekommen?«
»Im Rahmen von Ermittlungen. Aber bislang konnten wir ihm nichts nachweisen.«
»Aufhängen sollt’ man das Gesindel«, sagte Frau Maikranz. »Einen anständigen Menschen halb totschlagen, der bis spät in der Nacht in der Küche arbeiten muss. Und wenn er jetzt noch sein Aug’ verliert …« Sie folgte Reitmeyers Blick auf die Ziegelsteine, die unter die Füße der Möbelstücke geschoben waren. »Das ist wegen dem Wasser«, sagte sie. »Wenn’s stark regnet, drückt’s von unten oft rein.«
»Einmal sind meine Schuh davong’schwommen«, sagte ein kleiner Bub stolz, bevor seine ältere Schwester ihn anstieß und er wieder schwieg.
Reitmeyer stand auf. »Ich hab’s leider eilig, Herr Maikranz. Ich muss gleich weiter. Aber ich meld mich wieder, wenn sich was Neues ergibt.« Er schüttelte ihm die Hand. »Und weiterhin gute Besserung.«
Frau Maikranz öffnete ihm die Tür. »Jetzt sperren S’ den Lump doch ein?«
»Ich tu mein Bestes, Frau Maikranz. Das versprech ich Ihnen.«
Wie gehetzt lief Reitmeyer den Gang entlang und mit ein paar Sätzen die Treppe hinauf. Erst vor dem Haus wagte er, wieder tief durchzuatmen. Der faulig modrige Geruch in der Kellerwohnung, der Mief aus altem Bettzeug, Windeln und aufgewärmtem Kohl hatte ihm fast die Luft abgeschnürt. Am liebsten hätte er sich geschüttelt wie ein Hund nach einem Regenguss. So mussten diese Leute leben. Es war menschenunwürdig. Aber sie waren nicht die Einzigen. Es herrschte verheerende Wohnungsnot.
Als er über die Ludwigsbrücke fuhr, kam von Westen eine dunkle Wolkenwand auf ihn zu, in der Ferne grollte Donner, und über der Isar zuckten Blitze. Ein Wintergewitter. Das war selten. Er trat in die Pedale, um noch vor Ausbruch des Unwetters die Ettstraße zu erreichen. Doch es fielen bereits die ersten Tropfen, und als er im Hof sein Fahrrad abstellte, goss es so heftig, dass er gerade noch den Eingang erreichte, bevor er völlig durchweicht war.
Im Treppenhaus wischte er sich die Nässe vom Mantel und hastete die Stufen hinauf. Um fünf hatte er die Vernehmung angesetzt. Jetzt würde er den Kerl drankriegen. Diesmal würde er ihn festnageln.
Als er die Tür zum Vernehmungsraum öffnete, war noch niemand da. Er sah auf die Uhr. Fünf vor fünf. Aber die angeforderte Akte über die Militärlaufbahn von Willy Bauer lag auf dem Tisch. Er blätterte sie kurz durch. Mit sechzehn hatte sich Bauer freiwillig gemeldet, mehrere Auszeichnungen für Tapferkeit erhalten, und 1918, im letzten Kriegsjahr, war er zum Leutnant befördert worden.
Reitmeyer zuckte zusammen, als draußen ein Blitz aufflackerte, gefolgt von einem Donnerschlag, der das Gebäude in seinen Grundfesten zu erschüttern schien. Er stand auf und ging zum Fenster. Heftiger Regen prasselte gegen die Scheiben, der Baum gegenüber bog sich unter den peitschenden Böen. Reitmeyer rieb sich den Nacken. Der Typus Bauer war ihm bekannt: Verwegener Frontkämpfer, EK II. Dekoriertes Kanonenfutter. Ohne die verheerenden Verluste gerade unter Leutnants hätte er eine solche Karriere nie gemacht. Von den Offizieren mit regulärer Laufbahn, die auf ihrem Standesdünkel beharrten, wurden solche Leute allerdings nicht für voll genommen.
Wieder ertönte ein Donnerschlag, und in den prasselnden Regen mischten sich Hagelkörner, die wie Kugeln ins Blech der äußeren Fensterbank einschlugen. Als er sich abwandte, sah er den Tisch im Augenwinkel: Papiere, Flaschen, Becher, der graue Kasten des Feldtelefons, ein paar Revolver – das übliche Durcheinander, alles beleuchtet von einer einzigen Kerze, die in einem See aus geschmolzenem Talg auf der Tischplatte klebte.
Er blieb ruhig. Das plötzlich wiederkehrende Bild von seinem Unterstand brachte ihn nicht mehr aus der Fassung. Es ließ sich wegblinzeln. Wenn ihn jedoch ganze Salven von Erinnerungsbildern bedrängten, wie Filme gleichsam, war es anders. Immer noch.
Im selben Moment ging die Tür auf. Zwei Wachleute schoben den Delinquenten herein, führten ihn zu dem Stuhl am Vernehmungstisch und drückten ihn auf den Sitz. Bauer ließ alles mit hochmütig verächtlicher Miene über sich ergehen.
»Sie warten draußen«, sagte Reitmeyer zu den Wachleuten.
Bauer lehnte sich zurück, rutschte an die vordere Sitzkante und streckte die Beine von sich, als lümmelte er auf einem Kneipenstuhl. Reitmeyer ließ sich nicht provozieren. Er nahm die Akte und blätterte darin herum.
»Sie waren also Offizier?«, fragte er nach einer Weile und blickte über die Akte hinweg auf das blasse Bürschchen, das in der grauen Jacke und der fleckigen Hose eher wie ein Hoteldiener aussah. Keines nobleren Etablissements allerdings. Auch in den ungeprägten, fast kindlichen Zügen seines Gesichts erinnerte nichts an die Attribute, die man mit einem leitenden Militär in Verbindung brachte.
Bauer setzte sich auf. »Ich war Frontoffizier«, spuckte er aus.
Reitmeyer nickte. Natürlich wollte er sich von den Stabsoffizieren absetzen, die von Leuten wie seinesgleichen als Drückeberger in der Etappe angesehen wurden.
»Und nach dem Krieg?«
»Freikorpskämpfer.«
»Aha.« Reitmeyer lehnte sich zurück. »Und nachdem die Freikorps in Preußen aufgelöst wurden?«
»Bin ich zurück nach Bayern gekommen. Und hab mich bei der Reichswehr beworben. Im Moment bin ich noch bei der Einwohnerwehr.«
Die Hoffnung, in die Reichswehr übernommen zu werden, konnte er sich abschminken. Die »echten« Offiziere der ehemals kaiserlichen Armee teilten die wenigen Stellen unter sich auf. Das wusste er sicher selbst. »Und bei der Einwohnerwehr haben Sie eine feste Stelle? Ich meine, ein Einkommen, von dem Sie leben können?«
»Ach, darauf wollen Sie hinaus?«, erwiderte Bauer mit einem hochmütigen Lächeln. »Wenn ich Ihrer Meinung nach nicht genügend verdiene, liegt es auf der Hand, dass ich ein Einbrecher bin?«
»Vielleicht nicht ganz abwegig. Sie haben keine Ausbildung, nichts gelernt, außer mit der Waffe zu kämpfen, können in keinen bürgerlichen Beruf zurückkehren …«
»Und deshalb wollen Sie mir einen Einbruch anhängen?«, schrie Bauer und sprang auf. »Mich zu einem Verbrecher abstempeln, während die wirklichen Verbrecher, die mit ihrem Defätismus und ihren Streiks die Heimatfront zersetzt haben, frei herumlaufen oder auf Regierungsbänken sitzen!« Er lief rot an, und einen Moment lang sah es aus, als wollte er sich auf sein Gegenüber stürzen.
»Wenn Sie nicht sofort wieder Platz nehmen, lasse ich Sie in verschärften Arrest nehmen«, sagte Reitmeyer ruhig.
Bauer lachte krächzend und setzte sich wieder. »Arrest? Bei Wasser und Brot?«, fragte er spöttisch. »In den Schützengräben hat es oft nicht einmal das gegeben.«
»Herr Bauer«, begann Reitmeyer nach einer Weile betont sachlich wieder. »Bezüglich des Einbruchs in der Neuhauserstraße haben sich neue Erkenntnisse ergeben.«
»Die können mich nicht betreffen.«
»Vielleicht aber doch. Wir haben die Aussage eines Zeugen, der Sie eindeutig beim Verlassen des Pelzgeschäfts erkannt hat. Bevor Sie ihn so brutal niederschlugen, dass er möglicherweise auf einem Auge die Sehkraft einbüßt.«
Bauer machte eine wegwerfende Handbewegung und erwiderte ungerührt Reitmeyers Blick. »Wie ich Ihnen schon letztes Mal gesagt habe, hab ich den Abend mit meinen Freunden verbracht und die Nacht bei meiner Verlobten. Der muss sich also getäuscht haben.« Und nach einer Pause fügte er mit einem verschlagenen Ausdruck hinzu: »Was sich spätestens bei einer Verhandlung herausstellen wird …«
»Soll das eine Drohung sein?«, fuhr Reitmeyer auf. »Der Zeuge wird sich von Ihren ›Kameraden‹ nicht einschüchtern lassen.«
»Wie kommen Sie darauf, Herr Kommissär? Wozu hätte ich so was nötig? Ich habe ein lupenreines Alibi.«
Die Unschuldsmiene und der verlogene Tonfall weckten bei Reitmeyer kurz den Drang, auszuholen und dem Kerl eins überzuziehen. Aber er beherrschte sich. Dennoch kam er hier im Moment nicht weiter. Er klappte die Akte zu. »Ich werde Ihre Aussagen überprüfen«, sagte er und erhob sich. »So lange bleiben Sie in Haft.«
Bauer schenkte ihm ein verächtliches Grinsen, als die Wachleute ihn abführten.
Reitmeyer sah ihm nach. Der fühlt sich vollkommen sicher, dachte er. Weil er sich absolut darauf verlassen kann, dass seine Freunde von der Einwohnerwehr für ihn aussagen werden. Und wenn die beschwören, dass sie den Abend gemeinsam verbracht haben, muss der Zeuge sich getäuscht haben. Darauf würde der Anwalt dieser Halunken pochen. Bei dem Gedanken an Maikranz gab es Reitmeyer einen Stich. Diese »Verlobte« würde er in der Sitte überprüfen lassen, dachte er auf dem Weg in sein Büro. Vielleicht ließ sich das Alibi dieses Kerls an der Stelle aufweichen. Vielleicht war sie schon öfter in dieser Funktion aufgetreten.
»Und?«, fragte Steiger, nachdem er mit schnellem Schritt das Büro durchquert und die Aktenbündel auf den Schreibtisch geworfen hatte. »Was rausgekommen bei der Vernehmung?«
»Ach!« Reitmeyer winkte verärgert ab. »Die feinen Freunde geben dem Kerl ein Alibi. Und wenn alle zusammenhalten, werd ich ihn laufen lassen müssen. Dabei bin ich mir absolut sicher …«
»Und die Spurensicherung? Hat die keine Fingerabdrücke?«
»Ha.« Reitmeyer lachte auf. »So blöd sind die Einbrecher heut nicht mehr. Die ziehen doch alle Handschuhe an.«
»Das kommt vom Kino.«
»Was?«
Steiger zog eine Zeitschrift zu sich heran, die aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch lag. »Das steht in dem Artikel, den mir der Oberinspektor gegeben hat. Die wichtigen Stellen hat er rot angestrichen.«
»Ja, das ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen.«
Steiger fuhr mit dem Finger eine Spalte entlang. »Pass auf! Jetzt erfährst du, warum wir so viel Arbeit haben. ›Nicht nur die sogenannten Liebesfilme richten ungeheure sittliche Verheerungen an …‹«
»Ah, bitte«, unterbrach ihn Reitmeyer, »erspar mir das Geseiere von diesen Moralaposteln.«
»Nein, nein, wart doch, jetzt kommt’s! ›Noch verderblicher in ihrer Konsequenz sind womöglich die Darstellungen der Detektiv- und Kriminalfilme, die unweigerlich zur Schule des Verbrechertums werden müssen.‹« Er hob den Zeigefinger. »›Die immer zahlreichere Verletzung der Gesetze ist unbedingt auf die Wirkung des Kinobesuchs zurückzuführen!‹«
»Ja, sehr erhellend«, sagte Reitmeyer. »Letzte Woche hat er uns noch erklärt, dass der Verfall der Sitten eine Folge von Linksradikalismus und Revolution sei.«
»Und mir hat er erklärt, dass alles besser wird mit der neuen bayerischen Regierung. Vor allem mit unserem neuen Polizeipräsidenten«, erwiderte Steiger und zog seine Wolljacke enger um sich.
»Ja, linksradikal ist der nicht.« Reitmeyer ging zum Fenster hinüber. »Eher im Gegenteil.«
Der Regen war schwächer geworden. Das trübe Licht der Straßenlaternen spiegelte sich im nassen Pflaster, und Windstöße trieben altes Laub und Papierfetzen die Rinnsteine entlang. Fröstelnd knöpfte er sein Jackett zu und legte die Hand auf die Heizung. Sie war kaum lauwarm. Im Polizeipräsidium wurde gespart. Kohle war knapp und teuer. Er drehte sich wieder um. »Machst du bald Schluss?«
Steiger blickte auf und schüttelte den Kopf. »Ich mach den Bericht noch fertig. Und überhaupt«, er zog eine Decke über die Knie, »daheim ist’s auch nicht wärmer.«
Reitmeyer ging an seinen Platz zurück. »Ich wart noch auf den Rattler, der soll mir ein Fahrzeugkennzeichen raussuchen. Die Bande hat die Bronzestatuen und Urnen vom Ostfriedhof ja sicher nicht im Rucksack abtransportiert. Jedenfalls hat ein Zeuge einen Lieferwagen gesehen.«
Steiger schnaufte auf. »Darauf hat mich der Oberinspektor heut schon zwei Mal angesprochen. Die ständigen Metallplünderungen auf den Friedhöfen sorgen angeblich für großen Unmut in der Bevölkerung. Aber die Leut’ sind genauso sauer«, er zeigte auf den Aktenstapel vor sich, »wenn ihre Türklinken, die Messingstangen von den Treppenläufern oder ganze Eisenzäune verschwinden.«
»Dann sollte der Herr Oberinspektor halt darauf drängen, dass entweder der Kinobesuch verboten oder ein Bataillon neuer Ermittler eingestellt wird. Wie sollen wir denn mit dieser Flut von Anzeigen noch fertigwerden?«
Reitmeyer nahm einen Stift und warf ihn gleich wieder ärgerlich auf die Schreibtischplatte. Es war sinnlos. Eigentumsdelikte hatten tatsächlich massiv zugenommen. Schon während der Revolution und nach der Demobilmachung hatte es einen rapiden Anstieg von einfachem und schwerem Diebstahl gegeben, und der war seitdem nicht mehr abgerissen. Die Vorkriegsmark war bloß noch zwanzig Pfennig wert. Tendenz fallend. So gesehen war die viel beklagte »Diebstahlseuche« vermutlich nichts anderes als eine Flucht in Sachwerte. Die alle antraten. Zumindest die Schlauen. Der Gesetzgeber schaffte es nicht, die Geldstrafen der Geldentwertung anzupassen, also verloren sie ihre abschreckende Wirkung. Die Polizei verfolgte kleine Fische, die in Läden und Kioske einbrachen, Gärtnereien plünderten und alles klauten, was nicht niet- und nagelfest war, um es dann für ein paar Pfennige zu verscherbeln. Während sie an die großen Fische, die ganze Wagenladungen begehrter Güter verschoben und auf dem Schwarzmarkt Millionen machten, nicht herankamen. Weil die geschickter waren. Oder bessere Verbindungen hatten.
Er stand auf. »Wo bloß der Rattler bleibt?« Gerade als er die Tür öffnete, um nachzusehen, kam der Polizeischüler atemlos angelaufen.
»Tut mir leid«, keuchte er und wedelte mit einem Zettel. »Das hat länger gedauert. Weil die Nummer nicht stimmt. Die ist überhaupt nicht vergeben.« Er rang nach Luft.
»Jetzt renn doch nicht immer so. Du weißt doch, dass dir das nicht guttut«, sagte Reitmeyer und sah ihn tadelnd an. Rattler hatte während des Kriegs zwei Gasverletzungen erlitten, und seine Lunge war so stark geschädigt, dass er die letzten Jahre in Lazaretten und Kliniken verbringen musste. »Jetzt verschnauf dich erst einmal!«
Rattler beugte sich nach vorn und stützte die Hände auf die Knie. »Der Zeuge muss sich geirrt haben«, stieß er ächzend hervor.
»Na prima. Jetzt haben wir wieder nichts«, sagte Reitmeyer.
Rattler richtete sich wieder auf. »Vielleicht sollte man sich systematisch auf die Ankaufstellen konzentrieren«, schlug er, immer noch röchelnd, vor.
»Ja, was meinst du denn, was wir machen?«, fragte Steiger und zog eine Brotzeit aus seiner Tasche.
»Ich meine, dass man gezielte Ermittlungen vornehmen müsste.«
Steiger wickelte umständlich die Brotzeit aus, was ihm mit einer Hand nur schlecht gelang. Seine Linke, die starre lederne Prothese, war keine Hilfe. Reitmeyers Angebot, ihm beizustehen, wehrte er ab.
»Das nächste Mal kannst du ja in der Au rumrennen und die Altwaren- und Krattlerläden filzen«, sagte er. »Ich hab mir gestern schon den Arsch abgefroren bei dem Dreckswetter. Die stellen das gestohlene Zeug ja nicht im Schaufenster aus. ›Gezielte Ermittlungen‹«, fügte er zu Reitmeyer gewandt hinzu. »Jetzt will er uns schon wieder erklären, wie wir unsere Arbeit machen müssen.«
»Ich meine, man müsste vielleicht auf Zuträger und Spitzeldienste zurückgreifen, das hat doch früher auch …«
»Früher? Im Kaiserreich?«, rief Steiger. »Ist dir schon mal aufgegangen, dass wir ganz andere Verhältnisse haben? Dass Klauen der reinste Volkssport geworden ist? Dass jeder meint, er sei berechtigt, sich was zu ›organisieren‹, wenn er sieht, was für Profite die Schieber und Kriegsgewinnler machen?« Er zerrte gereizt an der Decke, die sich um seine Knie gewickelt hatte. Dann biss er in sein Brot.
»Pfui Teifel!«, fluchte er und spuckte es angewidert in die hohle Hand. »Was ist denn das?« Er klappte die Brothälften auseinander und starrte auf die bräunlich grauen Fladen, bevor er alles neben die Akten schleuderte. »Das soll ein Fleischpflanzl sein?« An seiner Stirn schwoll eine Ader, und die lederne Prothese schlug auf die Tischkante. »Straßendreck mit Sägmehl verrührt ist das.« Scharrend fuhr sein Stuhl zurück. »Das kann doch kein Mensch fressen. Das schmeißt man doch keiner Sau hin!«
Reitmeyer wich einen Schritt zurück, während Rattler ungerührt das Pflanzl inspizierte.
»Wurst und ähnliche Produkte müssen fünf Prozent Fleisch enthalten«, sagte er gelassen. »Ansonsten dürfen Ersatzmittel verwendet werden … cirka elftausend …«
»Ersatz, Ersatz!«, schrie Steiger. »Den ganzen Krieg durch ham wir Ersatz gefressen! Ersatzeier, Ersatzweizen, Ersatzbutter, in der Marmelad’ ist kein Obst mehr drin, der Mist ist bloß mit Rübensaft gefärbt, und der Fleischanteil in dem Pfanzl …« Er schnappte nach Luft. Reitmeyer und Rattler beobachteten fassungslos, wie der sonst so besonnene und eher wortkarge Steiger völlig außer sich geriet. »Was sind die fünf Prozent? Hund, Katz oder Ratz?«, schrie er. »Was steht in der Verordnung?«
»Das ist nicht genau spezifiziert«, erwiderte Rattler. »Aber Ratte wär’ auf jeden Fall besser als Rattenersatz.«
Steiger stierte den Polizeischüler an. »Scheiß verreckter«, stieß er hervor, packte die Brotscheiben mitsamt dem Belag und schmiss alles in den Papierkorb.
Rattler setzte erneut zu einem Kommentar an, klappte den Mund aber wieder zu, als Reitmeyer ihm einen strengen Blick zuwarf.
»Soweit hat’s kommen müssen«, sagte jemand von hinten.
Reitmeyer drehte sich um. Brunner, der Polizeiassistent, stand in der Tür.
»Jetzt fressen die Franzosen unser Fleisch. Und mollig warm ham sie’s dabei. Mit unseren Kohlen. Aber das Bolschewikengesindel in Berlin hat diesen Schandvertrag ja unterschreiben müssen.«
»Schluss jetzt«, unterbrach ihn Reitmeyer mit erhobener Stimme. »Wir haben einen Haufen Arbeit und …«
»Man wird ja wohl noch sagen dürfen, was wahr ist.« Brunner hob das Kinn und humpelte ein paar Schritte in den Raum. Seine Knieverletzung stammte zwar nicht aus dem Krieg – ein ausschlagendes Pferd hatte ihn bei einer Arbeiterdemonstration 1914 erwischt –, dennoch trat er so auf, als hätte er an der Heimatfront die entscheidenden Schlachten geschlagen. Gegen Sozis und Bolschewiken, gegen »Novemberverbrecher« und »Vaterlandsverräter«, überhaupt gegen das ganze »Schwabingertum«, worunter er alles Revolutionäre und Umstürzlerische subsumierte. Und für den Niedergang in der Nachkriegszeit hatte er die Verantwortlichen ebenfalls ausgemacht. »Wer ist denn schuld an dem ganzen Saustall? Das sind doch die in Berlin …«
»Schluss, hab ich gesagt. In meinem Büro wird nicht politisiert«, rief Reitmeyer. »Herrschaftszeiten! Wenn’s nichts Dienstliches zu berichten gibt, dann …«
»Es ist aber dienstlich«, erwiderte Brunner und humpelte näher. »Da hat der Gastwirt vom Roten Adler in der Müllerstraße ang’rufen. Einen Arzt hat er auch schon verständigt. Der ist sich nicht ganz sicher …«
»Und was will der Gastwirt?«
»In seinem Keller liegt eine Frau.«
»Und was geht das uns an?«
»Die ist tot.«
Die Fahrt vom Präsidium in der Ettstraße zum Roten Adler in der Müllerstraße verlief weitgehend schweigend. Abgesehen vom leisen Fluchen des Polizeichauffeurs, der zwar geschickt den Hebel des Wischerblatts bediente, es bei dem Regen aber dennoch nicht vermochte, für genügend Sicht zu sorgen. Entsprechend langsam kamen sie voran.
»Da wären wir zu Fuß ja schneller«, sagte Rattler.
Reitmeyer hob die Hand. »Du kannst gleich aussteigen und zu Fuß nach Haus marschieren.«
Eigentlich hatten sie Rattler gar nicht mitnehmen wollen. Aus Rücksicht auf seine Gesundheit. Er könne sich erkälten bei dem schlechten Wetter, meinte Reitmeyer. Und eine dampfige, verqualmte Kneipe sei auch nicht gut für ihn. Aber Rattler ließ nicht locker. Er sei kein Krüppel. Außerdem sei es schon schlimm genug, dass er wegen Krieg und Krankheit noch immer keinen Abschluss habe und mit Holzschädeln, die beim Lesen mit dem Finger die Zeile entlangfuhren, wieder im Unterricht sitzen müsse, wo er rein gar nichts Neues erfahre. Das hatte Reitmeyer schließlich überzeugt. Für Rattler, der von Beginn seiner Ausbildung an Polizeihandbücher und kriminologische Fachzeitschriften verschlang – und ihnen mit seiner Besserwisserei zuweilen gehörig auf die Nerven ging –, konnte es nur Qualen bedeuten, mit dumpfen, desinteressierten Polizeieleven wieder die Schulbank drücken zu müssen. Er hatte eine Belohnung verdient.
Als sie vor dem Gasthaus hielten und ausstiegen, kam ihnen ein Mann entgegen, der unter dem Vordach gewartet hatte. »Ich bin der Arzt«, sagte er. »Der Hausarzt der Wirtsleute. Man hat mich verständigt, weil man dachte … ich könnt’ noch helfen. Aber leider …« Er wandte sich ab und deutete auf die hellen, stark beschlagenen Fensterscheiben. »Da drinnen ist ein großer Trubel und ein furchtbares Gedränge. Wir gehen lieber einmal ums Haus. Ich hab den Hintereingang aufsperren lassen.«
Sie folgten ihm über einen dunklen Hof. Er öffnete eine metallene Tür, die in einen spärlich beleuchteten Gang führte, wo es drei Männer ziemlich eilig hatten, Kartons und Kisten in angrenzende Räume zu schleppen.
»Die sind … aufgeregt«, erklärte der Arzt flüsternd. »Sie verstehen schon«, er machte eine bedauernde Geste. »Wenn Polizei ins Haus kommt …«
Reitmeyer warf Steiger einen Blick zu. Es lag auf der Hand, dass die Leute Waren wegschafften, die nicht ganz legal erworben waren. »Klar verstehen wir das«, erwiderte er. »Wer will schon Polizei im Haus.«
Der Arzt sah ihn unsicher an. Rattler grinste.
»Da vorn rechts geht’s in den Keller. Aber seien Sie vorsichtig, die Treppe ist sehr steil, und unten ist es nicht besonders hell. Ich geh am besten voraus.«
Die Treppe entpuppte sich als eine Art Hühnerleiter mit so schmalen Stufen, dass man sich am Geländer festklammern musste, um nicht kopfüber in die Tiefe zu stürzen. »Das gehört verboten«, brummte Steiger. »Das ist ja gemeingefährlich.«
»Ganz richtig«, meinte der Arzt. »Das ist dem armen Opfer wohl auch zum Verhängnis geworden.«
»Und wo ist das Opfer?«, fragte Reitmeyer, als sie unten angekommen waren.
»Da hinten«, sagte der Arzt und deutete in eine Ecke des dämmrigen Gewölbes. »Die Leute haben die Frau da hingelegt. Weil sie im Weg war, verstehen Sie.«
»Ja sicher«, erwiderte Reitmeyer. »Wenn man Sachen wegräumen muss, ist eine Leiche schnell im Weg.«
»Ich hab mir Licht geben lassen«, sagte der Arzt und griff nach einer Petroleumlampe, deren Flamme er höher drehte. Er machte ein paar Schritte nach rechts und hielt die Lampe hoch.
Sie blickten auf eine junge Frau mit kurz geschnittenem Haar, die ausgestreckt am Boden lag. Sie trug ein schwarzes ärmelloses Kleid und glänzende Seidenstrümpfe, ihre Schuhe, schwarze Lackpumps, standen neben ihr.
»Wissen Sie, wer das ist?«, fragte Reitmeyer den Arzt.
»Nein. Niemand kennt sie hier.«
»Die ist doch sicher nicht in diesem Fähnchen hier angekommen. Irgendwo muss doch ihr Mantel sein. Rattler, geh mal ins Lokal rauf und sieh nach, ob du was finden kannst. Und Steiger, du gehst rauf und kriegst raus, wer die Frau gefunden hat. Und sag dem Wirt, dass ich ihn sprechen will.«
»Vielleicht ist oben auch noch ihre Tasche«, sagte Rattler und stieg die Treppe hinauf.
»Ich hab die Frau untersucht«, sagte der Arzt. »Aber es ist schwierig, verstehen Sie. Wenn man davon ausgeht, dass sie sich das Genick gebrochen hat bei dem Sturz, müssten eigentlich auch die Bänder am Hals gerissen sein, das heißt, der Kopf müsste sozusagen instabil sein.« Er machte mit den Händen eine Bewegung, die ein haltloses Kippen ausdrücken sollte. »Aber das ist nicht der Fall.«
»Also hat sie sich nicht das Genick gebrochen?«
»Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Dens axis kann angebrochen sein, obwohl der Bandapparat noch hält. Das müsste man in der Gerichtsmedizin klären. Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass sie eine Fraktur am Handgelenk hat. Aber die war natürlich nicht tödlich.«
Reitmeyer nahm die Lampe, kniete sich nieder und leuchtete der Toten ins Gesicht. Sie wirkte, als würde sie schlafen, als könnte sie jeden Moment die Lider heben, die rot geschminkten Lippen öffnen und ihn anlächeln. Gleichzeitig hatte er das Gefühl, dass er sie kannte. Sie irgendwo schon einmal gesehen hatte. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Aber ihm fiel nicht ein, wo.
»Können Sie zum Todeszeitpunkt etwas sagen?«, fragte Reitmeyer.
Der Arzt zuckte die Achseln. »Tja, ich hab noch keine Anzeichen von Leichenstarre feststellen können. Allzu lang liegt sie noch nicht hier.«
»Hallo«, rief Steiger von oben. »Kommst du rauf? Ich hab den Wirt und seine Leute in der Küche zusammengetrommelt.«
»Wenn Sie mich nicht mehr brauchen«, sagte der Arzt, »würde ich auch gern gehen. Ich hab noch Patientenbesuche.«
Reitmeyer dankte dem Arzt und folgte ihm nach oben.
Aus der Wirtsstube dröhnte laute Akkordeonmusik, begleitet vom grölenden Gesang der Gäste. Ein ziemlich angetrunkener Mann trat in den Gang und taumelte in Richtung Toilette.
»Wir müssen unbedingt die Kellertür absperren«, sagte Reitmeyer. »Sonst liegt das nächste Opfer unten.«
Steiger nickte. »Ich hab mir den Schlüssel schon geben lassen.«
Reitmeyer ging zur Tür mit der Aufschrift KÜCHE. Als er sie öffnete, schlug ihm ein stechend säuerlicher Geruch entgegen, die Gesichter des Mannes und der Frau, die Kraut aus einem Kessel schöpften, waren in dem aufsteigenden Dampf kaum zu erkennen. Eine dritte Person nahm die Teller ab und legte Fleischscheiben mit weißlichem Fettrand darauf. Weiter hinten wuselten zwei Küchenhilfen um eine Anrichte, die etwas Puddingartiges in kleine Schalen gossen.
»Bloß noch einen Moment«, rief der Mann über den Lärm hinweg, der durchs Servierfenster drang. »Ich bin gleich fertig.« Als er Steiger auf die Teller starren sah, hielt er kurz inne. »Zuteilung von der Freibank«, fügte er schnell hinzu.
»Möchten S’ auch eine Portion?«, fragte die Frau. Die Wirtin offensichtlich.
Reitmeyer schüttelte den Kopf. »Wir sind nicht zum Essen hergekommen.«
»Ham jetzt alle?«, rief der Mann durch die Luke, wo zwei Hände nach den Tellern griffen.
»Passt«, antwortete eine Stimme.
»Tut mir leid, Herr Kommissär.« Der Mann, ein massiger Zweieinhalbzentner-Hüne, band sich die fettige Schürze ab. »Wir ham heut Abend eine große Gesellschaft. Eine Jubiläumsfeier. Schon länger vorbestellt. Das sieht für Sie jetzt«, er blickte kurz auf den dampfenden Kessel, »vielleicht pietätlos aus, aber es ist halt unser Geschäft, und ich kann meine Gäste nicht warten lassen. Übrigens, Endres mein Name. Ich bin der Wirt hier.« Er schüttelte Reitmeyer die Hand.
»Der Arzt hat mir gesagt, dass die Person im Keller hier niemandem bekannt sei. War sie denn Gast im Lokal?«
»Unser Kellner meint, dass sie so gegen acht hereingekommen ist und an der Theke gestanden hat. Einer von den Gästen hat ihr drei Schnäpse bezahlt. Der Alois, unser Kellner, hat sie dann aber nicht weiter beachtet, weil so viel Arbeit war.«
»Und wie erklären Sie sich, dass sie im Keller gelandet ist?«
»Ja, das ist furchtbar.« Er sah die Wirtin an. »Der Keller ist eigentlich immer verschlossen. Aber unsere Rita«, er deutete auf eine der Küchenhilfen, »muss vergessen haben, wieder abzusperren, nachdem sie was raufgeholt hat. Die junge Frau hat wahrscheinlich die Toilette gesucht. Die ist aber weiter vorn. Und sie soll ja vorher schon angetrunken gewesen sein …«
»Wer sagt das?«
»Unser Kellner.«
»Mit dem würde ich gern reden.«
»Herr Kommissär?« Rattler kam herein und hielt einen Mantel hoch. »Ich hab ihn gefunden. Da ist nichts drin. Und eine Tasche ist nirgends. Und mit dem Gast, der dem Opfer ein paar Schnäpse bezahlt hat, hab ich auch gesprochen. Namen und Adresse hab ich aufgeschrieben.«
»Und?«
»Er sagt, sie sei schon ziemlich angedudelt gewesen. Er hat sich trotzdem breitschlagen lassen, ihr noch was zu bestellen. Wie sie geheißen hat, weiß er nicht. Er hat sie vorher auch noch nie gesehen. Er kann sich nur noch erinnern, dass sie angedeutet hat, sie wartet auf jemand. Und dass sie irgendwie sauer gewesen ist, seiner Meinung nach. Aber dann war sie plötzlich weg, und er hat sich nicht weiter gekümmert, weil Freunde von ihm gekommen sind.«
»Hat sonst noch jemand mit ihr geredet?«
»Ich hab alle Gäste gefragt. Die waren sehr kooperativ. Auch bei der Suche nach dem Mantel. Aber geredet hat sonst keiner mit ihr. Und kennen tut sie auch niemand.«
»Alois«, rief der Wirt durch die Servierluke, »kannst du schnell kommen?«
Kurz darauf erschien ein jüngerer Mann mit erhitztem Gesicht, schnappte sich ein Glas vom Tisch, ließ Wasser einlaufen und stürzte es in einem Zug hinunter. »Ich hab dem jungen Polizisten schon alles gesagt«, erklärte er. »Ich kenn die Frau nicht.«
»War sie denn früher schon einmal hier?«, fragte Reitmeyer.
Der Kellner zuckte die Achseln. »Kann sein. Mit so andere Flitscherln vielleicht. Die kommen manchmal vom Kolosseum rüber. Aber sicher bin ich mir nicht.«
»Wieso ›Flitscherln‹?«
»Ja, vom Konvent der Unbefleckten Jungfrau war die nicht. So wie die ausgesehen und gesoffen hat.«
»Es kann sich nur um einen tragischen Unfall handeln, Herr Kommissär«, fiel der Wirt dem Kellner ins Wort und funkelte seinen Angestellten an. »Was wir natürlich sehr bedauern.«
»Und Sie haben die Frau gefunden?«, fragte Reitmeyer die Küchenhilfe.
Die drückte sich ein Tuch auf den Mund und schluchzte trocken auf.
»Wie hat sie dagelegen?«
»Ja, so verkrümmt halt … furchtbar … Und dann bin ich rauf …« Sie drückte wieder das Tuch ans Gesicht.
»Und wer hat sie dann in die Ecke gelegt?«
»Der Alois und ich.« Der Wirt trat einen Schritt näher auf Reitmeyer zu. »Verstehen S’ schon, Herr Kommissär«, er machte eine kreiselnde Handbewegung, als wollte er die Einsichtsfähigkeit des Kriminalers ankurbeln, »wir ham da unsere Sachen drunten, dann geht’s halt nicht … wenn wir was brauchen …«
»Unsere Rita macht sich solche Vorwürfe«, unterbrach die Wirtin ihren Gatten, menschliche Anteilnahme simulierend. »So ein Unglück. Wir sind noch immer ganz schockiert.«
Reitmeyer nickte. »Das wär’ im Moment alles«, sagte er und machte Steiger und Rattler ein Zeichen, ihm nach draußen zu folgen.
»Wir müssen einen Wagen anfordern, der die Leiche in die Gerichtsmedizin bringt. Hier gibt’s doch sicher ein Telefon.«
»Ja, drinnen, an der Theke. Ich ruf gleich an«, sagte Steiger.
»Ich hab eine Skizze von der Baulichkeit gemacht«, sagte Rattler und zückte einen Block. »Die Maße sind zwar nur geschätzt, aber man kann sich einen Eindruck machen.«
Reitmeyer warf einen Blick auf die Zeichnung.
»Und dann hab ich noch den Namen von dem Fotografen aufgeschrieben, der Bilder von der Feier gemacht hat. Er hebt den Film auf, falls wir ihn brauchen.«
»Sehr gute Arbeit«, sagte Reitmeyer und klopfte Rattler auf die Schulter.
»Bis der Wagen kommt, brauchen wir ja nicht zu dritt hier warten«, meinte Steiger. »Also, wenn du vorausgehen möchtest …«
Rattler nickte heftig. »Sie können ruhig schon gehen, Herr Kommissär. Ich halt mit dem Herrn Steiger die Stellung.«
Reitmeyer sah die beiden an und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie wollten ihn loswerden, um sich eine Portion Sauerkraut mit Kesselfleisch zu bestellen, das ganz gewiss nicht von der Freibank stammte. Er gönnte es ihnen. »Ja, gut, ich lass euch den Wagen da und nehm die Tram.«
»Es schüttet auch nicht mehr so«, versicherte Rattler, um ihm den Abgang zu erleichtern.
Reitmeyer ging über den Hof und blieb einen Moment unter dem Vordach des Lokals stehen. Der Regen hatte aufgehört, stattdessen trieben jetzt erste Schneeflocken durch die Nacht. Er klappte den Mantelkragen hoch und zog die Handschuhe aus der Tasche. Das blasse Gesicht der Frau tauchte kurz vor ihm auf. Hunger hätte er auch gehabt. Trotzdem wäre ihm irgendwie nicht wohl dabei gewesen, hier etwas zu essen. Er schlüpfte in die Handschuhe. Sicher hatte seine Tante etwas gekocht für ihn. Sie war wieder in Freising bei ihren Verwandten gewesen, wo sie immer ein paar Dinge ergatterte, die man auf Lebensmittelkarte nicht bekommen konnte. Auch nicht hundertprozentig legal. Aber wer konnte schon auf hundertprozentig legale Weise überleben?
Hinter ihm öffnete jemand die Tür, und ein Schwall Akkordeonmusik drang heraus. Eine Männerstimme sang gegen den Lärm an: »Eine Miezekatze hat se aus Angora mitgebracht« Johlendes Gelächter. »Und die hat se, hat se, hat se … mir gezeigt die ganze Nacht.«
Reitmeyer trat beiseite, um ein paar Gäste vorbeizulassen. Mit einem Mal sah er es wieder vor sich, wie er vor ein paar Tagen mit Sepp in der Brennnessel gestanden hatte. Der Pianist hatte den Schlager gehämmert, ein paar Leute den Refrain gebrüllt. Eine hübsche, stark geschminkte junge Frau hatte sich zu ihm durchgedrängt.
»Du bist doch Kommissär«, hatte sie gesagt.
»Wer behauptet so was?«
»Du musst mich beschützen.« Sie hatte bereits gelallt.
»Warum?«
»Weil ich Angst hab.«
»Dass dir der Schnaps ausgeht?«, hatte Sepp gefragt.
»Nein, ich mein’s ernst.«
»Dann geh zur nächsten Polizeiwache und mach Anzeige.«
Sie hatte geschwankt, sich an Reitmeyer festgehalten und ihn mit aufgerissenen Augen angesehen. Dann hatte jemand von hinten ihren Arm gepackt und sie weggezerrt.
Reitmeyer starrte noch eine Weile in das Schneetreiben und hielt mit einer Hand den Mantelkragen zusammen. Angst war nichts Besonderes, dachte er beim Weggehen. Die gab es im Überfluss. Sie grimassierte aus vielen Gesichtern. Aber diese Frau lag jetzt tatsächlich tot dort unten im Keller.
2
Reitmeyer stürzte den Rest des Kaffees hinunter – wenn man die bittere, mit Zichorie gefärbte Brühe als solchen bezeichnen konnte – und kontrollierte im Garderobenspiegel noch einmal seinen Anzug. Der Schneider hatte recht gehabt, Jackett und Hose sahen wirklich gut aus, nachdem alles aufgetrennt, gewendet und neu zusammengesetzt worden war. Das abgetragen Schäbige war nicht mehr sichtbar, der andere Farbton, ein leicht ins Violett changierendes Blau, stand ihm vielleicht noch besser.
Als er nach seinem Mantel griff, streifte sein Blick noch einmal kurz sein Spiegelbild. Erst jetzt sah er die Spuren einer schlechten Nacht, die Schatten um die Unterlider, die kleinen Kerben um den Mund. Er wandte sich schnell ab. Zuweilen war Schlaf schlimmer als Schlaflosigkeit. Wenn er den Bildern wehrlos ausgeliefert war, die sich im Wachzustand noch wegdrücken ließen. Doch sein Inneres ließ sich nicht wenden wie dieser Vorkriegsanzug.
Rasch schlüpfte er in seinen Mantel, nahm seine Tasche und verließ die Wohnung. Seine Tante war schon fort. Morgen würde es »echten« Kaffee geben, hatte sie versprochen. Wie sie dies anzustellen gedachte, hatte sie nicht verraten, weil sie ihren Neffen als Angehörigen der Ordnungsmacht nicht »in Bredouille« bringen wollte. Aber er wusste natürlich Bescheid. Und profitierte davon, dass seine alte Tante dank der Hamsterfahrten aufs Land zu einer gewieften Schwarzmarkthändlerin geworden war. Sein schlechtes Gewissen wurde allerdings noch viel größer, wenn er daran dachte, dass sie oft stundenlang in der Kälte anstand, um auf Lebensmittelkarte etwas zu bekommen. Und wenn sie endlich an die Reihe kam, war meistens alles aus.
Auf dem Weg zu seinem Rad im Hinterhof spürte er plötzlich ein Ziehen im Oberschenkel, das sich zu einem lärmenden Pochen verstärkte, als er sich auf den Sattel schwang. Er hielt kurz inne und rieb sich die Narbe. Es lag am Wetter. Die alte Schusswunde meldete sich immer, wenn es kalt wurde, vor allem bei feuchter Kälte wie heute. Aber das war nicht das Schlimmste, was er aus den Schützengräben in Frankreich zurückbehalten hatte.
Als er in die Ludwigstraße einbog, riss mit einem Mal der grauwässrige Himmel auf, und grelles Licht stach ihm in die Augen. Er zog die Mütze tiefer ins Gesicht und radelte mit gesenktem Kopf weiter. Möglichst schnell, damit ihm warm wurde und die nagende Pein in seinem Schenkel aufhörte. Mit zusammengebissenen Zähnen konzentrierte er sich nur auf das rhythmische Auf und Ab der Beine und merkte wegen der gebückten Haltung fast zu spät, dass vor dem Haupteingang des Präsidiums zwei Leute standen, denen er – insbesondere so früh am Morgen – nicht begegnen wollte. Zudem näherte sich mit gezogenem Hut und in devoter Haltung Oberinspektor Klotz dem Duo. Reitmeyer machte schnell kehrt und nahm den Eingang in der Löwengrube.
Das Ganze nützte ihm vermutlich nicht viel, dachte er, als er die Treppe hinaufstieg. Auch wenn es ihm gelungen war, die Begegnung mit Pöhner, dem Polizeipräsidenten, und Hofmiller, dem rechtsnationalen Journalisten, zu vermeiden – der Oberinspektor würde ihm ausführlich von dem Treffen berichten. Schon um sich zu brüsten, wie nahe er der höchsten Macht in der Ettstraße stand. Und daran würde sich unweigerlich eine Hymne auf die neue Zeit anschließen, die ihnen nicht nur eine »verantwortungsvolle Regierung«, sondern endlich auch wieder einen Präsidenten beschert hatte, der diesen Namen verdiente. Anstelle von »Zinngießern und Spenglergesellen« und all den »unsäglichen Subjekten«, die durch Umsturz und Revolution in ein Amt gespült worden waren, das sie weder verdienten noch auszufüllen vermochten. Womöglich sprach ihn Klotz auch wegen der Sache vor ein paar Tagen an, als er gewagt hatte, eine Entscheidung ihres Präsidenten zu kritisieren. Als er fragte, welches Rechtsverständnis hier eigentlich herrschte, wenn man statt der Randalierer, die mit Stinkbomben und antisemitischen Parolen eine Aufführung von Schnitzlers Reigen gesprengt hatten, die Kammerspiele belangte, die mit der Auswahl ihrer Stücke angeblich die öffentliche Sicherheit gefährdeten.
Er schnaufte einmal tief durch, hastete den Gang entlang und öffnete die Tür zu seinem Büro. Sein Kollege und der Polizeischüler blickten kaum auf, als sie seinen Gruß erwiderten. Dicht nebeneinander saßen sie an Steigers Schreibtisch und betrachteten ein Foto. Rattler hielt eine Lupe darüber. Steiger beugte sich näher.
»Ja, jetzt kann ich’s auch lesen«, sagte er.
»Was habt ihr da?«, fragte Reitmeyer.
Rattler richtete sich auf. »Mir ist gestern Nacht was eingefallen.« Ein triumphierender Ausdruck trat auf sein Gesicht. »Ich hab die Frau in dem Keller schon einmal gesehen!«
»Tatsächlich? Wo?«
»In einem Film. In einem Frontkino vielleicht. Ich weiß nicht mehr genau.«
»Und er hat ein Foto gefunden«, sagte Steiger.
»Ich hab die Sammlung meiner Cousine durchstöbert. Die sammelt nämlich Bilder von Filmschauspielern. Und jetzt schauen S’ einmal, Herr Kommissär.«
Reitmeyer trat näher und nahm das Foto. Zwei junge Frauen in kurzen Kleidern, besser gesagt, in leichten, fast durchsichtigen Hemdchen, standen hintereinander, jeweils ein Bein neckisch angewinkelt, und lächelten in die Kamera. Eine Art Tanzszene. Und die rechte war unverkennbar das Opfer im Roten Adler – und die Frau, die er in der Brennnessel abgewiesen hatte.
»Die ist Filmschauspielerin? Oder Tänzerin?« Er gab das Bild zurück. »Aber einen Namen haben wir totzdem nicht.«
»Aber da unten, ganz klein, steht ›EMELKA‹«, erklärte Rattler. »Das ist der Name einer Münchner Filmfirma. Da müsste man bloß hingehen und nachfragen.«
»Jedenfalls ginge das sicher schneller, als wenn man ein Foto von der Toten an die Zeitungen gibt«, meinte Steiger.
»Ich hab auch die Adresse von der Firma schon rausgesucht. Die ist in der Sonnenstraße fünfzehn.« Rattler hielt einen Zettel hoch.
»Ja, gut«, sagte Reitmeyer. »Dann frag ich da nach.« Vielleicht hatte er Glück und entging, wenn er sich beeilte, dem Oberinspektor. »Und Steiger, ruf doch mal in der Gerichtsmedizin an, wann wir mit dem Befund rechnen können. Wenn es tatsächlich ein Unfall mit Genickbruch war, dürfte die Feststellung ja nicht allzu lange dauern.«
Er hatte kein Glück. Die Tür ging auf. Klotz trat ein.
Nach einem kurzen Gruß in die Runde machte er Reitmeyer ein Zeichen. »Ich müsste Sie kurz sprechen. In meinem Büro.«
»Ja, sicher, Herr Oberinspektor. Ginge das auch heute Nachmittag? Ich bin eigentlich auf dem Sprung. Es geht um den Todesfall im Roten Adler gestern Abend. Da hat sich ganz plötzlich ein Hinweis ergeben.«
»Was für ein Todesfall?«
Steiger erklärte ihm die Zusammenhänge und zeigte ihm das Foto. »Unglaublich«, murmelte der Oberinspektor. »Und unser Polizeischüler hat diese …« Er suchte nach einem Wort. »Hat diese … Person in einem Film gesehen?« Auf sein Gesicht trat ein Ausdruck, als könnte er den vorzeitigen Tod des Opfers nur als ein Zeichen höherer Gerechtigkeit werten.
»Ah, jetzt fällt’s mir wieder ein«, sagte Rattler. »Am Weibe zerschellt, so hieß der Film.« Er sah einen Moment an die Decke. »Nein, nein, es war vielleicht doch Hyänen der Lust …«
Klotz starrte den Polizeischüler ungläubig an und schüttelte den Kopf. »Derlei Schund sieht unsere Jugend?«, fragte er an Reitmeyer gewandt. »Einen solchen Unrat und Schmutz …«
»Ach, die Titel sind oft viel reißerischer als das, was dann geboten wird«, warf Rattler ein. »So furchtbar schlimm ist das alles gar nicht …«
Steiger stieß ihn an, und nach einem Blick seines Kommissärs brach er ab.
»Reitmeyer, Sie kommen gleich rüber in mein Büro«, sagte Klotz und ging zur Tür.
»Das ist jetzt wirklich ungünstig …« Er sah hilfesuchend zu Steiger hinüber.
»Ich hab den Herrn Kommissär schon bei der Filmfirma angemeldet. Die erwarten ihn«, warf der ein.
Klotz fixierte Steiger mit einem scharfen Blick. Dann riss er die Tür auf und verließ das Büro.
»Sehr umsichtig von dir«, sagte Reitmeyer grinsend. »Hast du denn schon jemanden erreicht?«
»Nein, noch nicht«, erwiderte Steiger glucksend. »Aber ich probier’s gleich noch mal.«
Reitmeyer durchquerte die Empfangshalle des ehemaligen Hotels, die heute nicht mehr zum Verweilen in tiefen Samtfauteuils einlud. Für Muße und Genuss schienen die Leute, die eilig zu den Fahrstühlen oder die breite Treppe hinauf strebten, auch keine Zeit zu haben. Nur noch die prächtige Rezeption aus Mahagoni erinnerte an die frühere Nutzung. Statt eines würdigen Portiers stand dort jetzt eine Dame, jung und dezent geschminkt, die ihm erklärte, dass er sich oben im ersten Stock melden solle, die Sekretärin von Herrn Steinbichler würde ihn in Empfang nehmen.
Tatsächlich erwartete ihn die Sekretärin bereits oben an der Treppe, führte ihn einen Gang entlang und öffnete die Tür zu einem Büro. »Herr Steinbichler ist noch in einer Besprechung. Aber nehmen Sie doch kurz Platz.« Sie deutete auf einen Stuhl vor dem imposanten Schreibtisch. »Er ist gleich für Sie da.«
Es war der Fluch der guten Tat. Steiger hatte ihn tatsächlich angemeldet, und jetzt wurde er gleichsam »offiziell« empfangen. All seine Erklärungsversuche, dass er nur eine schlichte Auskunft wünsche und sich der »Herr Produzent« nicht zu bemühen brauche, blieben wirkungslos. Er wusste zwar nicht genau, was die Bezeichnung »Produzent« bedeutete, aber sie klang nach einer höheren Stellung in der Hierarchie des Konzerns – eine Vermutung, die sich angesichts der Größe und Ausstattung des Büros bestätigte: Edle Hölzer, tiefe Ledersessel, ein teurer Teppich. Hier residierte ein Chef.
Reitmeyer setzte sich und ließ den Blick durch den Raum schweifen, bis er an einem großen Filmplakat links von der Tür haften blieb. Eine Maid in altbayerischer Tracht, mit Alpenrosen im Arm, saß unter einem Wegkreuz und blickte zu einem trutzigen Ritter auf, dahinter ein Gebirgspanorama unter dräuendem Himmel. »Der Ochsenkrieg. Eine Geschichte aus Bayerns früher Zeit. Nach Ludwig Ganghofer«, verriet die Schrift darunter. Seiner Tante hatte der Film gefallen. Er selbst hatte es nicht so mit dem Heimatdichter, genauso wenig mit den Verfilmungen seiner Romane. Von den eher schlüpfrigen Produktionen, von denen Rattler noch gesprochen hatte, war jedoch nichts zu sehen. Kein Hinweis auf einen Sumpf der Großstadt, nirgendwo ein Weg in den Wahnsinn, ganz zu schweigen von irgendwelchen Hyänen der Lust. Im Gegenteil, hier atmete alles verlässliche Seriosität, hier wirkte alles genauso gediegen und solide wie der mächtige Eichenholzschreibtisch.
Er griff nach einer Zeitschrift, die auf dem Stapel am Rand der Tischplatte lag. Als er sie aufschlagen wollte, ging die Tür auf, und die Sekretärin kam mit einem kleinen Tablett herein.
»Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten?«, fragte sie. »Bei Herrn Steinbichler dauert’s noch einen Moment.« Sie stellte das Tablett ab. »Er führt gerade Verhandlungen mit Herrn aus Amerika, verstehen Sie. Aber er ist gleich fertig, soll ich Ihnen ausrichten.«
»Aus Amerika?«
»Ja, sicher. Wir verkaufen unsere Filme auch nach Übersee.«
Reitmeyer sog den langvermissten Duft von echtem Bohnenkaffee ein und rührte Sahne in die Tasse, kaum dass die Sekretärin draußen war. Dann stürzte er das köstliche Gebräu mit ein paar Schlucken hinunter, atmete tief durch und lehnte sich zurück. Hier schwebte man in einem Luftschiff über der Welt aus Not und Mangel, hier herrschte selbstverständlicher Luxus, hier war man in der Sphäre des Großkapitals, der internationalen Geschäfte.
Nach einer Weile griff er wieder nach der Zeitschrift. Nicht sonderlich interessiert blätterte er darin herum. »Im Gegensatz zum Tier gelüstet es den Menschen nach Abwechslung«, las er auf einer Seite. Man könne sogar sagen, dass »große Unterschiede« die sinnliche Liebe nur umso heftiger entflammen ließen. »Üppige, fremdrassige Frauengestalten peitschen die Lüste des Mannes auf, der dann im Rausch der Sinne vergisst, dass er mit seinem Tun zum Untergang des Volkes beiträgt.«
Er klappte die Zeitschrift wieder zu und griff nach einem anderen Exemplar. Für Nachhilfestunden in »völkischer Rasselehre« fehlte ihm so früh am Morgen noch jeglicher Sinn – was aber auch für alle anderen Tageszeiten galt. Es reichte schon, wenn ihm die Sprüche dieser Fanatiker von Plakatwänden und Aufklebern in der Straßenbahn entgegenplärrten.
Von draußen ertönten schnelle Schritte. Er legte gerade die Zeitschrift auf den Stapel zurück, als im selben Moment die Tür aufging.
Ein jüngerer Mann, den er auf Mitte bis Ende dreißig schätzte, trat ein. In seinem perfekt sitzenden dunklen Anzug, dem blütenweißen Hemd und der dezent gemusterten Krawatte sah er aus wie einer der Herrn, die im Magazin Gentleman als Vorbilder propagiert wurden. Und mit seiner drahtig-sportlichen Erscheinung und den markanten Zügen hätte er problemlos in einem der Filme auftreten können, die seine Firma produzierte. Als Typ des eleganten Verführers, des Frauenschwarms.
»Tut mir leid, Herr Kommissär, ich hab Sie warten lassen.« Er machte eine charmant bedauernde Geste und schüttelte Reitmeyer die Hand.
»Ihre Sekretärin hat mich schon informiert. Internationale Geschäfte. Aber ich hätte Ihre Zeit gar nicht in Anspruch nehmen müssen …«
Steinbichler winkte ab und ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder. »Nein, nein, Herr Kommissär, überhaupt kein Problem.« Sein gewinnendes Lächeln entblößte makellose Zahnreihen. »Ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung. Was kann ich für Sie tun?«
Reitmeyer zog das Foto heraus und schob es über den Tisch. »Ich brauche eigentlich nur eine Auskunft. Diese zwei Frauen haben in einer Ihrer Produktionen mitgewirkt. Wir würden gern die Namen der beiden erfahren.«
Steinbichler sah auf das Foto und schüttelte den Kopf. »Die Namen … Wissen Sie, ich erinnere mich vage, dass ich die beiden schon gesehen habe. Aber wo?« Er blickte an die Decke. »Also wirkliche Schauspielerinnen sind sie nicht. Ich meine, sie hatten keine tragenden Rollen. Vielleicht kleine Nebenrollen, nicht viel mehr als Statistinnen …«
»Darüber gibt’s doch sicher Aufzeichnungen in Ihrer Firma. Könnten Sie veranlassen, dass jemand die Namen für mich heraussucht, möglichst mit einer Adresse?«
»Ja sicher. Das dauert nur einen Moment.« Er warf noch einmal einen Blick auf das Bild, dann stand er auf und verschwand mit dem Foto in der Hand zur Tür hinaus.
Nach ein paar Minuten kam er wieder zurück. »Einer unser Mitarbeiter klärt das für Sie.« Er setzte sich wieder. »Liegt denn gegen die beiden Mädchen irgendetwas vor?«
»Nein, nichts. Aber eine ist leider tot aufgefunden worden. Und wir würden gern die Identität der Frau feststellen.«
»Tot?«, fragte Steinbichler konsterniert. »Ein Unfall?«
»Möglicherweise. Sie wurde leblos im Keller einer Gastwirtschaft gefunden.«
»Im Keller? Einer Gastwirtschaft? Wie kam sie denn da hin?«
»Das ermitteln wir noch.«
»Unglaublich.« Steinbichler schüttelte wieder den Kopf.
»Sie kannten die beiden Frauen also nicht persönlich? Oder eine von ihnen?«
»Herr Kommissär«, erwiderte er nachsichtig, »ich habe andere Aufgaben, als mich um Kleindarstellerinnen zu kümmern. Vielleicht hab ich die beiden in einem Film gesehen, vielleicht bei einer Veranstaltung … ich weiß nicht mehr. Ich bin hier eher für das Große und Ganze verantwortlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Für Organisation und Finanzen, und für eine Menge rechtlicher Probleme.«
»Sie meinen Zensurbestimmungen?«
Steinbichler lachte kurz auf. »Ja, dafür auch. Und wir würden uns tatsächlich wünschen, dass sich die Herrn Politiker mal auf was einigen könnten. Ich meine reichsweit.«
»Aha?«
Das Thema schien ihn eindeutig mehr zu interessieren als das Schicksal von Kleindarstellerinnen. Er richtete sich auf. »Wie Sie ja wissen, haben wir seit dem Frühjahr ein Reichslichtspielgesetz, das aber in Bayern nicht anerkannt wird. Dafür gibt’s eine bayerische Filmprüfstelle. Und kann man sich auf deren Entscheidungen verlassen?« Seine Stimme war zunehmend schärfer geworden. »Nein, kann man nicht! Weil die Münchner Polizeidirektion eine eigene Lokalzensur durchführt. Aber was erzähle ich Ihnen da? Das wissen Sie doch alles selbst.«
»Damit hab ich nichts zu tun. Ich bin bei der Kriminalpolizei.«
»Da können Sie von Glück sagen. Aber der Geschäftsmann braucht Verlässlichkeit für seine Investitionen, verstehen Sie.« Zum Nachdruck trommelte er mit dem Zeigefinger ein paarmal auf den Tisch. »Wenn die Berliner Prüfstelle einen Film fürs ganze Reich zugelassen hat, geht’s doch nicht an, dass ihn die Münchner Polizei nach Gutdünken verbietet! Mit schwammigen Begründungen …«
»Dass der Streifen die öffentliche Sicherheit gefährdet?«
Steinbichler stutzte einen Moment. »Sie verstehen also, was ich meine?« Er beugte sich vor und fügte mit gesenkter Stimme hinzu: »Wir überlegen uns tatsächlich, ob wir den Firmensitz nicht nach Berlin verlegen sollen. Wie es bereits eine ganze Reihe ehemals Münchner Firmen getan hat.«
»Das wäre aber ein großer Nachteil für die Münchner Wirtschaft.«
»Herr Kommissär«, erwiderte Steinbichler, jetzt mit dem Ausdruck eines Lehrers, der unvermutet Bestnoten verteilen durfte. »Sie zeigen eindeutig mehr Verstand in Wirtschaftsdingen als unser Münchner Magistrat und unser Innenministerium zusammen.«
Es klopfte, und die Sekretärin kam herein. Sie legte das Foto und einen Zettel vor Reitmeyer auf den Schreibtisch und sagte: »Hier sind die Namen. Die linke heißt Marie Zaumer und die rechte Cäcilie Ortlieb. Adressen der beiden haben wir nicht.«
Steinbichler stand auf, ging um den Schreibtisch herum und sah Reitmeyer über die Schulter. »Und welche von den beiden ist … verunglückt?«, fragte er.