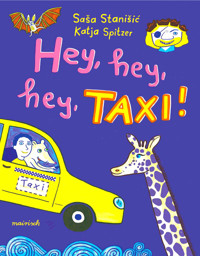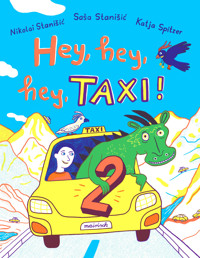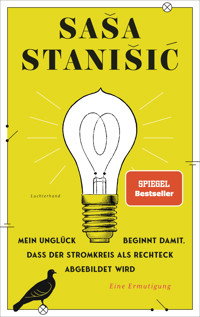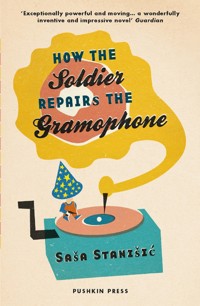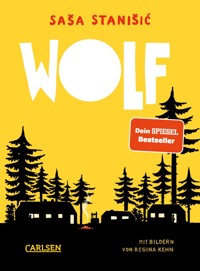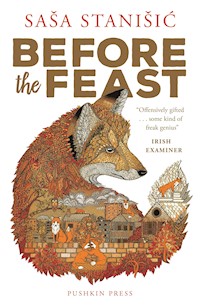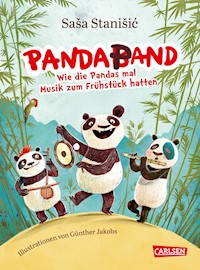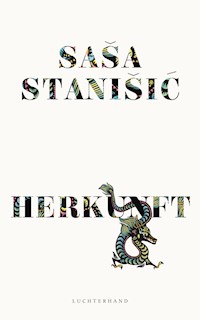
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt.
HERKUNFT ist ein Buch über ein Dorf, in dem nur noch dreizehn Menschen leben, ein Land, das es heute nicht mehr gibt, eine zersplitterte Familie, die meine ist. Es ist ein Buch über die Frage, was zu mir gehört, ein Selbstporträt mit Ahnen. Und ein Scheitern des Selbstporträts.
HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen sammle, verliert sie ihre.
HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache und Scham, Ankommen und Zurechtkommen, Glück und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
»Herkunft« ist ein Buch über ein Dorf, in dem nur noch dreizehn Menschen leben, ein Land, das es heute nicht mehr gibt, eine zersplitterte Familie, die meine ist. Es ist ein Buch über die Frage, was zu mir gehört, ein Selbstporträt mit Ahnen. Und ein Scheitern des Selbstporträts.
»Herkunft« ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch über Sprache und Scham, Ankommen und Zurechtkommen, Glück und Tod.
Die Toten sprechen in »Herkunft«, und auch die Drachen, und meine Großtante Zagorka macht sich in die Sowjetunion auf, um Kosmonautin zu werden.
»Herkunft« ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen sammle, verliert sie ihre.
Diese sind auch »Herkunft«: Drina und Neckar. Ein Flößer, der nicht schwimmen kann. Eine Marxismus-Professorin, die ausgebeutet wird. Ein nicht korrupter bosnischer Polizist. Ein Wehrmachtssoldat, der Milch mag. Boris Becker. Eine Grundschule für drei Schüler. Ein Nationalismus. Eine ARAL-Tankstelle. Ein Tito. Ein Eichendorff. Ein Saša Stanišić.
Zum Autor
SAŠA STANIŠIĆ wurde 1978 in Višegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sein Debütroman »Wie der Soldat das Grammofon repariert« wurde in 31 Sprachen übersetzt. Mit »Vor dem Fest« gelang Stanišicć erneut ein großer Wurf; der Roman war ein SPIEGEL-Bestseller und ist mit dem renommierten Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Für den Erzählungsband »Fallensteller« erhielt er 111 Flaschen Rheingauer Riesling. Saša Stanišić lebt und arbeitet in Hamburg.
SAŠA STANIŠIĆ
HERKUNFT
Luchterhand
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Das Kapitel »Heidelberg« ist in abgewandelter Form in MERIAN Heidelberg (Heft 3/11) erschienen. Eine frühe Fassung von »Spiel, Ich und Krieg, 1991« erschien 2017 in der Anthologie »Das Spiel meines Lebens« bei Rowohlt. Einige Bestandteile des Textes waren enthalten in den vom Autor gehaltenen »Zürcher Poetikvorlesungen« 2017.
Copyright © 2019 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: buxdesign/München
Covermotiv: Ruth Botzenhardt
ISBN 978-3-641-16324-2 V009 www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
GROSSMUTTER UND DAS MÄDCHEN
Großmutter hat ein Mädchen auf der Straße gesehen. Sie ruft ihm zu vom Balkon, es solle keine Angst haben, sie werde es holen. Rühr dich nicht!
Großmutter steigt auf Strümpfen drei Stockwerke hinunter, und das dauert, das dauert, die Knie, die Lunge, die Hüfte, und als sie dort ankommt, wo das Mädchen gestanden hat, ist das Mädchen fort. Sie ruft es, ruft nach dem Mädchen.
Autos bremsen, umkurven meine Großmutter in den dünnen schwarzen Strümpfen auf der Straße, die einmal den Namen Josip Broz Titos getragen hat und heute den Namen des verschwundenen Mädchens trägt als Hall, Kristina!, ruft meine Großmutter, ruft ihren eigenen Namen: Kristina!
Es ist der 7. März 2018 in Višegrad, Bosnien und Herzegowina. Großmutter ist siebenundachtzig Jahre alt und elf Jahre alt.
AN DIE AUSLÄNDERBEHÖRDE
Am 7. März 1978 wurde ich in Višegrad an der Drina geboren. In den Tagen vor meiner Geburt hatte es ununterbrochen geregnet. Der März in Višegrad ist der verhassteste Monat, weinerlich undgefährlich. Im Gebirge schmilzt der Schnee, die Flüsse wachsen den Ufern über den Kopf. Auch meine Drina ist nervös. Die halbe Stadt steht unter Wasser.
Im März 1978 war es nicht anders. Als bei Mutter die Wehen anfingen, brüllte ein heftiger Sturm über der Stadt. Der Wind bog die Fenster vom Kreißsaal und brachte Gefühle durcheinander, und mitten in einer Wehe schlug auch noch der Blitz ein, dass alle dachten, aha, soso, jetzt also kommt der Teufel in die Welt. So unrecht war mir das nicht, ist doch ganz gut, wenn Leute ein bisschen Angst haben vor dir, bevor es überhaupt losgeht.
Nur gab all das meiner Mutter nicht unbedingt ein positives Gefühl, den Geburtsverlauf betreffend, und da die Hebamme mit der gegenwärtigen Situation ebenfalls nicht zufrieden sein konnte, Stichwort Komplikationen, schickte sie nach der diensthabenden Ärztin. Die wollte, so wie ich jetzt, die Geschichte nicht unnötig verlängern. Es reicht vielleicht zu sagen, dass die Komplikationen mithilfe einer Saugglocke vereinfacht wurden.
Dreißig Jahre später, im März 2008, musste ich zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft unter anderem einen handgeschriebenen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde einreichen. Riesenstress! Beim ersten Versuch brachte ich nichts zu Papier, außer dass ich am 7. März 1978 geboren worden war. Es kam mir vor, als sei danach nichts mehr gekommen, als sei meine Biografie von der Drina weggespült worden.
Die Deutschen mögen Tabellen. Ich legte eine Tabelle an. Trug auch ein paar Daten und Infos ein – Besuch der Grundschule in Višegrad, Studium der Slavistik in Heidelberg –, es kam mir jedoch vor, als hätte das nichts mit mir zu tun. Ich wusste, die Angaben waren korrekt, konnte sie aber unmöglich stehen lassen. Ich vertraute so einem Leben nicht.
Ich setzte neu an. Schrieb wieder das Datum meiner Geburt und schilderte den Regen und dass mir Großmutter Kristina meinen Namen gegeben hat, die Mutter meines Vaters. Sie kümmerte sich auch in den ersten Jahren meines Lebens viel um mich, da meine Eltern studierten haben (Mutter) beziehungsweise berufstätig waren (Vater). Sie war bei der Mafia, schrieb ich der Ausländerbehörde, und bei der Mafia hat man viel Zeit für Kinder. Ich lebte bei ihr und Großvater, am Wochenende bei den Eltern.
Ich schrieb der Ausländerbehörde: Mein Großvater Pero war mit Herz und Parteibuch Kommunist und nahm mich mit auf Spaziergänge mit den Genossen. Wenn sie über die Politik sprachen, und das taten sie eigentlich immer, schlief ich super ein. Mit vier konnte ich mitreden.
Ich radierte das mit der Mafia wieder aus, man weiß ja nie.
Ich schrieb stattdessen: Meine Großmutter besaß ein Nudelholz, mit dem sie mir stets Prügel androhte. Es kam nicht dazu, ich habe aber bis heute ein reserviertes Verhältnis zu Nudelhölzern und indirekt auch zu Teigwaren.
Ich schrieb: Großmutter hatte einen goldenen Zahn.
Ich schrieb: Ich wollte auch einen goldenen Zahn, also malte ich einen meiner Schneidezähne mit gelbem Filzstift an.
Ich schrieb der Ausländerbehörde: Religion: keine. Und dass ich quasi unter Heiden aufgewachsen sei. Dass Großvater Pero die Kirche den größten Sündenfall des Menschen nannte, seit die Kirche die Sünde erfunden hat.
Er stammte aus einem Dorf, in dem der Heilige Georg, Georg, der Drachentöter, verehrt wird. Beziehungsweise, wie mir damals schien, mehr so die Drachenseite. Drachen besuchten mich früh. Vom Hals der Verwandten baumelten sie als Anhänger, Stickereien mit Drachenmotiv waren ein beliebtes Mitbringsel, und Großvater hatte einen Onkel, der schnitzte kleine Drachen aus Wachs und verkaufte die als Kerzen auf dem Markt. Das war schon gut, wenn man den Docht anzündete und das Viech aussah, als würde es ein Feuerchen speien.
Als ich fast alt genug war, zeigte mir Großvater einen Bildband. Die fernöstlichen Drachen fand ich am besten. Die sahen grausam, aber auch bunt und lustig aus. Die slawischen Drachen sahen nur grausam aus. Auch die, die angeblich nett waren und kein Interesse an Verheerung oder Jungfrauenentführung hatten. Drei Köpfe, krasse Zähne, so was.
Ich schrieb der Ausländerbehörde: Das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, gibt es nicht mehr. Gott, wie viel Penicillin ich dort in den Arsch gepumpt bekommen habe, schrieb ich, ließ es aber nicht stehen. Man will ja eine womöglich etepetete Sachbearbeiterin mit solchem Vokabular nicht verstören. Ich änderte also Arsch zu Gesäß. Das kam mir aber falsch vor, und ich entfernte die ganze Info.
Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte mir der Rzav die Zerstörung der Brücke in unserem Viertel, der Mahala. Ich sah zu vom Ufer, wie der Nebenarm der Drina die Brücke so lange mit Frühling in den Bergen bearbeitete, bis die Brücke sagte, alles klar, dann nimm mich halt mit.
Ich schrieb: Keine biografische Erzählung ohne Kindheitsfreizeitgestaltung. Ich schrieb mit Großbuchstaben mitten auf das Blatt:
SCHLITTENFAHREN
Die Meisterstrecke begann unter dem Gipfel des Grad, wo im Mittelalter ein Turm über das Tal gewacht hatte, und endete nach einer engen Kurve vor dem Abgrund. Ich erinnere mich an Huso. Huso schlich mit einem alten Schlitten den Grad hinauf, außer Puste, lachend, und auch wir, die Kinder, lachten, lachten ihn aus, weil er dürr war und Löcher in den Stiefeln hatte und viele Zahnlücken. Ein Irrer, dachte ich damals, heute denke ich, er hat einfach am Konsens vorbeigelebt. Wo man schlief, wie man sich kleidete, wie deutlich man Wörter aussprechen und in welchem Zustand sich die Zähne befinden sollten. Er ging es anders an als die meisten. Genaugenommen war Huso bloß ein arbeitsloser Säufer, der vor dem Abgrund nicht gebremst hat. Vielleicht weil wir ihn nicht gewarnt hatten vor der finalen Kurve. Vielleicht weil er sich die Reflexe weggesoffen hatte. Huso schrie, wir hin, und dann war es ein Freudenschrei gewesen: Huso saß auf seinem Schlitten, und der Schlitten hing auf halbem Hang im Unterholz.
»Weiter, Huso!«, riefen wir. »Gib nicht auf!« Angefeuert durch unsere Rufe und vor allem die Tatsache, dass es in seiner Lage leichter war, nach unten als nach oben zu gelangen, schlug sich Huso aus dem Gestrüpp und rauschte den restlichen Hang hinab. Es war unglaublich, wir waren ekstatisch, und Huso wurde 1992 angeschossen in seinem Verschlag an der Drina, seinem Haus aus Karton und Brettern, unweit des Wachturms, wo – die alten Epen besingen es – je nachdem, wen du fragst, entweder der serbische Held, Königssohn Marko, einst Zuflucht vor den Osmanen fand, oder der bosniakische – AlijaĐerzelez auf seiner geflügelten Araber Stute über die Drina sprang. Huso überlebte, verschwand und kam nicht wieder. Die Meisterstrecke hat nie wieder einer so gemeistert wie er.
Ich schrieb eine Geschichte auf, die so begann: Fragt man mich, was für mich Heimat bedeutet, erzähle ich von Dr. Heimat, dem Vater meiner ersten Amalgam-Füllung.
Ich schrieb der Ausländerbehörde: Ich bin Jugo und habe in Deutschland trotzdem nie was geklaut, außer ein paar Bücher auf der Frankfurter Buchmesse. Und in Heidelberg bin ich mal mit einem Kanu in einem Freibad gefahren. Radierte beides aus, weil vielleicht Straftaten und nicht verjährt.
Ich schrieb: Hier ist eine Reihe von Dingen, die ich hatte.
SPIEL, ICH UND KRIEG, 1991
Hier ist eine Reihe von Dingen, die ich hatte:
Mutter und Vater.
Großmutter Kristina, die Mutter meines Vaters, die immer wusste, was mir fehlt. Wenn sie mir das selbstgestrickte Jäckchen brachte, dann war mir wirklich kalt gewesen. Ich gab es bloß ungern zu. Welches Kind will schon, dass seine Großmutter immer recht hat?
Nena Mejrema, die Mutter meiner Mutter, die mir aus Nierenbohnen die Zukunft las. Sie warf die Bohnen, und die Bohnen warfen Bilder eines noch ungelebten Lebens auf den Teppich. Einmal prophezeite sie mir, eine ältere Frau werde sich in mich verlieben, oder ich würde alle Zähne verlieren, die Nierenbohnen zeigten da eine gewisse Unschärfe.
Eine Furcht vor Nierenbohnen.
Ich hatte einen gut rasierten Großvater, den Vater meiner Mutter, der gern angeln ging und gern zu allen freundlich war.
Jugoslawien. Das aber nicht mehr lang. Der Sozialismus war müde, der Nationalismus wach. Fahnen, jeder eine eigene, im Wind, und in den Köpfen die Frage: Was bist du?
Interessante Gefühle gegenüber meiner Englischlehrerin.
Einmal lud sie mich zu sich nach Hause ein, bis heute weiß ich nicht, warum. Ich hin, aufgeregt wie Frühlingsanfang. Wir aßen selbstgemachten Englischlehrerinnenkuchen und tranken schwarzen Tee. Es war der erste schwarze Tee meines Lebens, ich kam mir irrsinnig erwachsen vor, tat aber so, als tränke ich schwarzen Tee seit Jahren, wurde auch den Expertensatz los: »Ich mag es, wenn er nicht so richtig schwarz ist.«
Ich hatte einen C-64. Sportspiele waren mein Lieblingsgenre, Summer Games, International Karate Plus, International Football.
Eine Menge Bücher. 1991 hatte ich ein neues Genre entdeckt: Choose your own adventure. Als Leser entscheidest du selbst über den Fortgang der Geschichte:
Rufst du: »Aus dem Weg, Höllengezücht, sonst schneid ich dir die Adern durch!« – lies weiter auf Seite 306.
Und ich hatte meine Mannschaft: Crvena Zvezda – Roter Stern Belgrad. Ende der Achtziger holten wir in fünf Jahren drei Mal den Meistertitel. Standen 1991 im Viertelfinale des Pokals der Landesmeister gegen Dynamo Dresden. Zu wichtigen Spielen kamen hunderttausend in unserem Marakana von Belgrad zusammen, davon mindestens fünfzigtausend Wahnsinnige. Immer brannte was, immer sangen alle.
Meinen rot-weiß gestreiften Schal trug ich oft zur Schule (gern auch im Sommer) und schmiedete für die Zukunft Pläne, die mich in die Nähe der Mannschaft bringen sollten. Den Weg, selbst Fußballer zu werden und vom Roten Stern für 100.000.000.000.000 Dinar (die Inflation) gekauft zu werden, sah ich als wenig wahrscheinlich an. Also wollte ich Physiotherapeut werden oder Ballwart oder von mir aus auch Ball, Hauptsache, ich wurde Teil vom Roten Stern.
Ich verpasste keine Spielübertragung im Radio und keine Zusammenfassung im Fernsehen. Zum dreizehnten Geburtstag wünschte ich mir eine Dauerkarte.
Nena befragte die Bohnen und sagte: »Du kriegst ein Fahrrad.«
Woher die Bohnen das wüssten, fragte ich.
Sie warf erneut eine Handvoll und sagte ernst: »Verlass an deinem Geburtstag das Haus nicht.« Dann stand sie auf, warf die Bohnen aus dem Fenster, wusch sich die Hände und legte sich schlafen.
Eine realistische Chance auf die Erfüllung meines Wunschs gab es schon deswegen nicht, weil Belgrad knapp 250 Kilometer entfernt lag. Das Einzelkind in mir spekulierte dennoch darauf, dass die Eltern sich meinetwegen zu einem Umzug in die Hauptstadt entschließen würden.
Am 6. März fegte Roter Stern im Hinspiel Dynamo Dresden mit 3:0 weg. Vater und ich sahen die Übertragung, unsere Stimmen waren schon nach dem ersten Treffer heiser. Nach dem Abpfiff nahm er mich zur Seite und sagte, er werde versuchen, uns Tickets für das Halbfinale zu besorgen, falls sich die Mannschaft qualifizieren sollte. Mit uns meinte er auch Mutter, die tippte sich aber bloß mit dem Zeigefinger an die Schläfe.
Das Rückspiel in Dresden wurde nach Ausschreitungen beim Stand 1:2 abgebrochen und als 0:3-Sieg für uns gewertet. Das Halbfinal-Los fiel auf die Bayern. Schon damals theoretisch unbesiegbar. Vater und ich verfolgten das Hinspiel wieder gemeinsam im Fernsehen. In der Halbzeitpause wurde von Unruhen in Slowenien und Kroatien berichtet. Schüsse waren gefallen. Roter Stern schoss zwei Tore, die Bayern eins.
Es ist so: Das Land, in dem ich geboren wurde, gibt es heute nicht mehr. Solange es das Land noch gab, begriff ich mich als Jugoslawe. Wie meine Eltern, die aus einer serbischen (Vater) bzw. einer bosniakisch-muslimischen Familie stammten (Mutter). Ich war ein Kind des Vielvölkerstaats, Ertrag und Bekenntnis zweier einander zugeneigter Menschen, die der jugoslawische Melting Pot befreit hatte von den Zwängen unterschiedlicher Herkunft und Religion.
Dazu muss man wissen: Auch jemand, dessen Vater Pole und Mutter Mazedonierin war, konnte sich zum Jugoslawen erklären, sofern ihm Selbstbestimmung und Blutgruppe mehr bedeuteten als Fremdbestimmung und Blut.
Am 24.4.1991 fuhren Vater und ich zum Rückspiel nach Belgrad. Ich ließ meinen rot-weißen Schal aus dem Fenster hängen, weil man das im Fernsehen so machte als richtiger Fan. Am Stadion angekommen war der Schal aufs Fürchterlichste verdreckt. Vor so was warnt dich ja keiner.
Am 27.6.1991 fanden in Slowenien die ersten Kriegshandlungen statt. Die Alpenrepublik erklärte sich für unabhängig von Jugoslawien. Es folgten Scharmützel in Kroatien, Horror in Kroatien, dann die kroatische Unabhängigkeitserklärung.
Am 24.4.1991 hatte der serbische Abwehrspieler, Siniša Mihajlović, Roten Stern mit einem Freistoßtor in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Foul an Dejan Savićević, einem Edeltechniker aus Montenegro. Der Jubel aus achtzigtausend Kehlen war ohrenbetäubend, war unheimlich. Heute könnte ich behaupten, darin hätten sich Wut entladen, unterdrückte Aggressionen, Existenzängste. Das stimmt aber nicht. All das würde sich später aus Waffen entladen. Das hier war nur eines: Jubel über ein wichtiges Tor.
Fackeln wurden angezündet, roter Rauch stieg über den Rängen auf, ich zog meinen Schal höher ins Gesicht. Um uns jubelten Menschen, fast ausschließlich Männer, junge Kerle, Vokuhilas, Kippen, Fäuste.
Im Mittelfeld wirbelte Prosinečki die Bayern immer wieder durcheinander, sein hellblonder Schopf wie eine kleine Sonne, die über dem Rasen auf- und – wenn ein Gegenspieler sich nicht anders zu helfen wusste – niederging. Ein Jugoslawe wie ich: Mutter Serbin, Vater Kroate. Die hochsitzenden, kurzen Shorts. Die bleichen Beine.
Hinten machte Refik Šabanadžović die Räume eng, ein unbequemer Bosnier, stämmig, aber schnell. Mein Lieblingsspieler lümmelte vor dem gegnerischen Strafraum scheinbar schläfrig herum: Darko Pančev, genannt Kobra. Der mazedonische Stürmer, Torschütze im Hinspiel, lief immer leicht vorgebeugt über den Platz, die Schultern hochgezogen, als ginge es ihm ausgerechnet heute nicht so gut. Die krummsten Beine des Universums, ich hätte auch gern solche gehabt.
Was für eine Mannschaft! So eine wird auf dem Balkan nie wieder möglich sein. Nach dem Zerfall Jugoslawiens entstanden in jedem neuen Staat neue Ligen mit schwächeren Teams, die besten Spieler wechseln heute jung ins Ausland.
Die Bayern glichen Mitte der zweiten Halbzeit aus. Ein Augenthaler-Freistoß, der Ball rutschte Stojanović unter den Händen durch. Belodedić, der rumänische Vorstopper (serbische Minderheit), tröstete seinen Kapitän auf dem Boden.
Vater, dieser selten laute Mann, brüllte, beschwerte sich, fluchte, und ich imitierte das, ich imitierte Vaters Wut, ich weiß gar nicht, was mit meiner eigenen Wut los war, vielleicht fehlte sie, weil alle um mich herum so viel davon hatten, vielleicht, weil ich wusste, es würde alles gutgehen. Und gerade, als ich das Vater mitteilen wollte – es wird alles gut –, gingen die Bayern in Führung.
Vater sackte in sich zusammen.
Ziemlich genau ein Jahr später fragte er mich besonnen, welche Gegenstände mir so wichtig sind, dass ich ohne sie nicht sein kann auf einer womöglich langen Reise. Mit der langen Reise meinte er die Flucht aus unserer besetzten Heimatstadt, wo betrunkene Soldaten ihre Lieder sangen, als feuerten sie eine Mannschaft an. Mein rot-weißer Schal fiel mir als Erstes ein. Ich wusste, es gab Wichtigeres. Nahm ihn trotzdem mit.
Vater sagte: »Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut.«
Wäre es beim 1:2 geblieben, hätte es Verlängerung gegeben. Vielleicht hätten die Bayern dann die besseren Beine und Ideen gehabt, um es ins Finale zu schaffen. Vielleicht wäre dann überhaupt alles anders gekommen, der Krieg nicht nach Bosnien, ich nicht zu diesem Text.
Das 2:2 habe ich nicht gesehen. Zu diesem Zeitpunkt – es lief die 90. Minute – standen alle, das ganze Stadion stand, vielleicht stand sogar das ganze Land ein letztes Mal gemeinsam hinter einer Sache. Ich konnte den entscheidenden Angriff bis zu dem Moment verfolgen, als der Ball, von Augenthaler abgefälscht, seine Torreise antrat, dann aber bewegten sich die Männer vor uns, neben uns, die ganze Tribüne bewegte sich, nach rechts, nach oben, ich wurde gedrückt, verlor kurz das Gleichgewicht und den Ball aus den Augen –
Wie oft habe ich dieses Tor in der Wiederholung gesehen? Hundert Mal bestimmt. Bis sich jedes Detail so in mein Gedächtnis gebrannt hat wie etwas, das man nur mit großer Liebe verbindet oder mit großem Unglück. Augenthaler will die Flanke abwehren, trifft den Ball unglücklich, eine Bogenlampe ins eigene Netz.
Hier ist eine Reihe von Dingen, die ich hatte:
Eine Kindheit in einer kleinen Stadt an der Drina.
Eine Sammlung von Katzenaugen, abgeschraubt von Autokennzeichen. Das einzige Mal geschlagen worden von den Eltern deswegen.
Eine Großmutter, die das Alphabet der Nierenbohnen beherrschte und die mir riet, dass ich mich an Worte halten solle, ein Leben lang, dann werde zwar trotzdem nicht alles gutgehen, aber einiges lasse sich besser ertragen. Oder an Edelmetalle. Da hätten sich die Bohnen nicht festgelegt.
Ich hatte zwei Wellensittiche, Krele (hellblau) und Fifica (weiß nicht mehr).
Einen Hamster namens Indiana Jones, dem ich in den letzten Tagen seines viel zu kurzen Lebens zu Pulver zerriebenes Andol auf einem Löffelchen gab (nahm ich selber gegen Kopfschmerzen) und Ivo Andrićs Erzählungen vorlas.
Häufig Kopfschmerzen.
Eine unwahrscheinliche Reise mit meinem Vater zum unwahrscheinlichen Spiel einer unwahrscheinlichen Mannschaft, die nach dem Weiterkommen in Belgrad das Turnier gewinnen und danach nicht mal mehr auszudenken sein würde.
Einen undenkbaren Krieg.
Eine Englischlehrerin, der ich nie Auf Wiedersehen gesagt habe, und ein Wiedersehen ist nicht mehr möglich.
Einen rot-weißen Schal, den ich nach dem Spiel in Belgrad nicht mehr waschen wollte, dann landete er doch in der Waschmaschine. Roter Stern Belgrad ist heute eine Mannschaft mit zahlreichen rechtsradikalen, aggressiven Fans. Den Schal habe ich damals nach Deutschland mitgenommen, ich weiß nicht, wo er heute ist.
OSKORUŠA, 2009
Im Osten, unweit von Višegrad, liegt in den Bergen, grundsätzlich schwer und bei unwirtlicher Witterung gar nicht zugänglich, ein Dorf, in dem nur noch dreizehn Menschen leben. Die dreizehn haben sich dort niemals fremd gefühlt, glaube ich. Sie sind nicht von woanders hergekommen, haben die längste Zeit ihres Lebens an diesem Ort verbracht.
Gewiss ist auch: Die dreizehn gehen nirgendwo mehr hin. Sie werden die Letzten sein. Hier oben (oder in einem Krankenhaus im Tal) enden sie und mit ihnen endet ihr Gehöft – die Kinder werden nicht übernehmen –, ihr Glück und ihr knirschendes Hüftgelenk. Ihr Schnaps, der die Sehenden blind macht und die Blinden wieder sehend, wird ausgetrunken oder auch nicht, hier wird bald keiner mehr gebrannt (in der Flasche ein Kreuz aus Holz). Die Zäune werden nichts mehr trennen, was eine Bedeutung hat, die Äcker werden brachliegen. Die Schweine werden verkauft oder geschlachtet. Was mit den Pferden sein wird, weiß ich nicht. Mit den Lauchpflanzen und dem Mais und den Brombeeren geht es zu Ende. Wobei die Brombeeren vielleicht auch allein weitermachen werden.
Ich war 2009 zum ersten Mal hier. Ich erinnere mich, beim Anblick der Strommasten laut und blöd über den Strom nachgedacht zu haben, ob der wohl abgestellt werde, nachdem der Letzte hier gestorben ist. Wie lange wird es dann noch surren zwischen diesen Masten?
Gavrilo, einer der ältesten im Dorf, spuckte daraufhin saftig ins saftige Gras und rief: »Was ist los mit dir? Kaum angekommen, sprichst du schon vom Sterben. Ich sag dir was. Wir haben das Leben hier überlebt, der Tod ist das kleinere Problem. Solange ihr unsere Gräber pflegt, vielleicht mal Blumen drauflegt und mit uns sprecht, geht es hier weiter. Mit oder ohne Strom. Auf mich muss aber keiner Blumen legen, was soll ich tot mit Blumen? So. Los jetzt, Augen auf, ich zeig dir ein paar Sachen, du hast ja offenbar keine Ahnung von nichts.«
Oskoruša, so heißt das Dorf. Der alte Mann hatte uns außerhalb am Wegesrand aufgelesen mit Händen wie aus Lehm gebrannt. Uns, denn ich war nicht allein. Die Reise war die Idee meiner Großmutter Kristina gewesen.
Noch dabei war Stevo, er hatte uns gefahren, ein ernster Mann mit sehr blauen Augen, zwei Töchtern und Geldsorgen.
Großmutter trug, von der Sonne unbeeindruckt, Schwarz an dem Tag. Sprach viel, erinnerte sich an vieles. Im Nachhinein wirkt es, als ahnte sie, dass ihr die Vergangenheit bald entgleiten würde. Sie führte Oskoruša sich selbst noch einmal und mir zum ersten Mal vor Augen.
2009 hatte Großmutter ihr letztes gutes Jahr. Sie hatte noch nicht zu vergessen begonnen, und ihr Körper machte, was sie wollte. In Oskoruša schritt sie die Wege ab, die sie ein halbes Jahrhundert zuvor als junge Frau mit ihrem Mann gegangen war. Mein Großvater Pero war hier geboren und hatte seine Kindheit in diesen Bergen verbracht. Gestorben ist er 1986 in Višegrad vor dem Fernseher, während ich im Schlafzimmer nebenan mit Indianerplastikfigürchen auf Cowboyplastikfigürchen schoss.
Früher hatte Großmutter behauptet – da war ich zehn oder fünf oder sieben –, ich würde niemals täuschen und lügen, sondern immer nur übertreiben und erfinden. Den Unterschied kannte ich damals wohl nicht (will ihn auch heute nicht immer kennen), ich mochte aber, dass sie mir zu vertrauen schien.
Am Morgen vor unserer Reise nach Oskoruša bekräftigte sie noch mal, es immer gewusst zu haben: »Erfinden und übertreiben, heute verdienst du sogar dein Geld damit.«
Ich war gerade angekommen in Višegrad, wollte mich erholen von der langen Lesereise mit meinem ersten Roman. Ein Exemplar hatte ich als Geschenk dabei, sinnloserweise auf Deutsch.
Ob es das Buch über uns sei, fragte Großmutter.
Ich legte sofort los – Fiktion, wie ich sie sähe, sagte ich, bilde eine eigene Welt, statt unsere abzubilden, und die hier, ich klopfte auf den Umschlag, sei eine Welt, in der Flüsse sprechen und Urgroßeltern ewig leben. Fiktion, wie ich sie mir denke, sagte ich, ist ein offenes System aus Erfindung, Wahrnehmung und Erinnerung, das sich am wirklich Geschehenen reibt –
»Reibt?« Großmutter hustete dazwischen und wuchtete einen Riesentopf mit gefüllten Paprika auf den Herd. »Setz dich, du bist hungrig.« Das Buch drapierte sie auf einer Vase wie ein Museumsexponat auf einen Sockel.
Und dann kam der Satz mit dem Geldverdienen.
Die gefüllten Paprika rochen nach einem schneereichen Tag im Winter 1984. In Sarajevo fand gerade die Olympiade statt, und ich tat auf meinem Schlitten so, als sei ich Wintersportler wie unsere slowenischen Helden, die in ihren herausragend enganliegenden, quatschbunten Anzügen die Berge hinabrasten. Ich gewann jedes Rennen (ich fuhr erst los, wenn hinter mir keiner mehr war, der mich hätte überholen können).
Auf die Paprika wartend sehe ich jetzt am Hang das Haus von den Kupus’, seit dem Krieg zerschossen und leer. Als ich mit dem Schlitten damals zu Großmutter nach Hause gekommen war, tischte sie die Paprika auf. Meine Finger juckten fürchterlich, sie hielt meine Hände fest und wärmte sie, und im Fernsehen fuhr Jure Franko im Riesenslalom die Silbermedaille ein. Nicht einmal Paprikagemüse kommt ohne Erinnerungsfußnote in dieser Stadt.
Großmutter schenkte mir Wasser ein, es ist wichtig, hatte sie 1984 gesagt, und sie sagte es 2009 mit derselben Überzeugung, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt. Auch das Glas war noch dasselbe, ich erkannte es an dem kleinen Sprung am Rand.
»Oma, das müsste man mal aussortieren.«
»Du hast doch Augen. Trink von der anderen Seite.«
Das tat ich, sie sah zu. Wie ich aß. Wie ich sie ausfragte. Wie geht es dir, Oma? Was machst du den ganzen Tag? Kriegst du denn Besuch? Es waren Fragen, die ich auch am Telefon stellte.
Sie war kurz angebunden, wollte nicht über sich sprechen – erst als ich mich nach den anderen erkundigte, nach den Nachbarn, antwortete sie etwas ausführlicher: »Seit du das letzte Mal hier warst, ist keiner gestorben oder verrückt geworden. Rada ist noch da, Zorica ist noch da. Und Nada im vierten Stock. Die sind nur ein bisschen verrückt. Was so kommt mit den Jahren. Aber gut. Gut, dass sie da sind. Auch verrückt sind sie für mich gut.«
In dem Moment klingelte es.
»Und mein Andrej!«, rief Großmutter und eilte zur Tür. Ich hörte eine Männerstimme und Großmutter kichern wie ein Mädchen. Hörte Tüten rascheln und Großmutter danke sagen. Sie kam zurück und räumte direkt meinen Teller ab. Ich war zwar noch nicht fertig, aber einigermaßen satt.
»Wer war das?«
»Mein Polizist«, rief Großmutter, als sei damit alles klar.
Ich wollte den Abwasch machen, Großmutter schickte mich aus der Küche, das sei keine Arbeit für einen Mann. Das hatte sie früher schon gesagt. Über Staubsaugen, das Beziehen von Betten, Putzen. Großmutter entstammte einer Familie und einer Zeit, in der die Männer Schafe schoren und Frauen Pullunder strickten. Manieren blieben anwendungsbezogen, Fantasien unausgesprochen, die Sprache war präzise und grob. Dann kam der Sozialismus und diskutierte die Rolle der Frau, und die Frau ging aus der Diskussion nach Hause und hängte die Wäsche auf.
Die ältere Schwester meiner Großmutter, meine Großtante Zagorka, wollte auf andere Zeiten nicht länger warten. Sie wollte zur Schule, wollte in den Himmel, ins All. Kosmonautin wollte sie werden, brachte sich erst Trotz, dann Lesen und Rechnen bei, mithilfe der rachitischen Zwillinge Todor und Tudor. Mit fünfzehn, kurz nach dem großen Krieg, kehrte sie den Felsen ihrer Kindheit den Rücken, nahm bloß die Ziege mit, die ihr auf den Felsen die angenehmste Gesellschaft gewesen war, und machte sich auf den Weg in die Sowjetunion. Im Banat lernte sie fliegen von einem ungarischen Piloten und verliebte sich, während einer milden Nacht auf einem Rollfeld in der Pannonischen Tiefebene, nicht in ihn. In Wien putzte sie drei Jahre lang in Militärkasernen die Klos und ließ sich am Ufer der Donau von Aleksandr Nikolajewitsch, einem blassen sowjetischen Oberfeldwebel im Veterinärdienst, Russisch beibringen. Aleksandr sang und spielte Gitarre, beides nicht gut, aber gern. An der Donau sang der Russe aus Gorki an der Wolga für meine Großtante Zagorka aus Staniševac am Rzav von schönen Flüssen und Städten und Augen – braunen, vielleicht aber auch blauen Augen, es ist ja ein bisschen egal, welche Farbe die Augen jetzt genau hatten, und meine Großtante wollte von dem singenden Russen etwas anderes als der von ihr. Sie verließ Wien mit der treuen Ziege und etwas Geld sowie den Papieren eines russischen Oberfeldwebels und einem Kurzhaarschnitt. Moskau erreichte sie an ihrem neunzehnten Geburtstag. Die Ausbildung zur Kampfpilotin schloss sie mit Auszeichnung ab und wurde 1959 in den erweiterten Kreis der Ersten Kosmonautengruppe der Sowjetunion aufgenommen. Für ihre hochfliegenden Träume war es zu spät, der Amerikaner sprang bald auf dem Mond herum, der Russe wollte nicht Zweiter irgendwo sein. An einem warmen Montag im Februar des Jahres 1962 betrat sie das Büro von Wassili Pawlowitsch Mischin und sagte, sie habe eine Idee und eine alte, aber gesunde Ziege, und nur ein halbes Jahr später wurde die Ziege meiner Großtante Zagorka, eine Ziege aus dem Dorf Staniševac im Osten Bosniens, in die Umlaufbahn des Mondes geschossen. Sie ist namenlos geblieben und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vielleicht verglüht.
Zagorka starb 2006. Sie war am Ende nicht besonders müde gewesen und nicht besonders traurig. Sie war schwerhörig und hatte keine Zähne mehr. Meine Großmutter pflegte ihr Schwesterchen, wie sie Zagorka nannte, bis zum letzten Atemzug, und ich wollte mich gerade wieder an den Tisch setzen, da sagte Großmutter: »Was machst du da, komm jetzt her, mach den Abwasch! Was ist los mit dir?«
Unter der Spüle hing ein Küchentuch, circa so alt wie ich. Rot-weiß kariert, von abertausenden Karussellfahrten in der Waschmaschine weich und fadenscheinig geworden. Ich trocknete einen Teller ab, eine Gabel, ein Messer, das Glas mit dem kleinen Sprung.
Großmutter stand, umgezogen, hinter mir. Schwarze Bluse, schwarze Stoffhose, nur die Gummistiefel waren gelb. Ich musste an Supergirl denken, das sein Kostüm anlegt in Sekundenschnelle, nur war das Haar meiner Großmutter nicht lang und blond, sondern Dauerwelle und lila, und sie trug ein Trauercape.
»Wo willst du hin?«
»Wir fahren nach Oskoruša.«
»Ich bin doch gerade erst angekommen.«
»Das Ankommen kann warten. Oskoruša hat das Warten satt.« Ein Hupen. »Der Fahrer ist auch schon da.« Sie band sich das schwarze Kopftuch unterm Kinn, begutachtete ihr Spiegelbild, nahm es wieder ab.
»Hör zu«, sagte sie. »Es ist zum Schämen, dass du noch nie oben warst.« Und als ich mich immer noch nicht rührte: »Das Zögern hat noch nie eine gute Geschichte erzählt.«
Ich weiß nicht, woher sie das hatte, aber es klang gut.
»Wie lange bleiben wir?«
»Ist man einmal oben, will man für immer bleiben.«
Im Gang standen Tüten voller Lebensmittel. Die hatte wohl »ihr Polizist« vorbeigebracht. Jetzt sollte ich sie tragen. Großmutter lächelte mich an. »Willkommen zu Hause«, sagte sie. »Mein Esel.«
Sollte es in Višegrad je Mafia gegeben haben, war meine Großmutter die Patin. Als Kind wusste ich von drei stadtbekannten Kleinkriminellen, die sie fürchteten und Besorgungen für sie erledigten. Wenn sie sich beim Friseur die Haare lila machen ließ, stand meist einer wie zufällig vor dem Salon, Kürbiskerne knackend. Die frischgewellte Großmutter trat auf die Straße, raunte ihm etwas zu, worauf er eilfertig in den Gassen verschwand, mit welchem Auftrag auch immer.
Zur Schule gegangen ist Großmutter nie. Die Jungen mussten zur Schule, seien aber lieber draußen rumgerannt, sagte sie, die Mädchen wären lieber zur Schule gegangen und mussten zu Hause bleiben. Nähen, Stricken, Hausarbeiten hatte ihr die Mutter beigebracht, Lesen und Schreiben Zagorka, die ältere Schwester.
Der Anschein, dass meine Großmutter alles sein und tun konnte, meine Zuversicht, dass sie das Leben, das Altwerden, leicht meistern würde, ist mit dem Fortschreiten ihrer Krankheit verschwunden. Es begann im Frühjahr 2016. Großmutter verlegte Dinge und konnte deren Abwesenheit nicht begreifen. Sie suchte nach dem richtigen Wort und vergaß darüber, was zu sagen war. Sie verstand die Fernbedienung nicht mehr und zerlegte sie. Zum Friseur ging sie nur noch, wenn jemand sie zum Friseur brachte. Sie ließ sich von einem Vertreter überreden, für ein Kopfkissen zweihundert Euro zu bezahlen, wofür sie ihm früher Prügel angedroht und ein eigenes altes Kissen verkauft hätte.
2009 ging es ihr gut. Im Frühling 2009 stieg meine Großmutter ohne Mühen die drei Stockwerke hinunter zum Hof. Der Motor des blauen Yugo lief, der Fahrer in Jeans und T-Shirt beeilte sich, ihr in den Wagen zu helfen. Mir stellte er sich als Stevo vor und ergänzte mit einem Nicken zur Großmutter: »Der Chauffeur.«
Die harte, unebene Piste nach Oskoruša tat dem Yugo nicht gut. Der kleine Wagen gab sich große Mühe, ohne Achsenbruch aus den Schlaglöchern herauszufinden, doch Stevo hatte bald genug, hatte Erbarmen.
Wir wollten zu Fuß weiter, da rief von irgendwo einer den Namen meiner Großmutter, und die Berge meißelten den Hall freundlich und streng in die vom Frühling summende Luft.
Großmutter lächelte.
Der Rufende war erst nicht zu sehen, dann trat ein junger Mann aus dem Waldstück oberhalb der Straße und sprang über den Hang, unvernünftig und präzise wie ein Ziegenbock. Ein junger Mann, der immer älter wurde, je näher er kam. In seinem Bart steckten Tannennadeln.
Ein zweites Mal rief er Großmutters Namen, als ihn nur wenige Schritte von uns trennten. Er nahm die Mütze ab – die serbische Šajkača, und sie sahen sich an, lang genug, dass man zärtlich schreiben möchte.
Ein Händedruck für Stevo, dann die Drehung zu mir mit großer Geste und auch ein Schmettern meines Namens, alles eine Spur zu viel: das Umdrehen zu laut, die Augen zu braun, und unter den Nägeln: Erde.
»Du bist der Enkel. Ich bin Gavrilo. Wir sind verwandt – ich könnte dir jetzt sagen, wie, aber ich zeig es dir lieber.«
Das Zeigen begann am Friedhof – Großmutter wollte zum Grab ihrer Schwiegereltern. Gavrilo führte uns zügigen Schrittes zu einer schiefen Wiese, von schiefen Bäumen gesäumt. Die Sicht war frei nach Westen, wo über milden Hügeln, auf denen einzelne Häuser und Höfe verstreut lagen, ein Berg aufragte, dichtgrüne Wälder, fast bis zum Gipfel, und der Gipfel nackter Fels, rötlich in der Sonne. Die Toten haben einen schönen Ausblick in Oskoruša.
Wir marschierten zwischen den Gräbern durch Mittagshitze und hohes Gras. Ich bemühte mich, mit Gavrilo Schritt zu halten, und schielte zum Gipfel. Da schlug mir der alte Mann mit der flachen Hand vor die Brust. »Pass doch auf, was träumst du dich so ein!«
Eine Schlange kreuzte unseren Weg.
»Poskok«, zischte Gavrilo.
Ich trat einen Schritt zurück, und es war, als schritte ich auch zurück in der Zeit, zu einem ähnlich heißen Tag in Višegrad vor vielen Jahren.
Poskok bedeutet: ein Kind – ich? – und eine Schlange im Hühnerstall.
Poskok bedeutet: Sonnenstrahlen, die zwischen den Brettern durch die staubige Luft schneiden.
Poskok: ein Stein, den Vater über den Kopf hebt, um die Schlange zu erschlagen.
In poskok steckt skok – Sprung, und das Kind malt sich die Schlange aus: an deinen Hals springt sie, spritzt dir Gift in die Augen.
Vater spricht das Wort aus, und ich fürchte das Wort mehr als das Reptil im Hühnerstall.
Am Friedhof von Oskoruša erstarrte ich vor den Bildern, die aus dem unerhörten Wort aufgingen. Poskok enthielt für das Kind alles, was es brauchte für eine gute Angst. Gift und Vater, der töten will. Fast ist es, als stünde Vater in Komplizenschaft mit dem, was das Wort in dem Kind, mir, auslöst. Ich habe Angst vor dem Wort und um das Tier und mit dem Vater. Ich stehe schräg hinter ihm, sehe beide gut, den Vater und die Schlange. Eine Ahnung sagt mir: Vater trifft nicht. Vater trifft nicht, und das Wort wird zum skok ansetzen, das Maul aufgerissen. Ich, rasend vor Furcht und Neugier: Was wäre, wenn nicht Vater die Schlange, sondern die Schlange den Vater? Ich spüre die Zähne in seinem Hals, poskok.
Vater schleudert den Stein.
Das übersetzte Wort – Hornotter – lässt mich kalt.
Die Hornotter auf dem Friedhof von Oskoruša wand sich, grün und gelassen, in die Krone eines Obstbaums, um sich eine bessere Perspektive auf die Eindringlinge zu verschaffen. In den Ästen richtete sie sich in der Sonne ein, wurde sich selbst zum Nest über dem Grab meiner Urgroßeltern.
Dort warteten Speisen und Getränke und eine großgewachsene Frau, die im Stehen mit einem Riesenmesser Räucherfleisch in dünne Scheiben schnitt, ungerührt, auch als das Reptil sich den schiefen Stamm nur wenige Meter entfernt hinaufwand.
Gavrilo nahm die Hand von meiner Brust und ging weiter. Großmutter und Stevo überholten mich und begrüßten die Frau. Sie tischten die mitgebrachten Speisen auf, Getränke in Plastikflaschen. Die Grabplatte war die Tafel. Fleisch und Brot lagen schon da. Der Schlange schenkte niemand weiter Beachtung. Es schien, als sei sie bloß Einbildung, bloß Sprache. Großmutter entzündete Kerzen.
Ich wandte mich ab. Ging von Grabstein zu Grabstein und las. Ich las Stanišić. Las Stanišić. Las Stanišić. Auf fast jedem Grabstein, auf fast jedem Grabholz stand mein eigener Nachname, und von den kleinen Fotos blickten sie mich an, stolz oder verlegen. Es gab, schien mir, nur das: Stolz und Verlegenheit.
Moos hatte einige Namen überwachsen, die Zeit einige verwittern lassen. »Keiner ist vergessen«, versicherte Gavrilo mir später am Grab meiner Urgroßeltern. Er deutete auf die unleserlichen und sagte: »Der da ist auch einer, und die auch. Stanišić, Stanišić.« Und nach kurzer Pause: »Die weiß ich nicht mehr.«
Die große Frau reichte mir zur Begrüßung erst die Hand, dann einen Schnaps. »Marija«, sagte sie. »Gavrilo ist mein Mann. Hast du die Früchte?«
Da ist Marija: baumlang unter Bäumen. Ein steifes braunes Kleid wie die Schürze eines Schmieds. Sie stammt aus einem Dorf ein paar Täler weiter, den Namen habe ich vergessen. Am Tag als Josip Broz Tito starb, kam in dem Dorf ein Mädchen zur Welt mit rotem Haar, was ungewöhnlich war und schön. Als Zweijährige, heißt es, begann das Mädchen Latein zu sprechen, was ungewöhnlich, doch vor allem ziemlich unpraktisch und nutzlos war. Man unterwies es in der Kräuterkunde. Das Mädchen konnte bald jeden Dienstag die Zukunft relativ präzise vorhersagen. Einiges bewahrheitete sich, anderes nicht. 1994 trat sie auf der Suche nach Schafgarbe – jemand aus dem Dorf klagte seit Tagen immer wieder über Nasenbluten – auf eine Landmine.
Ich übergab Marija die Tüte mit den Orangen und der Ananas. Sie legte die Früchte auf das Grab.
»Haben sie wohl gern gegessen?«, fragte ich.
»Weiß nicht«, sagte Marija und köpfte die Ananas mit ihrem Riesenmesser. »Ich ess sie gern. Willst du auch?«
Marija war so groß, ich konnte, als sie neben mir stand, die feinen Äderchen unter ihrem Kinn erkennen. Fingerfertig war sie auch und wendig. Wie sie die Ananas zerteilte. Wie sie vom Grab heruntersprang, um etwas zu holen, und wieder hinaufstieg – ich musste an Fechterinnen denken.
Über uns, in der Krone des Speierlings, lauerte poskok, die gehörnte Schlange. Heute ist der 25. September 2017. Ich sitze in der S-Bahn in Hamburg, neben mir unterhalten sich zwei Mittvierziger über Pokemon. Die Worte lauern über mir, sie verunsichern mich, machen mich froh, ich muss unter ihnen die richtigen finden für diese Geschichte.
Die Geschichte begann mit dem Schwinden von Erinnerung und mit einem bald verschwundenen Dorf. Sie begann in Gegenwart der Toten: Am Grab meiner Urgroßeltern trank ich Schnaps und aß Ananas. Die Luft roch nach Regenwürmern, nach der Milch des Löwenzahns, nach Kuhscheiße, je nachdem. Die verstreuten Häuser aus Kalkstein und Buche dem Hausberg und dem Wald aus dem Bauch geschnitten. Schön vielleicht. Auch nach der Schönheit habe ich Gavrilo gefragt, den Schweinezüchter Gavrilo, den Jäger Gavrilo, ob er Oskoruša je schön gefunden hat.
Die Schönheit, von der Schönheit seiner Frau abgesehen, sei ihm immer egal gewesen, sagte er und küsste Marijas Schulter. Ich war mir sicher, er würde etwas Nüchternes anfügen, einen Spruch über die ewige Schufterei, den Boden, die Ernte, doch Gavrilo schenkte sich bloß Schnaps aus einer Cola-Flasche ein und setzte sich auf das Grab.
Oskoruša ist ein schöner Name. Stimmt nicht. Oskoruša klingt harsch und unwirsch. Keine Silbe, an der man sich festhalten kann, null Rhythmus, eine bizarre Anordnung von Lauten. Ja, schon der Anfang: Osko – was soll das? Wer spricht so? –dann der Sturz auf das gezischte Ende: -ruscha. Hart und slawisch wie die Enden auf dem Balkan nun mal sind.
Das könnte ich so stehen lassen, man würde es mir als jemandem vom Balkan vielleicht abnehmen, harte slawische Enden? Klar, diese Jugos mit ihren Kriegen und Manieren.
Dabei ergibt das Bild gar keinen Sinn. Was soll man sich unter harten slawischen Enden vorstellen? Das Slawentum ist kein Herrenhut, nichts, was man zweifelsfrei beschreiben kann, sofern man weiß, was Herren und Hüte sind.
Vielleicht liest das hier aber auch jemand, der an der ironischen Vervielfältigung von Vorurteilen und Klischees keine Freude hat, dafür aber weiß, was Oskoruša bedeutet, was Oskoruša ist. Oskoruša ist eine Obstsorte. Eine weithin geschätzte Obstsorte, um genau zu sein, eine respektierte Mehlbeere mit hoher agricultural credibility. Beteuern die, auf deren Respekt es ankommt: Landwirte. Oskoruša ist der serbokroatische Name für Sorbus Domestica, den Speierling.
Der Speierling ist ein widerständiges Obst. Die Frucht wird bei voller Reife sonnenseits leuchtend rot, der Rest ist gelb. Die Sonnenseite schmeckt süß, die der Sonne abgewandte bitter. Von Parasiten gemieden, bedarf sie keines besonderen Schutzes und muss nicht besprüht werden. Stamm und Blätterwerk sind hingegen stark verbissgefährdet.
Es gibt in den bosnischen Bergen, im äußersten Osten des immerfort tragischen Landes, ein Dorf, das es bald nicht mehr geben wird. Oskoruša. In den Achtzigern lebten hundert Menschen hier. Einer spielte Gusle. Einer veranstaltete Domino-Abende. Und einen gab es, der Drachen aus Wachs schnitzte. Man hat die Winter in Fellen überstanden und im warmen Streit beim Domino-Spiel. Im Sommer hat man sich ordentlich eingeschmiert. Einmal verlief sich ein Rucksacktourist aus Island hierher, er lächelte viel und belegte bei einem der Domino-Turniere den ehrbaren vierten Platz.
Die Abgeschiedenheit war während der Kriege vermutlich lebensrettend. Oskoruša blieb unversehrt, bis auf die Männer, die sich freiwillig diesen oder jenen angeschlossen hatten und verlorengingen. Wer geblieben war, starb aus anderen Gründen.
Auf dem Friedhof von Oskoruša teilte ich meinen Namen und Brot mit den Toten. Wir aßen Räucherfleisch auf meinen Ahnen, da ergriff Gavrilo das Wort.
»Hier«, sagte er und goss etwas Schnaps in die Erde, »liegt dein Urgroßvater. Die Urgroßmutter hat nur heimlich getrunken.« Auch auf ihre Seite stellte er einen Becher und sah dann weg, damit sie weiterhin heimlich trinken konnte. Wir stießen an.
Am Grab ihrer Schwiegereltern war meiner Großmutter keine Anstrengung zu viel. Sie kratzte Vogelscheiße von der schwarzen Platte, jätete das Unkraut, beschnitt die Büsche. Sie schleppte zwei Steinbrocken heran, der Zweck erschloss sich mir nicht, ich fasste mit an, sie wollte sie dort und dort haben.
Heute gehört das Gewese um dieses Grab zu einer ihrer verlässlich wiederkehrenden Erinnerungen. Großmutter hat die Grabstätte selbst errichten lassen. »Niemand wollte sich kümmern«, wiederholt sie, »auch die nicht, die es gar nicht geben würde, wenn es die, die dort ruhen, nicht gegeben hätte.«
Die Friedhofshitze schmeckte salzig und klang nach Zikaden. Gavrilo suchte meinen Blick. Ich nickte ihm zu und fand es sofort unpassend, genickt zu haben auf einem Friedhof.
»Siehst du das?« Er zeigte in die Landschaft. »Da stand das Haus«, sagte er.
»Von meinen Urgroßeltern?«
»Ja.«
»Da?«
»Nein, da.«
»Da, wo man den Zaun sieht?«
»Nein, da, wo man nichts sieht.«
Ich lachte. Gavrilo fand es nicht komisch, und das war der Augenblick, da Gavrilo mich fragte, woher ich käme.
Also doch, Herkunft, wie immer, dachte ich und legte los: Komplexe Frage! Zuerst müsse geklärt werden, worauf das Woher ziele. Auf die geografische Lage des Hügels, auf dem der Kreißsaal sich befand? Auf die Landesgrenzen des Staates zum Zeitpunkt der letzten Wehe? Provenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? Wie man es dreht, Herkunft bleibt doch ein Konstrukt! Eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestülpt worden ist. Als solches ein Fluch! Oder, mit etwas Glück, ein Vermögen, das keinem Talent sich verdankt, aber Vorteile und Privilegien schafft.
So redete ich und redete, und Gavrilo ließ mich ausreden. Er brach das Brot und reichte mir die Kante. Dann sagte er: »Von hier. Du kommst von hier.«
Ich biss in das Brot. Wartete, dass er erklärte. Von hier? Was von hier? Wegen der Urgroßeltern?
Gavrilo putzte eine Gurke an seinem Ärmel, um sie zu essen, und während er die Gurke aß, sprach er über die Gurke und über den Vormarsch von genetisch manipuliertem Gemüse. Als ich fast den Faden verloren hatte, griff er meinen Arm, als wolle er meine Muskeln prüfen, und rief: »Von hier. Du kommst von hier. Wirst es sehen. Kommst du mit?«
»Hab ich eine Wahl?« Wenigstens witzig wollte ich sein.
»Nein«, sagte Gavrilo. Und Großmutter, flüsternd: »Sei nicht undankbar.«
Ich sah zur Schlange hoch und war mir fast sicher: Gleich sagt die auch noch was. Immerhin war sie eine Einheimische, verstand die Sprache dieser Berge, verstand vielleicht besser als ich, was vor sich ging, vielleicht sogar, wofür ich dankbar sein sollte.
Wir packten zusammen. Stevo und Marija trugen die Tüten weg, ich folgte Großmutter und Gavrilo. Die beiden führten mich zu einem Brunnen, dem Prototyp eines Brunnens – mit steinernem Mantel, Schrägdach aus Holz, Kurbel, Eimer, Seil, und Gavrilo sagte: »Die Quelle hat dein Urgroßvater entdeckt und den Brunnen dein Urgroßvater ausgehoben, und das Letzte, was dein Urgroßvater wollte, bevor er starb, war, dass ihm seine Frau, deine Urgroßmutter, noch einen Schluck von diesem Wasser holt. Worauf die sagte: Geh doch selber.«
Ich sollte trinken, hatte aber keinen Durst und Angst vor Keimen. Ich wollte aber auch niemanden enttäuschen, nicht Urgroßvater, nicht Gavrilo und Großmutter, also trank ich, und dann war es das beste Wasser, das ich jemals getrunken hatte, und während ich gleich noch meine Trinkflasche damit füllte, sagte Großmutter: »Dein Opa ist in Oskoruša geboren. Aus dieser Quelle hat er getrunken, in diesen Wäldern hat er Pilze gesucht und den ersten Bären erlegt, da war er keine acht Jahre alt.«
»Woher kommst du, Junge?«, fragte Gavrilo wieder, und ich dachte: Zugehörigkeitskitsch! Und dass ich doch nicht schwach würde wegen ein bisschen Wasser.
Großmutter übernahm dann aber sowieso wieder: »Dein Urgroßvater ist in Oskoruša geboren«, sagte sie. »Das alles war sein Land. Und dort oben, schau hin, dort hatte er sein Haus gebaut.«
»Komm schon«, sagte Gavrilo, und die beiden setzten sich wieder in Bewegung. »Einen besseren Blick ins Tal hinunter und zum Vijarac hinauf gibt es bei uns nicht.«
Und dann waren da bloß ein paar grob behauene Steine, Überreste einer Hauswand oder was. Gräulich, in Spinnweben gesponnen. Ich versuchte davon einen Grundriss abzuleiten, stieg durch Brennnesseln zu den Möbelresten im ruinösen Gemäuer. Einem Regal, eingebrochen in seiner nichts mehr tragenden Existenz. Auf dem skelettierten Eisenbett harrte eine Eidechse furchtlos aus. Und durch eine Öffnung in der Mauer, die einmal Fenster gewesen ist, greifen Zweige nach den Träumen meines Großvaters als Kind. Aber was, bitte, soll das alles für mich sein?
Ich habe Wasser aus dem Brunnen meines Urgroßvaters getrunken und schreibe darüber auf Deutsch. Das Wasser hat nach der Last dieser Berge geschmeckt, die ich nie tragen musste, und nach der beschwerlichen Leichtigkeit der Behauptung, dass einem etwas gehört. Nein. Das Wasser war kalt und hat wie Wasser geschmeckt. Ich entscheide, ich.
»Woher kommst du, Junge?«
Jetzt also auch von hier? Oskoruša.
LOST IN THE STRANGE, DIMLY LIT CAVE OF TIME
Ich lebe in Hamburg. Ich habe einen deutschen Pass. Mein Geburtsort liegt hinter fremden Bergen. An der vertrauten Elbe gehe ich zweimal die Woche laufen, eine App zählt die zurückgelegten Kilometer. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das ist, sich zu verlaufen.